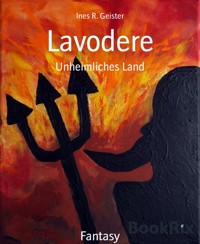
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Lavodere
Unheimliches Land
Roman
von Ines R. Geister
Genre: Horror/Thriller
Science Fiction
Solange wir leben, erscheint uns unser Alltag als unerschütterlich und ewig.
Wir wissen, daß der Tod uns irgendwann ereilt, aber wir sehen ihn als Bild in weiter Ferne.
Das Unausweichliche wird verdrängt, als wären nur die anderen dran.
Unsere Vernunft läßt uns glauben, daß wir auf festem Grund stehen.
Welch ein Irrglaube.
© Ines R.Geister 2016
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Lavodere
Unheimliches Land
Für meine Wegbegleiter, die schon vor langer Zeit vorausgegangen sind. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig. BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenInhaltsverzeichnis
Lavodere
Unheimliches Land
Roman von
Ines R. Geister
Genre: Fantasy
Inhaltsverzeichnis
Teil I
Der Anfang vom Ende
Peter Franzius, der Junge
Clarissa Montebey, die Betrogene
Florian Eichner, der Träumer
Ibo Kühl, der Zuhälter
Theodor Wolff, der Veteran
Teil II
Lavodere
Blumenwiese
Goldenes Portal
Bedrohung
Tunnelblick
Flingo
Die Zuflucht
Angekommen
Prüfungen
Flucht
Der Tunnel
Erika
Schlucht der Hilfe
Die Lebensmühle
Quelle der Versuchung
Regenbogen
© Ines R. Geister
Teil I
Der Anfang vom Ende
Peter Franzius, Der Junge
Exakt eine Stunde und 22 Minuten vor Peters Tod war es mucksmäuschenstill im Gebäude. Nur im Obergeschoss des geräumigen Einfamilienhauses mit den großen Fenstern, die von jedem Zimmer aus einen ungestörten Blick in den Garten gestatteten, saß Peter Franzius stöhnend über seinen Hausaufgaben.
Müde stützte er die Ellenbogen auf den Schreibtisch, legte sein Kinn in beide Hände und sah aus dem Fenster. „Ich hasse diese blöden Hausaufgaben. Jeden Tag, immer wieder. Das ist doch sowieso alles sinnloses doofes Zeugs und absolut überflüssig. Ich will Tierforscher und Naturforscher werden. Wozu muss ich da rechnen können. Außerdem bin ich schon neun, also alt genug, selbst zu wissen, wie das Leben läuft. Das Leben“ so wusste er ganz genau, „findet nämlich im Wald statt, und da ist es auch viel spannender, als hier in meinem Zimmer.“ Er seufzte und wanderte in Gedanken durch einen Wald. Er liebte den Wald, denn dort konnte er die Tiere beobachten, sich anschleichen und zusehen, wie sie ihre Häuser oder Nester bauten, oder welche Nahrung sie aßen und wie sie diese fanden.
Aber eigentlich, das musste er sich dennoch eingestehen, ging er gerne zur Schule. Allerdings nur, weil Oliver, sein bester Freund, in der selben Klasse wie er war, und sie in den Pausen mit den anderen Jungs auf dem Schulhof Fußball spielen konnten.
Einen Moment saß Peter regungslos da. Als er sich jedoch wenig später aufrichtete und sein Schulheft zuklappte, ahnte er nichts von seinem bevorstehenden Tod.
Er stand auf und stieß einen leisen Pfiff aus. Sofort hob Barky, der neben der Tür schlief, den Kopf und begann, mit dem Schwanz zu wedeln. Barky wußte, was das Pfeifen bedeutete. Jetzt ging es endlich los. Barky war ein Golden Retriever, den sein Vater ihm geschenkt hatte, mit der Begründung, dass er dann tagsüber nicht so alleine im Haus sei.
Seine Eltern, Claudia und Martin, mussten hart für das luxuriöse Haus arbeiten. Zumindest hatten sie ihm das so erklärt. Deshalb war er auch früher jeden Nachmittag von der Schule immer direkt zu seiner Oma Martha gegangen. Aber Oma war mittlerweile tot.
"Komm Barky. Ich habe keine Lust mehr. Lass uns rausgehen und nachsehen, was die Ameisen mit dem Apfel gemacht haben. Bin gespannt, ob sie es geschafft haben, ihn wegzukriegen.“ Barky sprang auf und lief ihm schwanzwedelnd entgegen. Peter öffnete die Tür, und gemeinsam flitzten sie die Treppe runter.
Seine Mutter würde erst in zwei Stunden von der Arbeit nach Hause kommen, und bis dahin konnten er und Barky auf Entdeckungsreise in den Forst gehen.
Zielstrebig steuerte Peter die Küche an und öffnete den Kühlschrank. Proviant war wichtig bei einer Expedition. Er nahm zwei Äpfel heraus und legte sie auf den Tisch. Sein roter Rucksack hing über der Lehne eines der Stühle. Aber bevor er etwas darin verstauen konnte, kontrollierte er gewissenhaft, ob alles, was er für seine Erkundungstour benötigte, darin war.
Zu seiner Standardausrüstung gehörten ein Feuerzeug, ein langes Stück Bindfaden, das um eine Streichholzschachtel gewickelt war, eine weiße, schlanke Kerze und ein durchsichtiges kleines Plastikkästchen, in dem er Erde mit Regenwürmern oder Käfer (für wissenschaftliche Experimente) aufbewahren konnte. Hin und wieder verirrte sich allerdings auch eine in Alu-Folie eingewickelte Brotstulle, belegt mit einer Gemüsefrikadelle, in den Rucksack. Alles, was er unterwegs fand und sammelte, landete ebenso darin. Heute würde er jedoch kein Brot mitnehmen. Das müsste er sich nämlich erst noch schmieren, wozu er keine Zeit hatte.
Sein ganzer Stolz war aber zweifellos das Taschenmesser, ein echtes Schweizer Messer Victorinox Traveler. Ein Geschenk seines Vaters zu Weihnachten im letzten Jahr. Dieses Messer war einfach eine Wucht. Es besaß sogar eine Lupe, einen Kompass, eine Säge und natürlich einen Dosenöffner. Selbstverständlich trug Peter das Messer nicht in seinem Rucksack mit sich, sondern immer griffbereit in seiner Hosentasche. Er langte hinein und holte das Messer heraus. „Die wichtigen Dinge muss man immer am Körper tragen“, erklärte er Barky nicht zum ersten Mal. Dieser beobachtete ihn aufmerksam und schien ihm zuzuhören, denn hin und wieder kippte er leicht seinen Kopf und sah Peter mit seinen haselnussbraunen Augen an. Einen Moment drehte Peter das Taschenmesser bewundernd hin und her, steckte es aber gleich darauf glücklich wieder zurück in die Hosentasche.
Den Rucksack auf den Rücken geschnallt, lief Peter zurück in den Flur, schnappte sich seine Jacke und sprang vergnügt raus in den Garten. Barky bellte vor Freude laut und wurde nicht müde, an seinem Menschen hochzuspringen und ihn unentwegt zu umringen. Sein blaues Halstuch leuchtete in der Sonne.
„Ach, das macht Spaß, was Barky? Vor allem, wenn es schon so toll warm ist.“ Barky wuffte zustimmend.
Der Winter war nun endlich vorbei. Die Sonne schien, und der Frühling vertrieb die Winterstarre der Insekten, die sogleich mit neuer Energie munter durch die Luft schwirrten.
Gestern waren sie, wie Peter es nannte, auf einem Frühlingskontrollgang durch den Wald, als sie einen großen Ameisenhügel entdeckten. Dort war das Leben schon in vollem Gange, weil die Sonne direkt darauf schien und den Hügel erwärmte. Er hatte seine Neugier nicht zügeln können und einen seiner Äpfel mitten oben auf den Ameisenhügel gelegt. Mindestens eine Stunde lang beobachtete er gespannt, wie die Ameisen den Fremdkörper entdeckten. Innerhalb kürzester Zeit hatten die ersten Arbeiterinnen damit begonnen, den Apfel zu erklimmen.
Dann jedoch war die Zeit knapp geworden. Mit seiner Mutter war verabredet, dass er zwar nach den Hausaufgaben in den Wald gehen durfte, hatte aber gleichzeitig hoch und heilig versprechen müssen, dass er wieder zurück sein würde, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam. Er wußte, wie streng sie sein konnte und wollte sich ihre Freizügigkeit nicht verscherzen.
Deswegen beeilte er sich jetzt, so schnell wie möglich wieder zu dem Ameisenhügel mit dem Apfel zu kommen.
Der Wald war nicht weit vom Haus entfernt. Sie liefen einmal quer durch die Siedlung und dann ein Stück an der Bundesstraße entlang bis zu einer Fußgängerampel. Auf der anderen Seite der Straße befand sich die Bushaltestelle 'Zum Waldgrund', und gleich hinter dem Wartehäuschen führte ein Weg, nur wenig breiter als ein Trampelpfad, in den Staatsforst. Dort wollten sie hin.
Peter drückte auf den Knopf an der Ampel, der ihm wie ein leuchtendes grünes Drachenauge entgegensah. Das Auge änderte seine Farbe und wurde feuerrot, fast, als würde es von innen heraus brennen. Ungeduldig zappelte er von einem Bein auf das andere und konnte es kaum abwarten, dass die Ampel auf grün umsprang.
Flüchtig ging ihm die Warnung seiner Mutter durch den Kopf:
„Peter“, hatte sie eines Tages mit ernster Stimme gesagt und ihm in die Augen geblickt. „Du musst mir versprechen, vorsichtig zu sein und auf alle Fälle zu warten, bis die Ampel grün wird, und auch dann siehst du erst nach, ob die Autos wirklich angehalten haben, bevor du über die Straße gehst.“ Forschend hatte sie ihn angesehen. „Hast du mich verstanden, Peter?“
„Ja, Mama.“
„Erinnere dich immer daran, dass damals, bevor es die Ampel gab und nur ein Zebrastreifen auf die Straße gemalt war, dort schon drei Kinder ums Leben gekommen sind, weil die Autofahrer, trotz Bushaltestelle und Zebrastreifen, nicht langsamer fuhren.“
Peter hatte mit einem Indianerehrenwort, in dem er verschwörerisch seine rechte Hand hob, den Zeigefinger und den Mittelfinger zu einem V gespreizt, versprochen, dass er sich daran halten würde.
„Oh man, Mama, ich bin doch schon erwachsen. Es ist nicht nötig, mich wie ein kleines Kind zu behandeln.“
Endlich wurde die Ampel grün. Er rannte los und Barky hinterher. Ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren, ließen sie das Haltestellenhäuschen hinter sich und schlugen ohne Umschweife den Weg in den Wald ein. Erst als die Straße nicht mehr zu sehen war, wurde Peter langsamer. Tief atmete er die frische, nach Frühling duftende Waldluft ein. Der Boden war weich und bedeckt mit den Tannennadeln und dem Laub vom letzten Herbst.
Der Lärm der Straße blieb allmählich hinter ihnen zurück. Jetzt konnte Peter auch die Vögel hören. Die Bäume knackten ein wenig, wenn der Wind durch ihre noch kahlen Äste strich. Aber, wenn man genau hinsah, entdeckte man, dass die meisten von ihnen bereits erste hellgrüne Blätterknospen zeigten. Nach dem langen Winter fing die Natur wieder an zu leben.
Peter blieb stehen und streifte sich den Rucksack vom Rücken. Im Schatten der Bäume war es doch noch recht kühl. Er zog sich seine Jacke, die er noch immer in der rechten Hand hielt, an und streifte sich den Rucksack wieder über. Jetzt hatte er wenigstens beide Hände frei.
Immer tiefer liefen sie in den Wald, bis sie zu einer Weggabelung gelangten. Hier bogen sie rechts ab und erreichten nach wenigen Metern einen versteckten Pfad, der sich nach links durch die Bäume schlängelte. Barky kannte den Weg und war bereits im Dickicht verschwunden. Peter folgte ihm.
Er brauchte nicht lange zu gehen, bis das Unterholz den Blick auf eine große sonnendurchflutete Lichtung freigab. Peter sah noch, wie Barky auf der anderen Seite wieder im Wald verschwand, und betrat die Lichtung.
Die Sonne traf sein Gesicht, und er schloss für einen Moment genussvoll die Augen. Dann aber öffnete er sie wieder und lief zur Mitte der Lichtung, wo sich ein gewaltiger Hügel aus dem Boden erhob. Erwartungsvoll näherte er sich ihm.
Er sah sofort, dass der Apfel weg war.
„Ob die Ameisen ihn schon aufgegessen haben? Oder haben die ihn einfach im Ganzen in den Hügel geholt und essen ihn jetzt nach und nach auf?“, murmelte Peter. „Das muss ich näher untersuchen.“
Er sah sich um und fand in der Nähe einen etwas dickeren Ast, ging hin und hob ihn auf. „Jetzt wollen wir doch mal sehen, was die kleinen Krabbeltierchen mit meinem Apfel angestellt haben.“
Neben dem Hügel ging er in die Knie.
Barky sah, dass er etwas Interessantes machte und kam mit hängender Zunge und wedelndem Schwanz auf ihn zu.
„Komm her Barky. Setz dich hier hin. Ich werde dir jetzt zeigen, wie man eine wissenschaftliche Untersuchung durchführt.“ Barky tat, wie ihm befohlen und sah Peter aufmerksam an.
Kurzerhand stach dieser dort mit dem Stock ein Loch in den Hügel, wo er gestern den Apfel hingelegt hatte.
Er war sich nicht sicher, ob er einen Widerstand spürte und bohrte noch etwas tiefer hinein. „Wenn ich doch nur was sehen könnte“, flüsterte er und bewegte den Stock nach rechts und links, um das Loch größer zu machen. Aber alles Herumstochern nützte nichts. So richtig etwas erkennen konnte er nicht. Er stand auf und machte einen kleinen Schritt nach vorne, bis seine Fußspitzen den Ameisenbau berührten.
„Verdammt“, entfuhr es ihm. „Ich kann aber auch gar nichts erkennen, Barky.“ Barky hörte seinen Namen, sprang auf und bellte einmal, wie zur Bestätigung. „Wir müssen noch näher ran, hörst du?“
Peter machte noch einen kleinen Schritt auf den Hügel zu. Er bemerkt nicht, dass seine Füße mittlerweile nicht mehr auf dem Waldboden standen, sondern auf der Seite des Hügels, mit den Fußspitzen in Richtung Himmel. Aufgeregte Ameisen liefen über seine Schuhe und Strümpfe, um den Eindringling zu identifizieren und zu beseitigen.
Auf den Stock gestützt beugte Peter sich noch weiter vor, um einen Blick in das Innere des Loches zu werfen, das er in den Bau bohrte. Aber jedes Mal, wenn er den Stock bewegte, füllte sich dieses sofort wieder mit Ameisen. Plötzlich hielt der Bau dem Druck nicht mehr Stand, und der Stock sank mit einem Ruck bis zur Hälfte ein.
„Oh Scheiße“, entfuhr es Peter, als er sich nicht mehr halten konnte und bäuchlings auf den Hügel fiel. Mit dem Kinn schlug er auf dem weichen Untergrund auf. Die Zähne klappten zusammen und die Nase bohrte sich ein eigenes kleines Loch in den Hügel. Peter öffnete die Augen, die er beim Fallen instinktiv geschlossen hatte, und sah genau vor sich die Fühler einer Ameise.
Innerhalb kürzester Zeit waren sie überall um ihn herum und auf ihm drauf. Nur wenige Augenblicke dauerte es und Peter merkte, wie die Ameisen in die Ärmel seines Pullovers krochen. Barky, der ganz begeistert war, dass Peter mit ihm spielen wollte, war mit einem Satz auf dem Rücken seines geliebten Zweibeiners und bellte wie verrückt.
„Geh runter von mir Barky. Das ist nicht lustig.“
Peter spürte das Kribbeln jetzt am ganzen Körper. Mit beiden Händen stützte er sich auf und sank augenblicklich bis zu den Ellbogen in den weichen Untergrund des Ameisenbaus ein. Sofort begannen die Ameisen mit der Erstürmung seiner Arme. Panik machte sich breit. Mit einem Ruck zog Peter erst die Knie an und dann die Arme aus dem Haufen und stand auf.
Zappelig klopfte er sich die Ameisen von der Kleidung. In den Haaren, in der Hose, unter dem Pullover und in den Strümpfen, überall kribbelte und krabbelte es.
„Barky, wir müssen so schnell wie möglich nach Hause und aus den Klamotten raus.“ Um sich schlagend rannte Peter, wie von Sinnen, durch den Wald. Barky folgte ihm bellend, und nach wenigen Minuten erreichten sie den Rand des Waldes und die Bushaltestelle.
Gerade verfing sich eine Ameise in den Wimpern von Peters linkem Auge, und erschrocken wischte er sie beiseite, vergaß in der Aufregung jedoch das gegebene Versprechen, auf die Ampel zu achten und rannte blindlings über die Straße.
Als er in der Mitte der Straße angelangt war, sah er seine Oma Martha auf der anderen Seite der Straße stehen. Sie stand da in ihrem hellblauen Kleid mit dem weißen Spitzenkragen, das sie so gerne trug und lächelte ihm entgegen.
„Hallo Oma, was machst du denn hier? Ich muss schnell nach Hause, meine Sachen ausziehen. Ich bin in einen Ameisenhügel gefallen.“
Aber Oma Martha sagte nichts. Sie lächelte nur und streckte ihm die Hand entgegen.
Die Erkenntnis und Erinnerung, dass Oma letztes Jahr gestorben war, traf ihn zur selben Zeit, wie der Bus der Linie 131.
Peter hörte einen dumpfen Knall, der sich anhörte, als wenn jemand ein dickes Buch auf den Teppichboden fallen lässt und sah aus dem Augenwinkel, wie rechts von ihm etwas durch die Luft flog.
Er spürte mehr als dass er sah, wie der Bus hinter ihm vorbei rauschte. Ein Luftzug wehte ihm durchs Haar und ließ seine Kleidung flattern. Dann hörte er das Quietschen von Reifen.
Verwundert blieb Peter mitten auf der Straße stehen und sah zu dem Bus, der einige Meter entfernt von ihm zum Stehen gekommen war. Einem inneren Gefühl folgend, er wusste irgendwie, dass es kein auf den Boden gefallenes Buch gewesen war, das den Knall verursacht hatte, ging er hinüber und sah, wie ein kreidebleicher Fahrer das Fahrzeug verließ. Mehrere Autos hielten auf der Straße, und von überall her strömten plötzlich Leute herbei.
“Oh, was ist da denn passiert?“ Die Ameisen waren vergessen. Neugierig ging Peter dem Fahrer hinterher.
Dutzende von Menschen standen schon in einer großen Traube vor dem Bus und versperrten ihm die Sicht. Peter ging in die Knie und versuchte, sich zwischen den Beinen der Schaulustigen hindurchzudrängeln. Als ein Mann in grauer Stoffhose und mit hellbraunen Halbschuhen vor ihm einen Schritt zur Seite ging, sah er den Busfahrer auf dem Boden hocken und sich über etwas hinüberbeugen.
“Hallo, Junge, hörst du mich?“, rief der Fahrer mit weinerlicher Stimme, richtete sich ein wenig auf und blickte hilflos umher, wodurch er es Peter ermöglichte, den Körper eines Jungen auf der Straße liegen zu sehen . Dieser trug eine Jeanshose und blaue Sportschuhe. Unter dem Jungen war ein roter Gurt zu erkennen, der zu einem Ruckscke zu gehören schien.
“Hey, cool“, rief Peter. “Der hat die gleichen Schuhe an, wie ich!“ In dem Augenblick in dem er das sagte, wurde ihm allerdings auch bewusst, dass das vielleicht doch gar nicht so cool war, denn der Junge hatte offensichtlich einen schweren Unfall gehabt. Verschämt senkte er den Kopf.
“Was ist denn passiert?“ Peter sah fragend den Busfahrer an, der sich gerade wieder über das Kind beugte. Keiner reagierte auf seine Frage. Hoffentlich ist es niemand den ich kenne, überlegte er. Vielleicht jemand aus der Siedlung? Er schob sich näher heran.
Sirenen von Krankenwagen und Polizei waren nun zu hören, und an der zunehmenden Lautstärke wurde klar, dass sie sich der Unfallstelle rasch näherten.
Wie an Fäden gezogen richtete sich der Busfahrer mit bleichem Gesicht wieder auf, und gab für Peter den Blick gänzlich frei auf das am Boden liegende Kind.
Ihm stockte der Atem, als er erkannte, wer da auf der Straße lag. Er kannte den Jungen. Er kannte ihn sogar sehr gut. Dieser Junge war er selber.
Peter setzte sich auf seinen Hosenboden.
“Wie kann das sein? Ich bin doch hier?“, stammelte er. “Das ist gar nicht möglich.“ Regungslos starrte er auf den Körper, der sich nicht bewegte.
Der Rettungswagen hielt neben dem Bus, und Sanitäter drängten durch die Menge der Gaffer, die noch immer um die Unfallstelle herum standen. Sofort begannen die Retter, den auf der Straße Liegenden zu untersuchen.
Wie hypnotisiert beobachtete Peter, wie der Notarzt versuchte, ihm wieder Leben einzuhauchen. Er hörte mit einem Stethoskop nach den Herztönen, gab ihm eine Spritze, während der Sanitäter neben ihm eine Beatmungsmaske auf das Gesicht des Bewusstlosen, oder Toten?, setzte. Der Notarzt legte das Abhörgerät beiseite und begann mit der Herzmassage.
Gedämpft, als wäre er in Watte gepackt, hörte Peter zwei Polizisten die Personalien der Umherstehenden aufnehmen und sie nach dem Unfallhergang zu befragen. Aber alle schüttelten den Kopf. Niemand war dabei gewesen und konnte etwas darüber sagen, wie der Unfall passiert war. Keiner wusste, wieso der Junge plötzlich auf der Straße stand, so dass der Bus nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und ihn überfuhr.
Der Notarzt richtete sich auf und schüttelte den Kopf. “Das wird nichts mehr“, flüsterte er einem der Sanitäter zu. “Seine Verletzungen sind zu schlimm, wir können nichts mehr machen! Der Kleine ist hinüber.“ Mit ernstem Gesicht begann er, seine Tasche zusammenzupacken.
Peter spürte einen Kloß im Hals und wie ihm die Tränen in die Augen schossen. “Mama wird böse mit mir sein, wenn sie hört, dass ich einfach über die Straße gelaufen bin, ohne auf die Ampel zu achten.“
“Nein, das wird sie ganz bestimmt nicht“, sagte eine vertraute Stimme hinter ihm. Peter drehte sich schluchzend um. Oma Martha stand dort und lächelte ihn an.
“Peterle“, sagte sie sanft. “Du musst ganz tapfer sein. Du bist nicht mehr dort, wo du eben noch warst.“
“Wieso?“ Peter war verwirrt. Er zwinkerte, weil ihm die Tränen in den Augen brannten. “Wo bin ich denn? Ich sehe doch, dass ich hier bin!“
“Du hast eine Aufgabe zu erledigen.“
“Welche denn?“ Peter zog die Nase hoch und wischte sie zusätzlich noch am Ärmel ab.
“Geh zum Regenbogen, aber sei auf der Hut. Wähle deine Begleiter mit Bedacht. Dann wird alles gut.“
“Zum Regenbogen?“ Peter verstand gar nichts mehr. “Wie soll ich zum Regenbogen gehen? Wo ist der denn?“
Aber Oma Martha lächelte ihn nur an. Ihre Gestalt wurde blasser, und Peter erkannte, dass sie ihn allein lassen wollte.
“Oma, halt!“, rief er und sprang auf, um sie festzuhalten. “Geh nicht weg. Wo willst du denn hin? Lass mich nicht alleine. Oma, nein, bitte nicht, bleib doch!“ Doch sie war bereits verschwunden.
Die Tränen flossen ihm ungehindert über das Gesicht. Er fühlte sich hundeelend und verlassen. Er stand da und heulte wie ein Schlosshund.
Es dauerte eine ganze Weile bis er sich wieder beruhigte, und sich erneut die Nase an seinem Ärmel abwischte. Immer noch schluchzend und ein bischen wimmernd rieb er sich die Augen trocken.
Als sein Blick nicht mehr durch die Tränen verschwommen war, stellte er als erstes fest, dass er sich nicht mehr an der Unfallstelle befand, sondern auf einer großen Wiese.
Was ist denn jetzt? Er schaute sich um und sah in einiger Entfernung einen Wald. Wo bin ich hier? Das ist doch nicht unser Wald. Wie bin ich überhaupt hierher gekommen?
“Barky?“, rief Peter, in der Hoffnung, dass der Hund in der Nähe war, aber es kam keine Antwort. Vielleicht ist er schon in den Wald gelaufen und wartet dort auf mich. Entschieden ging er in Richtung des Gehölzes und rief immer wieder laut nach Barky.
Er erreichte das Wäldchen und marschierte zielstrebig hinein. Aber auch hier kam auf sein Rufen keine Antwort. Seine Stimme hallte gespenstisch von den Bäumen wider. Suchend irrte Peter eine Weile durch die Bäume, musste aber schließlich einsehen, dass er alleine war. Außer den Vögeln in den Bäumen war niemand bei ihm.
Traurig setzte er sich an einer geschützten Stelle auf den Waldboden, legte den Rucksack neben sich und lehnte sich an einen dicken umgekippten und vollkommen mit Moos überwucherten Baumstamm. Während er teilnahmslos einen großen dunkelbraunen Käfer beobachtete, der vor ihm durch das Gras wuselte, dachte er über das Geschehene nach.
Oma! Letztes Jahr, er erinnerte sich genau, war er gerade mit seinen Eltern aus dem Urlaub in Frankreich gekommen, als seine Mutter ihn beiseite genommen hatte. Sie war vor ihm in die Knie gegangen und hatte seine Schultern ergriffen. Ihre Augen waren rot, als hätte sie gerade Zwiebeln geschnitten.
“Hör mal zu, mein Schatz“, sagte sie mit ernster Miene. “Du bist doch ein großer Junge.“
Er nickte.
“Bisher bist du nach der Schule immer zu Oma Martha gegangen.“
Wieder nickte er.
“Das brauchst du nicht mehr. Ab heute kommst du bitte direkt nach Hause.“
“Warum denn?“
“Oma kann sich nicht mehr um dich kümmern. Sie ist gestorben und jetzt im Himmel.“
Na, das war vielleicht ein Schock. Schließlich war er jeden Nachmittag zu ihr gelaufen um von seinen Entdeckungen im Wald zu berichten. Sie hatte dann immer mit ernstem Gesicht genickt, ihre Schürze mit den blauen Karos abgenommen und aufgehört, sauberzumachen. Dann hatte sie sich im Wohnzimmer in ihren großen rosafarbenen weichen Ohrensessel gesetzt und gespannt seinen Erzählungen zugehört.
“Du musst mir versprechen, keine Dummheiten anzustellen, während ich noch arbeite“, hatte ihn seine Mutter ermahnt. Selbstverständlich hatte er das sofort mit großem Indianerehrenwort versprochen.
Klar war er ziemlich traurig darüber, dass Oma nicht mehr da war, aber auf der anderen Seite boten sich ihm dadurch nun neue, unvorstellbare Möglichkeiten für die ungeheuerlichsten Entdeckungen im Wald. Es stand ihm nun viel mehr Zeit zur Verfügung. Das war doch genial.
“Oma ist wieder da“, flüsterte Peter erschöpft und müde. Er griff nach einem Stöckchen und schubste den Käfer, der noch immer durch das Gras lief, mit einem gezielten Stups um. Eine Weile strampelte der Käfer mit den Beinen in der Luft und schaffte es nicht, sich wieder umzudrehen. Also hatte Peter ein Einsehen und half ihm mit einem neuerlichen Stups dabei. Sofort setzte dieser unbeirrte, als sei nichts geschehen, seinen Weg fort.
“Das heißt, eigentlich ist Oma auch schon wieder weg.“ Er seufzte und warf das Stöckchen weg. “Bin ich jetzt auch tot? Naja, was soll's. Immerhin war ich nicht alleine, als ich gestorben bin.“ Dieser Gedanke tröstete ihn ein wenig. “Aber was meinte Oma mit dieser Aufgabe? Was hat das zu bedeuten, dass ich zum Regenbogen gehen soll? Wie soll ich da hinfinden; und überhaupt, wo ist eigentlich Barky geblieben?“
Peter merkte, wie ihm erneut die Tränen in die Augen schossen. Er legte sich auf die Seite, den dicken Baumstamm im Rücken und den Rucksack unter dem Kopf. Dann, als müsse er sich vor etwas schützen, legte er den rechten Arm über seinen Kopf und ließ den Tränen freien Lauf.
Kurz darauf war er eingeschlafen.
Clarissa Montebey, Die Betrogene
Es war ein perfekter Tag. Der letzte in Clarissas Montebeys Leben.
„Das hat doch prima geklappt.“ Clarissa Montebey lehnte sich zufrieden in ihrem Sitz zurück. Nicht nur, dass sie auf einer Modenschau in Paris zwei wunderschöne Kleider erstanden hatte, war zu ihrem Glück auch noch ein Platz in einem früheren als dem gebuchten Flieger freigeworden.
Mit wachsender Begeisterung flog sie seit Jahren immer wieder zu den Modenschauen der berühmtesten Modemacher. Sie liebte die klassischen Kreationen des Giorgio Armani, die die weiblichen Linien betonenden Werke des John Galliano, der für das Haus Christian Dior entwarf, die Stücke des Designerteams Dolce & Gabbana oder die Wäsche von Jean Paul Gaultier. Sie alle versetzten sie regelmäßig in Verzückung. Aber auch die interessante, jedoch nicht so plakative Mode von Miuccia Prada gefiel ihr ausgesprochen gut.
In Gedanken ließ sie die Schau noch einmal wie einen Film ablaufen. Sie erinnerte sich an die Models, die, in teure Kleider gehüllt, den Catwalk entlang stolzierten.
Bei zweien dieser Kunstwerke hatte sie nicht widerstehen können. Einem engen dunkelblauen Kleid, das wunderbar zu Cocktailparties passte, natürlich mit passendem Hütchen und farblich abgestimmter Handtasche aus feinstem Nappaleder, sowie einem etwas großzügiger geschnittenem Kleid in einem glänzenden Champagnerton für elegantere Anlässe. Besonders erfreut war sie über das Schnäppchen, das sie für George gefunden hatte. Eine dezent gemusterte Krawatte in dem gleichen Champagnerfarbton wie das Kleid. Sie war sich sicher, dass sie George gefallen würde. Immerhin passte die Krawatte wunderbar zu seinem anthrazitfarbenen Anzug. Sie lächelte.
Zum i-Tüpfelchen des Tages war nun der frühere Flieger geworden, durch den sie enorm viel Zeit sparte. Ihre Planung ging dahin, ihren Mann mit einem exquisiten Abendessen zu überraschen.
Das Dröhnen der Turbinen wurde lauter, und kurz darauf presste der Schub der startenden Maschine Clarissa tiefer in ihren Sessel. Sie liebte den Start eines Flugzeuges. Diese unbändige Kraft, die es ermöglichte, so viele Tonnen Stahl in die Luft zu heben, verursachte ihr einen wohligen Schauer.
Die Stewardess brachte ihr ein Glas Champagner und stellte es vor ihr auf die Ablage. Mit spitzen Fingern und dunkelviolett lackierten Fingernägeln griff sie nach dem Glas und nippte an dem perlenden Getränk.
Es dauerte nicht lange und der Flieger landete in Hamburg. Clarissa winkte einem Träger und ließ ihr Gepäck zu einem der vor dem Flughafengebäude stehenden Taxis bringen.
Auf dem Weg in die City ging sie noch einmal die Liste der Zutaten durch, die sie für ihr geplantes Menü benötigte. In den Delikatessenläden am Gänsemarkt und auf dem Jungfernstieg würde sie alles bekommen, was zu einem solchen Mahl gehörte. Oliven, Thunfisch, Lachs, getrocknete und in Knoblauchöl eingelegte Tomaten und Paprikaschoten, Käse, Weintrauben, Pasteten und eingelegte Holunderbeeren, die George so gerne aß. Bestimmt würde ihr das eine oder andere noch einfallen, wenn sie erst einmal vor den Regalen stand.
Im Berufsverkehr näherten sie sich langsam der Alster, einem Gewässer im Herzen Hamburgs mit direktem Zufluss zur Speicherstadt und zum Hafen.
Clarissa holte einen kleinen Spiegel und ihren Lippenstift aus der Handtasche. Mit gekonntem Blick kontrollierte sie ihre Frisur, zupfte zwei Strähnen, die ihr vor die Augen gefallen waren, zurecht und zog anschließend die Lippen in dem gleichen dunkelvioletten Farbton nach, in dem auch ihre Fingernägel lackiert waren. Zufrieden verstaute sie Spiegel und Lippenstift wieder in der Tasche.
Sie fuhren gerade am Hotel Vier Jahreszeiten vorbei, als ihr Blick auf einen schwarzen Mercedes fiel, der vor dem Hotel parkte.
Den gleichen Wagen fährt George auch, ging es Clarissa wie beiläufig durch den Kopf, während sie an dem Fahrzeug vorbei rollten. Unbewusst sah sie zum Kennzeichen. HH-GM. Die Zahlen konnte sie auf die Schnelle nicht erkennen. Sie schmunzelte. GM wie George Montebey. Was für ein Zufall.
Sie waren bereits an dem Fahrzeug vorbei, als ihr klar wurde, dass es kein Zufall war, sondern dass es sich um den Wagen von George handelte.
“Halt!“, rief sie dem Fahrer aufgebracht zu. “Halten Sie sofort an!“
“Ist etwas nicht in Ordnung?“ Der Taxifahrer sah besorgt in den Rückspiegel und lenkte den Wagen an die Straßenseite.
“Das geht sie nichts an“, blaffte sie zurück und drehte sich auf dem Rücksitz nach hinten, um sich zu vergewissern, ob sie sich auch nicht täuschte. HH-GM 538. Es war das Kennzeichen von Georges Wagen. Aber was machte er hier? Georges Büro war zwar in der Nähe, aber es gab einen eigenen Parkplatz in einer Tiefgarage. Welchen Grund sollte es also geben, dass der Wagen auf der Straße stand und dann auch noch vor einem der besten Hotels in Hamburg?
Sie merkte, wie sie misstrauisch wurde. Einem Hefeteig ähnlich begannen Panik und Übelkeit in ihr zu gären. Sie kannte das nagende Gefühl gut, das die Eifersucht tief in ihr hinterließ. Schon oft war es zu bösen Auseinandersetzungen zwischen ihr und George gekommen, und so mancher Teller war zu Bruch gegangen. Bisher jedoch war es ihm immer wieder gelungen, sie davon zu überzeugen, dass es keinen Grund für Eifersüchteleien gab. Letztes Mal, es war noch keine acht Wochen her, hatte sie ihm sogar versprechen müssen, sich zukünftig zu bemühen, ihre Eifersucht im Zaum zu halten. Ohne Vertrauen, so meinte er, funktioniert keine Ehe.
Nun werde mal nicht gleich hysterisch, rief sie sich zur Ordnung und versuchte, sich an ihr Versprechen zu halten. Bestimmt ist nur ein Geschäftskunde angereist und George hatte ihn zum Hotel gefahren, damit dieser einchecken und seine Koffer ins Zimmer bringen konnte.
Ein wenig entspannte sie dieser Gedanke.
Sie war gerade im Begriff sich wieder umzudrehen, als sich die Tür des Hotels öffnete und George in Begleitung einer schlanken Blondine aus dem Gebäude trat.
“Also doch! Mein Instinkt hat mich noch nie im Stich gelassen“, fauchte sie leise.
“Hören Sie, wir stehen im Halteverbot. Wir müssen weiter fahren. Oder wollen Sie hier aussteigen?“
Clarissa starrte durch die Heckscheibe zu dem schwarzen Mercedes. George. Es war George. Soviel stand fest. Und George hielt diese Frau im Arm. Beide lachten.
Clarissas Herz pochte, als würde jemand von innen gegen ihre Brust klopfen und damit zu erkennen geben: Hey, das ist hier zu eng, ich will raus!
Sie atmete tief ein und schluckte den Kloß in ihrem Hals runter. Tränen stiegen ihr in die Augen.
Jetzt ist es also vorbei, stellte sie enttäuscht fest. George hat immer beteuert, dass er mich liebt und es keine andere Frau in seinem Leben gibt. Aber ich wußte schon, warum ich ihm nie wirklich glauben wollte. Auf meine Intuition konnte ich mich stets verlassen. Jetzt habe ich den Beweis.
“Haben Sie mich gehört?“ Die Stimme des Fahrers drang in ihr Bewusstsein.
“Was?“
“Ich habe gesagt, wir müssen hier weg, wir stehen im Halteverbot. Ob Sie aussteigen möchten, oder ob wir weiterfahren sollen?“
“Wir fahren gleich weiter.“ Clarissa überlegte einen Augenblick. “Allerdings habe ich das Ziel geändert.“
“Meinetwegen. Aber wir müssen hier jetzt weg. Da vorne kommt schon ein Polizist.“
“Ja doch!“, herrschte sie ihn an. “Ich habe Sie ja verstanden. Einen Moment noch.“
Ihr Entschluss stand fest. Sie würde sich die beiden Turteltauben näher ansehen und bei günstiger Gelegenheit zur Rede stellen. So leicht würde sie sich nicht geschlagen geben.
“Hören Sie“, sagte sie zu dem Fahrer. “Da hinten, vor dem Hotel, steht ein schwarzer Mercedes. Ich möchte, dass sie ihm folgen.“
“Meinetwegen“, erwiderte der Fahrer mürrisch. “Hauptsache, die fahren bald los. Einen Strafzettel kann ich nämlich überhaupt nicht gebrauchen.“
“Die fahren bestimmt gleich weg. Den Strafzettel übernehme ich, falls Sie einen bekommen sollten“, erklärte Clarissa versöhnlich.
Wenig später fuhr der Mercedes an ihnen vorbei, und das Taxi klebte sich an seine Stoßstange.
Sie verließen das Stadtzentrum in Richtung Westen. Nach etwa dreißig Minuten und etlichen roten Ampelphasen auf der Elbchaussee wurde der Mercedes langsamer und bog schließlich in eine Einfahrt, die zu einer großen Villa gehörte.
“Warten Sie hier.” Clarissa hielt dem Taxifahrer einen Geldschein hin. “Ich bin gleich wieder zurück.“
“Wie Sie wollen“, lachte dieser. “Solange Sie genügend Kleingeld haben, warte ich hier bis Weihnachten, wenn es sein muss.“
Clarissa stieg aus. Sie mochte diesen Taxifahrer nicht. Aber es war besser, wenn das Gepäck im Wagen blieb. Es würde sie nur bei ihrem Vorhaben behindern.
Vorsichtig betrat sie die Einfahrt zum Grundstück und suchte Schutz hinter einer großen Buchsbaumkugel.
Der Mercedes war am Haus angekommen. Erst erloschen die Bremslichter, dann öffneten sich die Türen. Lachend stiegen George und die Blondine aus und betraten Arm in Arm das Gebäude.
„Das ist ja widerwärtig, wie sich diese Schlampe an seinen Hals wirft“, murmelte Clarissa.
Hinter Büschen und Sträuchern schutzsuchend näherte sie sich der Villa. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und spähte durch eines der Fenster an der Vorderseite, konnte aber nichts erkennen. Leise umrundete sie das Haus und blieb abrupt stehen, als sie Georges Stimme hörte.
“Oh Mann, Ria, Babe, du machst mich total wuschig.“
“Das will ich doch wohl hoffen“, antwortete eine rauchige Frauenstimme.
“Du fühlst dich so gut an. Du glaubst gar nicht, wie ich es satt habe mit meiner Frau. Da verballert sie mein ganzes Geld für Kosmetik und Fitness, aber nützen tut es auch nichts. Aus der ist die Luft raus. Ich denke, ich werde ihr bald den Geldhahn zudrehen. Schauen wir mal, was sie dann macht.“
“Dann wird sie noch älter aussehen, als sie es jetzt schon tut.“ Das Luder lachte und George fiel in ihr Lachen ein.
Clarissa traute ihren Ohren nicht. Geschockt und innerlich verletzt lehnte sie sich mit dem Rücken an die Hauswand und atmete tief durch. Allmählich beruhigte sich ihr Atem ein wenig und sie spähte um die Ecke.
Die Terrassentür stand offen. Obwohl es im Zimmer dunkler war als draußen im Garten, erkannte sie deutlich, wie George die Blondine auszuziehen begann.
Clarissa wurde übel.
Das ist also der Dank dafür, dass ich ihm jahrelang den Rücken freigehalten habe? Immer, wenn er mit seinen Geschäftspartnern zu Hause zum Essen anrauschte, war ich die perfekte Gastgeberin. Und wofür? Nur, um jetzt ausrangiert zu werden, wie ein altes Kleidungsstück? Bin ich mit 42 wirklich schon alt?
Mit Mühe unterdrückte sie ein Schluchzen.
Dann macht es auch keinen Sinn, die beiden zur Rede zu stellen. Sie würden mich nur auslachen, und ich wäre blamiert wie ein verliebter Teenager mit frisch gebrochenem Herzen.
Mit Tränen in den Augen schlich sie zum Taxi zurück.
Während der Wagen sie nach Hause brachte, hing sie weiter ihren Gedanken nach. Ich bin auch selber Schuld. Was habe ich mir bloß davon versprochen, die beiden in flagranti zu erwischen? Ich würde mich nur lächerlich machen. Darauf kann ich gut verzichten.
Immerhin wusste sie jetzt, was zu tun war.
Eine Stunde später war Clarissa zu Hause.
Mit einem Glas Rotwein in der Hand setzte sie sich auf den Badewannenrand und ließ warmes Wasser einlaufen. Der Badezusatz bildete im Wasserstrahl weiße Schaumbläschen, die sich zu immer höheren Gebilden auftürmten. Es roch angenehm nach wilder Rose. Gedankenverloren spielten die Finger ihrer rechten Hand mit den Schaumwolken.
Wenn ich nicht mit einem früheren Flieger nach Hause geflogen wäre, wüsste ich noch immer nichts von den beiden. Wie lange das wohl schon geht? Wieso bloß habe ich nichts davon gemerkt?
„Nun ist es egal. Wenigstens weiß ich jetzt, woran ich bin“, sagte sie mit fester Stimme. „Mein Entschluss steht fest. Ich werde diesen perfekten Tag auch perfekt beenden.“ Sie hob das Glas. „Prost, Clarissa. Oh, der Wein ist alle!“
Mit dem leeren Glas schlenderte sie ins Wohnzimmer, griff nach der Flasche auf dem Wohnzimmertisch und goss sich das Glas wieder voll. Gerade wollte sie die Flasche wieder zurückstellen, als sie zögerte. Sie überlegte einen Moment, zuckte dann mit den Schultern, lächelte und nahm kurzerhand die Flasche mit. Im Badezimmer stellte sie sie auf den Servierwagen neben der Badewanne und trank anschließend das Glas in einem Zug leer.
Ihr Blick glitt über den Spiegel, und sie sah in ihm ein perfekt geschminktes aber unendlich trauriges Gesicht. Sie seufzte und griff nach einem der Pillenröhrchen, die auf dem Servierwagen standen. Ruhig öffnete sie den Verschluss und schüttete alle Tabletten in ihre Hand. Mit der anderen griff sie nach dem Wein, goss sich das Glas voll und spülte die Tabletten mit der roten Flüssigkeit runter. In der gleichen Weise verfuhr sie mit den anderen acht Röhrchen.
Seit Jahren sammelte sie alles was sie an Tabletten bekommen konnte. Zwar war sie sich nie sicher gewesen, wofür genau sie die Tabletten sammelte, aber es gab ihr immer ein gutes Gefühl, sie einfach zu haben. Irgendwann einmal, davon war sie überzeugt, würde sie die Tabletten schon brauchen.
Nun war ihr klar, wofür.
Nachdem sie alle Tabletten geschluckt hatte, ging sie in die Küche, holte ein großes, scharfes Messer aus der Schublade und legte es neben die Weinflasche auf den Servierwagen.
Noch einmal goss sie das Glas voll und ging damit ins Schlafzimmer. Am Kleiderschrank hing auf einem Bügel das neue blaue Cocktailkleid. Zufrieden begutachtete sie das teure Stück, während sie an ihrem Wein nippte.
Augenblicke später schlüpfte sie aus ihren Leinenschuhen, zog sich Pullover und Jeans aus und legte alles ordentlich zusammen auf den Hocker neben dem Bett. Dann nahm sie das Kleid vom Bügel und glitt hinein. Sie drehte sich ein wenig hin und her und begutachtete sich dabei in dem großen Spiegel am Schrank. Ein abschließendes Nicken, und mit dem Glas in der Hand ging sie zurück ins Badezimmer. Ohne zu zögern, stieg sie in das warme Wasser.
Entspannt und zufrieden lehnte sie sich zurück und schloss die Augen.
Das sollte es also gewesen sein? Sie öffnete wieder die Augen und nahm einen großen Schluck Wein. Wärmend rann er durch ihre Kehle. Allmählich spürte sie, wie der Alkohol ihr die Sinne benebelte. Sie griff nach dem Messer, und ihre Fingerspitzen strichen, fast schon liebevoll, an der Klinge auf und ab. Ein Lächeln umspielte ihre Lippen. Ruhig fuhr sie mit der Klinge über den linken Arm. Vom Ellbogen über die Elle, am Daumen vorbei zum Mittelfinger. Dann bewegte sie das Messer wieder zurück. Diese Mal jedoch verstärkte sie den Druck am Handgelenk, so dass die Klinge tief ins Fleisch schnitt. Augenblicklich quoll Blut aus der Wunde.
Fasziniert sah Clarissa zu, wie die roten Tropfen ins Wasser fielen und den Schaum rosa und den Kleiderstoff dunkel färbten. Sie wechselte das Messer in die linke Hand und wiederholte die Prozedur, ebenso langsam und bedächtig, an ihrem rechten Arm. Als sie damit fertig war, hob sie den Blick, um das Messer auf den Servierwagen zurückzulegen.
Im gleichen Augenblick, in dem sie den Blick hob, entwich ihrer Kehle ein Schrei.
Neben der Wanne stand ein Engel.
„Das kann doch nicht möglich sein“, sagte sie lauter als beabsichtigt. „Clarissa, altes Haus, deine Sinne spielen dir einen Streich. Du hast jede Menge Alkohol und Tabletten intus. Du siehst Gespenster. Es gibt keine Engel.“
Sie schloss die Augen in der Hoffnung, dass die Gestalt weg war, wenn sie sie wieder öffnete. Aber der Engel stand noch immer neben der Badewanne und lächelte sie an.
„Geh weg!“ Ihre Stimme lallte ein wenig. „Du bist nicht echt, es gibt keine Engel.“
„Woher willst du das denn wissen?“ Der Engel verschränkte seine Arme vor der Brust und sah Clarissa freundlich an.
Clarissa traute ihren Ohren kaum. „Nein! Nein, nein, das kann nicht sein. Das bilde ich mir nur ein. Nicht genug, dass ich einen Engel neben der Wanne stehen sehe, ich bilde mir auch noch ein, dass er mit mir redet. Ich werde jetzt die Arme ins Wasser tauchen, die Augen schließen, das warme Wasser genießen, und dann hat der Spuk ein Ende.“
„Glaubst du?“
„Auch, wenn du nicht da bist und ich eigentlich mit mir selber rede: Ja, das glaube ich. Wenn ich erst tot bin, sehe ich auch keine Engel mehr.“
„Und was ist, wenn du bereits tot bist?“
„Dann ist das Ganze noch verrückter als ich dachte.“ Clarissa tauchte die blutenden Pulsadern ins mittlerweile rote Badewasser.
„Du kannst die Arme ruhig wieder hoch nehmen.“
„Warum?“
„Weil es keinen Sinn mehr macht, ob du sie ins Wasser tauchst, oder nicht.“
„Woher willst du das schon wissen? Du bist nicht real.“
„Ich weiß es. Ich wäre sonst nicht hier.“
„Was soll das bedeuten, du wärest sonst nicht hier?“
„Na was schon? Du hast Dein Ziel erreicht. Du bist tot, und ich hole dich ab. Du hast noch was zu erledigen. Steh jetzt auf. Wir müssen los.“
Clarissa kniff die Augen zu und rührte sich nicht.
Das ist bloß ein Traum, ging es ihr durch den Kopf. Vermutlich sind das die Wirkungen der Medikamente. Halte durch, Clarissa. Es wird gleich vorbei sein und dann bist du wirklich tot. Wenn man stirbt, steht nicht auf einmal ein Engel neben der Badewanne und sagt, man solle aufstehen, weil man noch was zu erledigen habe.
Mit fest zugekniffenen Augen lag Clarissa im warmen Wasser und wartete, dass etwas passierte.
„Willst du da liegen bleiben, bis das Wasser kalt ist?“
Clarissa bemühte sich, die Augen nicht zu öffnen und das, was sie meinte zu hören, zu ignorieren.
„Na gut. Ich habe Zeit. Ich werde hier so lange stehenbleiben, bis du einsiehst, dass es nichts bringt, tot im blutigen Wasser herumzuliegen. Wie tot möchtest du denn gerne sein?“
Clarissa öffnete die Augen. „Was soll denn das schon wieder heißen, wie tot möchte ich gerne sein?“
„Das soll heißen, dass du bereits tot bist. Wie ich schon sagte.“
„Aber ich habe doch gar nichts davon gemerkt“, erwiderte Clarissa ein wenig entrüstet. Sie hatte sich das Sterben immer ganz schlimm vorgestellt. Entweder schmerzhaft oder aber, dass es dunkel wird und dann nichts mehr ist. Dass sie einfach verschwindet. Jetzt sollte das alles gar nicht so schlimm sein?
„Ach, ich verstehe. Es war dir nicht schrecklich genug. Tja, tut mir leid. Aber das ist so gar nicht vorgesehen. Leider denken die meisten Menschen, dass das Sterben eine furchtbare Sache ist. Ich bin mir auch nicht sicher, woher dieser Irrglauben kommt. Aber eigentlich ist das Sterben nur für die trauernden Hinterbliebenen schlimm, oder die die meinen, sie könnten ohne den, der gestorben ist, nicht weiterleben. Manchmal leiden natürlich auch die, die sterben. Aber eigentlich auch nur, weil sie sich am Leben festklammern. Sie denken, dass alles vorbei ist, wenn sie sterben.“
„Ist es das denn nicht?“
„Nein.“
Einen Augenblick herrschte Ruhe.
„Also was ist nun? Kommst du?“ Der Engel klang ein wenig fordernd, aber noch freundlich und geduldig.
„Wohin?“
„Na nach drüben. Wohin denn sonst?“
„Nach drüben?“
„Ja, nach drüben!“
„Wo ist drüben?“
„Das wirst du schon noch erfahren. Alles zu seiner Zeit. Steh auf. Wir müssen los.“
Clarissa verstand noch immer nicht, was gerade mit ihr passierte. Sie hob die Arme aus dem Wasser und sah sie sich an. Eigentlich hätten an den Handgelenken große blutende Wunden sein müssen, aber dort war nichts zu sehen. Die Haut war heile.
Wie kann das möglich sein? Ich habe mir doch mit dem großen Messer die Pulsadern aufgeschnitten.
Dass das Wasser, in dem sie lag, rot verfärbt war, bemerkte sie nicht. Nachdenklich stand sie auf und kletterte aus der Badewanne. Automatisch griff sie nach dem Handtuch und trocknete sich ab, während das Kleid an ihrem Körper klebte.
In alter Gewohnheit wollte sie das Wasser aus der Wanne ablassen und drehte sich um. Bevor der Schrei ihre Kehle verließ, schlug sie die Hand vor den Mund. Was sie sah, ließ ihr den Atem stocken.
Sie selber lag blutüberströmt in der Badewanne, die Pulsadern aufgeschnitten und das Gesicht bis zur Nase unter Wasser.
Ich bin also wirklich gestorben. Der Engel hat doch Recht.
Bei dem Gedanken an den Engel drehte sie sich um. Noch immer stand er im Badezimmer und lächelte sie an.
„Komm!“, sagte er sanft und hielt ihr die Hand entgegen. „Hab keine Angst.“
Unsicher ergriff sie seine Hand, und mit einem Mal war alles um sie herum von gleißendem Licht erfüllt. Sie fühlte sich leicht und glücklich, und eine friedliche Wärme durchströmte sie.
Gerade wollte sie sich in dem hellen Licht fallen lassen, da bemerkte sie, wie die Intensität des Lichtes wieder abnahm. Enttäuscht sah sie sich um. Das Badezimmer war verschwunden. Stattdessen wurde langsam eine Landschaft sichtbar.
Florian Eichner, Der Träumer
Die Party war in vollem Gange.
Florian Eichner saß, mit dem Rücken an den Tresen gelehnt, auf einem Barhocker; in den Händen ein Glas Cola, auf dessen Außenseite sich durch die Kälte des Getränkes Tropfen aus Kondenswasser bildeten. Vereinzelt schlossen sich kleinere Tropfen zu größeren zusammen und rutschten dann gemeinsam, der Erdanziehung folgend, am Glas herunter bis zu Florians Zeigefingern. Gedankenverloren wischte er sich hin und wieder seine feuchten Hände an der Jeans ab.
Sein Blick war zwar auf die Tanzenden vor ihm gerichtet, doch seine Gedanken wirbelten um die bevorstehende Geburt seines und Elke ersten Kindes.
Es war ihre Idee, dass er zu der Fete fahren solle, und so hatte er sich, mehr oder weniger freiwillig, bereit erklärt, seine Kumpels hinzufahren. Zwar kam es ihm sehr gelegen, an diesem Abend keinen Alkohol trinken zu müssen, aber nun saß er hier wie auf einem heißen Grill und wartete darauf, dass das Handy klingelte und er eine SMS von Elke bekam, in der stand, dass die Wehen eingesetzt hätten. Dann würde er sofort nach Hause zurück fahren, um sie abzuholen und in die Klinik zu bringen. Seine Freunde müssten dann allerdings selber zusehen, wie sie nach Hause kämen, denn er wollte unbedingt bei der Geburt dabei sein. „Schließlich“, so versuchte er allen voller Stolz klarzumachen, „bekommt man nur einmal ein erstes Kind.“
Manchmal glaubte er, er wäre aufgeregter, als Elke. Dabei war sie es doch, der eine schmerzhafte Geburt bevorstand.
„Vielleicht ist es besser, wenn ich nicht zu der Party fahre“, hatte er ihr noch am frühen Abend angeboten, aber sie beruhigte ihn.
„Florian, es ist noch nicht soweit, glaube mir. Geh ruhig, und mach dir einen schönen Abend. Wenn du erst mal nachts zum Füttern aufstehen musst, wirst du dich früh genug an „die Zeit davor“ zurücksehnen“, versicherte sie und versuchte, eine ernste Miene dabei zu machen, was ihr nicht mal ansatzweise gelang, so dass sie nach ein paar Augenblicken beide losprusten mussten. Als er sie in den Arm nehmen wollte, hatte sie ihm einen Kuss gegeben und ihn sanft zur Tür bugsiert. „Ich schicke dir eine SMS, wenn ich doch Wehen bekomme. Einverstanden? Komm nur heile wieder, das ist das Einzige, was zählt.“
„Mal den Teufel mal nicht an die Wand. Ich bin doch nur drei Dörfer weit weg, was soll da schon passieren?“, erwiderte Florian.
„Viel Spaß, und amüsier dich gut“, rief sie ihm noch hinterher und war winkend vor dem Haus stehengeblieben, als er mit dem Wagen die Auffahrt hochfuhr und auf die Landstraße abbog.
Florian schmunzelte bei dem Gedanken, wie er sie mit ihrem dicken Bauch im Rückspiegel gesehen hatte, den sie fast vollkommen ausfüllte. Er freute sich riesig auf seinen Nachwuchs. Sie waren sich schnell einig gewesen. Sollte es ein Mädchen werden, würde es Marie heißen, und sollte es ein Junge werden, bekam er den Namen Max.
„Hey, Florian, träumst du?“
Erst jetzt bemerkte Florian die Hand, die wie ein Scheibenwischer vor seinen Augen hin und her fuchtelte.
„Ist ja gut Olaf, pass auf, dass dir die Hand nicht abfällt.“ Florian grinste seinen Freund an. „Was ist los? Kleine Verschnaufpause, oder ist Betty nicht mehr da?“
„Doch, doch, alles im grünen Bereich“, lachte Olaf verschmitzt zurück. „Sie ist sich bloß die Nase pudern.“
„Und Frank und Dieter? Wo sind die abgeblieben?“
„Keine Ahnung.“ Olaf ließ seinen Blick über die Leute streifen und überlegte. „Ich glaube, vorhin habe ich sie mit ihren besten Freunden ‘Jonny Walker’ und ‘Jim Beam’ auf die Terrasse verschwinden sehen. Vermutlich lassen sie sich volllaufen.“
Er stellte sich auf die Zehenspitzen und sah über die Köpfe der Tanzenden hinweg zum Fenster.
„Ach guck“, sagte er und streckte den Arm in die Richtung. „Petra und Anne sitzen auch draußen.“ Olaf zwinkerte ihm verschwörerisch zu.
„Ah, verstehe“, erwiderte Florian. „Dann lass uns mal nachsehen, wie es den beiden geht.“
„Welche beiden meinst du? Die Frauen oder die Flaschen?“ Olaf konnte sich nicht beherrschen und lachte brüllend über seinen eigenen Witz.
Florian rutschte grinsend vom Hocker und bahnte sich den Weg zur Terrasse.
„Warte, ich komme mit.“ Heiter folgte Olaf seinem Freund.
Sie schoben sich durch den von Menschen überquellenden Raum. Einige Bekannte hatten am Morgen ihre Abschlussprüfungen bestanden und dementsprechend viele Leute waren gekommen, um das Ende ihrer Ausbildung zu feiern. Einer der Prüflinge hatte seine Eltern für das Wochenende in Urlaub geschickt und die Wohnung kurzerhand in eine Partyhöhle verwandelt.
Die Stimmung war gelassen und fröhlich. Die meisten Gäste standen auf der Tanzfläche, die vorher das Wohnzimmer gewesen war, und unterhielten sich angeregt, wobei Unterhaltung vermutlich der falsche Begriff war, denn die lärmende Musik zwang sie eher dazu, sich gegenseitig in die Ohren zu schreien. Einige versuchten, trotz der beengten Verhältnisse, zu tanzen und ließen sich nicht dadurch stören, dass die anderen ihnen eigentlich keinen Platz dafür ließen. Der Alkohol floss in Strömen und machte alle entsprechend locker und tolerant.
Das Cola-Glas über seinem Kopf haltend quälte sich Florian bis zur Terrassentür. Durch die Scheibe entdeckte er die beiden Mädchen. Auf dem Tisch neben ihnen standen zwei leere Whisky-Flaschen, und auf der anderen Seite des Tisches lagen mehr als dass sie saßen, Frank und Dieter auf einer Bank. Beide hielten, abgestellt auf ihren Bäuchen, ein Glas in den Händen, in dem sich noch ein Rest Whisky befand. Mit glasigen Augen, die immer wieder zuzufallen drohten, glotzten sie teilnahmslos geradeaus in die Gegend.
„Oh je.“ Florian zog die Augenbrauen hoch. „Das hat wohl nicht so richtig hingehauen mit den beiden.“
Die kühle Nachtluft war eine Wohltat nach dem verräucherten Zimmer und gierig sog er sie in seine Lungen.
Der Frühling machte sich zwar langsam bemerkbar, aber der Geruch von feuchtem Laub aus dem letzten Herbst lag noch immer in der Luft. Nicht weit hinter der Terrasse begrenzte Nebel die Sicht.
„Hi.“ Florian ging auf die Frauen zu. „Na, alles klar?“
„Bei uns ja“, antwortete Petra zickig und ließ die Mundwinkel nach unten hängen. „Aber bei denen nicht.“ Sie hob das Kinn in Richtung Frank und Dieter.
Dieter ahnte, dass man über ihn sprach und begann zu kichern, während ihm beinahe das Glas vom Bauch rutschte. „Hallo Florian“, lallte er undeutlich. „Ich wusste gar nicht, dass du auch da bist.“
„Alter, wir sind zusammen hergekommen, weißt du nicht mehr?“
Dieter hob das Glas zum Mund und trank es aus. „Nee, weiß ich nicht mehr“, antwortete er mit schwerer Zunge.
Florian wandte sich an seinen anderen Freund, der sich die ganze Zeit nicht bewegte. „Frank? Alles in Ordnung?“
Dieser war jedoch in eine andere Welt abgetaucht und reagierte nicht. Starr sah er einfach nur geradeaus.
„Na, ich glaube, diese Party ist vorbei, oder was meinst du?“ Florian drehte sich zu Olaf um und sah ihn fragend an.
„Jepp, das sehe ich genauso. Schade eigentlich, ich wäre gerne noch eine Weile mit Petra und Anne“, er stockte, als ihm siedendheiß Betty einfiel. „Oh Shit. Betty. Die habe ich ganz vergessen. Ich werde mal sehen, ob ich sie finde.“
„Alles klar“, erwiderte Florian. „Ich versuche in der Zwischenzeit, die beiden Schnapsleichen hier zum Auto zu verfrachten.“
„Schaffst du das alleine, oder soll ich dir helfen?“
„Kommt darauf an, wie lange du brauchst, um dich von Betty zu verabschieden.“ Florian überlegte kurz. „Oder willst du noch bleiben?“
„Naja“, zögernd kratzte sich Olaf am Kopf. „Eigentlich hätte ich da schon noch andere Pläne.“ Schelmisch grinste er Florian an. „Aber, ach, egal, ich habe auch schon eine ganze Menge getankt. Betty kann ich bestimmt ein anderes Mal wiedertreffen. Bin gleich zurück“, sagte er und verschwand ins Innere des Hauses.
Florian drehte sich seinen Freunden zu. „So ihr beiden. Die Party ist zu Ende. Ab geht es, zurück zu Muttern.“ Er nahm Dieter das Glas aus der Hand, was diesen mit plötzlichem Leben erfüllte.
„Hey, gib das wieder her. Ich will noch was trinken.“
„Es gibt nichts mehr. Ihr habt alles ausgetrunken“, erklärte Florian.
„Du lügst.“
„Hör auf zu quatschen. Schau doch, wenn du mir nicht glaubst.“ Florian trat zur Seite, damit Dieter einen Blick auf die Flaschen werfen konnte. „Alles leer.“
„Dann hole ich mir eben noch was von drinnen.“ Dieter stützte sich mit den Händen auf seine Knie und versuchte, sich hochzustemmen.
„Das glaube ich kaum“, erwiderte Florian. „Wir gehen jetzt zum Auto. Außerdem ist es schon weit nach Mitternacht.“
„Mir doch egal“, polterte Dieter zurück.
„Mir aber nicht. Los komm jetzt, ich bringe dich nach Hause.“
Florian fasste Dieter an den Ellbogen und half ihm hoch. Mit großer Anstrengung erhob dieser sich und blieb heftig schwankend stehen.
„Ich will aber noch was trinken, die Party ist doch noch gar nicht vorbei“, lallte Dieter.
„Für dich schon, mein Freund.“ Florian wandte sich um. „Frank? Schaffst du es alleine?“
Frank hob nun doch den Kopf, sah mit trüben Augen zu Florian, und ganz allmählich verzog er das Gesicht zu einem Feixen. Er sagte aber nichts.
„Alles klar?“, fragte Florian. Frank nickte langsam, behielt das Grinsen aber bei. „OK, ich sehe schon, ich komme gleich wieder.“ Er wandte sich an die beiden Frauen. „Habt ihr kurz ein Auge auf ihn?“ Beide nickten beiläufig, unterhielten sich aber weiter.
Dieter war in der Zwischenzeit auf dem Weg zur Terrassentür. Amüsiert beobachtete Florian wie es ihm gelang, um einige Stühle herumzutorkeln ohne gegenzustoßen. Die Tür jedoch schien ein größeres Hindernis auf dem Weg zur Theke zu sein, und gerade noch rechtzeitig sprintete Florian ihm zur Hilfe und fing ihn auf, als er von der geschlossenen Glastür abprallte.
„Hey, langsam Alter.“
„Pah, ich habe genau gesehen, dass die Tür zu ist.“
„Ja, klar.“
Florian öffnete die Tür. Zigarettendunst gemischt mit Schweißgeruch, dem hämmernden Bass der Stereoanlage und Stimmengewirr, hin und wieder von einem Grölen oder lauten Gelächter durchbrochen, schlug ihnen entgegen. Von einer unsichtbaren Kraft mobilisiert stürmte Dieter in das überfüllte Zimmer. Sein Weg führte ihn geradewegs zu der kleinen Theke.
„n’ Whisky!“, bestellte er mit schwerer Zunge.
„Hast wohl wieder vollgetankt, was?“ Christine, an diesem Abend die Getränkefee, sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. „Meinst du, dass es gut ist, noch mehr zu trinken?“
„Quatsch mich nicht voll, rück endlich den Whisky rüber.“
Christine zuckte mit den Schultern, füllte ein Glas mit Whisky und stellte es vor ihm ab.
„Ich würde sagen, du trinkst das im Auto.“ Florian stand hinter Dieter. „Wir gehen jetzt. Los. Du wartest im Wagen, während ich Frank hole. OK?“ Florian fasste Dieter von hinten an beide Schultern und schob ihn vor sich her in Richtung Ausgang.
Dieter hielt das Glas mit beiden Händen fest und setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen, um keinen Tropfen des edlen Nass' zu verschütten.
Am Wagen ließ er sich auf den Beifahrersitz fallen, hob das Glas zum Mund und nuckelte glücklich daran, wie ein Baby an seiner Flasche.
„Du rührst dich nicht von der Stelle, hast du das verstanden?“ Dieters Grunzen wertete Florian als Zustimmung.
Frank saß noch immer auf der Bank und schlief, in den Händen das leere Glas, das sicher auf dem Bauch deponiert war. Von den beiden Frauen war nichts zu sehen.
Florian rüttelte ihn am Arm. Nichts passierte, außer dass ein tiefer Atemzug in Form eines Schnarchens aus Frank entwich.
„Na Klasse. Das kann ja heiter werden“, ächzte Florian und rüttelte Frank erneut am Arm, dieses Mal energischer. „Wach auf, Frank!“ Lediglich ein Brummen, das sich wie das Knurren eines Hundes anhörte, ließ sich Frank entlocken. „Ach shit, das hat keinen Zweck.“ Florian ging zurück ins Haus und suchte Olaf.
In der Küche, in der deutlich mehr Menschen standen als hineinpassten, entdeckte er ihn schließlich. Munter goss dieser Ouzo aus einer bereits halb leeren Flasche in ein Schnapsglas, während Betty ihm mit glasigen Augen und leicht schwankend dabei zusah. Kaum war das Glas voll, war es auch schon wieder leer, denn Betty, so schien es, hatte eine Abneigung gegen gefüllte Gläser.
Nun war Florian sauer. „Ich dachte, du wolltest dich nur verabschieden und dann gleich wiederkommen?“
„Bleib mal locker!“ Olafs Stimme verriet, dass er mittlerweile auch ziemlich betrunken war. Aber wenigstens konnte man sich noch mit ihm unterhalten.
„Ich brauche deine Hilfe. Frank sitzt noch immer draußen, ist aber nicht mehr ansprechbar. Wir müssen ihn irgendwie zum Auto manövrieren.“
„Hey, Mann.“ Olaf hob Florian ein Glas Ouzo entgegen. „Trink erst mal was, dann siehst du alles viel gelassener.“
„Nein, ich muss fahren“, erwiderte Florian knapp.
„Ach, ist doch egal. Ein kleines Gläschen wird schon nicht schaden.“
Florian schüttelte den Kopf und quetschte sich an zwei Männern vorbei aus der Küche. „Los jetzt“, rief er Olaf über die Musik hinweg zu.
Olaf sah ihn einen Moment forschend an, nickte dann und trank sein Glas in einem Zug aus. „Tja Betty, wir müssen unsere private Party verschieben.“
„Ach schade. Warum denn?“, nölte Betty. „Bleib doch hier. Wir suchen uns eine kuschelige Ecke und.“
„Sorry Süße, geht nicht. Ich würde ja gerne, aber die anderen brauchen mich.“ Olaf gab ihr einen langen Kuss. „Außerdem muss ich nach Hause. Zu meiner Frau.“ Damit drehte er sich um und schlingerte an Florian vorbei aus der Küche. Florian sah Betty an, zuckte mit den Schultern und folgte Olaf auf die Terrasse.
Während Dieter noch immer mit seinem mittlerweile fast leeren Glas auf dem Beifahrersitz saß, verfrachteten sie Frank mit vereinten Kräften auf die Rückbank des Wagens.
Nachdem die beiden angeschnallt waren, ließ Florian sich auf den Fahrersitz fallen und lehnte sich mit einem langgezogenen Seufzer gegen die Rückenlehne. „Man, das war eine schwere Geburt.“
„Jepp“, kam von Olaf, der neben Frank auf die Rückbank kletterte.
Florian zog sich den Sicherheitsgurt über die Brust, startete den BMW und fuhr los. Er bemühte sich, so ruckelfrei wie möglich zu fahren, damit niemandem übel wurde und auf die Idee kam, ihm das Auto vollzukotzen. Erst nach dem Ortsschild beschleunigte er den Wagen.
Nach einigen hundert Metern verschwand die Straße hinter einer engen Linkskurve im Wald. Die Bäume standen, wie stumme Beobachter, dicht am Straßenrand, und als der Wagen an ihnen vorbei sauste, sah es durch den Fahrtwind aus, als würden die Äste nach ihm greifen wollen.
Nur hin und wieder drang etwas Mondlicht durch das erste neue Blätterwerk des Jahres auf die Straße, und Florian schaltete das Fernlicht an. Augenblicklich war der Wald vor ihm in kaltes, weißes Licht getaucht, das die Scheinwerfer vor sich her trieben. Florian kannte die Strecke und beschleunigte den Wagen weiter. Es war, bis auf ein Schnarchen, von dem Florian nicht wusste, von wem es kam, still im Wagen. Alkohol macht müde, und so ging er davon aus, dass seine Kumpels selig ihren Rausch ausschliefen.
Nachdem sie mehrere Kilometer gefahren waren, begann Olaf auf dem Rücksitz jedoch, wie aus heiterem Himmel, zu pöbeln, und Florian zuckte erschrocken zusammen.
„Ich finde es total ätzend, dass ihr euch so volllaufen lassen habt. Das beste Date seit Monaten habt ihr mir versaut.“
Einen Augenblick passierte nichts. Die Worte hingen in der Luft wie tiefgefroren. Nach und nach sickerten sie in Dieters Gehirn wie Tauwasser von einem Eiszapfen.
Florian beachtete die Worte von Olaf nicht weiter, aber für Dieter schien es wie ein Kommando zu sein, das ihn aus seiner alkoholisierten Nebelwelt zurück in die Wirklichkeit holte.
„Was willst du?“ Er klang gereizt.
„Ich finde es Scheiße, dass du dich so volllaufen lassen hast, habe ich gesagt“, wiederholte Olaf genauso gereizt.
Dieter schnappt hörbar nach Luft.
Florian schaute nach rechts zum Beifahrersitz und sah, dass sich Dieters Gesichtsfarbe von teigig weiß in johannisbeerrot veränderte.
Der Wagen glitt durch die Nacht.
„Du Pisser“, schoss es aus Dieter heraus. „Willst du mich anmachen, oder was?“
„Lass mich in Ruhe, du Säufer“, erwiderte Olaf lallend.
„Hey, hey, hey“, versuchte Florian zu schlichten. „Kriegt euch mal wieder ein.“
„Halt dich da raus!“, pöbelte Dieter nun ihn an, und winzige Speicheltropfen trafen Florian im Gesicht.
Reflexartig wischte dieser sich das Gesicht mit einer Hand trocken und schaute, ohne eine Bemerkung abzugeben, wieder auf die Straße. Er wollte keinen Streit. Seine drei Kumpels waren betrunken und wussten nicht, was sie sagten. Es war immer das Gleiche, wenn sie auf Feiern waren und sich bis fast zur Besinnungslosigkeit besoffen.
Einen Augenblick später bekam Florian einen Stoß rechts in die Rippen. Wieder drehte er den Kopf und sah mit Entsetzen, dass Dieter ungelenk nach dem Knopf für den Gurt suchte. Er fand den Mechanismus, drückte drauf und schnallte sich los.
„Hey, Mann, lass das. Schnall dich wieder an!“





























