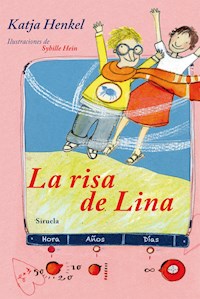9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Ballade einer verhängnisvollen Leidenschaft Im New York der 50er Jahre erschießt die junge deutsche Pianistin Thilda Horn einen weltberühmten Jazzmusiker. Der Mann, der sie liebt, sieht fassungslos zu. Hinter den beiden steht – regungslos – seine Ehefrau. In diesem Moment verbinden sich die Schicksale dreier Menschen unwiderruflich zu einem Gespinst aus Vergangenheit und Zukunft, Liebe und Hass, Abhängigkeit und Stolz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Katja Henkel
LaVons Lied
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Die Ballade einer verhängnisvollen Leidenschaft
Im New York der 50er Jahre erschießt die junge deutsche Pianistin Thilda Horn einen weltberühmten Jazzmusiker. Der Mann, der sie liebt, sieht fassungslos zu. Hinter den beiden steht – regungslos – seine Ehefrau. In diesem Moment verbinden sich die Schicksale dreier Menschen unwiderruflich zu einem Gespinst aus Vergangenheit und Zukunft, Liebe und Hass, Abhängigkeit und Stolz.
Über Katja Henkel
Katja Henkel, geboren 1967, lebt als Autorin und Übersetzerin in Hamburg.
Inhaltsübersicht
In Erinnerung an Miles Davis
Gewidmet meinem Vater Bernhard Henkel
Wir steigen in denselben Fluss und doch nicht in denselben, wir sind es, und wir sind es nicht.
Heraklit
Kapitel 1
Wir haben uns vor dem Café verabredet, das für uns beide gleichermaßen gut zu erreichen ist, am Times Square, wo wir schon viele Donnerstage verbracht haben.
Wie immer ist Thilda zuerst da, wie immer wartet sie vor der Tür, obwohl es eisig kalt ist. Sie würde niemals allein ein Lokal betreten. Sie braucht jemanden an ihrer Seite, sogar wenn sie nur einen Kaffee trinken will. Als suche sie ständig nach einer Rechtfertigung dafür, an einem bestimmten Ort zu sein.
Seltsamerweise ist Thilda der pünktlichste Mensch, den ich kenne. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein einziges Mal auf sie warten musste. Das ist umso ungewöhnlicher, wenn ich bedenke, wie sie lebt. Immer in der Hölle ihres eigenen Körpers gefangen, der nach nichts verlangt als nach Erleichterung. Ein paar Stunden ohne Schmerzen. Nichts sonst.
Ich bin überzeugt davon, dass Thilda auch kommen würde, wenn ich ihr kein Geld gäbe. Aber ich tue es gerne. Was wäre ich ohne sie. Was wären wir ohne sie.
Während ich mit hastigen Schritten auf sie zugehe, an den Lichttürmen und gigantischen Plakaten vorbei, die Arme um meinen Körper geschlagen, weil der Wind an meiner Jacke zerrt, umfasse ich ihre dünne Gestalt mit meinem Blick. Aus der Ferne sieht sie aus wie ein Kind. Umso größer ist jedes Mal mein Erschrecken, wenn ich ihr Greisengesicht sehe. Ich kann mich nicht daran gewöhnen. Ich stehe vor ihr und lächle sie an, öffne meine Lippen weit und zeige meine immer noch weißen Zähne, weil ich weiß, dass sie das mag, dass sie es gerne sieht, wenn ich lächle, obwohl sie nie zurücklächelt. Auf ihrem Gesicht spiegelt sich eine Lichtreklame und ich bin einen Moment verwirrt, weil sie fast gesund aussieht in dem rötlichen Schimmer. Auch bin ich es immer, die zuerst die Arme öffnet, in die sie sich einfach hineinsinken lässt, ohne meine Umarmung zu erwidern. Ich lege mein Kinn auf ihr nasses Haar und schaue über sie hinweg die Straße hinunter. Wir müssen ein seltsames Bild abgeben, zwei alte Frauen schweigend aneinander gelehnt, doch niemand beachtet uns. Nicht nur, weil das Wetter die Menschen zur Eile antreibt. In New York wird man sowieso niemals beachtet. Und wenn, dann bemerkt man es nicht.
Ich öffne ihr die Tür zum Café und schiebe sie hinein. Die Luft ist warm und angefüllt mit dem strengen Geruch frisch gemahlener Bohnen. Ich habe mir mein Leben lang gewünscht, Kaffee würde so gut schmecken, wie er riecht. Ich wähle den Tisch aus, wie immer, dann mache ich einen Schritt hinter sie und lege meine Hände auf ihre Schultern.
«Komm, ich helfe dir», sage ich, und gehorsam streckt sie ihre Arme ein wenig nach hinten, damit ich ihr den Mantel ausziehen kann. Seit wir uns regelmäßig treffen, also seit ungefähr vierzig Jahren, bin immer ich es gewesen, die ihr in oder aus einem Mantel hilft, obwohl es dafür keinen Grund gibt. Ich bin schließlich sogar ein paar Jahre älter als sie und ihr erst in den letzten Jahren körperlich überlegen. Eine Zeit lang habe ich darauf gewartet, dass sie wenigstens einmal abwinken würde, aber das ist nicht geschehen.
Wir setzen uns gegenüber, das grelle Licht drückt die Augenhöhlen noch tiefer in Thildas Gesicht.
«Du siehst … besser aus», sage ich, und das ist nicht einmal gelogen. Natürlich sieht sie nicht gut aus, aber wirklich besser als das letzte Mal. Damals hatte sie gerade ein paar Tage Krankenhaus hinter sich, was sie mir erst erzählte, als wir uns trafen. Mich wunderte, dass sie Thilda überhaupt nochmal nach Hause ließen, und ich hätte zu gerne die Gesichter der Ärzte nach der ersten Untersuchung gesehen. Ich könnte wetten, dass sie so einen Fall wie Thilda zuvor nicht erlebt hatten. Dass jemand so lange wie sie überlebte, war doch bestimmt einmalig.
«Danke», antwortet Thilda, und möglicherweise errötet sie ein wenig. Ich bin mir nicht sicher. «Aber du brauchst nicht zu lügen.»
«Nein, wirklich!» Ich schaue sie sehr lange und möglichst ausdruckslos an. Das habe ich von Vernon gelernt, und es funktioniert fast immer. Wer so ruhig und unbeeindruckt in das Gesicht eines anderen sehen kann, muss doch die Wahrheit sagen.
«Das Übliche für dich?» Jetzt gestatte ich mir, mich wieder von ihrem mageren Gesicht abzuwenden. Ohne ihre Antwort abzuwarten, die ich sowieso kenne, bestelle ich Thilda einen Caffè latte mit Kakaopulver und Zimt und mir ein Glas Wasser. Es würde ihr gut tun, wenn ich ihre Hand hielte. Das weiß ich. Aber ich brauche noch eine Weile, und so sitzen wir und schweigen und warten, bis unsere Körper sich aufgewärmt haben und unsere Gedanken.
Es wollte mir nie gelingen, in Thilda eine Mörderin zu sehen. Obwohl ich alles beobachtete. Damals. Vor einem halben Jahrhundert. Obwohl ich neben ihr saß, als sie sich schwerfällig von ihrem Stuhl erhob, im Aufstehen noch schwankend, als gebe sie uns allen oder dem Schicksal noch die Chance, es zu verhindern. Ihr immer bleiches Gesicht war von einem Schimmer überzogen, der sie in dem dürftig beleuchteten Raum unwirklich erscheinen ließ, vermutlich schwitzte sie, aber das machte sie nur noch schöner.
Ich habe mich wieder und wieder gefragt, ob ich ahnte, was sie vorhatte, ob ich erkannte, dass sie einen Entschluss gefasst hatte, einen einsamen. Ob sie mir mit diesem langsamen, umständlichen Sichaufrichten Zeit geben wollte, ihrem Leben doch noch eine andere Wendung zu geben. Ich weiß nur, dass ich eine unbestimmte Bedrohung spürte, mir klar war, dass sich alles ändern würde, in wenigen Sekunden, aber ich konnte mir dieses Gefühl nicht genauer erklären und reagierte nicht. Meine Instinkte versagten kläglich, sie waren zu untrainiert nach so vielen Generationen von Entfremdeten. Zumindest habe ich all die Jahre daran glauben wollen.
Manchmal aber, wenn ich in meinem Bett liege, in diesem dumpfen Augenblick zwischen Wachen und Schlafen, wenn die Gedanken zu schweben beginnen, dann frage ich mich, ob in meiner Weigerung, irgendetwas zu tun, eine Absicht lag. Wahrscheinlich hätte es schon gereicht, meine Hand auf ihren Arm zu legen, sie zu fragen, ob sie noch etwas trinken möchte, zu husten. Egal, was. Und ein- oder zweimal in den vergangenen Jahren bin ich aufgewacht mit rasselndem Atem und einer vagen Ahnung, dass es meine Idee gewesen war, meine eigene. Nur ein- oder zweimal, Gott sei Dank, damit lässt sich ganz gut weiterleben.
Was Vernon dachte, als sie sich erhob, den Blick starr nach vorne gerichtet, das Gesicht ihres Opfers nicht aus den Augen lassend, weiß ich bis heute nicht. Er pflegt zu sagen, er habe Thilda in diesem Moment gar nicht richtig wahrgenommen, er sei vermutlich davon ausgegangen, dass sie auf die Toilette wollte. Er sagt, er habe sich auf die Musik konzentriert und sei völlig in Gedanken gewesen.
Ich habe ihm nicht vorgeworfen, dass er mich anlügt.
Nie hatte Vernon Thilda einmal nicht beachtet. Im Gegenteil. Er beobachtete und belauschte sie, ihm entging kein Seufzen, kein Zucken ihrer Mundwinkel, kein verschämtes Lächeln. Selbst wenn er nicht in ihre Richtung schaute, konzentrierte er sich mit allen anderen Sinnen auf sie, lauernd, wahrnehmend, auf der Hut – ohne eine erkennbare Reaktion zu zeigen. Er wies sie niemals zurecht, wenn sie in der Laune war, großzügig ihr Lachen und mehr an andere Männer zu verschenken, er wurde nicht böse, wenn sie ihn bloßstellte, und nicht eifrig, wenn sie ihn plötzlich mit Aufmerksamkeit überschüttete.
Aber es entging ihm nichts.
Nichts konnte ihn ernsthaft von ihr ablenken.
Solange sie zusammen waren.
Dafür habe ich ihn bewundert. Diese Absolutheit hielt mich gefangen, diese schier grenzenlose Fähigkeit, mit seinem ganzen Körper auch ihre unscheinbarsten Stimmungen zu erfassen, ich habe ihn dafür bewundert, obwohl er diese Aufmerksamkeit für mich nicht aufbringen konnte und bis heute nicht kann. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder daran, dass er diese Gabe aufs Spiel setzte und verlor, als ihn nichts anderes mehr interessierte als das Rauschen in seinen Venen, der hässliche Ruf in seinem Kopf, die unbezähmbare Gier. Doch das war später. An dem Abend, an dem Thilda sich erhob, um zu töten, war sein ganzes Denken auf sie gerichtet. Deshalb kann ich behaupten, dass er log, als er sagte, er habe nicht auf Thilda geachtet. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er wusste, was sie vorhatte – aber ich halte es für möglich.
Als Thilda sich endgültig aufgerichtet hatte, schien sich die Zeit wieder in ihrem üblichen Rhythmus zu bewegen, nicht mehr abwartend zu verharren – und dann ging alles sehr schnell. Sie lief zwei, drei Schritte um den Tisch herum und war ihm schon sehr nahe, denn wir hatten uns unweit von ihm, ihrem geheimen Opfer, einen Platz gesucht. Auch er sah sie jetzt an, nachdem er unvermittelt die Augen geöffnet hatte. Ich glaube, jeder in dem düsteren, stickigen Raum sah sie an.
Ihr schmaler Körper schwankte ein wenig wie betrunken, vermutlich war sie es, ich erinnere mich, dass ihr Alkoholkonsum im Prozess eine Rolle spielte. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sich an ihrem Rücken rosa schimmernde Elfenflügel entfaltet hätten. Thilda hat mich damals immer an eine Elfe erinnert. Oder daran, wie ich mir Elfen vorstelle. Diese Vorstellung war allerdings ausschließlich von ihren Erzählungen geprägt, denn erst von ihr erfuhr ich, dass es Elfen tatsächlich gibt. Rabensteinelfen, leise singend, versteckt im Pfeifen des Windes. In vulkanischem Gestein lebend, auf Tautropfen tanzend, mit durchsichtigen, empfindlichen Flügeln. Thilda glaubte so fest an sie, dass ich es ihr unwillkürlich gleichtun musste, und manchmal kam es mir so vor, als sei sie selbst eine Elfe, die sich aus Versehen in unsere Welt verirrt hatte und nicht mehr zurückfand. Ich weiß nicht, woran sie heute glaubt.
Sie schwankte also, drückte sich an mir vorbei, und so konnte ich ihren Gesichtsausdruck nicht mehr sehen. Der Schlagzeuger hat mir aber später bestätigt, dass ihr Blick freundlich war, einladend fast, dass ihre Lippen lächelten. Das war nicht das hämische Grinsen einer Mörderin, o nein, sagte er.
Ich glaube nicht, dass sie gezielt hat. Dafür erfolgte der Schuss zu schnell. Vielmehr erinnerte ihr rechter Arm an den einer Marionette, der von einem unsichtbaren Puppenspieler an seinem Faden nach oben gezogen wird.
Sie brauchte nur einen Schuss. Er traf mit tödlicher Sicherheit. Hätte sie seine Hinrichtung durchdacht und geplant, dann wäre es nicht so einfach gewesen. Sicherlich nicht.
Ich bilde mir ein, dass Benjamin schon tot war, als er noch stand, mit blicklosen Augen von seinem Publikum Abschied nahm, die Trompete verharrte an seinen Lippen. Er entlockte ihr noch einen letzten Ton, schon gestorben, einen hilflosen, brüchigen Ton, weinerlich, wie er ihn nie zuvor gespielt hatte, «All the Things You Are», und auch die anderen spielten noch ein, zwei Takte weiter. Als er langsam auf die Knie sank, als wolle er beten oder jemanden anflehen, bemerkten auch seine Kollegen, dass etwas nicht stimmte. Der Schlagzeuger setzte erstmals an diesem Abend seine Sonnenbrille ab und stand auf. Der Tenorist war der Letzte, dem etwas auffiel, und ein einsamer Ton zerplatzte, als er das Saxophon widerwillig aus dem Mund nahm. Vielleicht glaubten sie einen Moment, Benjamin sei schlecht geworden.
Dann endlich ließ er die Trompete fallen, die in dem unfreundlichen Scheinwerferlicht aufblitzte, und ein einziger Schrei aus vielen Mündern erhob sich. Alle begriffen jetzt, was geschehen war. Benjamin fiel zur Seite, auf seine Trompete.
Vernon stürzte nach vorne, ohne einen Blick auf die Bühne und den Toten zu werfen, der so harmlos dalag – nicht einmal Blut war zu sehen –, und nahm Thilda von hinten in die Arme.
Während sich die Musiker zu seinem toten Vater hinunterbeugten.
Kapitel 2
Wir sitzen noch immer schweigend und ich fahre mit meinen Händen über die klebrigen Abdrücke von Kaffeebechern auf der Tischplatte. Es ist der letzte Donnerstag im Monat. Obwohl ich morgens im Radio gehört habe, dass am Nachmittag ein Schneesturm über New York hinwegfegen soll, habe ich nicht einen Moment lang darüber nachgedacht, Thilda anzurufen und unser Treffen abzusagen.
Mein Leben unterteile ich in diese Donnerstage. Ich rechne in Zeiten, bevor ich Thilda sehe und nachdem ich Thilda gesehen habe. Es ist die einzige Sicherheit, die ich habe. Es gibt mir das Gefühl, die Kontrolle zu behalten. Nicht nur, weil ich ihr jedes Mal Geld zustecke, was mir ein beruhigendes Gefühl gibt, denn solange sie Geld nimmt, sind wir vielleicht sicher. Helen, Vernon und ich. Wenn ich meine Arme zur Begrüßung um ihre dünnen Schultern schlinge, dann nicht aus Zärtlichkeit. Während dieses kurzen Kontakts unserer Körper versuche ich zu erahnen, was in ihr vorgeht. Mit lauschenden Fingerspitzen will ich spüren, ob sich etwas verändert hat. Ob sie plötzlich einen Entschluss gefasst hat. Einfordert, was ihr gehört. Ich rechne immerzu damit. Vermutlich würde ich es nicht bemerken, weil sich ihr Körper stets gleich anfühlt, steif und widerwillig. Wenn ich über ihren knochigen Rücken streiche, drängt sich mir unwillkürlich das Bild des Körpers auf, den ich einst kannte.
Und ich kannte ihn gut. Jahrelang habe ich mir eingebildet, Thilda nur als Randfigur wahrgenommen zu haben, schließlich ging es in meinen Plänen nie um sie, sondern um meine kleine Familie, um Vernon, um mich und später um Helen. Doch je älter ich werde, umso mehr schieben sich unerwünschte Gedanken vor meine Erinnerungen, Gedanken, von denen ich nichts wusste, Gefühle, die ich nicht wollte. Vielleicht bin ich auch einfach nur alt genug, um ehrlicher zu sein. So wurde mir erst in den letzten Jahren klar, dass ich Thildas jungen Körper noch immer sehr gut kenne, dass ich mir ohne Schwierigkeiten zurückrufen kann, wie er sich anfühlte. Sich bewegte. Und dass ich ihn immerzu vergleiche mit ihrem alten Körper, ob ich will oder nicht.
Ihr junger Körper. Ich sehe heute noch dieses schimmernde weiße Abendkleid, das an ihm entlang glitt, sich anschmiegte, und die langen Handschuhe aus weißem Satin. Ihre tomatenroten Lippen wie gelackt, ihre Augenlider glänzten fast unheimlich. Das kurze blonde Haar lag eng an ihrem Gesicht. So sah ich sie zum ersten Mal. Ich konnte nicht wegschauen. Ich konnte nicht wegschauen, ohne zu wissen, dass ich mich an ihr Gesicht in dieser Nacht ein Leben lang erinnern würde. Und Vernon auch.
Heute dient ihre Kleidung keinem anderen Zweck mehr, als ihren freudlosen Körper zu bedecken. Sie achtet nicht auf Farben und Formen. Ihr Lippenstift passt nur selten, und wenn, wohl eher zufällig zu ihrem Nagellack. Sie trägt Silber- und Goldschmuck zur gleichen Zeit, den alten Ring ihrer Mutter neben einem Plastikring, eine grobe Sportuhr zu dem fein ziselierten Armreif irgendeiner lang verstorbenen Tante.
Die einst so strahlende, ferne Thilda. Thilda Horn.
Es ist schnell gegangen. Mir kommt es so vor, als ob sie auf einen Schlag von einem zum anderen Donnerstagstreffen gealtert ist. Sie hat sich nicht in langsamen, stetigen und somit fast unmerklichen Schritten verändert. Das erachte ich als konsequent, denn das Leben hat ihr nie Zeit gelassen, Veränderungen zu planen, es geschah einfach und warf alles über den Haufen, was bis dahin gegolten hatte. So wurde sie eben auch ganz plötzlich, ohne sich darauf einstellen zu können, eine sehr alte Frau.
Sie wird von Jahr zu Jahr dünner – so wie die meisten Frauen, die in ihrer Jugend sehr schlank waren, im Alter zur Hagerkeit neigen. Über ihren kaum mehr wahrnehmbaren Brüsten bedeckt sie ihr faltiges Dekolleté auch bei der größten Hitze mit einem Tuch – eine letzte Reminiszenz an ihre frühere Eitelkeit. Ihre Handgelenke sind so schmal, dass sie aus ihrem Uhrenarmband regelmäßig ein Glied entfernen lassen muss, damit es ihr nicht einfach über die Knochen rutscht. Selbst ihre Haare sind dünn. Vereinzelte kahle Stellen versucht sie durch Toupieren und mit viel extraklebrigem Haarspray zu verstecken. Offenbar glaubt sie, dass ihr das gelingt, und ich fühle mich nicht berechtigt, ihr vorzuschlagen, die Haare abschneiden zu lassen. Kurzes Haar sähe nicht so grotesk aus. In jungen Jahren trug sie ihr Haar immer kurz.
Auch ihre Haut wird dünner, durchscheinend, mit einem blauen Unterton. Ihr Gesicht ist so runzlig wie meine Fingerkuppen, wenn ich Berge von Tellern und Gläsern abgewaschen habe, und an ihren Oberarmen hängt die Haut wie Wäsche an der Leine.
Mit mir hat es die Zeit gut gemeint. Die Frau, die ich im Spiegel sehe, leuchtet. Ihre Augen, ihr Haar. Tatsächlich habe ich bis heute nicht ein einziges graues Haar, obwohl sich die Farbe im Laufe der Zeit verändert hat. Alles an mir ist ein wenig heller geworden, in meinem Haar sehe ich jetzt einen versteckten rötlichen Schimmer, einen kaum wahrnehmbaren sonnenroten Ton, den keine Kamera festzuhalten vermag. Betrachte ich Fotos von mir, dann erscheint mein Haar nur schwarz. Ein so dumpfes, tiefes Schwarz, dass es fast farblos wirkt. Aber wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich etwas anderes.
Auch meine Augen sind blasser geworden. Ich sehe mich an und wundere mich über meinen klaren, selbstverständlichen Blick, der keinen Zweifel aufkommen lässt, dass ich das Leben gemeistert habe. Am meisten überrascht mich meine Figur. Ich bin nie schlank gewesen. Schon als junges Mädchen hatte ich kräftige Arme, starke Beine, breite Schultern und Hüften. Ich hatte einen Körper, über den sich niemand länger Gedanken machte, weil ich weder dick noch schlank war. Kompakt, pflegte meine Mutter zu sagen, unspektakulär, aber gesund. Auch ich störte mich kaum daran, dass meine Beine zu kurz waren und meine Oberarme zu rund.
Denn dieser Körper war perfekt für mein Leben. Ich konnte kilometerweit laufen, ohne die geringste Ermüdung in den Beinen zu spüren. Ich konnte jahrelang Stoffbahnen aneinander nähen, Reißverschlüsse einsetzen oder Löcher stopfen, und nie begannen meine Finger zu schmerzen. Ich konnte Helen auf einem Arm und schwere Einkaufstaschen am anderen die fünf Stockwerke zu unserer damaligen Wohnung in der 147th Street Ecke Broadway hinauftragen, ohne außer Atem zu geraten. Und jetzt, im Alter, überrascht mich mein Körper aufs Neue, er wird plötzlich graziler, fast mädchenhaft, ohne etwas von seiner Kraft einzubüßen.
Die Zeit hat alles ins Gegenteil verkehrt. Wenn wir in einem Restaurant sitzen, dann bemerken die Leute zuerst mich, und meistens lächeln sie mich an. Thilda streifen sie nur mit einem schnellen Blick. Gelangweilt oder manchmal mit einem Hochziehen der Augenbrauen. Ich bin mir sicher, dass sie das bemerkt. Vielleicht empfindet auch sie es als ausgleichende Gerechtigkeit.
Ich denke an eines unserer letzten Treffen, als wir beschlossen, ausnahmsweise ins Kino zu gehen. Links neben mir saßen zwei junge Mädchen mit riesigen Eimern Popcorn auf den Schenkeln, in die sie erstaunlich regelmäßig ihre butterglänzenden Finger tauchten, und eine der beiden sah, bevor das Licht ausging, mehrfach zu mir herüber. Dann flüsterte sie ihrer Freundin ins Ohr: «Sieht die nicht toll aus?» Manchmal ist ein Flüstern lauter als ein geschrienes Wort. Und dann fuhr sie fort: «Sie muss einmal sehr schön gewesen sein, das kann man sehen …»
Ich musste lächeln. Ich bin nie schön gewesen. Nicht einen einzigen Tag in meinem Leben. Nicht einmal hübsch. Wie mein Körper hatten sich auch meine Gesichtszüge für keine konkrete Form entschieden. Es war einfach ein Gesicht, das durch nichts hervorstach. Nicht einmal durch Hässlichkeit.
Hatte Thilda das auch gehört?
Ich jedenfalls war froh, dass es dunkel war, obwohl: Die Wahrscheinlichkeit, dass Thilda mich anschaut, wenn sie mir nicht gegenübersitzt, ist nie sehr groß. Trotzdem starrte ich auf die Leinwand, tat so, als hätte ich die Worte nicht verstanden, und versuchte mich als Frau zu fühlen, der man ansah, dass sie einmal schön gewesen war. Nichts fühlte ich. Dann überlegte ich, wie mein Leben mit einem hübschen Gesicht und einer gefälligen Figur ausgesehen hätte. Es wollte mir nicht gelingen, vermutlich, weil ich mich nicht genug anstrengte. Wozu auch. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich jeden Mann bekommen, den ich wollte, und ein paar mehr. Ich habe entschieden und nicht entscheiden lassen, ausgesucht, nicht aussuchen lassen, habe Menschen an mich gebunden und verlassen, so, wie es meinem Gefühl entsprach.
Bei einem bin ich immer geblieben, obwohl er mir nie wirklich gehört hat.
Thilda dagegen hat sich begehren, erwählen und lieben lassen. Sie musste nicht darum kämpfen – kämpfte sie deshalb auch nicht um ihre Musik? –, die Männer lagen ihr sowieso zu Füßen. Nicht nur Musiker. Schriftsteller. Maler. Weiße. Schwarze. Taxifahrer. Clubbesitzer. Ich musste nur in die Augen der Männer sehen. Wie sie sich veränderten und mit Leben füllten, sobald Thilda auftauchte. Ich weiß nicht, wie vielen sie ihre Gunst gewährt hat. Doch ich hatte immer das Gefühl, dass der, der am hartnäckigsten war, sie bekam und behalten durfte, solange er sich genug anstrengte. Dann kam ein anderer.
Im Kino drückte sie kurz meine Hand, eine inzwischen so ungewöhnliche Geste, dass ich viel zu überrascht war, um den Druck zu erwidern. Aber ich verstand, was sie sagen wollte. Ich habe es auch gehört und es macht nichts. Es bedeutet mir nichts. Zumindest glaube ich, dass sie das meinte.
Das Altwerden hat ihr so zugesetzt, dass sie ihren eigensinnigen, eleganten Stil vollständig verloren hat, der zwar, wie nur ich wusste, zufällig und aus ihrer Unsicherheit und ihrem fehlenden Körpergefühl heraus entstanden war, für den sie aber nichtsdestotrotz bekannt war, damals. Zumindest in Deutschland. In Amerika hat sie ja nicht lange genug durchgehalten, um bekannt zu werden.
Als Thilda Anfang der fünfziger Jahre hierher kam, war New York das höchste Ziel für europäische Jazzmusiker. Sie alle reisten voll gepackt mit vagen Vorstellungen an. Sie wollten eine Zeit lang bleiben und dann im Triumph zurückkehren in die Heimat, Listen im Gepäck, voll geschrieben mit den Namen ferner Jazzlegenden, mit denen sie auf der Bühne gestanden hatten oder auch nicht, wer hätte das schon überprüfen können. Durch diese Listen jedenfalls taten sich ihnen zu Hause mit einem Mal Auftrittsmöglichkeiten auf, von denen sie zuvor nur hatten träumen können. So viel Licht warfen diese Namen auf ihr Können, wie seltsam. Schließlich spielte damals in New York eigentlich jeder mit jedem, wenn man nur Geduld bewies und lange genug wartete.
Ich habe mich oft gefragt, warum Thilda diese Geduld nicht aufbrachte. Möglicherweise war sie einfach nicht klug genug, das zu durchschauen. Oscar hätte sie auf ihre Liste schreiben können, Lester, Dizzy, meinetwegen Miles, auch wenn das geflunkert gewesen wäre, Art, Max, meine Güte, strahlend hätte sie zurückkehren können nach Deutschland. Unabhängig davon, wie groß ihr Versagen war – das hätte doch niemand erfahren.
Warum also blieb sie in dieser Stadt, die von der ersten Sekunde an eine grausame Offenbarung für sie war, die sie tief verstörte mit ihren maßlosen Gebäuden, dem Lärm, den Autos und den durchgedrehten Leuten, die an jeder Ecke standen? Vor allem an die vielen Menschen hat sie sich nie gewöhnen können. Warum, zum Teufel, ist sie dann nicht einfach wieder nach Deutschland zurückgekehrt?
«Warum bist du nie zurück?», rutscht mir raus. Ich unterdrücke den Impuls, noch eine Erklärung hinzuzufügen oder eine Entschuldigung. Ich entschuldige mich oft bei ihr.
«Wie zurück?», fragt sie ohne viel Interesse. Ein junger Mann stellt einen großen Kaffeebecher und mein Mineralwasser auf den Tisch. Thilda beobachtet ihn, bedankt sich aber nicht.
«Zurück nach Deutschland. Damals, du weißt schon, als alles so … schwierig wurde.» Ich muss über diese idiotische Umschreibung fast lachen. Aber weil ich schon mal angefangen habe, mache ich auch weiter: «Als das mit dir und Vernon zu Ende war, oder vielleicht schon vorher – wenn du da New York verlassen hättest, hätte man sich in Deutschland noch an dich erinnert, meinst du nicht?»
Sie nickt und gibt mir dabei das Gefühl, dass sie keine Ahnung hat, wovon ich spreche. Das bringt mich noch mehr in Fahrt: «Du hättest ein bisschen an deiner Biographie rumfeilen können, ein paar phantasievolle Interviews geben, erzählen, mit wem du in Amerika gearbeitet hast. Du hättest in Deutschland eine eigene Band gründen können.» Auch wenn es völlig unsinnig ist, diesen Gedanken weiterzuverfolgen, kann ich nicht aufhören, es macht Spaß, mir auszumalen, was auch hätte geschehen können. Wie grausam ich bin.
«Deine Kontakte nach Amerika hätten es doch möglich gemacht, ab und zu einen Gaststar in deine Band zu holen, sagen wir mal Sonny oder Chet, ist doch ganz egal, ich glaube, das hätte funktioniert! Du hättest eine riesige Karriere machen können. In deiner Heimat. Meinst du nicht?» Diese Frage ist rhetorisch, weil ich weiß, dass sie nichts meint, und wenn, verrät sie es mir nicht. Ich weiß auch, dass sie die Worte quälen, weil sie seit damals nie mehr auch nur ein Wort über Musik verloren hat. Ihr Gesichtsausdruck versteinert noch mehr. Wenn das überhaupt geht.
Aber ich habe doch Recht. Und wofür hat sie sich entschieden? Dafür, nichts anderes zu werden als eine musician’s musician, im Hintergrund zu bleiben und kurz darauf völlig aufzugeben. Das Einzige, was von ihr als Musikerin bleibt, sind ein paar Aufnahmen für Blue Note, an die sich niemand mehr erinnert.
Thilda sitzt da wie verloren und starrt ihren Kaffeebecher an. Als ich sehe, dass sie ihn in die Hand nehmen will, greife ich schnell nach ihrem Arm. «Warte», sage ich sanft, «er ist noch zu heiß.»
Sie lässt ihre Hand wieder sinken, als sei es ihr egal. Wenn sie aufgefordert wird zu warten, dann wartet sie eben. Plötzlich wünschte ich, ich hätte ihr auch noch ein Glas Wasser oder Cola bestellt, dann müsste sie jetzt nicht so hier sitzen, die Augen gesenkt, und warten, bis ihr Kaffee kälter wird. Dann könnte sie einfach trinken, und ich würde mich nicht schuldig fühlen. Schuldig, wie lächerlich. Aber es stimmt. Ich fühle mich für alles verantwortlich. Selbst dafür, dass sie stumm vor mir hockt und nichts mit ihren Händen anzufangen weiß.
Ich treffe also Thilda jeden letzten Donnerstag im Monat. Und fast immer gehen wir in dieses Café am Times Square. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir eines dieser Treffen jemals ausgelassen oder auch nur verschoben hätten, seit sie vor fast vierzig Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Mir ist langweilig und so beginne ich zu rechnen. Ich bewege dabei sogar meine Finger ein wenig, ich war noch nie sehr gut im Kopfrechnen. Aber wenn wir mal grob annehmen, dass Thilda vor vierzig Jahren aus dem Gefängnis kam, dann haben wir uns seitdem etwa 480-mal getroffen. Gut, es sind eher 38 Jahre, aber egal, über 450 solche Treffen, manchmal gehen wir spazieren, manchmal eben ins Kino, zu mehr kann ich sie nicht überreden. Nicht mal zum Essengehen, was ich zwar auch nicht gerne tue, was mir in diesem Fall aber lieber wäre, schließlich kann man sich mit Essen länger beschäftigen als mit einem Glas Wasser und einem Kaffee.
Helen fragte mich vor kurzem erst, warum ich das eigentlich tue. Sie mag Thilda nicht.
«Sie ist absolut merkwürdig», sagte sie. «Ich kann mit ihr nichts anfangen.»
«Musst du ja auch nicht.»
«Ich kann mir gar nicht vorstellen, worüber ihr miteinander redet. Gibt es irgendetwas, das sie interessiert?»
«Selbstverständlich.»
Gott sei Dank gehört Helen nicht zu den Menschen, die auf so eine Antwort hin unmittelbar nachhaken. Ich hätte keine Lust, ihr zu erklären, wie quälend diese Treffen für mich sind. Ich will nicht, dass sie weiß, wie lange wir schweigen. Denn dann hätte sie sicher wissen wollen, warum. Oder warum ich trotzdem darauf bestehe, Thilda einmal im Monat zu sehen.
«Wie auch immer, ich mag sie nicht. Außerdem ist sie furchtbar hässlich.»
«So etwas solltest du nicht sagen, Helen. Manchmal liegen die Dinge anders, als man …»
«Ach Ma, sei doch nicht immer so verständnisvoll. Wer alles toleriert, hat einfach nur keine eigene Meinung. Mehr nicht. Und du hast bei ihr eine Menge toleriert, oder etwa nicht?»
«Schon möglich.»
«Hat sie sich denn jemals dafür entschuldigt, was sie euch angetan hat? Vor allem Dad und Großmutter? Einen Musiker so mir nichts, dir nichts auf offener Bühne zu erschießen. Nicht zu fassen!»
«Du weißt nicht, wie das damals war.»
«Weißt du es?»
Was weiß ich wirklich? Während des Prozesses hat Thilda von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Nie hat sie einen Ton darüber verloren, woher sie die Waffe hatte. Als wollte sie niemanden sonst in Schwierigkeiten bringen. Und als sie nach zehn Jahren begnadigt wurde, schien nie der richtige Zeitpunkt zu sein, mit ihr darüber zu sprechen. Vielleicht dachte ich auch, es wäre Vernons Aufgabe gewesen, sie zur Rede zu stellen. Aber in den zehn Jahren ihrer Gefangenschaft beantwortete sie nicht einen seiner Briefe, bis er nicht mehr schrieb, und als sie zurückkam, haben sie sich nicht ein einziges Mal getroffen.
Thilda hat ihn und die Musik komplett aus ihrem Leben verbannt. Nicht nur, dass sie sich niemals mehr an ein Klavier setzte, sie hört auch keine Musik mehr, in ihrem Apartment gibt es weder ein Radio noch einen Fernseher, und wenn ich anfangs öfter mal von gemeinsamen Bekannten erzählte, von Konzerten und Plattenaufnahmen, dann sah sie mich mit so leeren Augen an, dass ich verstummte. Natürlich kommt sie nicht darum herum, Musik zu hören, im Kino etwa oder in einem Kaufhaus, doch mir scheint, dass sie das einzigartige Talent entwickelt hat, so vollständig wegzuhören, dass sie die Klänge tatsächlich nicht mehr wahrnimmt.
Ich selbst hörte in den sechziger Jahren damit auf, mich mit Jazz auseinander zu setzen. Das war die Zeit, als plötzlich von Black Classical Music die Rede war. Meine Ohren machten da einfach nicht mehr mit. Auch beim Bebop wurden unendlich viele Noten gespielt – ich weiß, dass ich anfangs noch dachte, die Jungs seien völlig verrückt, alles war so schnell und aggressiv – doch ich spürte immer den Blues. Das ist mir später nicht mehr gelungen. Mir kam es so vor, als schrien und kreischten sie auf der Bühne, heulten und jammerten und machten ein ernsthaftes Gesicht dazu. Vornehmlich weiße Kritiker waren es dann auch, die den Free Jazz für sich entdeckten, und damit verlor meine Musik, der Jazz, sein breites Publikum. «Das ist trauriger Scheiß», pflegte Miles zu sagen, darüber muss ich heute noch lachen. Treffender konnte man es nicht ausdrücken! Ich war regelrecht empört, und es war mir völlig egal, dass Vernon mich als «erschreckend konservativ» bezeichnete – und: Die Zeit gab mir Recht. Die Leute verloren irgendwann die Geduld mit der Avantgarde, und der Siegeszug der Rockmusik begann. Für den Jazz war es dann zu spät.
Vernon aber schwamm mit Begeisterung auf dieser Welle mit. Plötzlich war er ein Vertreter der so ziemlich intellektuellsten Musik, die man sich nur vorstellen konnte. Mit einem Mal begeisterte er sich für Zwölftonmusik und große Orchester. Er erzählte ausschweifend von komplexen Harmonien, von Dissonanzen, von Klangebenen – all so was. Gleichzeitig behauptete er erstaunliche Dinge wie, dass er eigentlich nur ein Medium sei, aus dem Musik herausdränge; er benutzte Worte wie Liebe und Gnade und Meditation und Spiritualität in inflationärem Maß – ohne dass ich irgendetwas davon fühlen konnte. Ich war nur irritiert.
Heute spielt er wieder das, was er am besten kann, wenn auch nicht mehr so brillant wie damals, nachdem sein Vater Benjamin Banner aus dem Leben gerissen wurde von der Frau, die er selbst so sehr liebte.
Ob Thilda eine gute Pianistin war, vermag ich nicht zu beurteilen, ich habe sie ja nie richtig gehört. In unserer Wohnung stand ein altes Klavier, aber wenn sie je darauf gespielt hat, dann nur, als sie allein war. Einmal legte sie eine Platte von sich auf. Sie hat mir gefallen, sehr gefallen, aber das ist so lange her, dass ich heute nicht mehr sicher sein kann, ob ich nicht einfach von ihrer Erscheinung geblendet war. Und von dem, was sie uns bald darauf schenken würde.
In Deutschland hatte sie in der Nachkriegszeit beachtliche Erfolge gehabt. Kurz nachdem wir uns kennen lernten, zeigte sie mir eines Abends einen Ordner, in dem fein säuberlich an die dreißig Zeitungsartikel abgeheftet waren. Dabei schaute sie ganz verschämt, und als ich sie bat, die Artikel zu übersetzen, schüttelte sie den Kopf.
Aber sie erzählte, in den für sie typischen, kurzen Sätzen und mit ihrer rauen Stimme, wie sie ihre Leidenschaft für den Jazz mitten im Krieg entdeckt hatte. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob Leidenschaft das richtige Wort ist. Es passt nicht zu Thilda. Vielleicht waren es eher freundliches Interesse und Neugier, was sie da in sich spürte, in einer Zeit, als Swingtanzen verboten war und bei Zuwiderhandlung sogar das Konzentrationslager drohte. «Negermusik aus Amerika hieß das bei uns», erklärte mir Thilda. «Und dass das fremdrassige Einflüsse seien, die die sittlichen Kräfte des deutschen Volkstums zu unterwühlen geeignet sind!»
Ich erinnere mich noch heute an diese verqueren Worte, weil Thilda lange brauchte, um sie zu übersetzen, penibel und bedächtig, und ein- oder zweimal sogar ein Lexikon zu Rate ziehen musste. Und selbst dann machten sie für mich nur wenig Sinn. Aber als ich nachfragte, sagte sie nur: «Ich kann dir das auch nicht erklären. Das war eben so. So richtig deutsch.»
Ich weiß bis heute nicht recht, was sie damit meinte. Ich war mir bei Thilda nie ganz klar darüber, ob sie einfach keine Lust hatte, verständliche Erklärungen abzugeben, oder ob ihr die englische Sprache zu schwer fiel.
«Du liebe Zeit, mein Vater wurde schon bitterböse, wenn er mich nur dabei erwischte, wie ich eine Broadway-Melodie vor mich hin summte», erklärte sie damals, und ich stellte mir vor, wie sie als junges Mädchen den Kopf schräg legte und sich in ihren noch ungeformten Hüften nach einer amerikanischen Melodie wiegte.
In den deutschen Großstädten, erzählte Thilda, gab es eine Hand voll Jazzfreunde, die sich trafen und Schallplatten auf einem Koffergrammophon abspielten, wieder und wieder, und sie, Thilda, mittendrin mit hochrotem Kopf und klopfendem Herzen. Weil sie es unvorstellbar fand, dass solche Musik überhaupt existierte.
«Es kam mir so obszön vor. So lasterhaft. Und so verboten!»
Ich weiß noch, dass sie lachte, als sie das sagte. Ich weiß das aus zwei Gründen. Erstens lachte sie selten, was ich schade fand, weil sie ein auffallendes Lachen hatte. Es war abgehackt und kratzig und absolut ansteckend. Zweitens erinnere ich mich besonders gut an diesen Abend, weil wir nur wenige Tage so fröhlich miteinander verbrachten. Zu dieser Zeit warteten wir nämlich alle drei mit Ungeduld auf Helens Ankunft, und Vernon und ich ahnten noch nichts vom Tosen in Thildas Herzen. Kurz darauf ermordete sie Vernons Vater.
Nach 1945, so schilderte mir Thilda ihre Erinnerungen, hätte sich dann der Soldatensender AFN um die Erziehung der Deutschen in der US-Zone gekümmert – nicht nur musikalisch.
«Was für ein Graus das für meine Eltern war! Ihre Tochter hörte den ganzen Tag Bing Crosby oder Ella Fitzgerald. Frank Sinatra. Louis Armstrong. Und sie tanzte zu Negermusik, die plötzlich bei fast allen Tanzveranstaltungen gespielt wurde.»
Ob Thilda sich schon in Deutschland einen amerikanischen Freund suchte, hat sie mir nicht verraten. Aber ich nehme es einfach an, denn sie begann, Jazzclubs zu besuchen, die sie ohne einen amerikanischen Begleiter wohl nicht hätte betreten dürfen. Ich fragte sie auch nicht danach, weil ich gelernt hatte, dass sie Fragen nur selten beantwortete, stattdessen aber oft plötzlich nicht mehr weitersprach, und das wollte ich an diesem Abend auf jeden Fall verhindern.
«Und dann kamen sie plötzlich alle nach Deutschland! Ich war damals neunzehn», sagte sie und sie lächelte. «Oscar Peterson, Ella, Satchmo, Monk.»
Thildas Augen glänzten, als sie das erzählte, wie sie später nicht mehr glänzen sollten, selbst als sie dieselben Menschen in New York persönlich traf. Das ist doch verrückt – und auch so etwas, das ich einfach nie begreifen konnte.
Thilda ist mir im Grunde völlig fremd geblieben. Die Geschichte, die ich hier erzähle, wird nur wenige Erklärungen bereitstellen. Alles ist gefiltert durch meine Gedanken und Vorstellungen und nie bestätigt worden. Es gelang mir nicht, herauszufinden, warum Thilda, wenn sie sich einmal herabließ zu sprechen, nur Fakten aufzählte. Interessante, aber unpersönliche Fakten. Warum sie mir und vor allem Vernon ihr Wesen verweigerte. Ihre Gedanken. Heute frage ich mich allerdings, ob es dafür überhaupt einen Grund geben muss.
«JatP war das Zauberwort», sagte Thilda, «Jazz at the Philharmonic», führte sie aus, als ob das nötig gewesen wäre. Aber ich ließ sie weiterreden.
«Norman Granz veranstaltete bei uns regelmäßig Konzerttourneen mit prominenten Jazzmusikern. Norman, du weißt schon, das ist der, der mich nach New York geholt hat. Er ist auch der, der damit begann, Mitschnitte zu machen – die ersten Liveaufnahmen.» Sie klang wie eine Lehrerin. Einerseits hätte ich sie gerne unterbrochen und sie gefragt, mit wem sie glaube zu sprechen, andererseits faszinierte mich ihre so ungewohnte Redseligkeit.
«An diese Schallplatten heranzukommen, das sag ich dir, war gar nicht einfach. Wir machten einen regelrechten Sport daraus. Und dann … und dann …», sie kicherte, wirklich, sie kicherte: «… zum Entsetzen meiner Mutter und fast wie aus Versehen gab ich dann selbst Konzerte. Zunächst nur in kleinen Clubs. In München, wo sich damals die meisten Jazzer tummelten. Aufregende, ungewöhnliche Menschen waren das, du hättest sie treffen sollen!»
Wenn ich mich heute an das Gespräch zurückerinnere, glaube ich, dass sie tatsächlich stolz war und vielleicht etwas mehr Interesse von mir erwartete. Aber damals war mir egal, was sie erwartete.
«Weißt du, eine Frau auf der Bühne war in diesen Clubs schon eine Sensation, und dann noch eine, die nicht etwa singt, sondern Klavier spielt! Ich, Thilda Horn, wurde fast über Nacht zum Star.»
Das werde ich nie vergessen. Wie sie sagte: Ich, Thilda Horn. Als gehörte das Ich zu ihrem Namen dazu. Im Laufe des Abends, sie wurde langsam betrunken, erzählte Thilda noch, dass sie Deutschland verließ, als ihr Vater, Hauptwachtmeister der Grenzpolizei, von einem tschechischen Soldaten erschossen wurde. Das war in einem kleinen Dorf an der Grenze zwischen Bayern und der Tschechoslowakei, ich habe den Namen vergessen.
«Sechs Schüsse durch Lunge, Niere und Herz», erzählte sie und klang genauso lehrerhaft wie zuvor. Ihre Mutter sei daran zugrunde gegangen, sagte Thilda. Nicht nur, weil sie ihren Mann verloren hatte, nicht nur, weil die Nachbarn und der Bürgermeister ihr die Hand drückten und dann mit ihrem Leben weitermachten. «Sondern weil sie nur noch eine einzige Frage an das Leben hatte. Sie wollte den Namen des Soldaten wissen, der ihren Mann ermordet hatte.»
Das herauszufinden sollte Thildas Mutter gelingen, allerdings erst kurz vor ihrem Tod, vierzig Jahre später. Dann erst durfte sie die Akten durchlesen, fand den Namen, nach dem sie so lange gesucht hatte, und stellte fest, dass der Soldat ein tschechischer Agent gewesen war, vierzehn Tage Arrest in seiner Heimat abgesessen hatte und dann versetzt worden war. Sie gab die Akten zurück und legte sich auf ihr Sofa.
Ich stelle mir vor, dass sie das Gesicht ihres Mannes anblickte, das nie die Chance bekommen hatte, so alt zu werden wie ihres, und zu ihm sagte, es ist so weit. Hol mich. Natürlich habe ich keine Ahnung, ob es so war, aber Thilda brachte mich oft dazu, ihre Geschichten weiterzuspinnen. Als ihre Mutter vor kurzem starb, hatte Thilda sie über vierzig Jahre lang nicht gesehen. Ihren Tod erwähnte sie mir gegenüber nur nebenbei. Bei einem unserer Treffen am letzten Donnerstag im Monat.
Kapitel 3
A