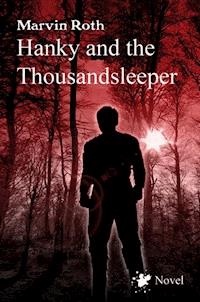Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Lebens Spender - (Hank Bersons zweiter Fall) Ist das Leben endlich? Manchmal wünschen wir uns, dass wir unsere eigene Sterblichkeit gegen ewiges Leben eintauschen könnten. Doch welchen Preis wären wir bereit zu zahlen, um Unsterblich zu werden? Mit dieser Frage konfrontiert Sie dieser Roman. Hat Moral einen Preis, oder ist es egal, wenn wir auf Kosten Anderer unser Ziel erreichen? Die schockierende Antwort finden Sie in meinem Roman " Lebens Spender." Begleiten Sie Hank Berson, der sich aufmacht, ein ungeheures Komplott aufzudecken. Alles nur Fiction? Wer weiß??? Herzlichst Ihr Marvin Roth
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Marvin Roth lebte von 2001 bis 2011 in den USA.
Durch berufliche und private Reisen, die ihn und seine Frau quer durch die USA führten, abseits der touristischen Routen lernten sie Land und Leute kennen und lieben.
Marvin Roth veröffentlichte bereits früh Kurzgeschichten und als Taschenbuch den RomanSeelenschlachter.
Mit dem zweiten Buch der Hank Berson Reihe stellt der Autor die Frage nach dem Wert des Lebens. Mit dem Roman Lebens Spender begibt sich der Leser, zusammen mit schon bekannten Protagonisten, auf eine spannende Reise.
Zurzeit sind weitere Romane in Vorbereitung, darunter eine weitere Hank Berson Story.
Der Duft des Zorns, ist ein weiterer Roman Marvin Roths, der in Kürze vorliegen wird.
Impressum
C&M Art House
Band 13002
Titelbild: Marvin Roth
Lektorat: Maike Würz
Satz und Layout: Ralf Berszuck
Umschlaggestaltung: Marvin Roth
Copyright © 2009 by Marvin Roth
Besuchen Sie unsere Website
http://www.cm-art-house.de
Original Titel Hanky und der Mächtige
Vom Autor überarbeitete Version.
Alle Rechte vorbehalten.
Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Verarbeitung
und die Verbreitung des Werkes in jedweder Form, insbesondere zu Zwecken der Vervielfältigung auf fotomechanischem, digitalem oder sonstigem Weg
sowie die Nutzung im Internet dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags erfolgen.
Imprint Lebens SpenderMarvin Roth published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Copyright: © 2013 Marvin Roth
Danksagung
Erneut danke ich meiner lieben Frau Conny.
Sie hat mir auch bei dieser Geschichte den notwendigen Zuspruch angedeihen lassen, mit mir über einige Szenen zum Teil ausgiebig
diskutiert und war beileibe nicht immer meiner Meinung. Doch inden vielen Monaten, in denen ich an dem vorliegenden Buch gearbeitet
habe, begleitete Conny mich mit ungeheurem Enthusiasmus und großer Geduld.
Fell from Heaven
Dear Conny, did it hurt when you fell from Heaven?
I think, I need to call God,
because He has lost His most beautiful Angel!
Widmung!
An alle, die nicht den Glauben an das Gute verloren haben!
Verbreitet die Botschaft des Lächelns!
Gerne auch mal über euch selbst!
Herzlichst Ihr
Marvin Roth
Vorwort
Liebe Leser,
beim Schreiben dieser Geschichte und im Übrigen ebenfalls bei der nächsten - Sie müssen wissen, dass ich stets gleichzeitig an mehreren Storys arbeite -, wie auch in meinem ersten Buch “Hanky und der Tausendschläfer”, startet das Geschehen im Wald. Ich habe mich gefragt, warum das so ist.
In meiner Kindheit war der Wald für mich und meine Freunde der schönste Spielplatz, der sich denken lässt. Hier erlebten wir jeden Tag unterschiedlichste Abenteuer. Gewöhnlich verabredeten wir uns nach der Schule, und schon bald nach dem Mittagessen standen meine Mitstreiter vor der Tür. Am Ende der Straße begann der Wald, und wir tauchten ab ins Abenteuerland. Mit Stöcken bewaffnet, die sich in unserer Fantasie in heilige Schwerter oder Kriegswaffen verwandelten, schritten wir, zu allen Seiten nach potenziellen Feinden Ausschau haltend, durch das flache Bett des Waldbachs. Mit kindlicher Vorstellungskraft kämpften wir uns unter größten Mühen durch das Amazonasgebiet, von gefährlichen Eingeborenen verfolgt, durch das Mekong-Delta, um unsere Soldaten aus den Fängen der Vietcong zu befreien, oder wir stellten Sarazenen im Niltal. Natürlich waren wir immer die “Guten”, und wenn die Dämmerung durch die Äste herabkroch, machten wir uns mit schlammigen, nassen Hosen auf den Weg nach Hause, glücklich darüber, wieder einmal die Welt gerettet zu haben.
Noch heute, wenn ich wieder einmal in Deutschland bin und meine Familie und die alte Heimat besuche, nehme ich mir oft die Zeit, “meine Wege durch den Abenteuerwald” wiederzufinden. Erstaunlicherweise hat sich der Wald fast nicht verändert, selbst die “geheimen Trampelpfade” sind noch so, wie ich sie vor mehr als vierzig Jahren verlassen habe.
Bei diesen Exkursionen in die Vergangenheit glaube ich fast, die Stimmen, das Lachen und Flüstern meiner Kindheitskameraden zu hören, und wäre nicht überrascht, sie hinter einem Busch hervorspringen zu sehen.
Fast magisch ist, dass der Wald immer noch der geheimnisvolle Ort ist, den ich in meinen Gedanken an meine Jugend sicher in meinem Herzen verwahre.
Das war der nette Teil meines Vorworts, doch die Geschichte Hanky und der Mächtige ist nicht nett und voller schöner Erinnerungen, sondern voller schrecklicher Ereignisse und Gefühle: der Panik des Ausgeliefertseins, Wehrlosigkeit und vielfachen Grausamkeiten, die manche Menschen ohne Skrupel anderen antun.
Um Ihnen, verehrter Leser, einmal bewusst zu machen, wie es zu einer dramatischen Wendung in Ihrem bisher so beschützten Leben kommen kann, folgende Bitte:
Stellen Sie sich einfach einmal vor, ich würde Sie auswählen und in einer meiner Geschichten als Held oder tragische Figur agieren lassen. Damit wären Sie natürlich meiner Willkür ausgeliefert, da ich die Handlungen in meinen Geschichten kontrolliere (das rede ich mir zumindest immer ein).
Ich lasse Sie, um zum Thema Wald zurückzukehren, durch eben einen solchen irren. Dazu gebe ich Ihnen noch einen angeknacksten Knöchel und eine ausreichende Portion Unsicherheit und Angst mit auf den Weg. Natürlich ist es Nacht, und Sie haben keine Vorstellung, wo Sie sich befinden oder wie Sie in den Wald gelangt sind. Nun wird es unheimlich. Der Mond erhellt die Szenerie nur so spärlich, dass Sie gerade genug sehen, um sich in Ihrer unmittelbaren Umgebung zurechtzufinden. Aber was liegt direkt hinter ihrem Wahrnehmungsbereich? War da nicht das Knacken eines brechenden Asts? Hat sich da etwas bewegt? Sind Sie allein, oder beobachten gierige Augen, wie Sie hilflos durch die Nacht humpeln? War da ein Wispern, eine leise geführte Unterhaltung, oder haben Ihnen nur Ihre vom angestrengten Lauschen überreizten Ohren einen Streich gespielt? Ist es wirklich nur die nächtliche Kälte, die Ihnen eine Gänsehaut über den Rücken jagt?
Nach einer Weile wird Ihnen Ihr Instinkt den Weg durch die Nacht weisen, Ihre Fantasie aber bringt Sie an den Rand eines Nervenzusammenbruchs.
All die Geschichten, die Sie zeitlebens mit einem müden Lächeln abgetan haben - wer glaubt schon an Geister, Gnome, Zombies, Werwölfe oder Vampire -, rücken auf einmal in den Bereich des Möglichen. Was, wenn wirklich etwas dran ist an all den Horrorgeschichten? Weiß es der Wald? Hat er das Böse, so es dies wirklich auf unserer Welt gibt, gesehen oder gar bereits beherbergt? Oder lauert das Böse im Alltäglichen, im freundlichen Nachbarn? Dem netten Mitbürger, der ein Wanderfreund ist, Sie hier allein im Wald entdeckt, hilflos und verletzt, und die einmalige Gelegenheit nutzt, um unbeobachtet einen Mord zu begehen - einfach nur, weil sich die Gelegenheit bietet?
Natürlich werden Sie als Erstes fragen, wie es denn sein kann, dass es Sie in einen Wald verschlägt und Sie nicht wissen, wo Sie sind. Aber ist es wirklich unvorstellbar? Reicht nicht schon ein Autounfall bei einer nächtlichen Fahrt, Sie schlagen sich den Kopf an, klettern benommen aus Ihrem Wagen und taumeln fort, immer noch vom Schock betäubt und nicht realisierend, wo Sie eigentlich hinwollen - laufen in den Wald hinein, statt bei Ihrem Auto oder wenigstens auf der Straße zu bleiben? Schon ist es um Sie geschehen. Nun werden Sie sagen, na ja, so oft fahre ich ja nicht durch den Wald. Nicht? Ja, wo leben Sie denn? Ist Ihnen klar, dass mehr als dreißig Prozent der Landmasse unserer Welt von Wald bedeckt ist? Das ist eine beachtliche Zahl, und die Wahrscheinlichkeit, gerade dort, im Wald, einen Unfall zu haben, ist wirklich nicht gering. Wildwechsel, feuchtes Laub, rutschige Straßenverhältnisse durch abgeschwemmte Erde, ständig wechselnde Lichtverhältnisse bilden permanente Gefahrenquellen.
Zum Glück für Sie befinden Sie sich zurzeit nicht in dieser Situation, sondern halten ein Buch in Ihren Händen, sind entspannt und sicher.
Wirklich?
Herzlichst Ihr
Marvin Roth
Kapitel 1
Der Brief
Er rannte um sein Leben. Äste peitschten ihm ins Gesicht. Seine Lungen pumpten den hastig eingeatmeten Sauerstoff in seinen Blutkreislauf. Das Gelände war abschüssig und durch altes, nasses Laub glatt wie eine Rutschbahn. Dennoch schaffte es der Flüchtende, das Gleichgewicht zu halten. Der Wald lichtete sich etwas, und ein Wildpfad erleichterte ihm das Vorankommen. Immer wieder tastete er nach dem Briefumschlag, den er in der Innentasche seiner Jacke verstaut hatte. Der Brief musste in Sicherheit gebracht werden, er war wichtig, sein Inhalt ungeheuerlich. Er konnte keiner Regierungsstelle vertrauen, denn er wusste nicht, wer alles dazugehörte. Aber er wusste, an wen er den Brief schicken musste.
Er war FBI-Agent, und seine Entdeckungen hatten all sein Vertrauen in die Regierung zerstört. Bei seinen verdeckten Ermittlungen war er eher zufällig auf diese Geschichte gestoßen. Das alles war so unfassbar, dass er anfangs nicht hatte glauben können, was er gesehen, erlebt hatte. Erst einige Zeit später hatte er heimlich alles notiert und sicher verwahrt. Zum Schein hatte er mitgespielt, bis zu dem Punkt, an dem er es nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren konnte. Da war die Zeit gekommen, sich aus dem Staub zu machen. Doch seine Flucht war schnell bemerkt worden, und nun waren sie hinter ihm her. Er machte sich keine Illusionen über seine Chancen, den Tag zu überleben.
Er rannte weiter, schaute sich ab und zu gehetzt nach seinen Verfolgern um und hörte schon die Geräusche der nahen Staatsstraße, dem New York Highway 66. Dorthin musste er es unbedingt schaffen.
Kurz darauf erreichte er den Rand des Waldes. Hinter einem Baum versteckt, versuchte er erst einmal zu Atem zu kommen. Angespannt beobachtete er die etwa fünfzehn Meter entferntliegende Straße und hielt nach Anzeichen Ausschau, dass dieser Straßenabschnitt von seinen Verfolgern überwacht wurde.
Doch alles schien ruhig, und der Verkehr floss träge dahin. Da sah er einen alten, verbeulten VW-Bus, dessen schrille Bemalung - an vielen Stellen bereits brüchig - von alten und doch so aufregenden Hippietagen zu erzählen schien. Das war seine Chance, den Brief doch noch auf den Weg zu bringen. Zumindest musste er es versuchen. Entschlossen mobilisierte er seine letzten Kraftreserven und rannte den kleinen Abhang hinunter zur Straße. Unter dem wütenden Hupen einiger erschrockener Autofahrer, die er zu hektischen Notbremsungen zwang, hetzte er über die Straße, um auf der Gegenfahrbahn den alten Bus anzuhalten.
Wie ein gestaltgewordenes Klischee saßen auf dem Fahrerund Beifahrersitz zwei grauhaarige Hippies mit bunten Stirnbändern, die nur noch karge Reste der einstigen Haarpracht bändigen mussten. Zum Glück waren die Seitenfenster offen, ein Hauch von Marihuanaduft drang aus dem Inneren. Der Mann achtete nicht auf die Beschimpfungen der beiden, sondern kramte eine zerknitterte Fünfzigdollarnote und seinen Brief hervor. Beides steckte er durch das Beifahrerfenster und drückte es der Beifahrerin in die Hände - jetzt erst erkannte er, dass es sich bei den beiden um ein Pärchen handelte.
Geistesgegenwärtig sprach er die Frau an, die ihn misstrauisch beäugte: »Bitte, Mam, helfen Sie mir und geben Sie den Brief in der nächsten Stadt für mich auf. Hier sind fünfzig Bucks. Den Rest können Sie behalten. Es ist wirklich wichtig. Bitte tun Sie mir den Gefallen.«
»Hast du gehört, George? Mam hat er zu mir gesagt. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört.« Sie lächelte breit zu dem Fahrer hinüber und entblößte eine Reihe gelber Zahnstummel. Der Mann zuckte nur mit den Schultern, als ob es ihm völlig egal wäre, ob jemand zu seiner Partnerin “Mam” sagte.
»Also gut, junger Mann, da Sie so ...«
Verwundert blickte sie sich um, doch der Mann war spurlos verschwunden. Sie drehte sich zurück zu George und sagte auf die bestimmende Weise, die er nur zu gut kannte: »Der Typ war zwar ziemlich merkwürdig, aber wir werden ihm den Gefallen tun und den Brief im nächsten Postamt aufgeben. Schließlich war er ja sehr höflich und hat mich immerhin mit Mam angesprochen.«
George zuckte erneut mit den Schultern, legte den Gang ein und fädelte sich gemächlich in den fließenden Verkehr ein.
Keine hundert Meter von der Stelle entfernt, an der der VW- Bus gehalten hatte, lag ein Mann in Tarnkleidung hinter einem Busch verborgen und schaute durch ein Fernglas. Ein dünnes, schwarzes Mikrofon führte von seinem rechten Ohr bis kurz vor seine Lippen. Leise sprach er zu einem unsichtbaren Partner: »Objekt hat die Straße überquert und kurz mit den Insassen eines bunten VW-Busses gesprochen. Danach ist er im Wald verschwunden.«
»Was für ein VW-Bus?«, antwortete ihm eine Stimme. »Hat er den Insassen etwas gegeben?«
»Bedauere, Sir,« antwortete der Mann im Tarnanzug, »das konnte ich leider nicht erkennen. Das Objekt stand hinter dem Bus, und alles ist sehr schnell gegangen. Hat keine Minute gedauert. Wie soll ich jetzt vorgehen?«
»Wo ist das Objekt jetzt?«, wollte die Stimme wissen.
»Auf der anderen Seite der Straße im Wald verschwunden, Sir.«
Einen Moment war nur das Rauschen in dem kleinen Lautsprecher des Headsets zu hören, dann erklang wieder die befehlsgewohnte Stimme. »Verfolgung des Objekts fortführen und Objekt wie besprochen eliminieren. Ende.«
Damit brach der Funkkontakt ab.
***
New York City
Etwa zur gleichen Zeit saß ein anderer Mann unter einem Baum. Allerdings machte dieser einen entspannten Eindruck, wie er da so lässig am Stamm lehnte und in der New York Times blätterte. Doch er las die Zeitung nicht. Vielmehr schaute er über den Rand hinweg und betrachtete die anderen Parkbesucher. Das Treiben fand er immer noch spannend, obwohl er nun schon fast ein Jahr hier lebte. So viele Leute, dachte er oft, und jeder scheint irgendwohin zu wollen. Selbst die Parkbesucher hasteten dahin, in bunte Trainingsanzüge gekleidet. Jogging nannte man das, aber er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass so ein Rumgerenne Spaß machen sollte. Na, ihm konnte es ja egal sein. Er genoss es, einfach nur hier zu sitzen und nichts zu tun. Die vergangenen Monate waren anstrengend genug gewesen, und er hatte dem FBI in einigen Fällen helfen können. Man hatte ihn gut entlohnt, sodass er sich unweit vom Central Park eine Wohnung gemietet hatte. Als freier Mitarbeiter konnte er sich so viel Freizeit nehmen, wie er nur wollte - oder wie er es sich leisten konnte. Er brauchte diese Zeit für sich, um all die Wunder dieser Welt zu bestaunen. Und wenn es fürs Erste nur die Wunder einer einzigen Stadt waren. Er hatte noch so viel zu lernen. Er musste noch so viel nachholen. Das war auch der eigentliche Grund, weshalb er hierhergezogen war.
Eine Stimme ließ ihn aus seinen Betrachtungen aufschrecken. »Also hier treibst du dich herum,« sagte ein Mann, halb über ihn gebeugt. »Da kann ich ja lange nach dir suchen. Und dein Handy hast du natürlich zu Hause auf dem Schreibtisch liegen lassen.«
Der unter dem Baum sitzende blonde Mann lächelte gutmütig und erwiderte, gespielt empört: »Du bist nicht meine Mutter, Walt.«
»Hast du etwa vergessen«, erwiderte Walt, »dass wir uns in einer knappen Stunde mit Rich zum Abendessen treffen wollen? Du bist noch nicht mal umgezogen. Also erheb dich. Los, komm schon.«
»Okay, ich komm ja schon. Immer musst du hetzen. Hast dich wirklich wunderbar an die hiesigen Verhältnisse angepasst. Bist schon ein richtiger New Yorker.«
»Jawohl, das kann man wohl sagen«, antwortete Walt verschmitzt. »Und du, Hanky, bist noch ein richtiger Hinterwäldler.«
Lachend gingen die beiden Männer durch den Park Richtung Fifth Avenue.
Richard Miller hatte den wohl aufregendsten Tag seines Lebens hinter sich. Zumindest in beruflicher Hinsicht - nachdem er vor einiger Zeit mit Hanky, Walt und dem alten Ray Berson den Tausendschläfer gejagt hatte, war er von Aufregungen nicht mehr leicht zu beeindrucken. Dieses Erlebnis hatte ihn dazu veranlasst, ein Buch zu schreiben, das von der örtlichen Bevölkerung erstaunlicherweise mit viel Interesse zur Kenntnis genommen wurde, was sich sehr positiv auf die Auflagenzahl auswirkte. Doch nicht nur seine neue Leserschaft war auf ihn aufmerksam geworden, sondern auch das FBI und die New York Times. Das FBI hatte ihn und die anderen intensiv, wenn auch freundlich verhört. Hanky musste als Einziger länger in Langly, Virginia bleiben. Die dortigen Agenten und Ärzte führten unzählige Tests mit ihm durch und waren sehr erstaunt über die außerordentlichen Ergebnisse. Noch nie hatte eine Testperson so hohe Psi-Werte erzielt. Am liebsten hätten sie Hanky gar nicht mehr gehen lassen, da er ein so interessanter Fall war. Doch Hanky stellte klar, dass er nach Abschluss der
Tests seinen eigenen Weg zu gehen beabsichtigte. Dem stellvertretenden Direktor Davis Miles gelang es schließlich, ihn als freien Mitarbeiter zu gewinnen. So zog Hanky von dannen und nach New York, wo er zusammen mit Walt Kessler ein privates Ermittlungsbüro eröffnete.
Richard war nach Fargo zurückgekehrt und hatte vor zehn Tagen einen Brief von der New York Times bekommen. Voller Erstaunen öffnete er den Umschlag, fand ein Flugticket und eine Einladung zu einen Gespräch mit dem Chefredakteur der Times.
So war er gestern angekommen, hatte im Marriott sein reserviertes Zimmer bezogen und sich für den nächsten Abend mit Walt und Hanky verabredet. In der folgenden Nacht bekam er fast kein Auge zu, so aufgeregt war er. Am nächsten Morgen stand er wie gerädert auf, schleppte sich müde ins Bad, duschte und kleidete sich an. Danach ließ er sich vor dem Hotel ein Taxi rufen und fuhr direkt zur 620 Eight Avenue, dem Hauptsitz der New York Times. Natürlich war er fast eine Stunde zu früh dran, und so setzte er sich in ein kleines Cafe gegenüber und frühstückte, allerdings mit einem mulmigen Gefühl im Bauch, da er nicht abzuschätzen wusste, was der Tag bringen würde. Seine Frau Rita war nicht so recht begeistert gewesen, als sie die Einladung gesehen hatte. Mit einem gezwungenen Lächeln hatte sie Rich aber schließlich ziehen lassen.
Nach dem Frühstück begab sich Richard Miller zu seinem Gespräch. Zwei Stunden später verließ er mit einem strahlenden Lächeln und einem neuen Job die Redaktion.
Morgen würde er ein noch viel schwierigeres Gespräch vor sich haben. Er musste seine Frau davon überzeugen, nach New York City umzuziehen, zumindest in eine der Vorstädte. Aber heute wollte er erst einmal seine Freunde treffen, um mit ihnen seinen Erfolg zu feiern. Das Leben war eben doch aufregend.
Kapitel 2
Salt Lake NY State
Der VW-Bus der Hippies stand auf dem Parkplatz an der Miller Hill Road, direkt vor einem Restaurant. Nur wenige Schritte entfernt befand sich das kleine Postamt.
Drei schwarz lackierte Ford SUVs fuhren langsam auf den Parkplatz. Männer mit schwarzen Sonnenbrillen schauten aufmerksam die kleine Einkaufszeile entlang. Natürlich hatten sie den bunt bemalten VW-Bus gesehen. Aber wo waren dessen Besitzer? Es dauerte nicht lange, bis die Männer das Hippiepärchen entdeckten. Sie saßen an einem Fensterplatz im Restaurant und schienen bester Laune zu sein. Eine Kellnerin brachte ihnen gerade ein volles Tablett, mit Tellern und Schüsseln beladen, die leicht ausgereicht hätten, um eine vierköpfige Familie mehr als satt zu bekommen.
Im ersten SUV aktivierte ein schwarz gekleideter Mann sein Funkgerät und rückte das Headset zurecht. »Player fünf an Teamleader«, sprach er leise in das Mikrofon. Sofort antwortete eine befehlsgewohnte Stimme: »Ich höre.«
»Wagen lokalisiert. Zielpersonen ebenfalls. Sie befinden sich in einem Restaurant und scheinen bester Laune zu sein. Kein konspiratives Verhalten zu erkennen. Kein Versuch seit unserem Eintreffen, mit einer dritten Person Kontakt aufzunehmen. Wie sollen wir vorgehen?«
»Erst einmal abwarten und beobachten. Wenn die Zielpersonen kein auffälliges Benehmen zeigen, lassen wir sie in Ruhe. Wir können uns kein Aufsehen erlauben. Ende.«
Es knackte kurz in der Leitung, und Player fünf wusste, dass der Teamleader abgeschaltet hatte.
Keiner der Männer in den SUVs kam auf die Idee, das Postamt direkt neben dem Restaurant mit den Hippies in Verbindung zu bringen, was diesen das Leben rettete.
Nur wenige Kilometer entfernt lag der FBI-Agent hinter einem mit Moos bedeckten Baumstumpf und schaute sich nach seinen Verfolgern um. Nichts rührte sich, kein Geräusch anschleichender Füße, kein Rascheln im Laub, kein brechender Ast knackte verräterisch. Nichts. Gerade diese Tatsache beunruhigte den Agenten. Zumindest hätte er Vogelstimmen hören müssen, doch auch die Tiere verhielten sich ruhig, was darauf hindeutete, dass hier etwas nicht stimmte. Waldbewohner spürten, wenn Gefahr in der Luft lag.
Plötzlich erscholl übermäßig laut der Warnschrei eines Eichelhähers, keine hundert Meter entfernt. Der FBI-Mann erstarrte. Seine Verfolger waren ganz nah. Hatten sie ihn gefunden? Befand er sich schon im Visier eines Scharfschützen? Sein Atem beschleunigte sich, und er verwünschte diese Stressreaktion seines Körpers. Auf seiner Stirn bildeten sich dicke Schweißtropfen, die brennend in seine Augen tropften. Er duckte sich so weit als möglich und presste seinen Körper in das feuchte Laub. Da hörte er ein leises Rascheln und gleich darauf ein metallisches Klicken. Er rechnete damit, einen Schuss zu hören oder Schmerz zu fühlen, der seinem Leben ein Ende setzte. Doch nichts geschah. Nach einigen sich unendlich in die Länge ziehenden Minuten glaubte er Schritte zu hören. Sie entfernten sich von seiner Position und wurden leiser. Mit angehaltenem Atem streckte er seinen Kopf aus der Deckung und sah rechts, fast hundert Meter entfernt, einen Mann in Tarnkleidung durch den Wald schleichen.
Während der Agent seinen Jäger mit den Augen verfolgte, suchte er zugleich den Wald nach Hinweisen auf andere
Verfolger ab. Erstaunt stellte er fest, dass es nur der eine war. Angestrengt dachte er nach. Was war zu tun, was sollte er nun machen? Eine Möglichkeit war, einfach liegen zu bleiben und zu warten, bis sein Verfolger verschwunden war. Dies war eine sehr verführerische Option, da er nicht in Aktion treten musste und die Hoffnung hegte, ungeschoren davonzukommen. Andererseits würde der Jäger Verstärkung anfordern, sollte seine Suche erfolglos sein. Dann hatte der FBI-Mann es mit mehreren Gegnern zu tun. Nein, auf dieses Risiko konnte er sich auf keinen Fall einlassen. Die andere Option war einfach, aber sehr riskant: Er musste seinen Jäger verfolgen und in einem günstigen Moment eliminieren.
Er entschied sich für die zweite Option. Behutsam darauf achtend, keinerlei Geräusch zu machen, stand er auf. Geduckt und mit flüssigen Bewegungen schlich er zu dem nächsten Baum, immer seinen Gegner im Auge, der anscheinend nur auf das Areal vor sich konzentriert war. Lautlos ließ der Agent sich auf die Knie nieder und robbte auf allen vieren zu einem Gebüsch. Auf dem Bauch liegend schaute er durch die Blätter. Sein Verfolger war stehen geblieben, das Scharfschützengewehr in der Armbeuge. Langsam drehte er sich im Kreis und lauschte auf verdächtige Geräusche. Nachdem er seine Drehung vollendet hatte, schlich er weiter in die ursprüngliche Richtung.
Auf einmal blieb er ruckartig stehen und horchte angespannt. Der FBI-Beamte hatte sich nicht gerührt und somit auch kein Geräusch verursacht. Was hatte den Jäger alarmiert?
Stimmen hallten durch den Wald. Es hörte sich an, als ob zwei oder mehrere Personen sich unterhielten. Die Stimmen wurden lauter und bewegten sich auf die Position des Verfolgers zu. Dieser stand zuerst völlig reglos da und lauschte. Vermutlich versuchte er herauszufinden, wie viele Leute da durch den Wald stapften. Nach einer weiteren Minute, die Stimmen waren inzwischen schon sehr gut zu verstehen, bewegte er sich rückwärts von seinem Standort weg und genau auf das Versteck des
FBI-Mannes zu. Unruhig beobachtete der Agent, wie er immer näher herankam. Er war nun keine vierzig Meter mehr entfernt. Tastend, auf der Suche nach irgendeiner Waffe, glitt die rechte Hand des Agenten über den Waldboden, während die Augen beständig seinem Gegner folgten. Seine Hand fand einen etwa apfelgroßen Stein und schloss sich darum. Der Stein fühlte sich kühl an und vermittelte ihm die Hoffnung, sich halbwegs wehren zu können.
Mittlerweile waren aus den Stimmen Personen geworden, vier an der Zahl, die mit ihren geschulterten Rucksäcken, festen Stiefeln und derber Kleidung ohne Zweifel Wanderer waren, die hier in den Wäldern ihrem Hobby frönten. Wie durch ein übergeordnetes Navigationssystem geleitet, marschierte die Gruppe genau auf den Jäger zu. Die Wanderer waren nun schon so nah, dass sie ihn eigentlich hätten sehen müssen. Nur seiner Tarnkleidung und dem angeregten Gespräch der Gruppe verdankte er es, bisher nicht entdeckt worden zu sein. Hastig, entgegen seiner bisherigen Verhaltensweise, rannte er auf die Buschgruppe zu, ließ davor sich auf die Knie fallen und schob sich rückwärts unter die tief hängenden Äste, immer die Wanderer im Auge. Das war ein Fehler, und es würde der letzte in seinem Leben sein. Abgelenkt durch die Wanderer hatte er nicht bemerkt, dass direkt neben ihm der FBI-Agent lag, nur einen halben Meter nach vorn versetzt. Zudem hielt er mit beiden Händen sein Gewehr. Unvermittelt traf ihn ein mörderischer Schlag auf den Hinterkopf, der ihm sofort das Bewusstsein raubte. Der Agent zog den schlaff gewordenen Körper vorsichtig tiefer in die Büsche, immer darauf gefasst, dass sein Gegner zum Gegenangriff ansetzen würde. Doch als er die heftig blutende Kopfwunde und den eingedrückten Hinterkopf seines Widersachers sah, erkannte er, dass dieser niemals mehr in der Lage sein würde, einem anderen Menschen Schaden zuzufügen.
Nach einigen Minuten passierten die Wanderer die Buschgruppe, ohne etwas zu bemerken, und verschwanden kurz darauf im Wald. Ihre Stimmen wurden immer leiser und waren schon bald nicht mehr zu hören.
Der FBI-Agent richtete sich auf und entwaffnete seinen Gegner. Dabei bemerkte er, dass der Mann nicht mehr atmete. Schnell durchsuchte er den Toten, fand aber keinen Hinweis auf dessen Identität. Er steckte sich ein langes Messer in die Jacke und eine SIG SAUER P220, eine der zielsichersten 45er- Pistolen, die auf dem Markt erhältlich waren. Dazu fand er noch einige Ersatzmagazine, die er ebenfalls in einer seiner Jackentaschen verstaute. Danach nahm er dem Mann noch das Funksprechgerät samt Headset ab, befestigte es an seinem Gürtel und den kleinen Lautsprecher an seinem Ohr. So hoffte er zu erfahren, was seine Gegner planten. Endlich deckte er die Leiche samt Gewehr mit Laub und Ästen zu, sodass sie, verborgen unter den Büschen, auf den ersten Blick nicht zu sehen war. Als er alles zu seiner Zufriedenheit erledigt hatte, marschierte er in die Richtung, aus der die Wanderer gekommen waren. Er hoffte darauf, einen Waldparkplatz zu finden, und auf eine Gelegenheit, aus der Gegend zu verschwinden.
Kapitel 3
Der Saal
Sie erwachte mit fürchterlichen Kopfschmerzen. Noch nie hatte sie so grauenhafte Schmerzen erlebt. Sie versuchte sich im Bett umzudrehen, doch ihr Körper gehorchte ihr nicht. Vorsichtig öffnete sie die Augen, um sie sogleich geblendet wieder zu schließen. Die Schmerzen schienen sich noch zu steigern, aber sie versuchte es erneut. Ihre gepeinigten Sehnerven leiteten nur das Bild einiger Neonröhren an das Gehirn weiter, die an einer unverputzten Betondecke befestigt waren. Vor Schmerz und Erschöpfung schloss sie die Augen. Bunte Kreise flimmerten vor den Pupillen, und Übelkeit breitete sich in ihr aus. Eine Frage, die entscheidende Frage formulierte sich in ihrem Geist: Wo war sie? Auch nach längerem Überlegen fand sie keine befriedigende Antwort. Das Letzte, an das sie sich erinnerte, war, dass sie sich auf dem Nachhauseweg befunden hatte. So wie an jedem Wochentag. Erst mit dem Bus bis in die Vorstadt und dann zu Fuß eine weitere halbe Stunde durch ihr Viertel. Alles war wie immer gewesen, oder etwa nicht? Hatte sie einen Unfall erlitten und war nun in einem Krankenhaus? Nein, das konnte nicht sein. Ein Krankenhaus mit einer rohen Betondecke gab es nicht in ihrer Gegend, und sie bezweifelte, dass es ein solches Krankenhaus überhaupt irgendwo in Mexico gab. War das überhaupt ihre Heimatstadt Juarez? Hier in dieser Millionenstadt, am Rio Grande gelegen und damit direkt an der Grenze zu den USA, hatte sie ihr ganzes Leben verbracht. Oft hatte sie an der Grenze gestanden und hinüber nach El Paso geschaut, wo sie doch so gern leben würde.
Eine weitere Schmerzwelle unterbrach ihre abschweifenden Gedanken. Farbige Nebel schienen ihren ganzen Gesichtskreis auszufüllen. In ihrem Schädel tobte ein Sturm der Qual, als würden Tausende Nadeln zugleich auf sie einstechen. Nach einer Weile - sie konnte nicht einschätzen, wie lang die Pein dauerte - ebbten die Schmerzen wieder ab. Sie begann erneut nachzudenken. Wenn das kein Krankenhaus war, was dann?
Auf einmal erinnerte sie sich an die vielen vermissten Frauen. Seit vielen Jahren verschwanden beinahe täglich Frauen und Mädchen aus ihrer Stadt spurlos, und niemand schien sich darum zu kümmern. Waren es Tausende oder gar schon Zehntausende, die verschwunden waren? Sie konnte sich nicht daran erinnern. War sie einfach nur ein weiteres Opfer? Anfangs hatten die Medien noch darüber spekuliert, dass die Polizei in die Entführungen involviert sei, doch das konnte nie bewiesen werden. Befand sie sich in den Händen dieser unbekannten Entführer? Was wollten diese Leute von ihr? Weshalb hatte sie solche Schmerzen? Was stellte man mit ihr an? Panik drohte ihr Bewusstsein davonzuschwemmen. Mühsam öffnete sie erneut die Augen. Wieder sah sie nur die Deckenlampen. Sie versuchte noch einmal, sich zur Seite zu drehen, aber auch dieser Versuch scheiterte. Alles, was sie bewegen konnte, waren ihre Augen. Angestrengt schielte sie nach links und konnte aus den Augenwinkeln unscharf eine Art Krankenbett ausmachen. Darauf lag eine nackte Frau. Aus ihrer Stirn führten mehrere Kabel und Schläuche zu einem Kasten. Einige kleine Lichter blinkten an seiner Vorderseite. Erschrocken schloss sie die Augen wieder. Was war das nur? War dies doch ein Krankenhaus? Es war also zumindest eine weitere Person in diesem Raum. Oder waren es noch mehr? Sie öffnete die Augen und rollte ihre Pupillen zur anderen Seite. Hier bot sich das gleiche Bild. Auch dort lag eine Frau nackt auf einem Bett, und auch aus ihrer Stirn ragten Kabel und Schläuche und verschwanden in einem Kasten. Sie schaute zu den Lampen an der Decke. Soweit sie sehen konnte, zogen sie sich in langen Reihen an der Decke entlang. Der Raum musste riesig sein. Voller Angst ließ sie ihre Augen nach oben wandern, um herauszufinden, ob auch aus ihrem eigenen Kopf Kabel und Schläuche ragten. Doch noch ehe sie etwas erkennen konnte, kam der Schmerz zurück, so heftig diesmal, dass sie in eine erlösende Ohnmacht versank.
***
New York City (einige Tage später)
Hanky hatte schlecht geschlafen. Albträume hatten ihn in dieser Nacht heimgesucht, mit wilden Verfolgungsjagden, Monstern und lachenden Mördern. Verdrossen setzte er sich auf und schwang die Beine aus dem Bett. Er wusste nicht, was ihm so zu schaffen machte. Irgendwas bahnte sich an, dass spürte er ganz deutlich. Besorgt griff er zum Telefon, das auf seinem Nachttisch stand, und wählte die Nummer seines Großvaters. Zwar wusste er, dass es noch früh war, doch er wusste auch, dass sein Großvater meist früh auf den alten Beinen war. Es hatte kaum dreimal geklingelt, als eine müde, aber dennoch unendlich vertraute Stimme aus dem Hörer drang. »Hallo, wer ist da? Hier spricht Ray Berson. Hallo ...«
»Guten Morgen, Großvater, hier ist Hanky. Habe ich dich etwa geweckt?«
Hanky versuchte fröhlich zu klingen, damit der alte Ray sich keine Sorgen machte, aber da hatte er seinen Großvater unterschätzt.
»Was ist los, Hanky? Stimmt was nicht? Du rufst doch sonst nicht so früh an.«
»Nein, nein, Großvater, alles in Ordnung. Ich wollte einfach nur mal deine Stimme hören. Ich vermisse dich halt. Willst du nicht für ein paar Tage nach New York kommen? Wir könnten ein paar Museen besuchen oder in ein Musical gehen. Einfach Zeit miteinander verbringen.«
»Nein, Hanky, lass mich mal, wo ich bin. Der eine Besuch bei dir hat mir fürs Erste gereicht. So viele Leute und so wenig Natur vertrage ich nicht so gut. Es genügt schon, dass du mir dieses Höllending aufgeschwatzt hast.« (Damit meinte er das Telefon. Hanky hatte nicht lockergelassen, bis der alte Ray schließlich zugestimmt hatte. Hanky hatte sogleich ein Handy gekauft und seinen Großvater eindringlich gebeten, das Gerät jeden Abend auf die Ladestation zu stellen, um sicherzugehen, dass sein Großvater in jeder Situation Hilfe herbeirufen konnte. Schließlich war der alte Ray ja nicht mehr der Jüngste.)
Sie unterhielten sich noch eine Weile, wobei Ray herauszufinden versuchte, was seinen Enkel so beunruhigt hatte. Hanky wiegelte ab und war zugleich beruhigt, dass es seinem Großvater ganz gut ging. Dann beendete er das Telefonat mit der Zusicherung, sich bald wieder zu melden.
Er legte das Telefon auf die Station und begab sich ins Bad. Was hatte seine Unruhe ausgelöst, fragte er sich. Jeden Tag passierten schreckliche Dinge, doch solange sich Hanky nicht bewusst damit befasste, schlug sein Unterbewusstsein auch keinen Alarm. Doch hier war es anders. Immer noch fühlte Hanky ein gewisses Unbehagen, als ob etwas sehr Schlimmes auf ihn zukäme. Jemand steckte in einer bösen Klemme und dachte an ihn. Das war die einzige, sehr nebelhafte Erklärung, die Hanky zu seiner Vorahnung einfiel.
Als er einige Minuten später in die Küche kam, schlug ihm der angenehme Duft frisch gekochten Kaffees entgegen. Walt stand hinter dem Küchentresen, pfiff ein fröhliches Lied und bereitete das Frühstück vor. Als er Hanky bemerkte, unterbrach er sein Tun und fragte lächelnd: »Na, alter Junge, gut geschlafen?«
»Nein, Walt, eher nicht. Mich haben beunruhigende Träume immer wieder wach werden lassen. Ich bin ziemlich gerädert«
»O je«, ließ Walt hinter dem Tresen verlauten, während er sich eine Scheibe Schinken in den Mund stopfte. Die nächsten Worte konnte Hanky nicht verstehen, ließ Walt aber in dem Glauben, dass er seinem Monolog folgen würde. Müde setzte er sich an den Küchentisch und schaute blicklos aus dem Fenster. Etwas lauter und vor allem deutlicher, so eine Scheibe Schinken konnte sich schon sehr negativ auf die Kommunikation auswirken, sagte Walt: »Sag mal, interessiert es dich denn nicht brennend, was in dem Brief von Roger steht?«
»Was für ein Brief?«, wunderte sich Hanky.
»Ja, von was rede ich denn eigentlich die ganze Zeit? Heute Morgen war ein Brief von diesem FBI-Mann in der Post, Roger Thorn, und ich hab dich gerade gefragt, ob du nicht mal nachschauen willst, was er denn will.«
»Entschuldige, ich bin noch nicht ganz wach. Wo ist denn der Brief?«
Walt legte die Stirn in Falten, ersparte sich aber jeglichen Kommentar. Er kam um den Tresen herum, verschwand kurz im Flur und kam gleich mit einem zerknitterten Umschlag zurück. Diesen legte er vor Hanky auf den Tisch und kehrte zur Küchenzeile zurück. Gespannt verfolgte er von dort aus, wie Hanky den Umschlag von allen Seiten betrachtete und schließlich aufriss.
***
Der Saal
Die ganzen Tage hatte sie - wann immer die Kopfschmerzen erträglich waren - ihre Umgebung im Auge zu behalten versucht. Ihr Name war Carmen Galinda, doch daran konnte sie sich nicht erinnern. Sie konnte sich an nichts erinnern, nur an den Schmerz, den fürchterlichen Schmerz, der in ihrem Kopf wütete wie ein wildes Tier. Suchend glitten ihre Augen hin und her und blieben an der Frau zu ihrer Rechten hängen. Über ihrem Kopf war jetzt ein Bildschirm positioniert. Carmen konnte nicht erkennen, was darauf zu sehen war. Nur einen rötlichen Schimmer auf der Haut der Frau sah sie und ihr gequältes, schmerzverzerrtes Gesicht.
Zwei Männer in grünen Krankenhauskitteln traten in ihr Blickfeld, einen glänzenden Wagen aus Aluminium vor sich herschiebend. Am Bett der Frau hielten sie an. Einer von ihnen beugte sich über sie und begutachtete die Schläuche, die aus ihrer Stirn ragten. Offenbar zufrieden, richtete er sich wieder auf und grinste. Fast fröhlich wandte er sich an seinen Kollegen: »Mit der werden wir eine gute Ausbeute erzielen. Ihre Panik begünstigt den Ausstoß des Serums. Der Chef wird zufrieden sein.«
Der andere nickte nur und deutete mit dem Kinn in Carmens Richtung. Ein hämisches Grinsen breitete sich auf seinen Lippen aus. »Ja, wird er wohl. Morgen kümmern wir uns um die Schönheit da drüben.« Er starrte Carmen unverwandt an und ließ seine begierigen Blicke über ihren Körper schweifen. Sein Partner bemerkte den Blick und die Gier darin und warf rasch ein: »Tu ja nichts Unüberlegtes. Der Boss wird sauer, wenn sich jemanden an den Spendern zu schaffen macht.«
Der Angesprochene grinste breit. »Nun mach dir mal bloß nicht ins Hemd«, brummte er abfällig. »Man wird ja wohl noch schauen dürfen. Außerdem, was macht es am Ende für einen Unterschied? Wenn die Ziegen keine Milch mehr geben, werden sie sowieso entsorgt. Du weißt, was ich meine!« Verschwörerisch zwinkerte er seinem Kollegen zu. Die beiden hantierten noch eine Weile an den Geräten herum, die auf einem Tisch hinter der Frau standen, und verließen dann Carmens Sichtfeld. Noch einige Zeit hörte sie die Männer, bis schließlich das Klacken einer Tür verriet, dass sie den Raum verlassen hatten.
Carmen versuchte die Worte einzuordnen. Spender? Was bedeutete das? War sie ein Spender? Für was? Sie wollte kein Spender sein. Sie wollte ihr Leben leben, auch wenn es nur ein einfaches, bescheidenes war. Angst breitete sich in ihr aus. Das Wort “Entsorgung” flößte ihr noch mehr Furcht ein. Sie fing an zu zittern, Schweiß brach aus allen Poren ihres Körpers. Nein, nein, nein! Sie wollte nicht entsorgt werden, sie wollte hier heraus. Sie musste fliehen. Adrenalin, ungeheuer konzentriert, verlieh ihrem Körper eine Kraft, die sie selbst nie für möglich gehalten hätte. Verzweiflung kämpfte gegen Chemie und bewirkte Unvorhergesehenes. Die Chemikalie, verantwortlich für die Lähmung ihres Körpers, wurde absorbiert. Carmen spürte sich selbst wieder, wenngleich brennende Schmerzen ihre Muskulatur peinigten. Mühsam hob sie den Arm und tastete über ihre Stirn. Doch da war nichts. Keine Kabel, keine Schläuche. Erleichtert atmete sie auf. »Morgen kümmern wir uns um die Schönheit da drüben«, hallte es in ihrer Erinnerung wider. Morgen würden diese Männer Schläuche in ihren Kopf stecken. Morgen würde sie verloren sein. Sie musste handeln, aus diesem Saal des Grauens fliehen, hinaus in die Freiheit, zurück ins Leben, nach Hause.
Unter unsäglichen Mühen richtete sie sich auf und hielt auf der Bettkante sitzend inne. Sie schwankte leicht, Übelkeit stieg in ihr auf. Hastig atmend, mit offenem Mund, saugte sie ihre Lungen voll Sauerstoff und konzentrierte sich darauf, den Brechreiz zu unterdrücken. Nach einigen Minuten stand sie auf, hielt sich noch mit einer Hand am Bettgestell fest, ehe sie einige unsichere, mit steigender Zuversicht immer sicherere Schritte wagte. Der Fußboden war kalt, was ihr half, sich der Realität ihrer Situation zu stellen. Kalte Füße signalisierten, dass sie immer noch unter den Lebenden weilte und dies hier keinesfalls ein Albtraum war. Suchend blickte sie sich nach einem Ausgang um. Absichtlich ließ sie den Blick an den unzähligen Betten mit den Menschen darin vorübergleiten, sah nicht genauer hin. Erst einmal musste sie sich in Sicherheit bringen, dann konnte sie versuchen, den Elenden hier zu helfen. Endlich erblickte sie eine Tür, gute fünfzig Meter entfernt. Sofort eilte sie dem Ausgang zu - sie hoffte, dass es ein Ausgang war. Es war wie ein Lauf durch die Hölle, vorbei an all den bemitleidenswerten Gestalten, die nackt und gepeinigt in den Betten lagen. Carmen hielt den Blick nach unten gerichtet, konzentrierte sich nur darauf, die Tür zu erreichen. Augenblicke später umfasste ihre Hand die Türklinke. Sie atmete einige Male tief durch, um ihren jagenden Puls zu beruhigen. Dann lauschte sie. Wo waren die Männer geblieben, die sie vorher beobachtet hatte? Waren sie dort draußen hinter der Tür? Doch so sehr sie sich auch anstrengte, sie konnte keinen Laut vernehmen. Vorsichtig öffnete sie die Tür einen Spalt weit und spähte hinaus.
Vor ihr lag ein dunkler Flur, Schatten deuteten Türöffnungen an. Alles war ruhig. Carmen schlüpfte in den Gang und schloss behutsam den Eingang zum Saal. Erstaunt stellte sie fest, dass es hier muffig roch, nach altem, nassem Gemäuer, nicht, wie sie erwartet hatte, steril wie in einem Krankenhaus. Darauf bedacht, die Füße so geräuschlos wie möglich aufzusetzen, schlich sie zum Ende des Gangs und zu einem sich anschließenden Treppenhaus. Sie entschied sich, den Weg nach unten zu nehmen.
Zwei Etagen tiefer fand sie endlich den ersehnten Ausgang. Durch ein kleines, in die Tür eingelassenes Fenster konnte sie auf den Hof eines Fabrikgeländes hinausschauen. So vermutete sie zumindest, da sich alte, aus Backstein errichtete Lagerschuppen an größere Gebäude schmiegten, und weiter hinten konnte sie schemenhaft einen hohen Schornstein erkennen. Draußen war Nacht, und dichter Nebel hüllte die Szenerie ein. Eisig lief ein Frösteln über ihre Haut, und sie wurde sich ihrer Nacktheit bewusst. Doch Kleidung zu finden, war im Moment von untergeordneter Bedeutung. Erst einmal musste sie von hier verschwinden.
Wie ein Phantom huschte sie nach draußen und verschwand im nächsten Schatten. Sie lauschte erneut auf verdächtige Geräusche, doch das ganze Gelände lag verlassen da. Nichts deutete darauf hin, was sich hinter diesen Mauern abspielte. Carmen tastete sich von Schuppen zu Schuppen, bis sie vor einem maroden Maschendrahtzaun stand. Zum Glück war er an vielen Stellen löchrig, zum Teil lag er ganz am Boden. Mit großer Vorsicht, da ihre Füße ungeschützt waren, stieg sie über die Überreste des Zauns, um dann über eine angrenzende Wiese zu einem Maisfeld zu laufen. Zwischen den mannshohen Stauden tauchte sie unter und verschwand.
Kapitel 4
Philadelphia
Roger Thorn war verdreckt und lag, nahe der Interstate - in diesem Teil der Stadt Lincoln Highway genannt -, unter einer Brücke. Mitten im Straßengewirr hatte die Stadt freundlicherweise jede Menge Bäume gepflanzt, die in all dem Beton eine grüne Insel bildeten. Diese Grünzone, fast ein kleiner Park, wurde von der Vine Street, der Interstate 676 und weiteren Straßen begrenzt. Dies war ein beliebter Platz für Obdachlose, Tramps und Leuten, die eine Weile von der Bildfläche verschwinden wollten. Genau das beabsichtigte auch Roger. Seine Verfolger mussten seine Spur längst verloren haben, und er hoffte, dass dem Hippiepärchen nichts zugestoßen war. Nie hätte er geglaubt, diesen Tag zu überleben. Doch umso besser. Auf seinem W;g aus den Wäldern hinaus nach Philadelphia hatte er Rache geschworen. Er würde diese Schweinehunde zur Strecke bringen, denen ein Menschenleben weniger bedeutete als der Dreck unter ihren Fingernägeln. Er wollte sie erwischen, sie alle, bis hinauf zu den Bossen, den Leuten, die das Ganze inszenierten, um Geld und Macht an sich zu raffen. Roger war nach Philadelphia gekommen, weil er hier auf Unterstützung hoffen konnte. Vor einiger Zeit hatte ihn ein Auftrag in diese Stadt geführt, und im Zuge der Ermittlungen hatte er sich die Gunst einiger Leute sichern können, indem er sie vor dem Gang ins Gefängnis bewahrte. Das war zwar nicht ganz legal gewesen, aber es wusste ja niemand von seinen Kontakten. Zudem hoffte er, dass seine geheimen Depots - einige Waffen und Bargeld - unentdeckt geblieben waren.
Es war kurz vor Sonnenaufgang, und selbst die hartgesottensten Säufer waren unter alten Kartons und Zeitungen eingeschlafen. Vorsichtig erhob sich Roger und verließ auf leisen Sohlen das Lager. Auf seinem Weg in die Stadt benutzte er Nebenstraßen und achtete peinlichst darauf, nicht von einem übereifrigen Cop aufgegriffen zu werden. Zuerst führte sein Weg durch Chinatown, wo schon zu dieser frühen Stunde emsige Händler ihre Obst- und Gemüsestände aufbauten. Danach durchquerte er eiligst Downtown, wo er schließlich in der Sansom Street ein öffentliches Telefon fand. Aus dem Gedächtnis wählte er eine Nummer und wartete geduldig, bis am anderen Ende der Leitung jemand den Hörer abnahm. Eine missmutige, knurrige Stimme meldete sich mit einem »Was ist? Wer ruft denn da schon in aller Herrgottsfrühe an? Eine Unverschämtheit, das!«
Roger grinste, denn es war völlig egal, zu welcher Zeit man Henry Rolin anrief: Es war immer die falsche Zeit. Dass Henry am Apparat war, hatte Roger schon nach dem ersten Wort erkannt.
»Guten Morgen, Henry. Hier ist Roger. Du erinnerst dich bestimmt noch an mich. Oder? Wehe, wenn nicht, dann kannst du deine schlechte Laune bald an einem liebenswürdigen Gefängniswärter auslassen. Hast du mich verstanden?«
»O je, der Staatsbulle«, entfuhr es Henry. »Du hast mir gerade noch zu meinem Glück gefehlt.«
»Wusste ich doch«, antwortete Roger schon fast amüsiert, gleichzeitig aber auch sehr froh darüber, dass er Henry erwischt hatte.
»Was willst du denn?«, knurrte der schon wieder.
»Als Erstes, Henry, will ich, dass du deinen Hintern in dein Auto schwingst und mich Sansom Street Ecke zwanzigste Straße abholst. Alles Weitere erkläre ich dir dann. Erschreck dich aber nicht, ich sehe heute etwas heruntergekommen aus.«
»Heute?«, antwortet Henry, hängte aber sofort auf, ohne auf eine Antwort zu warten.
***
Der Saal
Um kurz vor halb zehn rumpelte ein alter, verbeulter Lieferwagen auf den Hof des Fabrikgeländes. Auf dem zerkratzten Kastenaufbau stand in kaum noch leserlicher Schrift Schrotthandel Mac Mullen. Doch der Lieferwagen war keineswegs in so schlechtem Zustand, wie es schien. Der Wagen war nur aus Gründen der Tarnung so hergerichtet worden. Keinem zufälligen Beobachter würde es eigenartig vorkommen, den Transporter eines Schrotthändlers auf dem alten Fabrikgelände zu sehen.
Kurz vor dem Hauptgebäude hielt der Wagen an, und zwei Männer mittleren Alters stiegen aus. Sie trugen große, lederne Taschen und verschwanden kurz darauf im Haus. Es waren die gleichen Männer, die Carmen am Abend zuvor beobachtet und belauscht hatte. Zielstrebig stiegen sie die Treppen zum zweiten Stock hinauf und begaben sich zunächst in ein kleines Labor. Dort zogen sie ihre grünen Kittel über und legten aufgezogene Spritzen, Tupfer und Desinfektionsmittel auf den silbrigen Wagen.
Mit ironischer Stimme sagte der Größere der beiden: »Na, dann wollen wir mal unsere Visite machen. Außerdem wartet ja noch die Schönheit auf ihre Behandlung.«
Der andere Mann schüttelte nur besorgt den Kopf und schob den Wagen durch die Tür. Der Größere folgte fröhlich feixend. Kaum im Saal angekommen, fiel den Männern auf, dass Carmen nicht mehr in ihrem Bett lag. Sie ließen den Wagen stehen und rannten zwischen den Bettreihen hindurch. Ärgerlich drehte sich der kleinere der Männer zu seinem Kumpan um und schrie aufgebracht: »Wann hast du der Frau die letzte Injektion gegeben?«
»Ich?«, empörte sich der Angesprochene. »Wieso sollte ich der Schlampe die Injektion geben? Du warst an der Reihe. Du wolltest doch nicht, dass ich die Tante überhaupt anfasse.«
»Anfassen?«, schrie der kleinere Mann seinen Kollegen an. »Ich wollte nicht, dass du die Spenderin befummelst, auf deine kranke, sexistische Art. Das heißt aber nicht, dass du ihr keine Injektion geben sollst. Bist du denn völlig verblödet? Was meinst du, was nun geschieht? Der Boss wird außer sich sein vor Wut. Da kannst du dich auf was gefasst machen.«
»Wieso denn immer ich?«, maulte der andere, schon etwas kleinlauter.
»Ich muss den Boss anrufen«, murmelte sein Kollege. »Wir müssen wissen, was nun zu tun ist. Mann, das wird Ärger geben. Mannomann.« Damit drehte er sich um und eilte dem Ausgang der Halle zu.
Der größere Mann stand eine Sekunde wie versteinert da. In dieser kurzen Zeitspanne wurde ihm klar, dass er und sein Partner sich in einer sehr gefährlichen Situation befanden. Ihr Arbeitgeber kannte keine Gnade, und das Mindeste, womit die beiden rechnen mussten, war eine sehr unangenehme Befragung. Weiter wollte er gar nicht denken. So lief er schnell hinter seinem Kollegen her und rief, einer plötzlichen Intuition folgend: »Frank, warte mal! Lass uns erst mal nachdenken, ehe du anrufst. Wir können das Ganze ausbügeln, und der Boss wird nichts merken. Du weißt doch, wie er ist. Frank, nun bleib doch mal stehen!«
Der Angesprochene lief noch drei Schritte weiter und hielt dann tatsächlich an. Langsam drehte er sich um. Auch ihm war klar, dass sie in Schwierigkeiten steckten, und ein vernünftiger Ausweg konnte ihm nur recht sein. Er wollte, soweit das möglich war, sowieso nichts mit dem Boss zu tun haben. Dieser Mann und seine Kumpane waren gefährlich, sehr gefährlich, und dass ein Menschenleben in ihren Augen nichts wert war, sah man ja sehr deutlich in dieser Halle. Er würde sich die Idee seines Arbeitskollegen zumindest einmal anhören. »Also gut, Bob«, murmelte er gespielt gleichgültig. »Was hast du dir ausgedacht?«
Erleichtert, dass sein Kollege ihn anhören wollte, ehe er zum Telefon griff, erläuterte Bob seinen Plan. »Hör zu. Es ist doch eigentlich egal, wer die Spender sind. Wichtig für den Boss und damit auch für uns ist, dass die Anzahl der Einlieferungen stimmt. Wenn niemand fehlt, haben wir keine Probleme.«
»Aber es fehlt ein Spender«, entgegnete Frank.
Bob winkte ab und lächelte. »Ja, verstehst du denn nicht? Es ist ganz einfach. Wir brauchen nur einen neuen Spender. Niemand wird etwas merken.«
»So so, ganz einfach«, echote Frank. »Und woher willst du so schnell einen neuen Spender nehmen?«
»Na, wir ziehen los und fangen uns einen. So schwer kann das ja wohl nicht sein.«
Frank überlegte einen Moment. Ihm behagte es überhaupt nicht, sich als Menschenfänger zu versuchen. Er war Medizintechniker und kein Kidnapper. Aber so sehr er sich anstrengte, ihm fiel keine bessere Lösung ein.
Carmen war die ganze Nacht umhergeirrt. Immer wieder war sie stehen geblieben und hatte in die Nacht gelauscht, um herauszufinden, ob jemand sie verfolgte. Doch alles war ruhig geblieben. Sie war völlig verdreckt und nach ihrer Flucht durch den dunklen Wald ziemlich zerkratzt. Seit einigen Stunden war es nun schon hell, Carmen hatte Hunger, und sie fröstelte. Wo sollte sie nur hin? Wo konnte sie auf Hilfe hoffen? Irgendwo am Straßenrand hatte sie ein Hinweisschild gesehen. Sie war nicht mehr in Mexico. Sie befand sich irgendwo in den USA, dem Land ihrer Träume. Doch ein Albtraum hatte sie hierher verschlagen. Sie lief parallel zur kleinen Landstraße entlang und blieb, so weit es ging, in Deckung. Auf keinen Fall wollte sie durch eine Unachtsamkeit ihren Häschern erneut in die Hände fallen.
Nach einer Weile sah sie, dass die Landstraße in ein kleines Dorf führte. Hübsche Häuser säumten die Straße, mit blumenbepflanzten Vorgärten herausgeputzt. Der Ort lag ruhig vor ihr. In der Ferne hörte sie das Summen fahrender Autos.
Sie war offensichtlich in einem Wohnviertel oder einem Vorort. Der Verkehr konzentrierte sich, für Carmen nicht sichtbar, im Zentrum des Dorfs. Sie schlich vom Waldrand über eine Wiese auf das erste, mit einem weißen Lattenzaun umfriedete Haus zu. Ohne Mühe überwand sie den Zaun und hastete zur in zartem Gelb gestrichenen Hauswand. Durch ein Fenster wagte sie einen Blick ins Innere des Hauses. Sie sah direkt in eine schon etwas in die Jahre gekommene Küche. In den Schränken und an den Wänden sah sie reich dekorierte Kaffeetassen und Landschaftsbilder, vermutlich Erbstücke, die über Generationen liebevoll zusammengetragen worden waren. In diese Szenerie gediegener Gutbürgerlichkeit trat nun aus dem Flur eine grauhaarige, etwas dickliche Frau mit leicht gerötetem Gesicht, die einen großen Topf trug, den sie ächzend auf den emaillierten Gasherd stellte. Erschrocken und mit offenem Mund fuhr sie herum, als Carmen zaghaft ans Fenster klopfte. Mit einigen schnellen Schritten war sie beim Fenster, hob die Arme und rief laut aus: »Ach du liebe Güte, Kind, was ist denn mit Ihnen geschehen?«
Damit verließ sie das Fenster, eilte mit wehender Schürze aus der Küche und war in erstaunlich kurzer Zeit draußen angelangt. Hier erst sah sie, dass Carmen völlig unbekleidet war. Sofort riss sie sich die Schürze vom Leib und bedeckte notdürftig Carmens Blöße. Als sie Carmen beruhigend den Arm um die Schulter legte, sackte diese fast in sich zusammen. Schock und Anspannung der vergangenen Tage und Stunden forderten ihren Tribut. Die besorgte Hausfrau führte sie unter einem Schwall beruhigender Worte ins Haus und dann in ein kleines Gästezimmer. Dort setzten sich beide aufs Bett. Die Frau wartete einen Moment und ließ Carmen erst einmal zur Ruhe kommen. Währenddessen schaute sie sich deren zerschundenen, verschmutzten Körper genauer an. »Du armes Kind«, begann sie und schüttelte besorgt den Kopf. »Was um Himmels willen ist dir denn widerfahren?« Sie nahm Carmen in den Arm und streichelte ganz mütterlich über ihr verfilztes, schwarzes Haar.
»Ich bin Molly Barns«, stellte sie sich vor. »Und du bist nun in Sicherheit. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas geschieht. Leg dich erst mal hin, und ich lass dir in der Zwischenzeit ein heißes Bad ein. Du wirst sehen, wie schnell es dir dann wieder besser geht.« Mit diesen Worten drückte sie Carmen sanft auf das Bett und deckte sie mit einem dicken Federbett zu. Dann eilte sie in das gleich nebenan liegende Badezimmer.
Kapitel 5
New York City
Der Brief hatte Hanky erschüttert. Nicht etwa das Schreiben an sich, das eher sachlich verfasst war, sondern die Emotionen, die mit diesem Schriftstück reisten.
Hanky war sich noch immer nicht über alle seine Fähigkeiten im Klaren. Nun war schon etwas mehr als ein Jahr vergangen, seit er den Tausendschläfer besiegt hatte, dennoch entdeckte er fast jeden Tag kleine Hinweise darauf, dass die Welt des Übersinnlichen - oder, wie er lieber sagte, der Extrafähigkeiten - scheinbar grenzenlos war. Seine wichtigste Fähigkeit war es, von jeder beliebigen Person Informationen telepathisch zu empfangen und sie in seinem Gehirn zu speichern. Diese Fähigkeit erlaubte es Hanky, ungeheures Wissen anzuhäufen, und machte das Lernen leicht. Die Gefahr solcher Übungen lag darin, dass es häufig schwierig war, sich von den Gefühlen anderer Menschen zu distanzieren. Dass allerdings ein sogenannter toter Gegenstand Emotionen transportieren konnte, war neu für ihn. Zum Glück bewies Walt großes Einfühlungsvermögen und hatte ihn in Ruhe gelassen. Eine ganze Weile hatte Hanky unschlüssig auf dem Sofa gesessen und aus dem Fenster gestarrt. Ihm war noch nicht klar, wie er Roger helfen konnte. Instinktiv wusste er, dass der FBI-Mann noch am Leben war, doch das war auch schon alles. Wie sollte Hanky vorgehen, wo mit den Ermittlungen beginnen? Alles war sehr verschwommen und nebulös. Schließlich nahm er den Brief noch einmal zur Hand und las ihn erneut.
Bei den Ermittlungen zu mehreren mysteriösen Mordfällen im Gebiet der Staaten New York und New Hampshire hatten örtliche Einheiten der Mordkommission das FBI um Unterstützung gebeten.
Vier Leichen im nördlichen New York und drei Leichen in New Hampshire, aufgefunden auf Mülldeponien, stellten die Beamten der Mordkommission und die zuständigen Gerichtsmediziner vor ein schwieriges Problem. Alle Leichen hatten drei Millimeter große Löcher in der Stirn, die laut Obduktionsbericht aber nicht die eigentliche Todesursache waren. Alle Opfer starben an akutem Herzversagen, was normalerweise auf extrem hohe Stressbelastung zurückzuführen ist. Auffallend und bei allen Untersuchten identisch war die ungewöhnlich hohe Konzentration von Adrenalin. Bei der Öffnung der Schädeldecken wurde bei allen Opfern eine Perforation der Zirbeldrüse festgestellt. Die Mediziner waren ratlos und konnten sich keine Prozedur vorstellen, bei der es nötig war, durch die Stirn die Zirbeldrüse zu punktieren. Die ermittelnden Beamten wussten noch weniger mit diesen Informationen anzufangen. Ungewöhnlich war auch die Tatsache, dass die Täter ihre Opfer einfach auf Mülldeponien ablegten. Vermutlich hatten sie gehofft, dass die Leichen unter den Müllbergen begraben würden und niemand Notiz nehmen würde. Tatsächlich war das erste Opfer auch nur zufällig gefunden worden. Da die herbeigerufenen Polizeibeamten mehr als nur eine Leiche fanden, verständigte der zuständige Staatsanwalt seine Kollegen der angrenzenden Staaten, was zum Fund der Leichen in New Yorkführte.
In diesem Stadium wurde ich vom New Yorker Büro auf den Fall angesetzt. Ich sollte verdeckt ermitteln und versuchen, die Leute zu finden - wir waren uns von Anfang an sicher, dass es sich um mehrere Täter handeln musste -, die für die Morde verantwortlich waren. So streifte ich durch Kneipen und Bars, die von der Fundstelle aus in einem Radius von zwanzig Meilen aufgefunden worden waren.
Anfangs hörte ich nur das übliche Geschwätz angetrunkener Kleinstadtbewohner. Jeder hier hatte seine eigene Theorie über die Morde, sogar von Außerirdischen wurdegefaselt, bis ich eines Abends Zeuge eines leise geführten Gesprächs wurde.
Zwei Männer mittleren Alters saßen etwas abseits an der Theke einer kleinen Bar, die ich in den vergangenen Tagen schon des Öfteren besucht hatte. Den einen kannte ich schon vom Sehen, der andere Gast aber war mir unbekannt. Aus dem Gespräch konnte ich bruchstückhaft heraushören, dass der Unbekannte versuchte, seinen Gesprächspartner anzuwerben. Der Unbekannte hatte einen militärisch kurzen Haarschnitt und wirkte sehr durchtrainiert. Nach einer Weile ging er fort, und zurück blieb der offenbar tief in Gedanken versunkene andere Mann. Ich musste herausfinden, um was es in dem Gespräch gegangen war. Also bestellte ich zwei Drinks und rückte näher an ihn heran. Zunächst war er misstrauisch, im Verlauf des Abends und weiterer Getränke wurde er dann doch noch gesprächig. Er berichtete mir von einer Vereinigung, die sich Gruppe Phönix nannten. Diese Leute waren sehr konservativ und rassistisch. Mein Gesprächspartner war erschrocken über die krassen, gewaltbereiten Äußerungen des PhönixMitglieds und wollte deshalb in der nächsten Zeit Bars meiden, um diesen Leuten aus dem Weg zu gehen. Er hatte sichtlich Angst, ich hingegen wollte und musste jeder Spur nachgehen, die mich möglicherweise zu dem Täterkreis führen konnte. Also warum nicht hier beginnen? Gleich am nächsten Tag informierte ich mich im Internet über diese ominöse Gruppe. Ich fand nur sehr wenige Informationen. In entsprechenden Foren wurde jedoch erschreckend offen dem Rassismus gehuldigt und unverblümt eine weiße Vorherrschaft gefordert, um die minderwertigen Rassen< in die Schranken zu weisen. Doch niemand sprach direkt von der Gruppe Phönix und der ihr untergeordneten Odin Force. Trotzdem gab es diese Organisationen, und ich vermutete, dass diese Leute etwas mit den Morden zu tun hatten. Dieser Frage wollte ich auf den Grund gehen, und so wartete ich in der Bar einige Tage auf das Auftauchen des militärischen anmutenden Mannes. Eine Woche später war es so weit. Der Kerl kam herein und schaute sich suchend um. Ich hatte mir extra paramilitärische Kleidung gekauft und gab mich entsprechend progressiv. Laut schimpfte ich über die Ungerechtigkeit der Welt und die der Gruppen, jeder wisse ja wohl, wen ich damit meine, die das ganze Finanzsystem steuerten und damit Elend über alle rechtschaffenen Leute brächten. Ich dachte schon, ich hätte etwas zu dick aufgetragen - der Wirt schaute mich ganz verwundert an - als der Militärische auf mich zugeschritten kam. Er versuchte mich zu beruhigen, was ich zu Anfang nicht zuließ. Er blieb aber hartnäckig, und schon bald fing er mit seinem Anwerbungsgespräch an. Kurz gesagt, schon am nächsten Tag wurde ich der Ortsgruppe vorgestellt, durchlief am folgenden Wochenende einen Eignungstest, der meine sportliche und moralische Eignung prüfen sollte. Da ich erstaunlich gut abschnitt, wurde ich unter großem Tamtam feierlich aufgenommen und musste einen Treueeid ablegen. So wurde ich Woche um Woche weiter nach oben empfohlen, da meine Eignung für den militärischen Arm der Organisation nicht zu übersehen war. Schließlich wurde ich Mitglied einer mobilen Einheit mit dem heroischen Namen Odin Force. In dieser Gruppe, die mit allen Arten moderner, beweglicher Waffen ausgestattet war, besuchte ich weitere Fortbildungskurse. In abgelegenen Gegenden wurde trainiert, die Wälder im nördlichen Territorium des New York State waren nun mein neues Zuhause. An den abendlichen Lagerfeuern wurde von vergangenen Einsätzen geschwärmt, allerdings nie in Anwesenheit sogenannter Offiziere. Was ich da erfuhr, ließ mir den Atem stocken, obwohl ich das Gerede am Anfang als angeberisches Geschwätz abtat. Doch nach und nach glaubte ich den Geschichten. Natürlich hatte es in meiner Karriere bei der Odin Force kleinere Straftaten seitens meiner >Kameraden<gegeben, aber nichts, was ein Einschreiten und den Verlust meiner Tarnung gerechtfertigt hätte. Dann kam allerdings der Tag, der mich zur Flucht veranlasste und mich meinen Glauben an den Staat verlieren ließ.
Schon am frühen Morgen waren wir angewiesen worden, das Gelände zu sichern, da hoher Besuch angekündigt war. Wir verteilten uns rund um eine große Lichtung, die ab und zu als Landeplatz für Helikopter genutzt wurde. Ich stand, ganz in schwarz gekleidet, mit einer geladenen M16 in der Armbeuge am Rand des Waldes. Um Punkt neun Uhr hörte ich das Knattern eines nahenden Hubschraubers. Kurz darauf schwebte eine schwarz lackierte Maschine ohne jegliche Kennung heran und landete sanft in der Mitte der Lichtung. Mehrere Männer in dunklen Anzügen verließen den Helikopter. Aus reiner Neugier schaute ich durch mein Fernglas zu den Männern hinüber. Was ich sah, war ein Schock für mich: Ich kannte einige der Männer dort drüben. Gerade wurde der stellvertretende FBI-Direktor Stuart Melanscy vom Lagerkommandanten Rudgar Kruger begrüßt. Direkt daneben standen, breit lächelnd, Staatssekretär Wilson Mac Adams und Senator Samuel Benjamin aus Nevada. Hinter diesen Repräsentanten der Vereinigten Staaten von Amerika hatten sich zwei meiner Kollegen postiert, die ich aus dem Washingtoner Büro kannte: Joe Curtis und Mike Stellino. Ich fragte mich, was diese Männer hier zu suchen hatten. War diese ganze Organisation ein getarntes Projekt des FBI? War ich einer falschen Fährte auf der Spur? Das konnte doch nicht sein.
Nach einer Weile wurde ein gefesselter Mann zu der Gruppe gebracht. Mit angeekeltem Gesichtsausdruck blickte der Senator ihn an. Dann sagte er etwas zu ihm und spuckte verächtlich aus. Das Gesicht des Gefesselten war mit Blutergüssen übersät, was auf eine vorangegangene Folterung hindeutete. Der stellvertretende FBI-Direktor gab dem Agenten Curtis einen kurzen Wink, worauf dieser mit einer lässigen Bewegung seine Dienstwaffe zog und dem Gefangenen ohne Zögern in den Kopf schoss. Der Mann brach sofort zusammen und blieb liegen. Die Gruppe setzte ihr Gespräch fort, als sei nichts geschehen. Nach weiteren fünf Minuten brachten vier Odin-Mitglieder eine offenbar recht schwere Kiste herbei und verluden sie in den Hubschrauber. FBI-Agenten, Staatssekretär und Senator verabschiedeten sich vom Kommandanten und verschwanden einer nach dem anderen in der Maschine. Kurz darauf startete der Hubschrauber und flog dicht über den Baumwipfeln davon.
Zwei Stunden später lag noch immer der Leichnam auf der Lichtung, gut sichtbar für jeden. Vor dem Haupthaus sammelten sich die Männer. Den leise geführten Unterhaltungen entnahm ich, dass es sich bei dem Erschossenen um einen FBI-Agenten handelte. Dieser Mann war für die Entsorgung der Leichen verantwortlich gewesen, die später auf den Müllhalden gefunden worden waren. Ich vermutete, dass der Agent die Toten mit Absicht dort platziert hatte, um die Ermittlungsbehörden aufmerksam zu machen. Ich kannte den Mann nicht, was aber auch nicht verwunderlich war, da über dreißigtausend Mitarbeiter des FBI in den USA tätig sind. Das ich die Insassen des Helikopters identifizieren konnte, war schon ein großer Zufall.