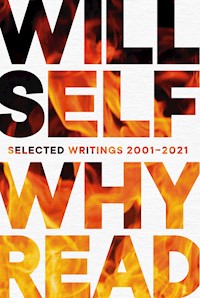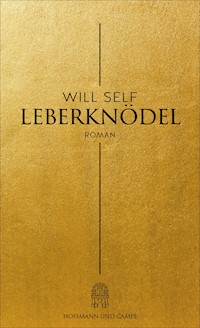
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie lebt man weiter, wenn das Todesurteil aufgehoben zu sein scheint? Die englische Witwe Joyce Beddoes leidet an Leberkrebs und fliegt mit ihrer alkoholsüchtigen Tochter in die Schweiz, um dort »in Würde« zu sterben. In letzter Minute verweigert sie jedoch das tödliche Gift und verlässt die Sterbeklinik. Sie driftet durch Zürich, und während sie sich von ihrer Tochter immer mehr entfernt, geht es ihr von Tag zu Tag besser. Als die Ärzte den Tumor nicht mehr nachweisen können, glauben die Mitglieder einer katholischen Gemeinde an ein Wunder. Aber je mehr sich ihre körperliche Verfassung bessert, desto entschiedener verweigert Joyce dieses geschenkte Leben ... - Will Self, brillanter Chronist der Neurosen unserer Zeit, erzählt von einer Frau, der die allgegenwärtige Sinnsuche in einer Extremsituation zur Farce gerät.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Will Self
Leberknödel
Roman
Aus dem Englischen von Gregor Hens
Hoffmann und Campe
Introitus
Joyce Beddoes – ihre Freunde nannten sie Jo, ihr verstorbener Mann hatte sie in offenherziger Vertrautheit gelegentlich Jo-Jo genannt, genauso wie in Kindertagen ihre Tochter Isobel – war drauf und dran, den Kopf zwischen die Knie zu stecken.
»Alles in Ordnung, Mama?«, fragte Isobel – die auf dem widerlich geschlechtslosen Izzy bestand – wohl schon zum fünfzigsten Mal an jenem Morgen, eine Nachfrage, die Joyce als bedrängend empfand, weil ihr keine echte Sorge zu entnehmen war.
»Ich – ich wollte mich einfach …« Sie hätte »vorbeugen« gesagt, doch die Zwecklosigkeit dieses Wunsches – der Sitz war zu eng, ihr fehlte die Kraft, ihre kaum noch menschliche Stimme scharrte und gluckte wie Federvieh – war zu übermächtig, um nach dem unverblümten Ausdruck des reinen Wollens noch etwas zu artikulieren.
Was aber nicht hieß, dass der Satz unvollständig war, denn Joyce wollte einfach alles: das Klapptablett, den falschen Schildpatt-Kamm im Honighaar der Stewardess, das Hochglanzmagazin, das sie durch die Lücke zwischen den Lehnen erspähte. Sie wollte einfach diese Zeitschrift haben – und alles, was darauf abgebildet war: die Ecke eines Tischs, der für ein ausgedehntes Frühstück gedeckt war, mit elegantem weißen Geschirr, einem Croissant-Körbchen und einem Glas Orangensaft. Joyce wollte einfach die hübsche Hand des Models in diesem Foto besitzen, eine Hand, die mit geübter Gelassenheit einen Teelöffel hielt.
Stattdessen hatte Joyce, was niemand haben wollte: sauer aufstoßende Übelkeit, einen schmerzhaft geschwollenen Bauch und einen Glühdraht in der Harnröhre. Und auf alldem lastete eine schreckliche, beinahe kriminelle Abgeschlagenheit.
»Willst du Wasser, Mama, soll ich dir Wasser bestellen?«, fragte Isobel; nur dass es wie »Warser« klang. Was war denn das? Ein fünftes Element vielleicht, ein klumpiges Substrat, auf dem sie alle wie Bakterien gediehen und verendeten?
Nichts verabscheute sie so sehr wie Isobels volksnah affektierte Sprache, es machte die junge Frau hässlich, oder eher: nicht mehr jung. Joyce bemerkte, dass Isobel ihrem Vater immer ähnlicher wurde. Sie war schon damals unübersehbar Derrys Mädchen gewesen – und das war eigentlich recht süß. Für Joyce bestand die Freude der Mutterschaft in erster Linie darin, zu entdecken, dass der junge Mann, der ihr mit Schellackplatten von Stan Getz und klebrigen Süßigkeiten den Hof gemacht hatte und der so glatt gewesen war wie die Pomade in seinem Haar, nun noch einmal in Erscheinung trat: diesmal in der Rolle des reizenden kleinen Mädchens.
Doch in den letzten Jahren hatte Isobel die junge Reife, die ihrem Vater so gut zu Gesicht gestanden hatte – straffes Grübchenkinn, ruhiger Blick aus nussbraunen Augen – gewissermaßen übersprungen, sie hatte gleich seine mittlere Lebensphase erreicht, in der Derry, es lässt sich nicht anders sagen, zur Fettleibigkeit neigte. Isobel, die erst vierunddreißig war, hatte unter dem eigenen Kinngrübchen bereits einen schlabberigen Hals. Ihr braunes Haar – das früher dicht und glatt gewesen war wie das des Vaters – war von Brenneisen und Färbemitteln derart malträtiert, dass es auf ihrem runden Schädel wie Zuckerwatte bröselte.
Nein, Joyce wollte kein Wasser – es gab ohnehin keins. Ihre Plastikflaschen waren an der Sicherheitskontrolle in die Tonne gewandert. Sie hatte Isobel gebeten, eine neue Flasche zu besorgen, doch als die jüngere der beiden Frauen endlich von der Toilette zurückkehrte, war keine Zeit mehr dafür gewesen.
Sie waren gerade erst gestartet: Das Flugzeug, diese eintönig dröhnende Röhre, befand sich im scharfen Steigflug. Es dauerte, bis Joyce sich überwand, einen Blick aus dem Fenster zu werfen. Statt die glühenden Wangen zwischen die eigenen Knie zu pressen, hoffte sie, die kühlenden Wolken zu spüren, die frische Luft tief einzuatmen, die Übelkeit zu bezwingen.
Im Flugzeugkörper wimmerten Stellmotoren, Querruder ruckten, aus wippenden Tragflächen traten Rinnsale wie Blut. Jeder der Nietenköpfe war, so bemerkte Joyce, von einem ansteckenden Rosthof umgeben.
Das Flugzeug krachte in ein Luftloch. Joyce verschlug es den Atem, sie hielt sich den Mund zu und versuchte, den metallischen Gallensaft zurückzuhalten, der ihr in die Kehle gestoßen war. Unter ihnen, weit unter ihnen, wogten die Hügel der English Midlands, bräunliche Dörfer und grünliche Felder, die sich in der buckelnden Landschaft verloren. Joyce entdeckte eine Perlenkette, glänzende Neuwagen, frisch vom Fließband. Das Flugzeug holperte und stolperte – als ihr plötzlich klar wurde, dass zwischen ihrem welken Fleisch und dem gehärteten Glas der Windschutzscheiben Tausende Meter klafften, war sie zu Tode erschrocken.
Zu Tode erschrocken bei der Vorstellung, am Autobahnring von Coventry auf dem Parkplatz eines Supermarkts aufzuschlagen. Zu Tode erschrocken bei der Vorstellung, dass der Inhalt ihrer spärlich bestückten Handtasche – eine frische Unterhose, Make-up, das sie nicht benutzen, und Geld, das sie nicht ausgeben würde – in den Furchen eines Feldes verstreut zu liegen käme. Zu Tode erschrocken bei der Vorstellung, von einem Strommast aufgespießt und ausgeweidet, von einem surrenden Kabel amputiert zu werden. Zu Tode erschrocken, obwohl sie unter den gut vierzig Passagieren dieses Flugs von Birmingham nach Zürich diejenige war, die am wenigsten Grund hatte, den Tod zu fürchten.
Trotzdem machte sie sich so klein wie möglich und wimmerte Beschwörungen – What will be, will be –, die ihr über die ausgetrockneten Lippen kamen. Joyce sehnte sich nach ihrem reservierten und doch heiteren Vater – dessen eine Gesichtshälfte von dem gehärteten Kautschuk geschwollen war, der den in Frankreich pulverisierten Wangenknochen auffüllte, während die andere glatt und harmlos war. Wie gern säße sie in einem lichtdurchfleckten Wald auf seinem Knie, wie damals vor dem Zweiten Weltkrieg. Doch er war tot – genau wie ihre Mutter, genau wie Derry. Und sie wusste: In den Armen der Toten sucht man den Trost vergeblich. Man spürt die Toten nicht – und sie bleiben ungerührt.
Gott aber – Gott würde sie im Sturz auffangen – er und der reine Klang unverdorbener Menschlichkeit.
Bis Ende Januar, als es ihr schließlich zu schlecht ging, um weiter mitzumachen, war Joyce Mitglied eines Chors gewesen, der in der Institutskantine Mozarts Requiem probte. Niemand, nicht einmal Tom Scoresby, der unerträglich eitle Chorleiter der Bournville Singers, hätte behaupten mögen, dass ihnen eine klanglich überzeugende oder auch nur getreue Aufführung des Werks gelingen würde, und doch hatten sie sich vor dem Hintergrund der Küchenklappen zu höchsten Höhen aufgeschwungen.
Requiem aeternam dona eis, Domine. Schwer atmende Männer, pummelig und mit weitgeöffneten Kragen – ehemalige Arbeiter aus der Autofabrik, Angestellte, Rentner – gefolgt von Joyce und den anderen Frauen, die hechelnd die Leiter hinaufkletterten: ex lux perpetua luceat eis … Sie vermied es, Scoresby anzublicken, der mit wippender, silbrig weißer Mähne seinen Chor aufpeitschte, und konzentrierte sich stattdessen auf die wunderschönen Harmonien, die wie Fahnenbänder in die Wolken reichten, wo Engel warteten, um sie emporzuziehen. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen.
Es war dumm gewesen, in dieses Flugzeug zu steigen, und es war geradezu idiotisch, dass sie nicht wenigstens alles, was sie zurückließ – die im Regal aufgereihten Behälter für Reis, Gerstengraupen, Mehl und Zucker –, noch einmal gewürdigt hatte, statt die wundersame Ordnung ihrer Küche schlicht als gegeben hinzunehmen.
Wenn ich je wieder aus diesem Himmel absteige, werde ich so einen Fehler ganz bestimmt nicht wieder machen.
Das Flugzeug durchbrach die Wolkeninselwelt, stieg aus dem Meer ins unirdische Sonnenlicht. Der Rumpf knisterte erleichtert. Die Stewardess öffnete ihren Gurt, stand auf und zog schwankend ihren Rock gerade.
»Wasser, Mama?«, fragte Isobel noch einmal, ihr pralles Gesicht gestopft vom Kautschuk der Besorgnis.
Die unmittelbare Angst fiel von ihr ab, die Aschewolke zog davon, der Blick öffnete sich auf die dahinterliegende finstere Wahrheit: Übelkeit, Glühdraht, Blähungen, Abgeschlagenheit. Was für ein Wahnsinn, was für ein verdammter Wahnsinn ist diese Todesangst, wo ich doch in ein paar Stunden ohnehin tot bin.
Der Flug verlief ohne weitere Vorkommnisse. Joyce war nicht einen Augenblick versucht, das pappige, mit Käsematsch belegte Brötchen anzunehmen – oder gar ein alkoholisches Getränk zu bestellen. Die Stewardess – vielleicht weiß sie etwas – schleppte sich mehrmals durchs ganze Flugzeug, um zu fragen: »Ihre … Mutter, ja? Kommt sie zurecht?« Worauf die Stewardess und Isobel – zwei Geschöpfe, fand Joyce, die beide etwas Kuhartiges hatten – gemeinsam muhten: »Vielleicht doch ein Glas Wasser?«
Wasser! Joyce war ziemlich sicher, dass sie sich beim Start nass gemacht hatte. Als sie aus dem Haus getreten waren und Joyce zum letzten Mal die Haustür abgeschlossen hatte, hatte sie bei der Schlüsselübergabe an Isobel eine unwürdige Wut gepackt. Was wird sie mit den guten Vorhängen machen, mit den Polsterüberzügen? Was wird mit den Schallplatten ihres Vaters geschehen, mit dem Muranoglas? Sie hatte genaueste Anweisungen gegeben und hatte doch das Bild all dieser Kartons vor Augen, achtlos abgestellt vor dem Wohlfahrtsladen in Shirley.
Sie saßen bereits im Taxi auf dem Weg zum Flughafen, als Joyce sich endlich wieder fing – zu spät, um umzukehren und die Inkontinenz-Einlagen zu holen. Und so war nun wohl ein dunkler Fleck auf dem blassblauen Polster ihres Flugzeugsitzes. Beschämend.
Ächzend sank die Maschine der Erde entgegen, überflog bewaldetes Alpenvorland, kahle Felder, Blechhallen an einer Verkehrsarterie, Wohnhäuser, eintönig und ununterscheidbar wie das, was sie zurückgelassen hatten. Das Matterhorn war nicht zu sehen – auch keine Almen. Sie sahen weder Schnee – und das im März – noch Kuckucksuhren, weder Chalets noch breite Satteldächer, weder Heidi, die ihre Zicklein hütete, noch hochgestapelte Schokolade. Das Einzige, was ihren Vorstellungen entsprach, war der Flughafen selbst, das bremsende Flugzeug, die Durchsage des Kopiloten: »Meine Damen und Herren, willkommen in Zürich, die Ortszeit ist 11:48 Uhr. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug. Im Namen der ganzen Crew wünsche ich Ihnen eine sichere Weiterreise.«
Joyce, die immer groß gewesen war – groß und feingliedrig wie eine Gazelle, so Derry, was sie immer wieder gern gehört hatte –, konnte sich nur aus ihrem Fensterplatz befreien, weil sie von Isobel gezerrt und von der Stewardess, die hinter ihr in den Sitz geglitten war, geschoben wurde.
Kurz bevor sie sich mit ungeheurer Anstrengung erhoben hatte, hatte sie ihren Hintern vom Sitz gelöst und die Serviette daruntergeschoben. Sie hatte einen winzigen, anrührenden Augenblick lang auf die Saugfähigkeit der Serviette vertraut, doch als sie sich nun noch einmal umsah, fiel ihr Blick auf eine unverkennbare Urinpfütze. Die Stewardess hatte es wohl gesehen, ließ sich aber nichts anmerken – Diskretion ist eine schweizerische Eigenschaft, dachte Joyce. Sie wollte ihr nun sogar in den Mantel helfen und ließ damit durchblicken, dass sie verstand, wie notwendig es war, den größer werdenden Fleck auf ihrem Rock zu verbergen.
Dr. Phillimore – den Joyce kannte, seit er ein Jahr vor ihrer Pensionierung im Mid-East angefangen hatte – hatte sehr wohl verstanden, wozu sie einen Brief benötigte, der konkret und ausführlich über ihren Krebs, den Krankheitsverlauf und die Prognose Auskunft gab. Selbst wenn sie ihn als Arzt schlichtweg nicht sonderlich respektierte – er hatte eine brüske, selbstzufriedene Art –, war sie anfangs einfach nur dankbar, dass er nicht versuchte, sie umzustimmen. Und das bedeutete, dass er, der sich kaum um sie gekümmert hatte, als es seine Aufgabe gewesen wäre, sie am Leben zu erhalten, ihr nun, da sie stoisch den Tod gewählt hatte, in der althergebrachten Weise helfen würde.
Also hatte er versäumt, das ausgezeichnete Palliativteam zu erwähnen – es wäre ohnehin eine dreiste Lüge gewesen. Denn obwohl Joyce seit einem Jahrzehnt nicht mehr direkt an der Verwaltung des Krankenhauses beteiligt war, stand sie mit ehemaligen Kollegen am Mid-East in Verbindung und wusste, wie ausgesprochen schlecht es um diese Dinge stand. Phillimore erinnerte sie auch nicht an die vielen Hospize, mit denen das Krankenhaus gute Erfahrungen gemacht hatte; er versäumte sogar zu erwähnen, welch enorme Fortschritte die Schmerztherapie gemacht hatte, was es Joyce ermöglicht hätte, ihrem Ende in Ruhe und mit geistiger Klarheit entgegenzusehen.
Erst als Joyce bereits über den Korridor davonschlurfte – dankbar für den Handlauf, den sie selbst hatte einbauen lassen –, kam ihr der Gedanke, dass es Phillimore nicht etwa egal war, sondern dass er ihre Entscheidung aktiv unterstützte: und zwar nicht aus philosophischen Erwägungen, sondern weil ihre Beseitigung ihm selbst die Arbeit erleichtern würde und ihm – dem dicken, mit einem weißen Kittel befiederten Pfeil – erlauben, in den konzentrischen Kreisen seines Budgets zu bleiben und ins Schwarze der Kostenvorgaben zu treffen.
Isobel führte sie vorsichtig am Arm, auf der anderen Seite wurde sie von der Stewardess gestützt. Joyce kratzte mit ihren Stiefeletten über die Betonplatten zum Bus. Geschäftsmänner und -frauen in schwarzen Anzügen griffen hastig nach ihren Handys. Joyce beachtete weder ihre Ungeduld noch die klamme Reibung ihrer eigenen Unterwäsche, sie atmete tief ein und genoss den beißenden, mineralischen Geruch des Flugbenzins, den Hitzeschwall und das hallende Jaulen der taxelnden Maschinen. Das Flugzeug, das sie hergebracht hatte, war von der Schwerkraft gefesselt. Auf der Heckfinne glänzte das gedrungene, aus roter Fläche gestanzte Kreuz: Das Negativ eines Rettungsflugzeugs, dachte Joyce – es hatte sie eilig hergebracht, nicht um sie zu retten, sondern um sie dem Untergang auszuliefern.
Kyrie
Herr, erbarme dich unserer Nummernkonten, unserer Neutralität und unseres Nazigolds … Schaudernd erreichte Joyce die Ankunftshalle, sie zitterte regelrecht, als sie sich durch den gedämpften Lärm der Einkaufszeilen schob. Ihr blieb nichts übrig – Christe eleison –, als ihrer Tochter zuzugestehen, dass es jetzt so weit war. Selbstverständlich hatten sie nur Handgepäck dabei. Joyce rechnete zwar damit, ewig zu bleiben, meinte aber trotzdem, ohne ein Totenhemd zum Wechseln auszukommen. Isobel wollte gleich am nächsten Tag wieder zurückfliegen.
Trotzdem war Isobel gezwungen, mit ihrer Mutter im Schlepptau einen Gepäckwagen zu finden und nach dem Weg zu fragen – beides Aufgaben, die sie in Joyces Augen nur unzulänglich erfüllte. Ihre Tochter war laut und gleichzeitig ineffizient: Sie wackelte, wenn sie ging, in gespieltem Triumph mit den breiten Hüften. Ihre hochhackigen Stiefel, die enge Jeans, die kurze Lederjacke waren offenbar gewählt, um ihr Übergewicht zu betonen. Sie hatte das schwerfällig Draufgängerische ihres Vaters, dachte Joyce nicht zum ersten Mal, allerdings fehlte ihr sein Charme.
Endlich saßen sie im Taxi, einem schwarzen Mercedes, der ihnen so perfekt passte wie ein orthopädischer Stiefel. Sieht man heute gar nicht mehr – all diese Opfer der Polio-Epidemien nach dem Krieg sind inzwischen erwachsen geworden – gestorben, nehme ich an. Als der Wagen anfuhr, schimpfte Joyce mit sich selbst. Hör auf, Isobel zu kritisieren: Für sie ist es schwerer als für dich, sie ist nämlich nicht wie du. Sie muss allein wieder nach Hause fliegen – und es wartet auf sie kein Zuhause, kein richtiges jedenfalls. Kein Freund – auch kein Liebhaber. Was macht sie nur aus ihrem Leben? Irgendein Fotoprojekt – eine Installation, so nennt sie es. Merkwürdiger Ausdruck, eher militärisch als künstlerisch.
Neue Birchstrasse. Glattalbahn. Flughofstrasse. Schon die Wörter auf den Schildern – pummelige Vokale, klobige Konsonanten – wirkten schwerfällig. Die Wohnblöcke und Fabrikhallen, die die Straße säumten, waren dick wie der Stiernacken des Taxifahrers.
Isobel hatte ihrer Mutter erzählt, dass sie in Soho, London, den Inhalt einiger Zimmer, die Jahrzehnte zuvor verschlossen und versiegelt sich selbst überlassen worden waren, minuziös fotografierte. Mit steigender Begeisterung hatte sie von dem verlassenen Büro eines Mr Vogel berichtet, das mit Hektographen, Stempeln, Schreibmaschinen und jeder Art von Bürogerät aus den Fünfzigerjahren – und sogar früher – vollgestellt war, alles noch in Originalkartons.
Joyce hatte nickend zugehört und einige ermutigende Geräusche von sich gegeben, als Isobel erklärte, dass sie ein visuelles Inventar von Objekten herstelle, die in gewisser Weise der Zeit getrotzt hätten. Tatsächlich dachte ihre Mutter, dass das bestimmt keine Arbeit war – und erst recht keine Kunst, sondern Unsinn, eine Art Spiel, dem das längst erwachsene Mädchen frönte, eine Leidenschaft, der verschiedene öffentliche Institutionen – Universitäten, Stadtverwaltungen, Büchereien – gern Vorschub leisteten, indem sie sie durch Zuschüsse unterstützten.
Christus, erbarme dich unser! Wie unfassbar langweilig: das Eintauchen der Unterführung unter den Buckel eines baumbestandenen Hügels.
Als sich Joyce oben im Himmel in lächerlicher Weise vor dem Sterben gefürchtet hatte – und dabei nicht eine Sekunde lang über das Platzen all der anderen Gedankenblasenwelten nachgedacht hatte, die doch alle ebenso zerbrechlich und vollständig waren, ja die jeweils die Vollständigkeit aller anderen prachtvoll widerspiegelten –, hatte die Angst die Banalität ihres eigenen ordnungsgemäß verabreichten Todes ausgelöscht, eine Alltäglichkeit, die sie nun ganz einhüllte wie der kalte, schmutzige Schnee, der den Straßenrand bedeckte.
Isobel nahm ihr Handy und schaltete es ein, und Joyce rief aus: »Bitte, Isobel, wir hatten uns doch geeinigt –«
»Ich wollte nur schauen, ob es geht, Mama«, sagte sie einigermaßen gefasst, bevor ihre von Rührung bewegte Stimme die Tonleiter hinaufstieg: »Ich. Muss vielleicht. Mal anrufen – nachher. Morgen. Du weißt ja«, um am Ende den höchsten Ton der Tränen zu treffen. Isobel war plötzlich wieder ein kleines Mädchen, sie saß im Schlafzimmer auf dem Boden, überwältigt von einer kolossalen Trauer, die durch die geringfügigste Verschiebung eines Tableaus winziger Püppchen verursacht worden war. Und so kam sie näher – oder vielmehr, Joyce rückte ihr ein kleines Stück entgegen. Aus dem Schatten ihres eigenen Todes kroch sie in das fahle Sonnenlicht der Liebe zu der Tochter, die sie getragen und ertragen hatte.
Die beiden Frauen lagen sich in den Armen, sie weinten, ohne vom Vorankommen des Mercedes Notiz zu nehmen, der zwischen prächtigen Villen, dann Wohnblöcken, dann dem grünen Farbklecks des Universitätsgeländes den Hang hinabrauschte. Eine Straßenbahn klingel-tingel-brauste in Gegenrichtung vorbei, rechter Hand erstrahlte die Limmat in demselben Züngeln, das auch auf den Kuppeln, Kirchen und Türmen der Zürcher Altstadt spielte.
Joyce hatte – so wie man es ihr beigebracht hatte – eine Auswahl der relevanten Fachliteratur gelesen. Der Leberkrebs und das unmittelbare Bevorstehen des Todes selbst würden, so hatte sie erfahren, ihre gesamten Kräfte in Anspruch nehmen. Die Alltagswelt würde beinahe angenehm in den Hintergrund treten, Milchlieferungen und Steuererklärungen würden nun, da die wichtigsten Unbekannten auf der Schwelle zum Bekannten standen, wie metaphysische Abstraktionen auf sie wirken.
Und doch … und doch war es überhaupt nicht so gekommen. Zwar hatte sie sich tatsächlich in der weiten Soutane des Todes, ihrem schweren und unsichtbaren Faltenwurf verfangen – um nicht zu sagen verirrt –, doch gab es vor dem Trivialen, dem Hässlichen, dem Banalen kein Entkommen.
Noch in Birmingham hatten sie über das Hotel gestritten. Isobel wollte ein Vier-Sterne-Hotel mit allem Drum und Dran, während Joyce für Schlichteres plädierte: nicht etwa, weil sie sich etwas versagen wollte – warum auch? –, sondern weil sie selbst in dieser späten Lebensstunde ihrer Tochter noch eine letzte Moralpredigt über die Tugend der Sparsamkeit halten wollte.
»Aber warum, Mama? Warum willst du die Nacht in einer dreckigen kleinen Pension verbringen?« Isobel hatte am Computer gesessen, der in dem engen Zimmer, in dem ihr Vater gearbeitet hatte, auf einem Rollschreibtisch stand. »Das hier«, sie tipp-pingte auf den Bildschirm, »soll sehr hübsch sein –«
»Hübsch?«
»Na ja, stilvoll.«
Stilvoll. Joyce verzog das Gesicht. Sie verstand sehr wohl, dass das alles für ihre Tochter schwer war, aber musste sie denn jedes einzelne Detail selbst planen? Das Vorzimmer des Todes zu reservieren war eigentlich nur ein geringfügiges Organisationsproblem, doch Joyce ahnte, dass sich im psychischen Hinterland ihrer Tochter ein Büroraum an den anderen reihte, ausnahmslos belegt von inkompetenten, ihre Zeit absitzenden Leuten, von denen nicht ein einziger den Mumm gehabt hätte, auch nur eine Tonerkassette für den Kopierer zu bestellen, hätte nicht Joyce sich so beflissentlich um alles gekümmert.
Es galt, Phillimores Gutachten zu besorgen und Joyces Geburtsurkunde. Es gab die ersten Anrufe in die Schweiz, gefolgt vom Hin-und-her der E-Mails, die Termine und Einzelheiten betreffend. Als Nächstes mussten die Hausbesuche arrangiert werden. Ausgebildete Hospizschwestern kamen, um den aus der Ferne gelenkten Prozess zu begleiten. Sie bezeichneten sich als »Suizidassistentinnen«, was Joyce als typisch schweizerische Sachlichkeit verbuchte. All dies erledigte Joyce selbst. Insgeheim wussten beide, dass Isobel sich als völlig unfähig erweisen würde, wenn sie es zu lange liegen ließe.
Die erste Diagnose hatte Joyce im September des Vorjahres bekommen, und kurz vor Weihnachten gab man ihr noch sechs Monate. Was für ein Geschenk. Und zwar eines, das nur widerwillig herausgerückt wurde, von Phillimore, in einer Weise, die, so mutmaßte sie, wohl als Kompliment für ihr nüchternes Gebaren gedacht war. »Jo, selbst mit einer weiteren Chemo sind fünfzig Prozent der Leute mit diesem Krebs innerhalb von sechs Monaten tot.« Jo! Jo! Der Mann hat vielleicht Nerven. Was für ein Geschenk. Ein bisschen Zeit. Keine Hoffnung.
Jetzt war es schon März, und Joyce fühlte sich nicht allzu schlecht. Unter anderen, leichter zu delegierenden Umständen hätte sie vielleicht noch bis in den Frühling verweilen können, um zu erleben, wie die Blumenzwiebeln sprössen, die sie – auf Knien, wie zum Gebet, die Hände in der wurmigen Erde gefaltet – gesetzt hatte. Sie hätte verweilen können, bis die Kirschblüten die Vorstadt aufhübschten, bis Scoresbys – und ihr eigenes – Requiem in der Konzerthalle aufgeführt würde. Kyrie eleison.
Hätte sie vielleicht – wenn sie nicht in ihrem Leben genügend Krebskranke gesehen hätte, um zu wissen, wie schrecklich die schleichende Normalität des Endstadiums war: Selbst wenn ihnen der schwarze Abgrund deutlich vor Augen stand, war da immer noch dieses Glas, das man gleich oder später austrinken konnte; und sie ließen es stehen und schoben es vor sich her – und dann war es irgendwann zu spät.
Hätte sie vielleicht – wenn sie nicht genug berufliche Erfahrungen mit Ärzten gesammelt hätte, die nichts anderes taten, als den Tod mit überflüssigem Mobiliar auszustatten, mit Bücherregalen an den irdenen Wänden des Kaninchenbaus, in den man unweigerlich hineinrutschte. Und die Möglichkeiten der Therapie – gab es denn welche? Sie waren nichts als ein Marmeladenglas, im Sturz geschnappt, das einem sofort wieder entglitt.
Hätte sie vielleicht – wenn Isobel nicht außerstande gewesen wäre, einen Antrag ordentlich auszufüllen: Sie brachte die Stipendienunterlagen – und ihre Wäsche – zu Mutti nach Hause.
Joyce stand auf dem Kopfsteinpflaster des Rennwegs vor dem Hotel Widder und spürte den kalten Schmirgel ihrer verschmutzten Unterwäsche, als sie plötzlich Mitleid bekam mit dem pummeligen Ding, das gerade mit siennabraunen Franken den Taxifahrer bezahlte, Isobel, die ihre Mutter gern überzeugt hätte, dass sie in London ein aufregendes Künstlerleben führte, deren atemlose Berichte von langen Nächten im Plantation Club aber auf skeptische Ohren stießen: »Und Trouget, also, der war sozusagen der Geist, der über allem schwebte, also, jahrelang … bis er gestorben ist.«
Weihnachten vor einem Jahr hatte sie Hilary mitgebracht, den Besitzer des Clubs, der zwar nicht so intersexuell war wie sein Name, aber eindeutig eine Tunte. Er trank einen guten Teil des Brandys, ohne an Höflichkeit nachzulassen. Isobel, die ihn anhimmelte, erledigte den Rest.
Dann hatte Hilary im Gästezimmer ins Bett gemacht. Als Joyce am zweiten Weihnachtstag um sechs Uhr morgens in die Waschküche kam, fand sie Isobel vor, die mit einem Schwamm die Matratze bearbeitete, während sich die Maschine an der Bettwäsche abrackerte. »Warum?«, fragte ihre Mutter. »Warum kannst du das nicht für dich selbst auch machen?«
Diese bitteren Grübeleien beschäftigten Joyce, als ihre Tochter die Formalitäten des Check-ins vollzog: Sie zückte die Kreditkarte ihrer Mutter, übertrug die Passnummern. Der Rezeptionist war keineswegs ein streng dreinblickender Alpinist, sondern ein bleichgesichtiger Kumpel mit schwarzem Haar. Als er einen kurzen Blick auf Joyce warf, um ihre Existenz zu bestätigen, dachte sie, er weiß Bescheid – seine fahle Haut sprach zu ihrer gelbsüchtigen wie der Herrgott zu seinem Volk.
Das Hotel Widder bestand aus mehreren Altbauten auf einem terrassierten Hang, die die Architekten, gerüstet mit Stahlträgern und schachbrettartigen Marmorplatten, über Durchbrüche miteinander verbunden hatten. Die Flure, Wandelpfade eigentlich, führten durch verglaste Zysten, an deren Sockeln unter dem Licht von Punktstrahlern Mauerreste konserviert wurden. Stilvoll. Isobels Absätze klapperten, sie lenkte ihre Mutter hierhin und dorthin, sie lehnte die Hilfe des Kofferträgers ab und verirrte sich ein wenig auf der Suche nach dem Aufzug.
Joyces stilvoll eingerichtetes Zimmer war kühl und trotzdem muffig. Zur Straße hin befanden sich vier breite Fenster, die gegenüberliegende Wand bestand aus hellen Holzschränken, Glastüren und verspiegelten Ablagen. Inmitten der Sitzgruppe am Ende des langen, gedrungenen Zimmers glänzte die Pfütze eines verspiegelten Couchtischs. Der ebenfalls verspiegelte Schreibtisch, ein stufiges Wasserspiel, befand sich in der Mitte des Zimmers, dahinter stand das weiße Bett mit ebenfalls verspiegeltem Kopfende. Zimmer 107, ausgestattet mit einer Menge unpersönlicher Grabbeigaben – Schokolade, Wein, Obst und Blumen –, war die grausamste Kiste, die man sich für seine letzte, einsame Nacht vorstellen konnte.