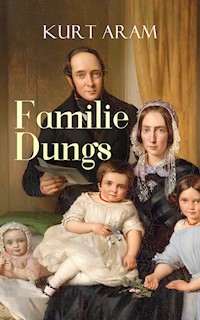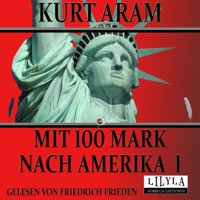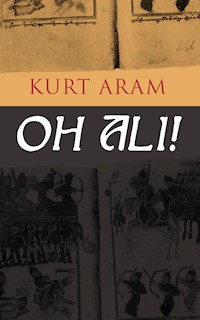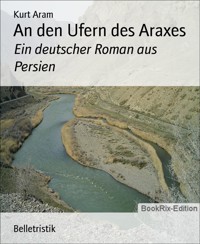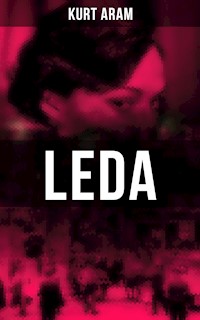
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Kurt Arams Roman "Leda" taucht der Leser in eine Welt voller Intrigen, Leidenschaft und unerwarteter Wendungen ein. Die Geschichte folgt Leda, einer jungen Frau aus einfachen Verhältnissen, die in die Welt der Reichen und Mächtigen gezogen wird. Dabei wird sie mit Liebe, Verrat und Machtspielchen konfrontiert. Aram's literarischer Stil ist geprägt von einer detaillierten Beschreibung der Charaktere und ihrer Beweggründe, was dem Leser ermöglicht, tief in die Psyche der Protagonisten einzutauchen. Der Roman spielt mit moralischen Ambivalenzen und lässt den Leser über die Grenzen von Gut und Böse nachdenken. Kurt Aram, selbst ein Meister der psychologischen Literaturanalyse, hat mit "Leda" ein Werk geschaffen, das sowohl Unterhaltung als auch tiefgründige Einblicke in die menschliche Natur bietet. Seine Erfahrung als Psychologe spiegelt sich in der Glaubwürdigkeit der Charaktere und ihrer Handlungen wider. Aram ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe Beziehungen und emotionale Tiefen in seinen Werken darzustellen, und "Leda" ist keine Ausnahme. "Leda" ist ein Buch für Leser, die sich von fesselnden Geschichten und rätselhaften Charakteren angezogen fühlen. Aram schafft es, die Spannung konstant aufrechtzuerhalten und den Leser bis zur letzten Seite gefesselt zu halten. Für Liebhaber psychologischer Romane ist "Leda" ein absolutes Muss, das nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leda
Books
Inhaltsverzeichnis
I.
Das »Herein« des Gastes, vor dem sich der Pikkolo sowieso schon ein wenig ängstigte, klang so laut und energisch, daß der Kleine fast ins Zimmer fiel.
Der Pikkolo sprach kein Deutsch, was ihn erst recht verlegen machte. Er stammelte unter vielen Gesten: » Gospoda, avtomobil tuka!«
» Dobré, dobré!« rief Friedrich Franz, zum Ausgehen bereit.
Der Pikkolo verschwand. Friedrich Franz warf durchs Fenster noch einen Blick auf den klaren, hellblauen Himmel, der einen guten Jagdtag verhieß, griff zur Büchse und lächelte in sich hinein.
Gestern abend nach dem Festessen hatte es ein gewaltiges Trinken gegeben. Die Mazedonier hatten dem Deutschen dadurch offenbar gefallen wollen. Infolge des Trinkens war es zu ungewöhnlichen Offenherzigkeiten gekommen. Peter Karakinow hatte ihn in eine Ecke gezogen und mit ein wenig schwerer Zunge zu erklären versucht, es sei doch noch nicht so ganz sicher, ob das Auto für den Jagdausflug heute zur Verfügung stehen würde. Es sei in der Nacht, so gegen Morgen, mit seiner Hilfe zuvor noch ein dringendes Geschäft zu erledigen, von dem man nicht voraussagen könne, wieviel Zeit es in Anspruch nähme. Auch handle es sich um eine nicht ganz einfache Arbeit, die den Chauffeur vielleicht etwas überanstrenge. Weitere Andeutungen, wenn sie auch mit einiger Zurückhaltung gemacht wurden, ließen Friedrich Franz vermuten, es handle sich darum, einen mazedonischen Feind noch in dieser Nacht zu beseitigen. Man wollte ihn vermutlich in dem Auto an irgendeinen entlegenen Ort bringen und den Mann dort stumm machen.
Nun war das Auto doch zur Stelle. Vielleicht hatte man die Beseitigung des Menschen verschoben? Friedrich Franz gestand sich, daß ihm das recht sympathisch gewesen wäre, obwohl man sich ja auf dem Balkan an einiges gewöhnen mußte, und er von Afrika her schon an einiges gewöhnt war.
Friedrich Franz von Kaufmann setzte seinen grünen Jagdhut auf und verließ das Zimmer.
Peter Karakinow kam ihm schon auf der halben Treppe entgegen. Die beiden begrüßten sich wie alte Freunde, obwohl sie sich noch nicht lange kannten. Sieht dieser Karakinow wirklich noch bleicher aus als gewöhnlich, ober bilde ich mir das nur ein? ging es Friedrich Franz durch den Kopf.
Sie traten zu dem geschlossenen Militärauto, dessen Wagenschlag der Chauffeur in der kleidsamen Tracht des bulgarischen Soldaten eilig aufriß.
Friedrich Franz kam es vor, als sähe der Chauffeur geradezu grüngelb aus. Auch schien der stramme junge Kerl etwas wackelig auf den Beinen zu sein.
»Er hat die Nacht durchgesoffen«, sagte Peter Karakinow ärgerlich. »Wir werden Geduld mit ihm haben müssen, bis er wieder ganz nüchtern ist.«
Soso, durchgesoffen nennt man das, dachte Friedrich Franz.
»Wir sind ja im allgemeinen wirklich ein nüchternes Volk«, meinte Peter Karakinow. »Um so schlimmer, wenn dann einer doch mal über die Stränge schlägt.«
Wie eindringlich dieser Mazedonier mit seinen scharfen schwarzen Augen das Gesicht des Deutschen absuchte.
»Ich bitte Sie, wir haben ja Zeit, das schadet doch nichts, er wird schon wieder nüchtern werden«, meinte Friedrich Franz, ohne eine Miene zu verziehen, und lehnte sich mit möglichst sichtbarem Behagen bequem zurück, obwohl es ihm schien, als befände sich gerade vor seinen Füßen ein Fleck, der sehr wohl von Blut herrühren konnte. Vielleicht hatte sich der Mann in der Nacht auf dem Transport in die Einsamkeit zur Wehr gesetzt, und man hatte sich genötigt gesehen, ihm die Fahrt ins Ungewisse durch einen kleinen Dolchstoß zu erleichtern, was ja nur selten ganz ohne Flecken abgeht, zumal in einem Auto, dessen Inneres erst kürzlich neu mit einem zarten grauen Stoff überzogen worden ist.
»Schöner Tag!« sagte Peter Karakinow und breitete eine Decke über des Gastes und seine Füße. Der Fleck war jetzt nicht mehr zu sehen.
Das Auto setzte sich in Bewegung, der Chauffeur riß es gleich zur höchsten Geschwindigkeit zusammen. Es fegte im Wettrenntempo über die Zar-Befreier-Straße am Ministerium des Äußeren, an der Sobranje vorbei dem Borispark zu. Es war noch früh am Tag, wenig Fuhrwerk, wenig Menschen auf der breiten Straße, der Prunkstraße Sofias.
»Ich freue mich, daß Ihnen der gestrige Abend gut bekommen ist,« sagte Peter Karakinow, »bei mir hat er einen leichten Kopfschmerz hinterlassen.«
»Da hätten wir den Ausflug vielleicht besser um einen Tag verschoben?«
»Aber durchaus nicht,« wehrte der Mazedonier, »nicht der Rede wert?«
»Mäßigen wir wenigstens das Tempo ein wenig. So eilig haben wir es wohl nicht.«
Sofort rief Peter Karakinow durch das Sprachrohr dem Chauffeur etwas zu. Dieser riß die Übersetzung zurück, daß der Wagen wie ein Strangulierter zusammenzuckte und dann langsamer fuhr.
»Es ist noch früh, ruhen wir noch ein wenig«, schlug Friedrich Franz vor. Worüber sollte man sich jetzt schon unterhalten? Peter Karakinow kam ihm plötzlich sehr fremd und fern vor.
Die beiden Herren machten es sich in ihren Ecken möglichst bequem und blinzelten zwischen halb geschlossenen Augen ein wenig übernächtig durch die geöffneten Fenster.
Die Luft war warm. Man befand sich zwar erst im März, aber es würde wohl ein recht heißer Tag werden. Die spärlichen Bäume zur Rechten schimmerten grün, auch das Ackerland zur Linken zeigte schon einen grünlichen Hauch.
Peter Karakinow fielen vollends die Augen zu. Der Mann hat sicherlich die ganze Nacht nicht geschlafen, dachte Friedrich Franz und schloß ebenfalls die Augen.
Nach einer Weile fuhr er auf. Er glaubte Schreie gehört zu haben.
»Fehlt Ihnen etwas?« fragte der Mazedonier, ohne seine Stellung zu verändern, und blinzelte den Genossen der Fahrt träge aus halbgeschlossenen Augen an.
»Ich habe geträumt, nichts weiter«, antwortete Friedrich Franz und sah eifrig zum Fenster hinaus.
Die Fahrt ging zwischen halbzerfallenen Lehmhütten dahin, vor denen halbnackte Kinder spielten.
»Gleich kommen wir ins Iskertal«, sagte Peter Karakinow und schloß die Augen wieder völlig.
Es ging bergan. Wie ein schmales kreideweißes Band schob sich die Straße zwischen die kahlen, hohen, grauen Berge, zwischen denen nur noch für den Isker Platz war, der seine kalten, klaren, schäumenden Gewässer zu Tal führte. Über dem Wasser flatterten kleine Krähenschwärme, deren Krächzen trotz des Autos zu hören war. Hoch oben im Himmelsblau spähte ein Geier. Recht wild, recht romantisch, sehr einsam, dachte Friedrich Franz und suchte mit den Blicken das niedrige dornige Gestrüpp ab, das den Weg zur Rechten einfaßte.
Wie eine Schlange begann das kreideweiße Band der Straße sich zwischen den Bergen nach rechts und links, auf und ab zu winden. Auf ihrem Rücken wand sich das Auto nach rechts und links, auf und ab. Es ächzte und stöhnte. Das Vorwärtskommen wurde ihm nicht leicht gemacht.
Plötzlich hielt der Wagen. Der Chauffeur sah seinen Herrn an. Peter Karakinow, der bis jetzt mit geschlossenen Augen in seiner Ecke gelegen hatte, fuhr auf und spähte nach rechts und links.
»Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, wir sind gleich wieder da.«
Schon war er aus dem Wagen gesprungen und mit dem Chauffeur in einem Dornendickicht zur Linken, das herab zum Isker führte, verschwunden.
Hier irgendwo haben sie den Feind in der Nacht stumm gemacht, schoß es Friedrich Franz durch den Kopf. Aber er blieb ruhig sitzen und beugte sich auch nicht zum Fenster hinaus, den beiden nachzublicken. Der Mazedonier wünschte nicht, an seine Offenherzigkeit von gestern erinnert zu werden. Er bereute sie offenbar. Also stellte sich Friedrich Franz auch weiterhin dumm und uninteressiert. Schließlich ging ihn die Geschichte ja auch direkt nichts an. Er wollte heute eine Gemse schießen oder einem Bären auf die Spur kommen, schlimmsten Falls begnügte er sich auch mit einem Wolf.
Der Isker rauschte, die Krähen krächzten. Sonst kein Laut ringsum. Um einen Feind beiseitezuschaffen, sicherlich ein recht geeigneter Ort. Und wenn man den Toten dann in den schnell dahinschießenden Isker warf, war alles geräuschlos und spurlos erledigt.
Nach kurzer Zeit kam Peter Karakinow mit dem Chauffeur zurück. Beide nahmen ihre Plätze wieder ein. Das Auto fuhr langsam weiter.
»Es war nichts,« sagte der Mazedonier, »Joseph ist immer noch nicht nüchtern, er behauptete steif und fest, zwei Serben seien durch die Büsche zum Isker geschlichen. Der Kerl halluziniert. Von Serben war keine Spur zu finden.«
»Wie sollten die auch hierherkommen?« meinte Friedrich Franz. Der Mazedonier lächelte. »Bei uns herrscht leider noch nicht die Ordnung und Disziplin wie in Deutschland. Bei Ihnen kommt es kaum vor, daß Kriegsgefangene entwischen, bei uns schon etwas häufiger, überall hier in den Bergen sollen sich Serben in kleinen Trupps herumtreiben, namentlich im Rilogebirge. Sogar Waffen haben sie.«
Friedrich Franz erwiderte nichts, dachte aber: von alledem glaube ich kein Wort. Die beiden haben nur nachsehen wollen, ob die Tat von gestern nacht nicht doch noch irgendeine Spur zurückgelassen hat.
Immer wilder, immer zerklüfteter wurden die Berge, immer schmaler und gewundener der Weg. Zwei Autos hätten kaum noch ohne Gefahr aneinander vorbeifahren können. Für Räuber eine sehr angenehme Gegend. Nur wenige Stunden von der Hauptstadt entfernt.
»Was macht man eigentlich, wenn ein Fuhrwerk entgegenkommt?« fragt Friedrich Franz interessiert.
»Ist es ein Bauer, muß er zurück bis zur nächsten, etwas breiteren Stelle. Ist es ein Auto, so kommt es darauf an, in welchem Wagen die entschlosseneren Leute sitzen.«
»Wenn nun aber gerade bei der Biegung da vorn in dem Augenblick, wo wir sie erreichen, ein Fuhrwerk uns entgegenkäme?«
»Das wäre eben Pech«, erwiderte der Mazedonier lakonisch. »Wär's ein Bauernfuhrwerk, müßte es die Böschung hinunter. Was von ihm dann noch übrigbliebe, ist nicht zweifelhaft. Wär's ein Auto, so käme es nur darauf an, welches von beiden der bessere Wagen ist. Die Insassen des andern hätten schwerlich viel zu lachen.«
Der Chauffeur hielt wieder an und lauschte. Der Mazedonier war schon wieder aus dem Wagen. Nun hörte auch Friedrich Franz den scharfen Knall von Schüssen. Immer wieder, immer schneller einander folgend.
Die beiden Jäger griffen zu den Büchsen. Das Gesicht des Mazedoniers strahlte. Der Chauffeur hatte plötzlich eine neue Mauserpistole in der Hand und schloß sich seinem Herrn an, der in Sprüngen vorwärts eilte.
Nach zwei Windungen der Straße erblickten die drei ein Auto. Der Fahrer, ein deutscher Soldat, saß seelenruhig auf seinem Sitz und rauchte eine Zigarre. Im Wagen selbst stand aufrecht eine Dame und blickte in die Richtung, von wo die Schüsse fielen. Sie kamen aus einem dichten Gestrüpp, aus dem man leichten Pulverrauch aufsteigen sah.
Die drei waren nur noch wenige Schritte von dem Auto entfernt, da stürzte aus dem Gebüsch ein deutscher Leutnant, immer noch nach einer bestimmten Stelle in dem Gestrüpp feuernd, und brüllte, als er den seelenruhig rauchenden Soldaten sah: »Du Heuochse, weshalb hast du denn immer noch nicht gewendet?«
Ehe der Soldat erwidern konnte, sprangen zwei weitere Leutnants aus dem Gestrüpp und eilten auf die Dame zu, die immer noch aufrecht im Wagen stand.
»Sind Sie nun zufriedengestellt, gnädiges Fräulein?« rief der eine.
»Ja, vollkommen«, lautete die Antwort.
Da sprangen die beiden Leutnants in den Wagen und begannen zu lachen, daß ihnen die Tränen über die gebräunten Wangen liefen. Auch das Gesicht des Soldaten verzog sich zu einem breiten Grinsen.
»Was soll denn das heißen?« rief der erste Leutnant verdutzt und hörte endlich auf, in das Gebüsch zu feuern.
Die beiden Kameraden konnten ihm vor Lachen immer noch keine Antwort geben.
Da verließ die junge Dame das Auto, trat zu dem Verdutzten und sagte: »Seien Sie mir nicht gar zu böse, ich will ihnen alles erklären.«
Auf einen Wink der jungen Dame folgte ihr der Leutnant. Sie schritt eilig aus, um außer Hörweite zu kommen.
Der eine der beiden Leutnants im Wagen hatte sich soweit wieder von seinem Lachen erholt, daß er rufen konnte: »Grüß Gott, Herr von Kaufmann, und Gospodin Karakinow, machen Sie nicht ein so blutgieriges Gesicht, es handelt sich nur um einen Scherz.«
Peter Karakinow rief seinem Chauffeur zu, er solle zu dem Auto zurückkehren. Die Herren schüttelten einander die Hand.
»Sehen Sie, der kleine Gonthard, unser Jüngster, schießt etwas zu üppig ins Kraut, seitdem ihm drei Rippen fehlen und er nolens volens Etappenschwein hat werden müssen. Nun macht er auch noch Fräulein Petrow die Kur und kommt gar nicht mehr los von all seinen Heldentaten, die er verübt, als er noch um drei Rippen reicher in Frankreich stand. Da wollten wir seine Tapferkeit mal auf die Probe stellen und luden Fräulein Petrow als Zeugin ein. Wir sattelten also unser Auto zur wildromantischen Fahrt ins Iskertal, allwo ja Serbenbanden rudelweise hausen sollen. Wir haben dem Kleinen mit Räubergeschichten auf der Fahrt nicht schlecht eingeheizt. Es dauerte gar nicht lange, da war er soweit, hinter jedem Strauch einen mordgierigen Serben zu wittern. Es war oft nicht leicht, ernst zu bleiben, wenn er alle paar Augenblicke mutige Augen kriegte. Es stand ihm gut, dem hübschen Jungen, und die Petrowa schien das auch zu finden, was durchaus nicht so ohne weiteres unseren Wünschen entsprach ... Na, vielleicht fiel dem Kleinen das Herzchen doch noch in die Hosen, wenn die Sache sich etwas ernster anließ. Wir also rein ins Gestrüpp, angeblich hinter mordgierigen Serben her, und damit die Sache ein ernsthafteres Gesicht bekam, lief der Kamerad voraus und markierte unter einem fernen Strauch, wo es am dunkelsten war, mit viel Gebrüll und Schießerei eine Serbenbande. Unser Kleiner ging wie der Teufel los, galt es doch auch die Petrowa zu schützen. Es entwickelte sich eine so üppige Schießerei, daß sie sogar Gospodin Karakinow herlockte.«
»Wird Leutnant Gonthard die Sache nicht gewaltig übelnehmen, wenn er die Wahrheit erfährt?« meinte Friedrich Franz ein wenig bedenklich.
»Ach was, so zimperlich sind wir nicht mehr. Außerdem haben wir ihm ja gegen unsern Willen zu einem wahren Triumph bei der Petrowa verholfen.«
Die junge Dame kam langsam wieder näher, Leutnant Gonthard ein wenig zögernd hinterdrein. Sein hübsches Knabengesicht war ein wenig blaß. Er biß sich die Lippen, und seine blauen Augen warfen stahlharte Blicke nach den Kameraden, die ihm schnell entgegengingen.
»Nicht die alte Jungfer spielen und beleidigt tun, Gonthard. Das steht Ihnen gar nicht.«
»Seien Sie brav, Gonthard, und gescheit. Es war nicht bös gemeint. Wenn Sie Wert darauf legen, entschuldige ich mich hiermit sogar in aller Form und Feierlichkeit, daß ich Sie aufs Glatteis locken wollte, und nun bin ich eigentlich selber der Blamierte, nicht wahr, mein gnädiges Fräulein?«
Maria Petrowa lächelte dem jüngsten Leutnant bittend zu.
»Sie sind ein ganzer Kerl, Gonthard, das haben wir immer gewußt, und fortan sollen Sie auch aus Ihrer Heldenbrust auskramen dürfen, was immer Ihnen Spaß macht, ohne daß ich ein schiefes Gesicht ziehe, was Sie immer so ärgert, namentlich wenn Maria Petrowa in der Nähe ist.«
»Also, Gonthard, her mit dem samtweichen Heldenpfötchen von knapp zwanzig Jahren, und darum keine Feindschaft nicht.«
»Tun Sie mir den Gefallen«, flüsterte Maria Petrowa dem jungen Menschen ins Ohr, daß es sofort rot wurde.
Das Knabengesicht heiterte sich auf. Er ließ sich die Rechte schütteln.
»Hoffentlich nehmen Sie mich in Zukunft etwas ernster«, sagte der junge Leutnant feierlich.
»Todernst, schauderhaft ernst, ganz wie Sie befehlen, Gonthard! Verlassen Sie sich darauf.«
Nun war der Friede wiederhergestellt. Das Auto Krakinows näherte sich. Man plauderte noch einen Augenblick und verabschiedete sich dann voneinander.
Etwas mehr kann man in der nächsten Nähe Sofias schon erleben als etwa in der Nähe Berlins, dachte Friedrich Franz, und in diesem weltverlassenen Iskertal scheint es mehr Autos zu geben als in der immer noch recht bevölkerten Hauptstadt des Deutschen Reiches.
»Das gefällt mir sehr an den deutschen Herren«, meinte Peter Karakinow. »Immer vergnügt, immer zu einem Scherz aufgelegt, ohne Spur von Angst, und diese Offenheit zueinander, und sie nehmen es einander nicht ernstlich übel, weil es ja nie übel gemeint ist. Oder haben Sie andere Beobachtungen gemacht, Herr von Kaufmann?«
»Durchaus nicht, Herr Karakinow, immer dieselben, genau wie Sie.« Ich werde mich hüten und ihm den Gefallen tun und kritisieren und nörgeln, wie es gute deutsche Art ist, dachte Friedrich Franz. Nein, mein Junge, so töricht bin ich schon lange nicht mehr. Und wenn ihr mal über Bulgarien schimpft, wollt ihr von uns ja auch keine Zustimmung, sondern das Gegenteil. Wir sollen Bulgarien noch viel vollkommener finden als ihr selbst. Das wollt ihr hören, dann gefallen wir euch, solche Bundesgenossen mögt ihr leiden.
Peter Karakinow sah nach der Uhr. »Frühstücken wir ein wenig. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte des Weges. Noch anderthalb Stunden Fahrt, dann eine Stunde zu Fuß, und wir sind bei meiner Waldhütte. Ich habe übrigens eine böhmische Köchin dort, und wir können ganz gut über Nacht bleiben.«
Der Wagen hielt, der Chauffeur schnallte einen Korb mit Eßwaren los, breitete den Herren ein weißes Tuch über die Knie, entkorkte eine Flasche Sekt und servierte Brot, Butter, kaltes Fleisch und Käse.
Es schmeckte den beiden nach den Anstrengungen der Nacht vortrefflich. Sogar der französische Sekt war trotz der Wärme des Morgens noch trinkbar, da die Flasche, in nasse Tücher eingehüllt, neben dem Chauffeur im Wind gehängt hatte.
Plötzlich hörte man in weiter Ferne wieder einen Schuß.
»Ein Jäger?« fragte Friedrich Franz.
»Bestenfalls ein Wilddieb«, erwiderte der Mazedonier und lauschte.
Wieder fiel ein Schuß. Dann zwei, drei kurz hintereinander.
»Weder ein Jäger noch ein Wilddieb«, sagte Peter Karakinow, griff zur Büchse und verließ das Auto. Der Chauffeur mit der Mauserpistole trat wieder hinter ihn.
»Vermutlich wieder ein Scherz?« meinte Friedrich Franz, griff ebenfalls zur Büchse und kletterte aus dem Auto.
Die drei standen eine Weile unschlüssig und lauschten.
Da kletterte der Chauffeur mit großer Gewandtheit auf eine alte Kiefer, die einsam in der Nähe stand. Nach einer Weile rief er seinem Herrn etwas zu.
»Joseph behauptet, Hilferufe zu hören. Wenn er diesmal wieder phantasiert, gibt es Prügel.«
Der Chauffeur sprang wieder zur Erde und blieb dabei, er habe Hilferufe gehört.
Friedrich Franz wollte vorwärts stürmen, aber der Mazedonier hielt ihn zurück. »Fahren wir noch eine Weile weiter. Wir kommen schneller vorwärts und sparen unsere Kräfte.«
Man fuhr schleunigst weiter, hielt, lauschte und fuhr wieder weiter.
»Es scheint nichts von Belang zu sein«, meinte Friedrich Franz und legte die Büchse wieder beiseite. Nachgerade kamen ihm die Ereignisse dieses Morgens etwas komisch vor.
Peter Karakinow zischte durch das Sprachrohr dem Chauffeur etwas zu. »Wenn es diesmal wieder nichts ist, setzt es wirklich Hiebe!«
Der Wagen stürmte vorwärts um eine Wegbiegung herum, tat einen wilden Satz und blieb zitternd stehen.
Nur wenige Schritte wegaufwärts lag ein Auto, das sich fast überschlagen hatte und jeden Augenblick über die Böschung stürzen konnte.
Mit äußerster Anstrengung gelang es den dreien, den Wagen davor zu bewahren. Die Fenster waren zertrümmert, das ganze Untergestell verbogen, das Innere des Wagens war leer.
»Ein regelrechter Überfall,« meinte der Mazedonier, »mit den altgewohnten Mitteln. Sehn Sie hier den dicken Baumstamm, geknickt wie ein Streichholz? Man hat ihn quer über den Weg gelegt, wahrscheinlich etwas erhöht, vor diese beiden Felsspitzen. Eine richtige Autofalle!«
»Keine Menschen, keine Blutspur, nichts dergleichen!« stieß Friedrich Franz hervor.
Der Mazedonier lächelte dünn. »Die Räuber hierzulande sind weniger mord- als geldgierig. Man wird die Insassen des Wagens fortgeschleppt haben und versuchen, von den Angehörigen eine möglichst runde Summe für die Freigabe der Gefangenen als Lösegeld zu erlangen.«
»Sehr weit können die Räuber mit ihrer Beute noch nicht sein«, meinte Friedrich Franz und suchte den Boden und die nächste Umgebung nach Fußspuren ab. Der Chauffeur tat einen leisen Pfiff und deutete auf ein gelbes Stückchen Seide, das an einem Dornenstrauch hing.
»Ein Stückchen von einem Schal, wie ihn Damen gern bei einer Autofahrt tragen«, sagte Peter Karakinow und prüfte die Seide zwischen den Fingern. »Wohlhabende Leute«, meinte er dann.
Der Chauffeur zwängte sich durch das Dornengestrüpp und hielt es mit seinen harten Händen so gut auseinander, als es irgend ging, damit die Herren bequem folgen konnten.
Die drei arbeiteten sich mühsam durch ein dichtes Gestrüpp bergaufwärts. Für die Jägeraugen war es ganz klar, daß hier vor noch nicht allzulanger Zeit Menschen sich durchgeschlagen hatten. Kleine geknickte Dornenzweige verrieten es. Wild war nicht so dumm, einen solchen Weg zur Flucht zu wählen.
Das Gestrüpp wurde immer dichter. Einen Augenblick hielten die drei an, holten tief Atem und lauschten.
Krähen krächzten vom Isker her, der harte häßliche Schrei eines Geiers. Sonst war nichts zu vernehmen. Der Chauffeur stampfte mit seinen schweren Soldatenstiefeln das Gestrüpp nieder, so gut es ging, und hielt das Ohr an den Boden. Er schüttelte den Kopf, es war nichts zu hören.
Die Augen des Mazedoniers funkelten nach allen Seiten.
»Hier sind sie weiter«, flüsterte er und deutete auf einen kleinen Seidenfetzen, der merkwürdig hoch an einem Strauch hing. »Jedenfalls ist ein weibliches Wesen dabei gewesen, und man hat sie auf dem Stücken oder auf den Schultern getragen.«
Die drei bohrten sich weiter durch das Gestrüpp.
Da hörten sie deutlich Hilferufe ... Eine weibliche Stimme ... Eiliger bahnten sie sich einen Weg durch das Gestrüpp und achteten nicht darauf, daß die Büsche sie wie mit Ruten peitschten, daß die Dornen ihnen Gesicht und Hände aufrissen.
Sie gelangten an eine kleine Lichtung, in deren Hintergrund etwas Weißes auf dem Boden lag.
Mit drei langen Sätzen sprang Friedrich Franz hinzu.
Ein junges Mädchen, an Armen und Füßen gefesselt, schien gerade wieder aus einer Ohnmacht zu erwachen und schlug die Augen auf, große, schwarze Augen, die wie aus einer fremden Welt auftauchten gleich zwei dunklen Segeln, die von fernen Meeren kommen.
Die schwarzen Augen tauchten in den blauen Friedrich Franzens unter, ein goldener Glanz trat aus ihnen, und von diesem Glanz breitete sich ein leises Lächeln aus und glitt über das schöne blasse Gesicht ... Zwei dunkle Segel, die von fernen Meeren kommen, wissen sich im sicheren Hafen und freuen sich.
Das dauerte mir wenige Sekunden, die Friedrich Franz sehr lange vorkamen.
Der Chauffeur sprang vor und schnitt die Stricke durch.
Peter Karakinow sagte verwundert: »Leda Serafinow, was ist geschehen?«
Leda Serafinow lächelte immer noch, öffnete langsam die befreiten Arme und richtete sich langsam, wie verwundert auf.
Wie merkwürdig getragene Bewegungen sie hat, ging es Friedrich Franz durch den Kopf, der die Augen nicht von ihr ließ, fast etwas Heroisches.
Leda Serafinow lehnte sich an einen schwächlichen Baum und berichtete Peter Karakinow. Ihre schwarzen Augen tauchten dabei immer wieder in den blauen unter, tauchten wieder auf und sahen weit und frei um sich wie geübte Schwimmer.
Friedrich Franz sah und lauschte nur.
Peter Karakinow lachte böse. »Nicht einmal bulgarische Räuber waren es, sondern serbische Banditen. Nun wird es aber wirklich Zeit, daß man das Pack ringsum einfängt und aufhängt!«
Leda Serafinow hatte mit ihrem Vater zusammen gestern ihr Landgut in der Nähe von Samakow besichtigt. Sie waren dort über Nacht geblieben, um heute morgen nach Sofia zurückzukehren. Unterwegs war ihnen die Autofalle gestellt worden. Ein wahres Wunder, daß sie mit heilen Gliedern davongekommen waren. Den Vater und den Chauffeur hatten die Banditen verschleppt, sie selbst gefesselt und an diese schwer zugängliche Stelle gelegt, damit man ihnen nicht allzubald auf die Spur kam.
Leda Serafinow zog einen Zettel aus der Tasche, auf dem die Höhe des Lösegeldes angegeben war und der Ort, wo es niederzulegen sei.
Peter Karakinow las den Zettel und fluchte in sich hinein. Die Summe war hoch und der Ort, wo sie niedergelegt werden sollte, gut gewählt.
»Aber ich und mein Mazedonier werden sie doch erwischen«, knirschte er.
»Wollen wir diesen unfreundlichen Ort nicht lieber verlassen?« fragte Leda lächelnd auf französisch Friedrich Franz von Kaufmann.
Unwillkürlich reichte er ihr den Arm. Sie nahm ihn auch.
Aber nur für wenige Schritte. Des dichten Gestrüppes wegen ging es nicht länger. Der Chauffeur und Peter Karakinow schritten voran und ebneten den Weg, so gut es sich machen ließ.
Ich bin verliebt, dachte Friedrich Franz. Kein Wunder, denn ich habe lange nicht mehr so etwas Schönes gesehen wie dieses Mädchen. Was sie für einen Gang hat! Schön und furchtlos wie eine Königin. Ich kann mir nicht helfen, es ist so, wenn ich sonst auch ein Feind von dicken Worten bin.
II.
Gospodin und Gospodscha Karakinow hatten wie jeden Donnerstag ihren Jour. Da Gospodscha Karakinow eine Rheinländerin war, die ihr Mann als junger Student der Medizin in Bonn kennengelernt hatte, wurde ihr Jour von den Deutschen besonders zahlreich besucht. Aber auch die österreichischen und ungarischen Herren, die nach Sofia abkommandiert waren, ließen es sich nicht nehmen, regelmäßig zu erscheinen, denn Peter Karakinows Haus war berühmt seiner vorzüglichen und reichhaltigen Küche wegen. Der Jour sollte zwar eigentlich nur in einem Tee mit Gebäck bestehen, aber meistens schloß sich noch ein Abendessen an; und der Tee war eigentlich nur für die Damen und die bulgarischen Herren da. Für die andern Gäste bildete er nur einen kurzen Übergang zu inhaltreicheren Getränken. Und gab es einmal kein warmes Abendessen, so stellten sich doch stets zahlreiche kalte Leckerbissen, wie geräucherter Bärenschinken aus dem Rilogebirge und eine umfangreiche, sehr zarte Lachsforelle aus dem Ochridasee ein. Die Mazedonier an der Front sorgten dafür, daß Peter Karakinow, der aus Ochrid stammte und ein führender Mann in den Freiheitsbewegungen gewesen war, immer zuerst das Beste erhielt, was in seiner alten Heimat zu haben war.
Am wenigsten zahlreich stellten sich im Hause dieses Mazedoniers altbulgarische Familien ein.
An diesem Donnerstag gegen fünf Uhr nachmittags rollten die deutschen und österreich-ungarischen Militärautos besonders zahlreich zu dem Hause in der 6. Septemberstraße, das von außen so unscheinbar und kleinbürgerlich aussah, in seinem Innern aber merkwürdig viele, große und nach neuestem Werkbundgeschmack eingerichtete Räume barg.
Als Friedrich Franz von Kaufmann dem Diener in Frack und weißen Handschuhen seinen Hut übergeben hatte, gelang es ihm nur mit Mühe, bis zur Hausfrau vorzubringen, um ihr die Hand zu küssen.
»Ist Ihnen die Heldentat von neulich gut bekommen?« fragte die Hausfrau leise und ein wenig forschend.
»Danke, vorzüglich, irgendwelche Schäden haben sich bis jetzt nicht bemerkbar gemacht, gnädige Frau.«
»Das freut mich sehr«, sagte die Hausfrau. Und auf einen fragenden Blick Friedrich Franzens fuhr sie noch leiser fort: »Es muß endlich doch auch einmal einen Mann geben, der sich an Leda Serafinow nicht das Herz verbrennt. Ich würde es vor allen ihr selbst wünschen, denn sie hat es bei ihrem auffallenden Äußeren nicht ganz leicht, ruhig durchs Leben zu kommen.«
»Mein Gott, ob das wirklich der Zweck des Lebens ist, gnädige Frau? ... Übrigens weiß man immer noch nichts Neues über die mutmaßlichen Räuber?«
»Nicht so ungeduldig, Herr von Kaufmann, hierzulande haben wir es nicht eilig in solchen Dingen. Mein Mann ist schon mit Eifer hinter der Sache her. Leda ist sein Patenkind, da weiß er sich besonders verpflichtet.« Die Hausfrau nickte ihm freundlich zu und wurde von andern Gästen in Anspruch genommen.
»Servus, Herr Baron, meine herzlichste Gratulation, das war fesch von Ihnen, meine Hochachtung!« wurde Friedrich Franz von einem Sekretär der österreichischen Gesandtschaft begrüßt. »Aber das Madel ist auch wert, daß man sich eine Hachsen um sie ausreißt.«
»Nein, was Sie ein Schwein haben! Rein zum Neidischwerden!« begrüßte ihn ein deutscher Leutnant.
»Das ist ja fürchterlich, so ein Nest!« wehrte Friedrich Franz heftig ab.
»Gehn's, reden's nit so daher, wir sin alle narrisch wor'n vor Eifersucht, wie wir davon g'hört ham.«
Friedrich Franz flüchtete zu einer Gruppe älterer bulgarischer Damen, wo man sich französisch über die Aussichten einer neuen deutschen Offensive im Westen unterhielt. Da Frauen höherer bulgarischer Stabsoffiziere sich in dieser Gruppe befanden, interessierte sich Friedrich Franz für das Gespräch, aus dem man mit ziemlicher Sicherheit heraushören konnte, wie die Männer darüber dachten, die sich in Gegenwart von Deutschen über das Thema entweder äußerst enthusiastisch oder sehr zurückhaltend und gewunden ausdrückten, um sich nicht nach irgendeiner Richtung hin festzulegen.
Alle Damen waren jedenfalls der Ansicht, daß die Offensive bald käme, und daß die Deutschen kraft ihrer Disziplin und Organisation Sieger bleiben würden.
Friedrich Franz wandte sich ein wenig mißmutig ab. Die Worte Disziplin und Organisation konnte er kaum noch hören. Wir erscheinen nachgerade der ganzen Welt nur noch wie eine besonders gutgeölte Maschine, dachte er ärgerlich. Disziplin und Organisation, das sind kalte, unpersönliche Begriffe, die man bestenfalls respektiert, noch mehr vielleicht fürchtet, aber sie erzeugen keine Wärme, keine Begeisterung, keinen Enthusiasmus, worauf es schließlich doch ankommt.
Die Gespräche ringsum verstummten plötzlich. Alles blickte auf einen alten Herrn, der nach rechts und links grüßend und Hände schüttelnd sich einen Weg zur Hausfrau bahnte, die ihm ein wenig entgegenkam. Ihre Wangen röteten sich, sie fühlte sich durch das Erscheinen dieses Gastes offenbar besonders geehrt. Auf eine Frage erfuhr Friedrich Franz, der alte Herr sei der Führer einer Abordnung aus der Dobrudscha, die gestern in besonderer Mission beim Ministerpräsidenten vorgesprochen habe wegen Angliederung der ganzen Dobrudscha an das Zarentum Bulgarien.
Ich wußte es ja, dachte Friedrich Franz, mit dem Essen wächst der Appetit. Mazedonien haben sie, nun kommt die Dobrudscha an die Reihe.
Peter Karakinow trat in die Mitte des einen Zimmers und hielt eine kleine Ansprache an den alten Herrn; und zwar französisch, damit ihn jedermann verstehen könne.
Eigentlich etwas naiv, dachte Friedrich Franz, wie Peter Karakinow, der Mazedonier, der seine Sache im Trockenen weiß, nun dem Dobrudschaner die Hilfe der Mazedonier verspricht, um die solange geknechteten Söhne der Dobrudscha ihrem wahren Vaterlande Bulgarien wieder zuzuführen.
Die kleine Rede rief große Begeisterung hervor. Es wurde heftig Beifall geklatscht.
Der alte Herr erwiderte sofort in einer längeren Rede. Er bewies haarscharf, daß die ganze Dobrudscha von jeher rein bulgarisches Land gewesen sei, sozusagen die Wiege Bulgariens, daß diese treusten Heldensöhne Bulgariens ein natürliches Recht darauf hätten, wieder mit dem alten Vaterland vereinigt zu werden, ein Recht, das sogar den feierlich proklamierten Grundsätzen der Entente und Wilsons entspräche, und daß von irgendeinem Annexionsgedanken dabei nicht die Rede sein könne.
Aus dem harmlosen Fünfuhrtee wurde so für eine halbe Stunde ein politischer Salon mit politischer Propaganda.
So etwas möchte ich mal in Deutschland erleben, wenn auch nur ein einziges Mal, dachte Friedrich Franz. Wenn alles, was einmal im Laufe der Geschichte deutsch war, wieder deutsch werden soll, mir ist es gewiß recht, aber was setzte das für Proteste in Deutschland selbst?
»Fesch seins, was, die Brüder?« Der österreichische Gesandtschaftssekretär schob lachend einen Arm unter den Friedrich Franzens. »Eine Mordhetz wird das wieder geb'n mit di Dobrudschaner, a Mordshetz ... Ganz recht haben's, die Brüder, schrein muß mer, sonst gibt's nix, garnixen!«
Ein Sekretär der deutschen Gesandtschaft trat herzu und murmelte etwas von der wirklich erstaunlichen Vitalität und dem echt orientalischen Länderappetit, der soeben laut geworden. Starr und wie aus den Wolken gefallen blickte das rechte Auge durch das Einglas, während sich um das linke Auge viele satirische Fältchen legten.
»Ge' mer ein Haus weiter«, schlug der Österreicher dem deutschen Kollegen vor. »Hier wird's jetzt fad mit dera Politik.«
Die beiden Herren schlängelten sich vorsichtig dem Ausgang zu, wurden aber verschiedentlich aufgehalten, weil man gerade ihre Ansichten über die beiden Reden und die Zukunft der Dobrudscha hören wollte, während sie es doch für ihre wesentlichste Aufgabe hielten, über derlei weder eine Ansicht zu haben noch eine solche zu äußern.
Peter Karakinow trat zu Friedrich Franz, um ihn zu fragen, ob er Lust und Zeit zu einem Bridge ober einem Poker habe. Im oberen Stockwerk sei schon alles dafür hergerichtet.
Aber Friedrich Franz lehnte dankend ab, während schon eine ganze Anzahl von Herren die Treppe in das obere Stockwerk hinaufgestiegen.
Musik ertönte. Die Damen und einige jüngere Herren schoben die Stühle an die Wände, damit es mehr Platz zum Tanzen gäbe.
Ein bulgarischer Leutnant trat in die Mitte und gab einige Nationaltänze zum besten. Sie glichen einander sehr, mochten sie nun aus Altbulgarien oder aus Mazedonien oder vom Morawagebiet stammen.
Eigentlich verwunderlich, dachte Friedrich Franz, daß die bulgarische Politik daraus noch kein Kapital geschlagen hat. Alles, was solche und ähnliche Tänze tanzt, gehört zum großen bulgarischen Brudervolk, das unter einen Hut kommen muß, wenn der ganze Weltkrieg überhaupt einen Sinn haben soll.
Friedrich Franz war schlechter Laune, ohne dafür einen sachlichen Grund angeben zu können.
Er hätte schon längst die jungen Mädchen begrüßen sollen, Maria Petrowa sah immer wieder fragend zu ihm hinüber, aber er verspürte nicht die geringste Lust dazu.
Die Musik spielte einen Walzer von Strauß. Die Paare drehten sich im Kreise. Friedrich Franz sah heimlich nach der Uhr. Es war sechs, neue Gäste kamen wohl kaum noch.
Friedrich Franz lauschte nach dem Gang, wo jemand begrüßt wurde. Die Musik brach mitten im Walzer ab und begann einen Tango zu spielen. Der bulgarische Leutnant, der die Nationaltänze zum besten gegeben, stürzte zum Gang und erschien schon im nächsten Augenblick mit Leda Serafinow am Arm. Alle klatschten Beifall und traten zurück, um dem Paar Platz zu machen.
Ihr Vater sitzt irgendwo bei serbischen Räubern und sie tanzt, dachte Friedrich Franz. Merkwürdige Sitten. Schon neulich war ihm aufgefallen, als er darüber nachdachte, wie ungewöhnlich es eigentlich war, daß Leda Serafinow weder weinte noch jammerte, als der Chauffeur sie von den Fesseln befreite, ja überhaupt keine Gemütsbewegung zeigte, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt, im einsamen Iskertal überfallen, gebunden und fortgeschleppt zu werden.
Aber tanzen konnte sie! Friedrich Franz wandte keinen Blick von ihr. Und ihr Partner tanzte ebenfalls vorzüglich. Er erkundigte sich nach ihm. Leutnant Boris Makarow von der Gardekavallerie, ein Sohn des bekannten Generals, der beim Zaren in besonderer Gunst stand. Wie Spötter behaupten, weil er trotz seiner Schönheit so beruhigend dumm sei.
Es war so still in dem Raum, wo das Paar tanzte, daß man nur den Atem der Tanzenden hörte.
Aller Augen hingen an den Bewegungen der beiden. Jeder Frau, jedem Mädchen sah man an, wie es den Rhythmus der vollendeten Bewegungen genoß wie ein Kunstwerk. Darauf verstanden sich diese Bulgaren.
Nun trat Friedrich Franz doch zu Maria Petrowna, die ihm nur stumm die Hand drückte, so ganz war sie dem Tanz der beiden hingegeben.
Die Musik ging zu einem rasenden Galopp über. Leda Serafinow und Leutnant Makarow rasten über den Boden. Die Frauen und Mädchen ringsum atmeten schneller, ihre schwarzen Augen glänzten und glühten. Es hielt sie kaum noch auf ihren Stühlen und Sesseln.
Die Musik brach jäh ab. Ein Beifallklatschen, das nicht enden wollte, erhob sich. Leda Serafinow, die Hand auf dem Herzen, eilte zu den jungen Mädchen. Maria Petrowa sprang auf, zog Leda Serafinow auf den Sessel, umarmte sie und küßte sie leidenschaftlich.
Boris Makarow, dessen schwarze Augen wie Feuer brannten, ließ sich von den älteren Damen huldigen.
Alles erhob sich, schwatzte, lachte und machte den beiden Komplimente. Die Musik begann von neuem zu spielen, einen Walzer.
Ehe Friedrich Franz noch zu einem Entschluß gekommen war, hatte Leutnant Gonthard sich vor Fräulein Serafinow verneigt, und schon schwebten die beiden durch das Zimmer. Nicht einmal ein Wort der Begrüßung hatte Friedrich Franz anbringen können.
Mißmutig begab sich Friedrich Franz zu einigen jüngeren bulgarischen Herren, die sich in einem Nebenraum bei einer Havanna niedergelassen hatten. Auch hier sprach man von der Dobrudscha. Es waren junge Schriftsteller, Maler und Juristen, aber alle zuerst, mit gleicher Leidenschaft Politiker. Friedrich Franz hörte eine Weile zu und strebte dann ruhelos weiter. Am einfachsten wäre es, ich ginge, ich bin heute gar nicht bei Laune, dachte er und sah wieder auf die Uhr. Dann aber beschloß er, doch bis sieben Uhr zu bleiben.
Die Musik war verstummt ... Leda Serafinow saß in einer Sofaecke und ließ sich von zwei deutschen Leutnants den Hof machen.
»Bei uns Fliegern hat sowieso fast jeder 'nen Knacks«, hörte Friedrich Franz den Leutnant von Hungen sagen.
»Wie meinen Sie das?« fragte Leda teilnehmend.
»Gott, mein gnädiges Fräulein, sehr einfach. Entweder holt man sich in der Luft einen Herzknacks, oder man kommt mal unsanft auf die Erde zu sitzen, worauf die menschlichen Gliedmaßen noch nicht eingerichtet sind. Aber das macht nichts, dafür sind wir ja da.« Er wandte sich seinem Kameraden Peters zu. »Dumm ist nur, daß die Herren von der Infanterie, wenn sie schon ihren Knacks weghaben und durchaus nicht zu Muttern heim wollen, auch noch zu uns kommen. Mit der Zeit werden wir noch die reine Krüppelgarde.«
»Lassen Sie sich nichts vormachen, gnädiges Fräulein«, lachte Peters. »So schlimm ist es noch lange nicht. Die Herren Flieger sind nur wahnsinnig eifersüchtig und möchten am liebsten ganz unter sich bleiben. Deshalb geben sie nach allen Seiten Warnungsschüsse ab, von Knacks und so. Dabei war Hungen von Haus aus Pferdejäger, brach 'ne Rippe an den Masurischen Seen, ist jetzt knapp ein halbes Jahr bei der Fliegerei und schon so eingebildet wie ein Zeppeliner.«
»Verzeihung,« fiel Hungen ein, »das ist überhaupt kein Vergleich. Diese Gulaschkanonen fliegen überhaupt nicht, die fahren, verstehst du? Wie Droschkenkutscher zweiter Güte, verstehst de?«
»Sie waren bei den Masurischen Seen?« fragte Maria Petrow, »bitte erzählen Sie!«
»Gott, gnädiges Fräulein, was sieht ein simpler Leutnant von so einer Schlacht. Einen Gaul hatte ich schon lange nicht mehr. Immer zu Fuß wie die Kartoffelhopser. Der Major war gefallen. Nur noch Reserveonkels außer mir. Tüchtige Kerle, aber mit dem Kommiß für den Hausgebrauch doch nicht immer gut zuwege ... Wir saßen also mit unsern paar Männekens zwischen zwei Moorlöchern und hatten Befehl, die Stellung bis zum letzten Mann zu halten. Mit solchen Befehlen ist man bei uns sparsam. Wie mit'n Sonntagskuchen. Da hieß es höllisch aufpassen, wenn auch niemand wußte, worauf eigentlich ... Patrouillen kommen und melden, die Russen rücken vor in hellen Haufen. Ich sage: ›Ihr habt wohl den Drehwurm, euch piekt er wohl? Helle Haufen, das gibt's ja gar nicht. Die Russen kommen in Kolonnen, so und so tief, aber nicht in hellen Haufen, denn sie sind doch nicht blödsinnig, verstanden?‹ Ich schicke neue Patrouillen aus, und die Reserveonkels machen lange Gesichter. Wir werfen Stellungen aus für die Maschinengewehre, was hast de, was kannst de, denn auch mir kam die Geschichte mulmig vor. Wir mit unsern paar Männekens, todmüde, zum Umfallen, und Russen in hellen Haufen, das konnte gut werden. Da kommen die Leute schon wieder mit derselben Meinung. Ich brülle: ›Was heißt denn helle Haufen? erklärt mir das doch mal, wenn ich höflichst bitten darf, ihr Heupferde, ja? ...‹ ›Sie kommen eben zu Tausenden, in hellen Haufen zum Sturmangriff auf uns los. Dagegen hilft alles Schimpfen nichts ...‹ Ich nehme mir den ältesten Unteroffizier beiseite, einen verständigen Mann, und sage: ›Unteroffizier, nu zotteln Sie man los. Die Kerle haben den Verstand verloren mit ihren hellen Haufen.‹ Der Unteroffizier zottelt los, und wir bauen unsere Stellungen weiter aus. Die Reserveonkels vorneweg, alles, was recht ist. Wir arbeiten im Schweiße unseres Angesichts, es war wohl auch ein bißchen Angstschweiß dabei ... Der Unteroffizier kommt zurück und bringt mit etwas wackeliger Kinnlade dieselbe verdammte Meldung ... ›In spätestens einer Stunde sind sie da‹, sagt der Unteroffizier und schweigt. Und rennen uns über den Haufen, und fertig ist die Laube, denke ich seinen Satz zu Ende ... Ein Bayerischer Kamerad, der im Zivilverhältnis Rechtsanwalt ist, denkt laut und sagt: ›Aus is, gar is! ... Aber das hilft nu alles nischt, Befehl is Befehl ... Es war doch schön auf dieser Welt, und wie es auf der andern aussieht, hat noch niemand verraten. Adjöh, Berlin! ...‹ Wir schuften weiter, was die morschen Knochen nur hergeben wollen. Rechts und links Maschinengewehre, was sich nur in Stellung bringen läßt ... Von den Flanken müssen wir sie zu fassen kriegen, dann verkaufen wir unser Leben wenigstens so teuer wie nur irgend möglich ... ›Kerls,‹ sage ich, ›keinen Schuß, bevor ich das Kommando gebe, sonst holt uns der Teufel nur eine halbe Stunde früher. Gebe ich aber das Kommando, dann 'raus aus dem Rohr, was es nur hergeben kann ...‹ Mein Bayer wirft sich auf die Erde und sagt: ›Sie kommen ...‹ Ich glaube, wir sahen alle aus wie schlechter Käse. Jeder duckt sich in seine Stellung ... Wahrhaftig, sie kommen in hellen Haufen, nun sehe ich es mit meinen eigenen Augen. Sie kommen in großen Sätzen, die Knarre hoch über den Köpfen, ohne einen Laut von sich zu geben ... ›Es wird Zeit,‹ flüstert ein Reserveonkel, dem die Nerven locker werden, ›denn die Kerle müssen noch viel näher ran, sollen wir sie richtig fassen. Das sieht doch ein neugeborenes Kind ...‹ Die Russen springen wie die Flöhe ... Jetzt wird's Zeit, denke ich, ade, du schöne Welt, und gebe das Kommando zum Feuern ... Herrgott, das flutscht nur so, es geht wie auf dem Exerzierplatz, die Rohre geben her, was nur in ihnen steckt ... Die hellen Haufen geraten ins Wanken. Aber es hilft nichts, sie müssen weiter vor, die dahinter drängen, wollen auch noch ihr Teil kriegen ... Wie lange das dauert, wissen wir nicht. Uns erschien es wie eine Ewigkeit, es war aber wohl nur knapp ein halbes Stündchen. Da wissen die Russen endlich, daß sie in eine Falle gegangen sind, aber wie wenige wir sind, das wissen sie glücklicherweise nicht ... Ein Durcheinander, ein Gebrüll! Alles drängt nach rückwärts, um aus unserem Feuer zu kommen. Alles schlägt, sticht, schießt in die eigenen Haufen, die Hölle ist los. Nach beiden Seiten suchen sie zu entkommen und drängen sich gegenseitig in die Moorlöcher. Die Pferde müssen mit in die Sümpfe, auch die Geschütze. Am fürchterlichsten sind die Schreie der ertrinkenden Pferde. Der bayerische Kamerad hält sich die Ohren zu, aber die Tränen laufen ihm über die Backen. Uns allen stehn vor Graus die Haare zu Berg ...«
Der Leutnant schwieg. Alle schwiegen.
Nach einer Weile sagte von Hungen: »Das war unser Anteil an der Riesenschlacht. Die hellen Haufen wollten keinen Sturmangriff, sie waren schon auf der Flucht. Derweil wir Angst schwitzten wie sie, war der Sieg sozusagen schon fertig.«
Wieder schwieg der Leutnant eine Weile. Dann fuhr er fort: »Am andern Morgen ritt ich auf einem Russenpferd zwischen den Sümpfen herum, um mir den Schaden bei Licht zu besehen. Erst glaubte ich, ich träumte, und rieb mir die Augen, um wach zu werden. Die ganzen Moore waren mit russischen Soldatenmützen bedeckt wie ein reifendes Ährenfeld mit Blumenköpfen. Unter den Mützen ragten die bleichen Russenschädel bis zum Mund aus dem Sumpf. Die Arme lagen ausgebreitet auf dem Moor wie bei Gekreuzigten ... Arme Kerle, jeder hätte ihnen einen anständigen Soldatentod gegönnt ...«
Leda Serafinow und Maria Petrow sahen blaß und ein wenig zitterig drein. Peters machte dem Kameraden Vorwürfe. Er hätte doch Rücksicht nehmen müssen auf die Damen.
Aber Hungen wehrte sich und meinte, es schade niemandem, wenn er einmal höre, wie der Krieg in Wirklichkeit sei.
Ein befrackter Diener erschien und reichte Sekt.
Die Musik spielte, so gut sie konnte, Wagners Einzug der Götter in Walhall. Friedrich Franz fand nun endlich Gelegenheit, Leda Serafinow zu begrüßen. Wieder tauchten ihre schwarzen Augen tief unter in den seinen, was in ihm ein leichtes Schwindelgefühl hervorrief, das nicht unangenehm war.
Plötzlich stand Boris Makarow zwischen ihm und Leda Serafinow und erkundigte sich eifrig, wieweit die Sache mit Gospodin Serafinow denn eigentlich gediehen sei. Wenn sie befehle, würde er mit einer Schwadron losrücken und das ganze Serbennest ausheben.
Aber die junge Dame wehrte lebhaft ab. Es seien nur noch einige Formalitäten zu erledigen zwischen den Serben und Peter Karakinow, der die Angelegenheit in die Hand genommen habe.
»Man handelt wohl noch um das Lösegeld?« fragte der bulgarische Leutnant lächelnd.
Leda nickte zustimmend.
»Auch darin ist Peter Karakinow Meister«, meinte der Leutnant etwas spöttisch. »Da bleibt für mich nichts mehr zu tun übrig.«
»Ich denke, auf dreißigtausend Lewa wird man sich einigen«, sagte die junge Dame.
»Und der Hausherr wird versuchen, sie ihnen hinterdrein wieder abzujagen?«
Leda nickte. »Onkels Plan ist gut, und ich denke, er wird gelingen.«
»Dann ist ja alles in schönster Ordnung«, erwiderte der junge Leutnant und wandte sich Maria Petrow zu, ohne aber den Platz zu verlassen, durch den er Leda Serafinow und Friedrich Franz von Kaufmann trennte.
Eigentlich benimmt sich dieser Leutnant etwas dreist, dachte Friedrich Franz.
Leda Serafinow nickte dem Leutnant zu, winkte Friedrich Franz herbei und ließ sich mit ihm im Nebenzimmer nieder.
Boris Makarows Augen folgten den beiden ärgerlich, aber Maria Petrow hielt ihn fest.
»Benimm dich etwas manierlicher, Boris,« flüsterte Maria, »nimm gefälligst etwas Rücksicht auf den Bundesgenossen.«
Boris Makarow zerdrückte einen Fluch zwischen den Zähnen, unterhielt sich noch kurze Zeit mit Maria Petrow und eilte dann in das obere Stockwerk, um sein Glück im Poker zu versuchen.
Leda unterhielt sich in englischer Sprache mit Herrn von Kaufmann, denn sie hatte erst angefangen, Deutsch zu lernen. Sie war wie so viele junge Bulgarinnen aus wohlhabendem Haus im Robert College in Konstantinopel erzogen worden, nachdem sie der russischen Mode entsprechend zunächst einige Jahre auf einem Gymnasium in Sofia verbracht hatte.
Es wurde zu Tisch gebeten. An den Tee schloß sich wieder einmal ein üppiges Abendessen, während den Herrschaften im ersten Stock, die sich vom Spiel nicht trennen mochten, kalte Schüsseln gereicht wurden.
Friedrich Franz saß neben Leda Serafinow. Die Stimmung bei Tisch wurde immer fröhlicher und ausgelassener. Der französische Sekt, der immer wieder die Gläser füllte, war nicht unschuldig daran.
Bald wurde wieder getanzt, und als gegen Mitternacht Leda sich von Friedrich Franz trennte, weil ihr Auto auf sie wartete, hatte er Leda Serafinow eine Loge für die nächste Wohltätigkeitsvorstellung im Modernen Theater abgenommen, weil sie ihm versprach, ebenfalls in dieser Loge zu sein.
Peter Karakinow wollte durchaus nichts davon wissen, daß Friedrich Franz sich auch schon verabschiedete, er müsse noch einen kleinen Poker mitspielen. Friedrich Franz, der sehr aufgeräumt war und doch noch nicht schlafen konnte, ließ sich überreden und begab sich mit dem Hausherrn nun auch in den ersten Stock.
Peter Karakinow hatte wohl wieder ein wenig zu tief ins Sektglas gesehen, denn er spielte sehr leichtsinnig und redete sehr offenherzig darauflos. Erst gegen vier Uhr morgens trennte man sich, Friedrich Franz als der letzte. Als der Hausherr hinter ihm die Haustür schloß, deutete er mit der rechten Hand nach unten, wo sich wohl die Kellerräume befanden und flüsterte mit einem breiten Lachen: »Erinnern Sie sich noch an neulich? ... Da unten hielt ich ihn gefangen, etwa vierzehn Tage lang, keine Kleinigkeit bei dem Verkehr bei uns, was? Jetzt hat er endgültig Ruhe und wir vor ihm auch. Gute Nacht, wünsche wohl zu schlafen.«
»Danke schön, ebenfalls«, erwiderte Friedrich Franz und beeilte sich, aus der Nähe des Hauses in sein Hotel zu kommen.
III.
Es war Freitag und, wie jeden Freitag, großer Markt in Sofia. Meilenweit strömten seit Sonnenaufgang die Bauern, soweit sie nicht im Felde standen, die Bauernweiber mit ihren Kindern auf Büffelwagen, auf kleinen Wägelchen mit einem mageren Pferdchen davor oder auf einem Esel reitend zur Stadt. An diesem Tage sah Sofia immer wie ein riesiges Dorf aus. Das stand der jungen Residenz ganz natürlich zu Gesicht, kehrte sie doch so für einen Tag in der Woche zu dem Leben zurück, das noch vor wenigen Jahrzehnten ihr eigenes gewesen war.
Das glatt und sauber gewordene Gesicht dieser Stadt nahm dann wieder für vierundzwanzig Stunden seine ursprünglichen Züge an.
Es gab Sofioter, die schämten sich an jedem Freitag ein wenig des Aussehens ihrer Stadt, aber den Fremden war sie an diesen Tagen jedenfalls am interessantesten, denn an den übrigen Tagen sah die Stadt in ihrem modernen Teil nicht viel anders aus wie irgendeine andere kleine Residenz, die weiß, was sie der Neuzeit schuldig ist.
Es gab aber unter den Sofiotern auch nicht wenige, von denen jeden Freitag ihr neumodisches, städtisches Wesen abfiel, ohne daß sie sich besonders darum zu bemühen brauchten, ja ohne daß sie sich dessen selbst bewußt wurden, denn die meisten von ihnen waren vor zwanzig, dreißig Jahren ja auch noch im Büffelwagen gefahren oder auf einem Esel geritten.
In der Nähe der alten Sveti-Kral-Kathedrale war das bäuerliche Leben am unverfälschtesten. Da standen, saßen oder hockten auf dem Boden die Männer und Weiber in ihren bunten Trachten, vor sich auf bunten Tüchern oder auf der nackten Erde, was sie zum Kauf anzubieten hatten: Zwiebeln, Knoblauch, Hühner, Lämmer, Eier, Ferkel und dergleichen.