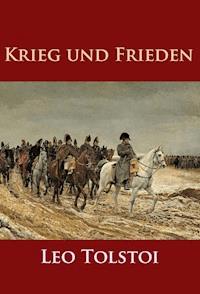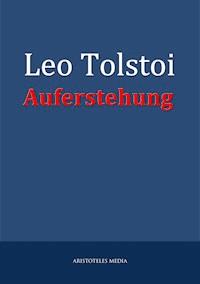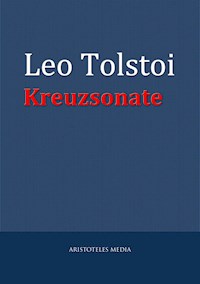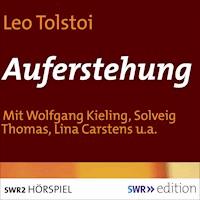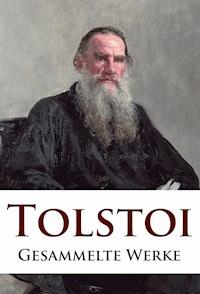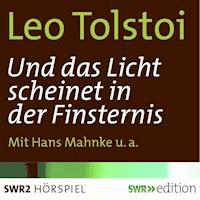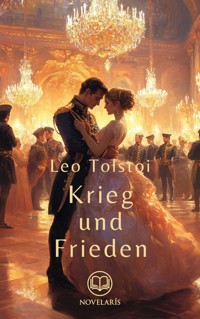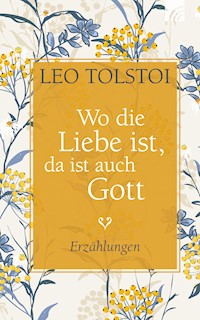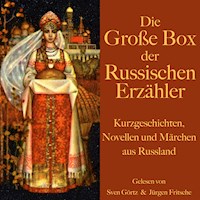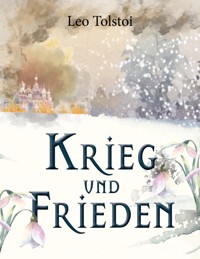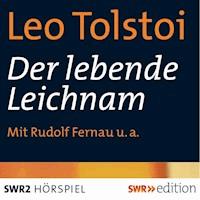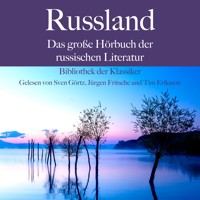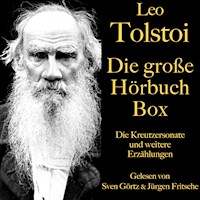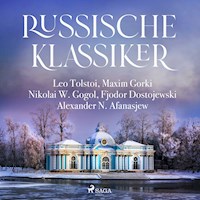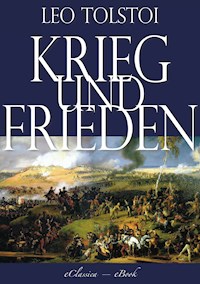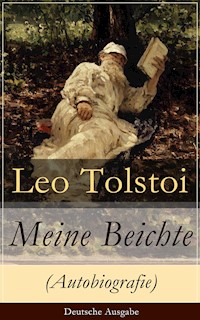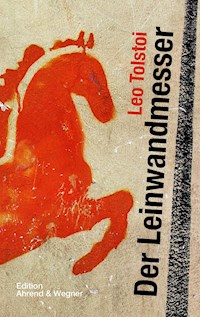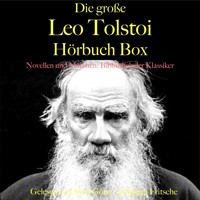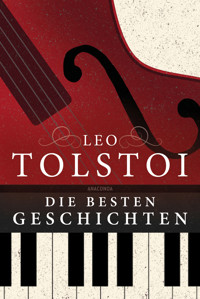
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Den großen russischen Erzähler Tolstoi kennt man in erster Linie als Autor seiner breit angelegten Romane »Krieg und Frieden« und »Anna Karenina«. Doch auch die kleineren literarischen Formen beherrschte er wie kaum ein anderer. Dieser Band enthält 7 Erzählungen: Neben Geschichten aus dem Kaukasus wie den »Holzschlag« oder den »Schneesturm« auch einige seiner Volkserzählungen, u.a. »Wie viel Erde braucht der Mensch«. Schließlich zwei seiner großen Novellen: »Der Tod des Iwan Iljitsch« und die »Kreutzersonate«.
- »Leo Tolstoi ist aktueller denn je« Der Tagesspiegel
- Sieben Geschichten des großen russischen Erzählers in einem Band
- Tolstoi hat nicht nur Monumentalwerke wie »Anna Karenina« und »Krieg und Frieden« verfasst: Er ist auch ein Meister der kurzen Form
- Unter anderem mit »Die Kreutzersonate«, »Der Tod des Iwan Iljitsch«, »Der Schneesturm«, »Ein Überfall« und »Wie viel Boden braucht der Mensch« etc.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Leo Tolstoi
Die besten Geschichten
Aus dem Russischenvon Alexander Eliasberg, Julie Goldbaum, Raphael Löwenfeld und Herrmann Röhl
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und
enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte
Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie the Nutzung
durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung
oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in
elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und
zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschütztenInhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhGausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Texte wurden behutsam überarbeitet, Orthografie und Interpunktionwurden unter Wahrung von Lautstand und grammatischen Eigenheiten aufneue Rechtschreibung umgestellt. Die Transkription russischer Eigennamenfolgt der Duden-Umschrift.
© 2025 by Anaconda Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
(Vorstehende Angaben sind zugleichPflichtinformationen nach GPSR)
Umschlaggestaltung: Katja Holst, Frankfurt am Main
Umschlagmotiv: Adobe Stock/GCART (Violine); mrpluck (Klaviatur);Shutterstock.com Merfin (Schmuck-Elemente)
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-33201-3V001
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Der Holzschlag
Der Schneesturm
Wieviel Erde braucht der Mensch?
Die drei Greise
Wovon die Menschen leben
Der Tod des Iwan Iljitsch
Die Kreutzersonate
Nachwort
Editorische Notiz
Der Holzschlag
Erzählung eines Fähnrichs
I
Im Jahre 185. um die Mitte des Winters gehörte eine Abteilung unserer Batterie zu einem Detachement, das in der Großen Tschetschnja stand. Am Abend des 14. Februar erfuhr ich, dass die Korporalschaft, die ich in Abwesenheit des Offiziers befehligte, dazu bestimmt war, am nächsten Tage einen Teil einer Kolonne zu bilden, welche Holz fällen sollte. Nachdem ich noch am Abend die nötigen Befehle empfangen und weitergegeben hatte, begab ich mich früher als gewöhnlich in mein Zelt, und da ich nicht die schlechte Gewohnheit hatte, dieses mit glühenden Kohlen zu heizen, so legte ich mich in den Kleidern auf mein Bett, das auf Pflöcken hergestellt war, zog die Fellmütze auf die Augen herunter, wickelte mich in meinen Pelz und versank in jenen eigenartigen festen, schweren Schlaf, den man in Zeiten der Aufregung und Unruhe vor einer Gefahr zu schlafen pflegt. Was mich in diesen Zustand versetzte, war die Erwartung eines Gefechtes für den bevorstehenden Tag.
Um drei Uhr morgens, als es noch völlig dunkel war, zerrte mir jemand den schön angewärmten Schafpelz vom Leib, und das dunkelrote Licht einer Kerze fiel mir unangenehm in die verschlafenen Augen.
»Bitte, stehen Sie auf!«, sagte eine Stimme. Ich schloss von Neuem die Augen, zog unbewusst den Schafpelz wieder über mich und schlief ein. »Bitte, stehen Sie auf!«, wiederholte Dmitri und schüttelte mich erbarmungslos an der Schulter; »die Infanterie rückt schon aus.« Ich kam auf einmal zur Erkenntnis der Wirklichkeit, fuhr zusammen und sprang auf die Beine. Nachdem ich schnell ein Glas Tee getrunken und mich in vereistem Wasser gewaschen hatte, kroch ich aus dem Zelt und ging in den Park (das ist der Ort, wo die Geschütze stehen). Es war dunkel, neblig und kalt. Die nächtlichen Wachtfeuer, die hier und da im Lager glühten, beleuchteten die Gestalten der verschlafenen Soldaten, die um sie herum lagen, und ließen durch ihren matten, rötlichen Schein die Dunkelheit noch dunkler erscheinen. In der Nähe hörte man gleichmäßiges, ruhiges Schnarchen, in der Ferne die Bewegungen der Infanterie, ihre Gespräche und das Klirren ihrer Gewehre; sie machte sich zum Abmarsch fertig. Es roch nach Rauch, nach Pferdemist, nach Lunte und nach Nebel. Ein morgendliches Zittern lief mir über den Rücken, und die Zähne schlugen mir wider meinen Willen aufeinander.
Nur an dem Schnauben und dem vereinzelten Stampfen konnte man in dieser undurchdringlichen Dunkelheit erkennen, wo die bespannten Protzen und Munitionswagen standen, und an den leuchtenden Punkten der Zündruten, wo sich die Geschütze befanden. Auf die Worte »Mit Gott!«, fuhr klirrend das erste Geschütz los; hinter ihm rasselte der Munitionswagen, und die Korporalschaft setzte sich in Bewegung. Wir nahmen alle die Mützen ab und bekreuzten uns. Nachdem die Korporalschaft in einen Zwischenraum zwischen der Infanterie eingerückt war, machte sie halt und wartete ungefähr eine Viertelstunde, bis die ganze Kolonne beisammen wäre und der Kommandeur käme.
»Nikolai Petrowitsch, bei uns fehlt ein Mann«, sagte eine an mich herantretende schwarze Gestalt, die ich nur an der Stimme als den Feuerwerker der Korporalschaft, Maximow, erkannte.
»Wer denn?«
»Welentschuk fehlt. Als angespannt wurde, war er noch da; ich habe ihn gesehen; aber jetzt fehlt er.«
Da nicht anzunehmen war, dass die Kolonne sich sofort in Bewegung setzen werde, beschlossen wir, den Gefreiten Antonow auszuschicken, um Welentschuk zu suchen. Bald darauf trabten in der Dunkelheit einige Reiter an uns vorüber: Das war der Kommandeur mit seiner Suite; und unmittelbar darauf rührte sich die Spitze der Kolonne und setzte sich in Bewegung, endlich auch wir – aber Antonow und Welentschuk waren nicht da. Indessen hatten wir noch nicht hundert Schritte zurückgelegt, als beide Soldaten uns einholten.
»Wo war er denn?«, fragte ich Antonow.
»Er schlief im Park.«
»Also ist er betrunken, ja?«
»Nicht im Geringsten.«
»Wie kommt es denn, dass er wieder eingeschlafen ist?«
»Das weiß ich nicht.«
Etwa drei Stunden lang zogen wir langsam, immer schweigend und im Nebel, über ungepflügte, schneefreie Felder und durch niedriges Buschwerk, das unter den Rädern der Geschütze knirschte. Endlich, nachdem wir einen nicht tiefen, aber außerordentlich reißenden Bach überschritten hatten, wurde befohlen, haltzumachen, und bei der Avantgarde ertönten einzelne Flintenschüsse. Diese Laute wirkten, wie das immer der Fall ist, auf alle stark aufregend. Die Truppe erwachte gleichsam: Die Leute rührten sich in den Reihen, man hörte sie sprechen und lachen. Hier rang ein Soldat mit einem Kameraden; dort hüpfte einer von einem Bein auf das andere; dort kaute einer seinen Zwieback oder machte zum Zeitvertreib »Präsentiert das Gewehr« und »Gewehr bei Fuß«. Gleichzeitig begann der Nebel im Osten merklich weiß zu werden; die Feuchtigkeit machte sich stärker fühlbar, und die umgebenden Gegenstände traten allmählich aus der Dunkelheit heraus. Ich unterschied schon die grünen Lafetten und Munitionswagen, das von Nebelnässe bedeckte Metall der Geschütze, die bekannten, mir ganz von selbst bis auf die kleinsten Einzelheiten vertraut gewordenen Gestalten meiner Soldaten, die braunen Pferde und die Reihen der Infanterie mit ihren hellen Bajonetten, den Brotbeuteln, den Kugelziehern und den Kochkesseln auf dem Rücken.
Bald wurde uns befohlen, wieder vorzurücken, und nachdem wir einige hundert Schritte ohne Weg marschiert waren, wurde uns ein Platz angewiesen. Auf der rechten Seite sahen wir das steile Ufer eines sich schlängelnden Flüsschens und die hohen Holzpfähle eines tatarischen Begräbnisplatzes; vorn links und geradeaus war durch den Nebel hindurch ein schwarzer Streifen wahrnehmbar. Die Korporalschaft protzte ab. Die achte Kompagnie, die uns zur Deckung diente, stellte die Gewehre zusammen, und ein Bataillon ging mit Gewehren und Äxten in den Wald.
Es waren noch nicht fünf Minuten vergangen, als auf allen Seiten Wachtfeuer zu knistern und zu rauchen anfingen; die Soldaten hatten sich zerstreut, sie fachten das Feuer mit den Händen und den Füßen an und schleppten Reisig und Äste herbei; im Wald erschollen unaufhörlich Hunderte von Äxten und fallenden Bäumen.
Die Artilleristen hatten sich, infolge einer gewissen Rivalität mit den Infanteristen, ein eigenes Wachtfeuer zurechtgemacht, und obgleich dieses schon dermaßen brannte, dass man sich ihm nicht auf zwei Schritte nähern konnte, und dichter, schwerer Rauch durch die beeisten Zweige drang, die die Soldaten auf das Feuer heraufpackten und von denen Tropfen zischend ins Feuer hineinfielen und sich unten Kohlen und abgestorbenes weißes Gras rings um das Wachtfeuer gebildet hatten, so schien das den Soldaten immer noch nicht genug: Sie schleppten ganze Stämme heran, legten Steppengras darunter und fachten die Glut immer mehr an.
Als ich zu dem Wachtfeuer trat, um mir eine Zigarette anzuzünden, holte Welentschuk, der immer eine große Geschäftigkeit bewies, jetzt aber im Bewusstsein seiner Verschuldung sich mehr als alle anderen um das Feuer bemühte, in einem Anfall von besonderem Eifer mitten aus der Glut mit der bloßen Hand eine Kohle heraus, warf sie ein paarmal von einer Hand in die andere und ließ sie dann auf die Erde fallen.
»Steck doch einen Span an und reich den hin!«, sagte ein anderer. »Gebt doch eine Zündrute her, Brüder!«, sagte ein Dritter.
Als ich schließlich ohne Welentschuks Hilfe, der noch einmal mit den Händen eine Kohle herausholen wollte, meine Zigarette angezündet hatte, rieb er seine verbrannten Finger an dem unteren Hinterteil seines Halbpelzes, hob, um sich irgendwie zu betätigen, einen großen Platanenklotz in die Höhe und warf ihn mit gewaltigem Schwung ins Feuer. Dann endlich glaubte er sich erholen zu dürfen; er trat dicht an die Glut heran, schlug seinen Mantel auseinander, den er wie eine Mantille an dem hinteren Kragenknopf trug, spreizte die Beine, streckte seine großen, schwarzen Hände vor, zog den Mund schief und kniff die Augen zusammen.
»Na so was! Ich habe meine Pfeife vergessen. Ist das ein Malheur, Brüder!«, sagte er nach einem kurzen Stillschweigen, ohne sich an jemand insbesondere zu wenden.
II
In Russland gibt es drei vorherrschende Soldatentypen, unter die sich die Soldaten aller Truppengattungen einrangieren lassen, die der Kaukasusarmee ebenso wie die von der Linie, von der Garde, der Infanterie, der Kavallerie, der Artillerie und so weiter.
Diese Haupttypen sind, von den vielen Untergruppen und Zwischenstufen abgesehen, folgende:
1. die Gehorsamen,
2. die Befehlshaberischen und
3. die Verwegenen.
Die Gehorsamen zerfallen in a) die gleichmütigen Gehorsamen, b) die geschäftigen Gehorsamen.
Die Befehlshaberischen zerfallen in a) die rauen Befehlshaberischen und b) die höflichen Befehlshaberischen.
Die Verwegenen zerfallen in a) die spaßhaften Verwegenen und b) die liederlichen Verwegenen.
Der häufigste und zugleich liebenswürdigste, sympathischste Typus, der sich meist mit den besten christlichen Tugenden, Sanftmut, Frömmigkeit, Geduld und Ergebung in den Willen Gottes, paart, ist der Gesamttypus des Gehorsamen. Das unterscheidende Merkmal des gleichmütigen Gehorsamen ist eine durch nichts zu erschütternde Ruhe und eine Verachtung für alle Wandlungen des Geschicks, die ihn treffen können. Das unterscheidende Merkmal des trunksüchtigen Gehorsamen ist ein stiller, poetischer Hang und eine gewisse Empfindsamkeit; das unterscheidende Merkmal des geschäftigen Gehorsamen ist die Beschränktheit der geistigen Fähigkeiten, gepaart mit zwecklosem Fleiß und unnötigem Eifer.
Der Gesamttypus der Befehlshaberischen begegnet vorzugsweise bei der höheren Schicht des Militärs ohne Charge: bei Gefreiten, Unteroffizieren, Feldwebeln und so weiter, und ist in seiner ersten Untergruppe, das heißt bei den rauen Befehlshaberischen, ein sehr vornehmer, energischer, hervorragend militärischer Typus, der einen hohen, poetischen Schwung nicht ausschließt (zu diesem Typus gehörte der Gefreite Antonow, mit dem ich den Leser bekannt zu machen beabsichtige). Die zweite Untergruppe bilden die höflichen Befehlshaberischen, die seit einiger Zeit sich stark auszubreiten anfangen. Der höfliche Befehlshaberische ist immer redegewandt und des Lesens und Schreibens kundig; er trägt ein rosa Hemd, isst nicht aus dem gemeinsamen Kessel, raucht manchmal Musatowtabak, hält sich für etwas unvergleichlich viel Höheres als den gewöhnlichen Soldaten, ist aber selbst selten ein so guter Soldat wie der Befehlshaberische der ersten Gruppe.
Der Typus der Verwegenen ist, ganz ebenso wie der Typus der Befehlshaberischen, in seiner ersten Untergruppe gut, das heißt bei den spaßhaften Verwegenen, deren unterscheidende Merkmale eine unerschütterliche Heiterkeit, eine hervorragende Befähigung für alles Mögliche, eine reiche Naturanlage und Kühnheit sind, und ebenso grässlich schlecht in seiner zweiten Untergruppe, das heißt bei den liederlichen Verwegenen, die jedoch (das muss zur Ehre des russischen Heeres gesagt werden) nur sehr selten vorkommen und, wenn sie vorkommen, von den übrigen Soldaten selbst wie nicht zur Kameradschaft gehörig behandelt werden. Unglaube und eine gewisse Kühnheit im Laster sind die hauptsächlichsten Charakterzüge dieser Gruppe.
Welentschuk gehörte zur Gruppe der geschäftigen Gehorsamen. Er war von Geburt Kleinrusse, diente schon fünfzehn Jahre und war zwar ein unansehnlicher und nicht sehr geschickter Soldat, aber treuherzig, gutmütig, außerordentlich eifrig, wiewohl großenteils nicht am richtigen Platz, und außerordentlich ehrlich. Ich sage: außerordentlich ehrlich, weil im vorhergehenden Jahr ein Fall vorgekommen war, bei welchem er diese charakteristische Eigenschaft in sehr augenfälliger Weise dokumentiert hatte. Ich muss vorausschicken, dass fast jeder Soldat ein Handwerk versteht. Die verbreitetsten Handwerke sind Schneiderei und Schuhmacherei. Welentschuk selbst hatte das erstere Handwerk erlernt, und wenn man danach urteilen darf, dass der Feldwebel Michail Dorofejitsch selbst sich seine Kleider von ihm machen ließ, so musste er es darin sogar bis zu einem gewissen Grad der Vollendung gebracht haben. Im vorhergehenden Jahr hatte Welentschuk es im Lager übernommen, für Michail Dorofejitsch einen feinen Mantel anzufertigen; aber gerade in der Nacht, als er das Tuch zugeschnitten, die Zutaten hinzugefügt und beides im Zelt unter seinen Kopf gelegt hatte, geschah ihm ein Unglück: Das Tuch, das sieben Rubel gekostet hatte, kam in der Nacht abhanden! Welentschuk machte mit Tränen in den Augen, mit zitternden, blassen Lippen, sein Schluchzen mühsam unterdrückend, dem Feldwebel davon Meldung. Michail Dorofejitsch wurde zornig. Im ersten Augenblick des Ärgers bedrohte er den Schneider; dann aber ließ er als ein wohlsituierter und gutherziger Mann die Sache laufen und verlangte von Welentschuk nicht, dass dieser ihm den Wert des Mantels ersetze. Wie sehr sich auch der geschäftige Welentschuk bemühte, wie viel er auch weinte und allen von seinem Unglück erzählte, der Dieb fand sich nicht. Es bestand allerdings ein starker Verdacht gegen einen liederlichen, verwegenen Soldaten namens Tschernow, der mit ihm in demselben Zelt schlief; aber positive Beweise waren nicht vorhanden. Michail Dorofejitsch, der zu den höflichen Befehlshaberischen gehörte, hatte als vermögender Mann (er trieb gewisse Geschäftchen mit dem Capitaine d’armes und dem Vorsteher der Speisegenossenschaft, den Aristokraten der Batterie) bald den Verlust seines Mantels ganz vergessen; Welentschuk dagegen vergaß sein Unglück nicht. Die Soldaten sagten, sie hätten damals gefürchtet, er könne Hand an sich legen oder in die Berge davonlaufen: So stark hatte dieses Unglück auf ihn gewirkt. Er trank nicht, aß nicht, war nicht einmal imstande zu arbeiten und weinte beständig. Nach drei Tagen erschien er bei Michail Dorofejitsch, holte ganz blass mit zitternder Hand aus dem Ärmelaufschlag ein Goldstück hervor und gab es ihm. »Weiß Gott, es ist mein letztes Geld, Michail Dorofejitsch, und auch das habe ich mir erst von Schdanow geborgt«, sagte er, von Neuem schluchzend; »und ich werde Ihnen bei Gott auch die noch fehlenden zwei Rubel bringen, sobald ich sie durch meine Arbeit mir werde verdient haben. Er« (wer »er« war, das wusste auch Welentschuk selbst nicht) »hat mich in Ihren Augen zu einem Schurken gemacht. Er, diese tückische, gemeine Seele, hat seinem Kameraden das Letzte genommen, was der hatte, seine Ehre; und ich diene schon fünfzehn Jahre …« Zu Michail Dorofejitschs Ehre muss gesagt werden, dass er von Welentschuk die noch fehlenden zwei Rubel nicht annahm, als dieser sie ihm zwei Monate später brachte.
III
Außer Welentschuk wärmten sich am Wachtfeuer noch fünf Soldaten von meiner Korporalschaft.
Auf dem besten Platz, wo man vor dem Wind geschützt war, saß auf einem Tönnchen der Feuerwerker der Korporalschaft, Maximow, und rauchte eine kurze Pfeife. An der Haltung, dem Blick und allen Bewegungen dieses Mannes war zu merken, dass er zu befehlen gewohnt und sich seines eigenen Wertes bewusst war, gar nicht zu reden von dem Tönnchen, auf dem er saß und das an einem Rastort das Emblem der Würde bildet, und von seinem mit Nanking überzogenen Halbpelz.
Als ich herantrat, drehte er seinen Kopf nach mir hin; aber seine Augen blieben auf das Feuer gerichtet, und erst weit später wandte sein Blick, der Richtung des Kopfes folgend, sich mir zu. Maximow war ein Einhöfer, besaß Geld und hatte in der Lehrbrigade Unterricht erhalten und sich Gelehrsamkeit erworben. Er war furchtbar reich und furchtbar gelehrt, wie die Soldaten sagten. Ich erinnere mich, wie er einmal bei einer Übung im Bogenschuss mit dem Quadranten den um ihn gescharten Soldaten erklärte, die Wasserwaage »sei nichts anderes, also es komme davon her, dass das atmosphärische Quecksilber seine Bewegung habe«. In Wirklichkeit war Maximow keineswegs dumm und verstand seine Sache vorzüglich; aber es war ihm die unglückselige, sonderbare Manier eigen, manchmal absichtlich so zu sprechen, dass es unmöglich war, ihn zu verstehen, und dass, wie ich überzeugt bin, er selbst seine Worte nicht verstand. Besonders liebte er die Ausdrücke: »Es kommt davon her, dass« und »In weiterem Verfolg«, und wenn er sagte: »Es kommt davon her, dass« oder »In weiterem Verfolg«, so wusste ich gewöhnlich schon im Voraus, dass ich von allem Nachfolgenden nichts verstehen würde. Die Soldaten dagegen hörten, soviel ich bemerken konnte, sein »Es kommt davon her, dass« sehr gern und vermuteten, dass ein tiefer Sinn dahinterstecke, obgleich sie, gerade wie ich, kein Wort verstanden. Aber dieses Nichtverstehen führten sie nur auf ihre eigene Dummheit zurück und achteten Fedor Maximowitsch nur umso höher. Kurz gesagt, Maximow gehörte zu den höflichen Befehlshaberischen.
Der zweite Soldat, der sich beim Feuer die Stiefel auf seine muskulösen, roten Beine zog, war Antonow – eben jener Bombardier Antonow, der schon im Jahr 37, als er ohne Bedeckungsmannschaft bei einem einzigen Geschütz zurückgeblieben war, sich durch Schießen gegen einen starken Feind verteidigt und mit zwei Flintenkugeln im Schenkel fortgefahren hatte, am Geschütz hin und her zu gehen und es zu laden. »Er müsste schon längst Feuerwerker sein, wenn er nicht so einen Charakter hätte«, sagten die Soldaten von ihm. Und in der Tat hatte er einen seltsamen Charakter: in nüchternem Zustand war er der ruhigste, friedlichste, ordentlichste Mensch, den es nur geben konnte; wenn er aber getrunken hatte, wurde er ein ganz anderer Mensch: Er erkannte keine Vorgesetzten mehr an, suchte Händel, prügelte sich und wurde als Soldat völlig unbrauchbar. Erst vor einer Woche hatte er sich in der Butterwoche dem Trunk ergeben und war trotz aller Drohungen und Vermahnungen und trotz des Anbindens an die Kanone bis zum ersten Montag in den Fasten aus der Betrunkenheit und Krakeelerei nicht herausgekommen. Während der ganzen Fastenzeit aber nährte er sich trotz des Befehls, dass auf der Expedition die ganze Mannschaft gewöhnliche Kost und nicht Fastenspeise essen solle, nur von Zwieback und nahm in der ersten Woche nicht einmal das festgesetzte Stof1 Branntwein an. Übrigens musste man diese kleine, eisenstarke Gestalt mit den kurzen, nach auswärts gebogenen Beinen und dem glänzenden, schnurrbärtigen Gesicht sehen, wenn er, ein bisschen angesäuselt, die Balalaika in die sehnigen Hände nahm und, geringschätzig um sich blickend, die »Gnädige Frau« anstimmte, oder wenn er, den Mantel mit den daran baumelnden Orden lose umgehängt, die Hände in den Taschen seiner blauen Nankinghose, auf der Straße ging – man musste den Ausdruck soldatischen Stolzes und der Verachtung für alles Nichtsoldatische sehen, der dann auf seinem Gesicht spielte, um zu begreifen, dass es ihm in solchen Augenblicken schlechterdings unmöglich war, mit einem gegen ihn grob werdenden oder auch einfach ihm in den Weg kommenden Offiziersburschen, Kosaken, Infanteristen oder einem Ansiedler, überhaupt mit einem Nichtartilleristen sich nicht zu prügeln. Er suchte Händel und prügelte sich nicht sowohl zu seinem eigenen Vergnügen, als um den Geist des ganzen Soldatenstandes aufrechtzuerhalten, als dessen Vertreter er sich fühlte.
1
Der dritte Soldat, der neben dem Feuer kauerte, mit einem Ring im Ohr, einem borstigen Schnurrbärtchen, einem Vogelgesicht und mit einer kleinen Porzellanpfeife zwischen den Zähnen, war der Fahrer Tschikin. Tschikin, »der liebe Mensch«, wie ihn die Soldaten nannten, war ein Spaßmacher. Bei der strengsten Kälte, bis an die Knie im Schmutz, zwei Tage ohne Essen, auf dem Feldzug, bei der Musterung, beim Exerzieren, immer und überall schnitt der liebe Mensch Grimassen, machte mit den Beinen Kapriolen und führte solche Scherzreden, dass sich die ganze Korporalschaft vor Lachen schüttelte. Am Rastort oder im Lager sammelte sich um Tschikin stets ein Kreis von jungen Soldaten; er spielte mit ihnen entweder Filka2 oder erzählte ihnen Geschichtchen von dem schlauen Soldaten und dem englischen Mylord oder stellte einen Tataren oder einen Deutschen vor oder machte einfach seine Bemerkungen, über die alle vor Lachen sterben wollten. Allerdings stand sein Ruf als Spaßmacher in der Batterie schon so fest, dass er nur den Mund aufzumachen und mit den Augen zu zwinkern brauchte, um ein allgemeines Gelächter hervorzurufen; aber es steckte tatsächlich in ihm viel echte, überraschende Komik. Er verstand es, an jedem Ding etwas Besonderes zu sehen, etwas, was anderen gar nicht in den Kopf kam, und was die Hauptsache war, diese Fähigkeit, an allem etwas Komisches zu sehen, hielt jeder Probe stand.
2Ein bei den Soldaten beliebtes Kartenspiel.
Der vierte Soldat war ein junger, unansehnlicher Bursche, ein Rekrut von der vorjährigen Aushebung, der zum ersten Mal an einem Feldzug teilnahm. Er stand im dicksten Rauch da und so nahe am Feuer, dass es schien, als werde sein abgescheuerter Halbpelz jeden Augenblick anbrennen; aber trotzdem konnte man an seinen zurückgeschlagenen Schößen und an seiner ruhigen, selbstzufriedenen Haltung mit den herausgedrückten Waden sehen, dass er das größte Vergnügen empfand.
Der fünfte Soldat endlich, der ein wenig abseits vom Wachtfeuer saß und ein Stöckchen zurechtschabte, war Onkelchen Schdanow. Schdanow war an Dienstjahren der Älteste von allen Soldaten in der Batterie; er hatte alle schon als Rekruten gekannt, und alle nannten ihn aus alter Gewohnheit Onkelchen. Wie es hieß, trank er niemals, rauchte nicht, spielte nicht Karten, nicht einmal Nase3, nahm nie ein hässliches Schimpfwort in den Mund. In seiner ganzen dienstfreien Zeit beschäftigte er sich mit Schuhmacherei; an Feiertagen aber ging er in die Kirche, wo das möglich war, oder stellte eine Kerze für eine Kopeke vor dem Heiligenbild auf und nahm den Psalter vor, das einzige Buch, in dem er lesen konnte. Mit den anderen Soldaten gab er sich wenig ab: Gegen diejenigen, die im Rang über ihm standen, obwohl sie weniger Lebensjahre zählten, benahm er sich mit kühlem Respekt; den ihm Gleichgestellten näherzutreten, hatte er als Nichttrinker wenig Gelegenheit; aber besonders liebte er die Rekruten und die jungen Soldaten; diese nahm er immer unter seinen Schutz, gab ihnen gute Lehren und half ihnen oft. Alle in der Batterie hielten ihn für einen Kapitalisten, weil er ungefähr fünfundzwanzig Rubel besaß, die er gern einem Soldaten lieh, der wirklich in Not war. Eben jener Maximow, der jetzt Feuerwerker war, hat mir erzählt, als er vor zehn Jahren als Rekrut angekommen sei und die alten Saufbrüder sein mitgebrachtes Geld mit ihm vertrunken hätten, da habe Schdanow, der seine unglückliche Lage bemerkt habe, ihn zu sich gerufen, ihn wegen seiner Aufführung streng gescholten, ja sogar geschlagen, ihm gehörig die Leviten gelesen, wie man als Soldat leben müsse, und, als er ihn wieder fortgeschickt habe, ihm ein Hemd gegeben, da er, Maximow, keines mehr gehabt habe, sowie einen halben Rubel Geld. »Er hat aus mir einen Menschen gemacht«, sagte Maximow selbst immer von ihm voll Hochachtung und Dankbarkeit. Er war es auch, der dem armen Welentschuk, seinem Schützling von der Rekrutenzeit an, bei dem Unglück mit dem abhandengekommenen Mantel geholfen hatte; und so hatte er noch vielen, vielen anderen während seiner fünfundzwanzigjährigen Dienstzeit beigestanden.
3Ein sehr einfaches Spiel, bei dem der Verlierer mit den Karten auf die Nase geschlagen wird.
Was den Dienst anlangt, so konnte man sich keinen Soldaten denken, der seine Sache besser verstanden hätte und tapferer und ordentlicher gewesen wäre; aber er war gar zu still und unansehnlich, als dass er hätte zum Feuerwerker befördert werden können, obwohl er schon seit fünfzehn Jahren Bombardier war. Schdanows einzige Freude, ja sogar seine Leidenschaft waren Lieder; besonders gewisse Lieder liebte er sehr und versammelte immer einen aus jungen Soldaten bestehenden Kreis von Sängern um sich; er stand dann, obwohl er selbst nicht singen konnte, bei ihnen, steckte die Hände in die Taschen seines Halbpelzes, kniff die Augen zusammen und drückte durch Bewegungen des Kopfes und der Kinnbacken seine Teilnahme aus. Ich weiß nicht, woher es kam, aber diese gleichmäßige Bewegung der Kinnbacken unter den Ohren, die ich außer an ihm an sonst niemandem wahrgenommen habe, fand ich außerordentlich ausdrucksvoll. Sein schneeweißer Kopf, der gewichste schwarze Schnurrbart und das sonngebräunte, runzelige Gesicht verliehen ihm auf den ersten Blick ein strenges, finsteres Aussehen; aber sobald man aufmerksamer in seine großen, runden Augen hineinblickte, namentlich wenn sie lächelten (mit den Lippen lachte er niemals), so überraschte einen auf einmal etwas ungewöhnlich Sanftes, beinahe Kindliches.
IV
»Na so was! Ich habe meine Pfeife vergessen. Ist das ein Malheur, Brüder!«, wiederholte Welentschuk.
»Du solltest Zicharren4 rauchen, lieber Mensch!«, sagte Tschikin, indem er den Mund schief zog und mit den Augen zwinkerte. »Ich rauche auch immer zu Hause Zicharren, die schmecken schöner.«
4»Zicharren« nennt der einfache Russe aus Zeitungspapier gedrehte und mit minderwertigem Tabak gefüllte Zigaretten.
Selbstverständlich wollten sich alle ausschütten vor Lachen.
»Na ja, nun hat er seine Pfeife vergessen«, unterbrach ihn Maximow, ohne das allgemeine Gelächter zu beachten, und klopfte mit Feldherrnmiene stolz seine Pfeife auf die linke Handfläche aus. »Wo hast du denn heute gesteckt? Sag mal, Welentschuk!«
Welentschuk drehte sich halb zu ihm hin, machte Anstalten, die Hand zur Mütze zu erheben, ließ sie dann aber wieder sinken.
»Du hast offenbar deinen gestrigen Rausch nicht ausgeschlafen, dass du im Stehen einschläfst. Das ist wahrhaftig kein Verhalten, für das man euch Menschen loben könnte.«
»Möge ich gleich auf der Stelle platzen, Fedor Maximowitsch, wenn ich auch nur einen Tropfen habe in meinen Mund kommen lassen; ich weiß selbst nicht, was mit mir los war«, antwortete Welentschuk. »Soll mich wohl vor Freude betrunken haben?«, brummte er.
»Na ja; da ist man nun den Vorgesetzten gegenüber für euch Menschen verantwortlich; aber ihr treibt es immer in derselben Weise weiter – in ganz ungehöriger Weise«, schloss der redekundige Maximow in schon ruhigerem Ton.
»Es war ganz wunderlich, Brüder«, fuhr Welentschuk nach minutenlangem Schweigen fort, indem er sich am Nacken kratzte und sich an niemand insbesondere wandte, »wirklich, ganz wunderlich, Brüder! Sechzehn Jahre lang diene ich nun schon, aber so etwas ist mir noch nicht vorgekommen. Als befohlen wurde, zum Appell anzutreten, da war ich zur Stelle, wie es sich gehört – ich spürte nichts an mir; aber im Park packte es mich auf einmal … es packte mich unwiderstehlich und warf mich auf die Erde, und damit war’s fertig. Und wie ich eingeschlafen bin, das habe ich selbst nicht gemerkt, Brüder! Es muss eine wahre Schlafsucht über mich gekommen sein«, schloss er.
»Ich habe dich ja auch nur mit Gewalt wach gekriegt«, sagte Antonow, während er sich den einen Stiefel anzog. »Ich stieß dich und stieß dich, aber da lagst du wie ein Holzklotz!«
»Siehst du wohl«, bemerkte Welentschuk; »wenn ich noch betrunken gewesen wäre …«
»So war auch bei uns zu Hause ein Weib«, begann Tschikin, »die kam fast zwei Jahre lang nicht vom Ofen herunter. Da wollten die Leute sie einmal wecken; sie dachten, sie schliefe; aber sie lag da und war tot. Die war auch immer so schlafsüchtig gewesen. Ja, ja, lieber Mensch!«
»Erzähle doch mal, Tschikin, wie du dich während deines Urlaubs aufgespielt hast«, sagte Maximow und blickte mich lächelnd an, wie wenn er sagen wollte: »Hätten Sie nicht Lust, den dummen Menschen auch einmal anzuhören?«
»Wieso aufgespielt, Fedor Maximowitsch?«, erwiderte Tschikin und warf mir einen schrägen, flüchtigen Blick zu. »Ich habe ihnen nur erzählt, wie es im Kaukasus zugeht.«
»Na ja, gewiss, gewiss! Zier dich nur nicht … erzähle, was du ihnen aufgebunden hast!«
»Aufgebunden habe ich ihnen allerdings etwas. Sie fragten mich, wie wir leben«, begann Tschikin in schneller Redeweise mit der Miene eines Menschen, der schon mehrere Male dasselbe erzählt hat; »ich sagte ihnen: ›Wir leben gut, liebe Leute; zu essen bekommen wir reichlich; morgens und abends erhält jeder Soldat eine Tasse Schokolade, und zu Mittag gibt es herrschaftliche Suppe, glühend heiß, aus Perlgraupen und Reis, und statt des Branntweins pro Mann ein Stof Modera, stark und würzig, kostet ohne Flasche zweiundvierzig!‹«
»Famoser Modera!«, fiel Welentschuk ein, der lauter als die anderen sich vor Lachen ausschüttete. »Das ist mal ein Modera!«
»Na, und was hast du ihnen von den Asiaten erzählt?«, fuhr Maximow fort zu fragen, als das allgemeine Gelächter sich einigermaßen gelegt hatte.
Tschikin bog sich zum Feuer hin, holte mit einem Stäbchen eine kleine Kohle heraus, legte sie auf seine Pfeife und setzte seinen Rippentabak schweigend mit einer Langsamkeit in Brand, als bemerke er gar nicht die schweigende Spannung, in die seine Zuhörer versetzt waren. Als er endlich genug Rauch eingesogen hatte, warf er die Kohle hin, schob seine Mütze noch weiter in den Nacken zurück und fuhr, mit den Achseln zuckend und leise lächelnd, fort:
»Sie fragten mich auch, was für eine Sorte von kleinen Tscherkessen es da gebe, oder ob wir im Kaukasus den Türken schlügen. Ich sagte: ›Liebe Leute, bei uns gibt es nicht nur eine Sorte Tscherkessen, sondern verschiedene. Es gibt da solche Tawlinzen; die wohnen auf steinernen Bergen und essen Steine wie Brot. Die sind so groß wie tüchtige Baumstämme und haben ein einziges Auge auf der Stirn’, und auf dem Kopf haben sie rote Mützen, die brennen nur so, ganz wie die deinige, lieber Mensch!‹«, fügte er hinzu, indem er sich zu einem jungen Rekruten wandte, der wirklich eine komisch aussehende Mütze mit einem roten Deckel auf dem Kopf hatte.
Der Rekrut hockte sich bei dieser unerwarteten Anrede plötzlich auf die Erde nieder, schlug sich auf die Knie und lachte und hustete dermaßen, dass er kaum mit stockendem Atem herausbringen konnte: »Nein, was sind die Tawlinzen für Kerle!«
» ›Und dann‹, sagte ich, ›sind da noch die Mumren‹ «, fuhr Tschikin fort und rückte sich durch eine Kopfbewegung die Mütze in die Stirn; »›das sind wieder andere, kleine Zwillinge; ja, so sind die beschaffen. Sie gehen immer paarweis‹, sagte ich; ›halten sich immer an den Händen angefasst und laufen so schnell, dass man sie nicht einmal zu Pferde einholen kann.‹ – ›Wie ist das?‹, sagte einer, ›werden die Mumren denn auch so Hand in Hand geboren, ja?‹ «, (Diese Worte sprach Tschikin in rauem Bass, um die Stimme eines Bauern nachzumachen.) » ›Jawohl, lieber Mann‹, sagte ich, ›so sind sie von Natur. Wenn man ihnen die Hände auseinanderreißt, dann kommt Blut, gerade wie bei einem Chinesen; wenn man dem die Mütze abnimmt, kommt auch Blut.‹ – ›Aber sage mal, wie kämpfen sie denn?‹, fragte er weiter. ›Das machen sie so‹, sagte ich: ›sie greifen dich, schlitzen dir den Bauch auf und wickeln dir deine eigenen Gedärme um den Arm; immerzu, immerzu wickeln sie. Du aber lachst und lachst so lange, bis du den Geist aufgibst …‹ «
»Na, und haben sie dir denn das alles geglaubt, Tschikin?«, sagte Maximow; er lächelte nur leise, während die Übrigen alle vor Lachen umkommen wollten.
»Sie sind ein wunderliches Völkchen, Fedor Maximowitsch, wahrhaftig; sie glauben alles, weiß Gott, alles. Aber da erzählte ich ihnen von dem Berge Kasbek, dass auf ihm der Schnee den ganzen Sommer über nicht taut; da fielen sie in helles Gelächter, lieber Mensch. ›Was schwindelst du uns da vor, Junge?‹, sagten sie. ›Hat man so etwas je gehört: ein großer Berg, und es soll auf ihm der Schnee nicht tauen! Bei uns tauen im Frühling gerade die Hügel zuerst, und in den Schluchten bleibt der Schnee liegen.‹ – Rede nun mit ihnen!«, schloss Tschikin, mit den Augen zwinkernd.
V
Die helle Sonnenscheibe, die durch den milchweißen Nebel hindurchschimmerte, war schon ziemlich hoch gestiegen; der grauviolette Gesichtskreis dehnte sich allmählich weiter aus, wurde aber, obwohl er viel größer war als vorher, doch ebenso scharf durch eine trügerische weiße Nebelwand begrenzt.
Vor uns, jenseits des abgeholzten Waldes, lag eine ziemlich große freie Waldwiese. Auf dieser Wiese breitete sich auf allen Seiten der Rauch der Wachtfeuer aus, hier schwarz, da milchweiß, dort violett, und weiße Nebelschichten zogen in seltsamen Gestalten dahin. In der Ferne vor uns zeigten sich ab und zu Gruppen von berittenen Tataren, und es waren vereinzelte Schüsse aus unseren Büchsen und ihren Flinten und aus den Geschützen zu hören.
»Das war noch kein Kampf, sondern nur ein Spaß«, wie der brave Hauptmann Chlopowsagte.
Der Chef der achten Jägerkompagnie, die unsere Bedeckung bildete, trat an die Geschütze heran, zeigte auf die drei Tataren, die gerade am Waldrand, gegen zweitausend Schritte von uns entfernt, einherritten, und bat mich, wie denn alle Infanterieoffiziere eine besondere Passion für Artilleriefeuer haben, eine Kanonenkugel oder eine Granate auf sie abzuschießen.
»Sehen Sie mal«, sagte er mit einem gutmütigen, auffordernden Lächeln und streckte den Arm von hinten über meine Schulter, »da, wo die beiden großen Bäume stehen, da reitet einer in einem schwarzen Tscherkessenrock auf einem Schimmel voran, und dahinter kommen noch zwei. Sehen Sie nur! Könnte man die nicht vielleicht ...«
»Und da reiten noch drei am Wald«, fügte Antonow hinzu, der sich durch eine wunderbare Sehschärfe auszeichnete; er war zu uns herangetreten und verbarg die kurze Pfeife, die er gerade rauchte, hinter seinem Rücken. »Der Vorderste hat soeben seine Flinte aus dem Futteral herausgenommen. Es ist ganz deutlich zu sehen, Euer Wohlgeboren!«
»Seht mal, er hat geschossen, Brüder! Da ist ein weißes Rauchwölkchen entstanden«, sagte Welentschuk in einer Gruppe von Soldaten, die etwas hinter uns stand.
»Gewiss hat er auf unsere Vorpostenkette geschossen, der Schweinehund«, bemerkte ein andrer.
»Ei, wie viele ihrer da aus dem Wald herausgeströmt sind; sie rekognoszieren wohl die Gegend und wollen ein Geschütz aufstellen«, fügte ein Dritter hinzu. »Wenn man eine Granate in den Haufen hineinschösse, die würden gut spucken …«
»Was meinst du, trägt das Geschütz so weit, lieber Mensch?«, fragte Tschikin.
»Fünfzehnhundert oder fünfzehnhundertfünfzig Schritte, mehr wird es nicht sein«, sagte Maximow kühl, als ob er zu sich selbst spräche; indessen war deutlich, dass er ebenso wie die anderen die größte Lust hatte, zu feuern. »Wenn man fünfundvierzig Linien aus dem Einhorn gibt, dann kann man ganz genau treffen, das heißt auf den Punkt.«
»Wissen Sie, wenn man jetzt auf diesen Haufen zielt, muss man unbedingt einen treffen. Da, da, wie sie jetzt zusammengeritten sind; bitte, befehlen Sie doch so schnell wie möglich zu feuern«, fuhr der Kompagniechef fort, mich zu bitten.
»Befehlen Sie, ein Geschütz zu lichten?«, fragte Antonow auf einmal kurz mit seiner Bassstimme und machte dabei ein grimmiges, finsteres Gesicht.
Ich muss gestehen, ich hatte selbst sehr große Lust und gab Befehl, das zweite Geschütz zu richten.
Kaum hatte ich das gesagt, als auch schon die Granate mit Pulver bestreut und eingeführt war und Antonow, sich an die Lafettenwand drückend und seine beiden Daumen gegen die Richtplatte stellend, die Kommandos für die Bewegung des Lafettenschwanzes nach rechts und links gab.
»Ein klein bisschen nach links … eine ganze Kleinigkeit nach rechts … noch, noch eine Spur … so ist’s gut!«, sagte er und trat mit stolzer Miene vom Geschütz zurück.
Der Infanterieoffizier, ich und Maximow legten einer nach dem anderen das Auge an das Visier und sprachen alle drei unsere abweichenden Meinungen aus.
»Bei Gott, sie wird treffen«, bemerkte Welentschuk, mit der Zunge schnalzend, obwohl er nur über Antonows Schulter gesehen und darum keine rechte Grundlage für diese Behauptung hatte. »Bei Gott, sie wird genau treffen; in jenen Baum wird sie einschlagen, Brüder!«
»Zweites Geschütz!«, kommandierte ich.
Die Bedienungsmannschaft trat auseinander. Antonow lief zur Seite, um den Flug des Geschosses zu beobachten; der Zünder flammte auf, und das Metall erdröhnte. In demselben Augenblick umgab uns dichter Pulverdampf, und von dem erschütternden Donner des Schusses löste sich der metallische, sausende, mit Blitzesschnelle sich entfernende Ton des Geschosses ab, der inmitten eines allgemeinen Stillschweigens in der Ferne erstarb.
Ein wenig hinter der Reitergruppe zeigte sich ein weißes Rauchwölkchen; die Tataren sprengten nach verschiedenen Seiten auseinander, und der Schall der Explosion kam bis zu uns herübergeflogen.
»Das war famos! Wie sie davonsausten! Nun seh einer, das mögen die Teufel nicht!«, ließen sich beifällige und spöttische Äußerungen in den Reihen der Artilleristen und Infanteristen vernehmen.
»Hätten wir ein klein bisschen niedriger geschossen, dann würde sie mitten hinein getroffen haben«, bemerkte Welentschuk. »Ich hab’s ja gesagt: Sie wird den Baum treffen; und so ist es auch – sie ist ein bisschen zu sehr nach rechts gegangen.«
VI
Ich verließ die Soldaten, die immer noch darüber sprachen, wie die Tataren davongesprengt waren, als sie die Granate erblickt hatten, und weshalb sie da herumritten, und ob ihrer noch viele im Wald seien, ging mit dem Kompagniechef ein paar Schritte weg und setzte mich, in Erwartung der aufgewärmten Klopse, die er mir angeboten hatte, mit ihm unter einen Baum. Der Kompagniechef Bolchow war einer von den Offizieren, die im Regimente »Bonjours« genannt werden. Er besaß Vermögen, hatte früher bei der Garde gedient und sprach Französisch. Aber seine Kameraden mochten ihn trotzdem gut leiden. Er war hinreichend klug und besaß Takt genug, um einen Petersburger Rock zu tragen, gut zu dinieren und Französisch zu sprechen, ohne durch diese Dinge die übrigen Offiziere allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Wir sprachen zuerst über das Wetter, über die kriegerischen Operationen und über unsere gemeinsamen Bekannten unter den Offizieren, und nachdem jeder von uns durch Fragen und Antworten die Überzeugung gewonnen hatte, dass der andere eine vernünftige Anschauung der Dinge besaß, gingen wir unwillkürlich zu einem vertraulicheren Gespräch über. Zudem entsteht ja, wenn im Kaukasus Angehörige derselben Gesellschaftsklasse einander begegnen, eigentlich immer die Frage: »Warum sind Sie hier?«, und wenn diese Frage auch nicht ausgesprochen wird, so steht sie doch einem jeden deutlich auf dem Gesicht geschrieben. Auf diese meine stillschweigende Frage also wollte, wie mir schien, mein neuer Bekannter antworten.
»Wann wird diese Expedition nur ein Ende nehmen?«, sagte er träge. »Es ist schauderhaft langweilig.«
»Mir ist es nicht langweilig«, entgegnete ich. »In der Garnison ist es ja noch langweiliger.«
»Oh, in der Garnison ist es zehntausendmal schlimmer«, sagte er ingrimmig. »Nein, wann wird das alles ganz zu Ende sein?«
»Was soll denn nach Ihrem Wunsch ein Ende nehmen?«, fragte ich.
»Alles, alles zusammen! … Na, sind die Klopse fertig, Nikolajew?«, fragte er.
»Warum haben Sie denn im Kaukasus Dienst genommen«, sagte ich, »wenn Ihnen der Kaukasus so wenig gefällt?«
»Wollen Sie wissen warum?«, antwortete er mit einem energischen Entschluss zur Offenherzigkeit. »Infolge der Tradition. Es gibt ja in Russland eine höchst seltsame Tradition über den Kaukasus, der das Gelobte Land für Unglückliche aller Art sein soll.«
»Ja, das ist nahezu wahr«, erwiderte ich. »Der größte Teil von uns …«
»Das Schlimmste aber ist«, unterbrach er mich, »dass wir alle, die wir infolge dieser Tradition nach dem Kaukasus kommen, uns in unseren Erwartungen furchtbar getäuscht sehen. Und ich weiß absolut nicht, warum die Leute wegen einer unglücklichen Liebe oder wegen zerrütteter Vermögensverhältnisse lieber nach dem Kaukasus gehen als nach Kasan oder Kaluga. In Russland stellt man sich ja den Kaukasus als etwas Majestätisches vor, mit ewigem, jungfräulichem Eis, mit reißenden Strömen, mit Dolchen, Filzmänteln und Tscherkessinnen – alles das hat etwas Aufregendes; aber in Wirklichkeit ist kein Vergnügen dabei. Wenn die Leute wenigstens wüssten, dass wir uns in dem ewigen Eis nie aufhalten und dass es auch gar kein Vergnügen macht, dort zu sein, dass aber der Kaukasus in Gouvernements eingeteilt wird: Stawropol, Tiflis und so weiter.«
»Ja«, erwiderte ich lachend, »in Russland sehen wir den Kaukasus mit ganz anderen Augen an als hier. Haben Sie das einmal an Ihrer eigenen Person erfahren? Es ist, wie wenn man Verse liest in einer Sprache, die man nur mangelhaft versteht; dann stellt man sie sich auch weit schöner vor, als sie in Wirklichkeit sind …«
»Ich weiß wirklich nicht, wie es damit steht; aber mir missfällt dieser Kaukasus furchtbar«, unterbrach er mich.
»Nein, für mich ist der Kaukasus auch jetzt schön, nur in anderer Weise …«
»Mag sein, dass er schön ist«, fuhr er mit einer gewissen Gereiztheit fort; »ich weiß nur, dass ich mich im Kaukasus nicht wohlfühle.«
»Woher kommt denn das?«, fragte ich, um überhaupt etwas zu sagen.
»Das kommt erstens daher, dass er mich getäuscht hat. Alles das, wovon ich auf Grund der Tradition im Kaukasus zu genesen hoffte, alles das ist mit mir hierhergewandert –, nur mit dem Unterschied, dass alles das sich früher auf der großen Treppe befand, jetzt aber auf einer kleinen, schmutzigen, wo ich auf jeder Stufe Millionen von kleinen Aufregungen, Widerwärtigkeiten und Kränkungen finde. Zweitens daher, dass ich fühle, wie ich hier mit jedem Tage moralisch immer tiefer sinke. Und die Hauptsache ist, dass ich mich für den hiesigen Dienst ungeeignet fühle: Ich kann nicht Gefahren ertragen … ich bin, geradeheraus gesagt, nicht tapfer …«
Er hielt inne und sah mich mit ernster Miene an.
Obgleich dieses unverlangte Geständnis mich in das größte Erstaunen versetzte, widersprach ich ihm nicht, wie er das offenbar wünschte, sondern erwartete von ihm selbst eine Widerlegung seiner Worte, wie das in solchen Fällen immer zu sein pflegt.
»Wissen Sie, ich komme bei dieser jetzigen Expedition zum ersten Mal ins Gefecht«, fuhr er fort, »und Sie können sich gar keine Vorstellung davon machen, wie es mir gestern gegangen ist. Als der Feldwebel den Befehl brachte, dass meine Kompagnie einen Teil der ausrückenden Kolonne bilden solle, da wurde ich bleich wie Leinwand und konnte vor Aufregung nicht reden. Und wenn Sie wüssten, wie ich die Nacht zugebracht habe! Wenn es wahr ist, dass man vor Angst grau wird, dann müsste ich heute vollständig weiß sein; denn sicherlich hat noch nie ein zum Tode Verurteilter in einer Nacht so viel gelitten wie ich. Und obgleich mir jetzt etwas leichter zumute ist als in der Nacht, so bewegt sich doch selbst jetzt bei mir hier etwas«, fügte er hinzu, indem er die Faust vor seiner Brust hin und her drehte. »Und das Lächerliche dabei«, fuhr er fort, »ist dies: Es spielt sich hier die furchtbarste Tragödie ab, man selbst aber isst Zwiebelklops und redet sich ein, das sei sehr lustig. Ist Wein da, Nikolajew?«, fügte er gähnend hinzu.
»Da ist er, Brüder!«, hörten wir in diesem Augenblicke einen Soldaten in erregtem Ton sagen, und alle Augen wandten sich nach dem Saum des fernen Waldes hin.
Eine bläuliche Rauchwolke vergrößerte sich in der Ferne und stieg, vom Wind getrieben, in die Höhe. Als ich begriff, dass das ein auf uns gerichteter Schuss des Feindes war, nahm alles, was ich in diesem Augenblick vor Augen hatte, auf einmal einen neuen, großartigen Charakter an. Die zusammengestellten Gewehre und der Rauch der Wachtfeuer und der blaue Himmel und die grünen Lafetten und Nikolajews gebräuntes, schnurrbärtiges Gesicht, alles dies sagte mir gleichsam, dass die Kanonenkugel, die schon aus dem Rauch herausgeflogen war und in diesem Augenblick durch den freien Luftraum flog, vielleicht geradeswegs die Richtung auf meine Brust nehmen werde.
»Wo haben Sie denn den Wein her?«, fragte ich Bolchow in lässigem Ton, während in der Tiefe meiner Seele zwei Stimmen gleich deutlich sprachen; die eine sagte: »Herr, nimm meine Seele in Frieden auf!«, die andere: »Ich hoffe, dass ich in dem Augenblick, wo die Kugel vorbeifliegen wird, mich nicht ducken, sondern lächeln werde« –, und in demselben Augenblick pfiff etwas schrecklich Unangenehmes über meinen Kopf hin, und die Kanonenkugel klatschte zwei Schritte von uns entfernt auf die Erde.
»Na, wenn ich Napoleon oder Friedrich der Große wäre«, sagte in diesem Augenblick Bolchow, indem er sich ganz kaltblütig zu mir wandte, »so würde ich unfehlbar irgendeine Liebenswürdigkeit zu Ihnen sagen.«
»Sie haben ja auch jetzt eine gesagt«, antwortete ich und verbarg nur mit Mühe die Aufregung, in die mich die glücklich vorübergegangene Gefahr versetzt hatte.
»Was hilft es, dass ich eine gesagt habe; es zeichnet sie ja niemand auf.«
»Nun, so werde ich sie aufzeichnen.«
»Aber wenn Sie sie auch aufzeichnen, so tun Sie es doch nur, um sie zu kritisieren, wie Mischtschenkow sagt«, fügte er lächelnd hinzu.
»Pfui, du verdammtes Biest!«, sagte in diesem Augenblick hinter uns Antonow und spuckte ärgerlich nach der Seite aus. »Beinah hätte sie meine Beine getroffen.«
All mein Bemühen, kaltblütig zu erscheinen, und alle unsere schlauen Redewendungen schienen mir auf einmal unsagbar dumm neben diesem treuherzigen Ausruf.
VII
Der Feind hatte wirklich zwei Geschütze an der Stelle postiert, wo die Tataren umhergeritten waren, und gab alle zwanzig oder dreißig Minuten einen Schuss auf unsere Holzfäller ab. Meine Korporalschaft wurde auf die Waldwiese vorgeschoben mit dem Befehl, ihm zu antworten. An dem Waldsaum zeigte sich ein Rauchwölkchen; es ertönten ein Schuss und ein Pfeifen, und eine Kugel fiel hinter oder vor uns nieder. Die Geschosse des Feindes fielen glücklich, und wir hatten keine Verluste.
Die Artilleristen hielten sich, wie immer, vorzüglich: Sie luden flink, richteten sorgfältig nach dem sich zeigenden Rauch und scherzten ruhig untereinander. Die Infanteriebedeckung lag in schweigender Untätigkeit neben uns und wartete, bis die Reihe an sie käme. Die Holzfäller verrichteten ihre Arbeit: Die Äxte erklangen im Wald immer schneller und häufiger; nur in dem Augenblick, wo sich das Pfeifen eines Geschosses hören ließ, verstummte alles plötzlich; inmitten der Totenstille erscholl der etwas aufgeregte Ruf: »Aus dem Weg, Kinder!«, und alle Augen richteten sich auf die Kugel, die bei den Wachtfeuern und den abgehauenen Ästen aufschlug und weitersprang.
Der Nebel war schon vollständig in die Höhe gestiegen, hatte die Gestalt von Wolken angenommen und verschwand allmählich an dem dunkelblauen Himmel; die hervorgekommene Sonne schien hell und warf heitere Lichter auf den Stahl der Bajonette, das Kupfer der Geschütze, die auftauende Erde und die Reifkristalle. In der Luft spürte man gleichzeitig die Frische des Morgenfrosts und die Wärme der Frühlingssonne; tausend verschiedene Schatten und Farben mischten sich in den trockenen Blättern des Waldes, und auf dem ausgefahrenen, glänzenden Weg sah man deutlich die Spuren der Radschienen und der Hufeisendornen.
Bei den Truppen wurde die Bewegung lebhafter und merklicher. Auf allen Seiten zeigten sich immer häufiger die bläulichen Rauchwölkchen von Schüssen. Die Dragoner mit den flatternden Lanzenfähnchen ritten voran; in den Kompagnien der Infanterie erschollen Lieder, und der Wagenzug mit dem Holz begann sich im Rücken der Kolonne zu ordnen. Zu unserer Korporalschaft kam der General herangeritten und befahl, wir sollten uns zum Rückzug bereitmachen. Der Feind hatte sich in dem Gebüsch unserer linken Flanke gegenüber festgesetzt und fing an, uns durch Gewehrfeuer stark zu beunruhigen. Von links her kam aus dem Wald eine Flintenkugel geflogen und schlug in eine Lafette, dann eine zweite, eine dritte. Die Infanteriebedeckung, die neben uns lag, erhob sich geräuschvoll, griff nach den Gewehren und bildete eine Schützenkette. Das Gewehrfeuer wurde stärker, und die Kugeln flogen immer häufiger. Der Rückzug begann und damit der eigentliche Kampf, wie das im Kaukasus immer ist.
An allen Anzeichen konnte man sehen, dass den Artilleristen die Gewehrkugeln ebenso missfielen, wie vorher die Kanonenkugeln den Infanteristen. Antonow zog ein sehr mürrisches Gesicht. Tschikin äffte den Ton der Kugeln nach und machte über sie seine Scherze; aber es war klar, dass sie sein Missvergnügen erregten. Von der einen sagte er: »Wie eilig sie es hat!«, eine andere nannte er »Bienchen«; eine dritte, die mit einer Art von gedehntem, kläglichem Winseln über uns hinflog, nannte er ein »Waisenkind«, wodurch er allgemeines Gelächter hervorrief.
Der junge Rekrut, der daran noch nicht gewöhnt war, bog bei jeder Kugel den Kopf auf die Seite und streckte den Hals aus, was ebenfalls die Soldaten zum Lachen brachte; »das ist wohl eine Bekannte von dir, dass du sie grüßt?«, sagten sie zu ihm. Auch Welentschuk, der sonst immer in Gefahren einen außerordentlichen Gleichmut bewies, war jetzt aufgeregt: Es ärgerte ihn offenbar, dass wir nicht mit Kartätschen nach der Richtung hinschossen, von wo die Kugeln geflogen kamen. Er sagte mehrere Male in unzufriedenem Tone: »Soll er uns denn ungestraft belästigen? Wenn man ein Geschütz dorthin richtete und mit Kartätschen hinüberpfefferte, dann würde er schon still werden.«
In der Tat war es an der Zeit, dies zu tun; ich befahl, die letzte Granate abzuschießen und dann mit Kartätschen zu laden.
»Kartätschen!«, rief Antonow triumphierend und trat, sowie nur das Geschoss herausgeflogen war, im dicksten Rauch mit dem Stückwischer an das Geschütz heran.
In diesem Augenblick hörte ich nicht weit hinter mir den schnellen, summenden Ton einer Gewehrkugel, der plötzlich mit einem trockenen Aufschlagen auf etwas abbrach. Das Herz zog sich mir zusammen. »Ich glaube, einer von den Unsrigen ist getroffen«, dachte ich; aber von dieser bedrückenden Ahnung zurückgehalten, fürchtete ich mich zugleich, mich umzuwenden. Wirklich wurde nach jenem Ton der schwere Fall eines Körpers hörbar und »o-o-o-oi!« das herzzerreißende Stöhnen eines Verwundeten. »Ich bin getroffen, Brüder!«, sagte mühsam eine Stimme, die ich kannte. Es war Welentschuk. Er lag zwischen der Protze und dem Geschütz auf dem Rücken. Der Quersack, den er getragen hatte, war seitwärts hingefallen. Die Stirn war ganz voll Blut, und über das rechte Auge und die Nase lief ein dicker, roter Strom. Seine Wunde war im Unterleib; aber an ihr war fast gar kein Blut; die Stirn hatte er sich beim Fall an einem Baumstumpf zerschlagen.
Alles dies wurde mir erst viel später klar; im ersten Augenblick sah ich nur eine undeutliche Masse und eine, wie es mir schien, furchtbare Menge Blut.
Keiner von den Soldaten, die das Geschütz luden, sagte ein Wort; nur der junge Rekrut murmelte etwas, das ungefähr so klang: »Nun seh einer, wie blutig«, und Antonow räusperte sich ärgerlich mit finsterem Gesichte; aber an allem konnte man merken, dass der Gedanke an den Tod einem jeden durch die Seele ging. Alle machten sich mit noch größerer Geschäftigkeit an ihre Arbeit. Das Geschütz war in einem Augenblick geladen, und der Soldat, der die Kartätsche herbeitrug, ging in einer Entfernung von etwa zwei Schritten um die Stelle herum, wo der immer noch stöhnende Verwundete lag.
VIII
Jeder, der in einem Gefecht gewesen ist, hat gewiss das seltsame, zwar unlogische, aber starke Gefühl des Widerwillens vor der Stelle kennengelernt, wo jemand getötet oder verwundet worden ist. Diesem Gefühl waren offenbar meine Soldaten im ersten Augenblick unterworfen, als Welentschuk aufgehoben und auf das herbeigekommene Fuhrwerk geladen werden sollte. Schdanow trat ärgerlich zu dem Verwundeten, fasste ihn trotz seines gesteigerten Schreiens unter die Achseln und hob ihn auf. »Was steht ihr da? Fasst mit an!«, rief er, und sogleich umringten den Verwundeten etwa zehn Mann, mehr Helfer als nötig waren. Aber kaum bewegten sie ihn von der Stelle, als Welentschuk furchtbar zu schreien anfing und sich loszureißen suchte.
»Was schreist du wie ein Hase!«, sagte Antonow und hielt ihn derb am Beine fest. »Sei still, sonst lassen wir dich liegen.«
Und wirklich verstummte der Verwundete und sagte nur noch ab und zu: »Oh, das ist mein Tod; o-oh, Brüder!«
Als sie ihn aber auf das Fuhrwerk gelegt hatten, hörte er sogar auf zu ächzen, und ich hörte, dass er mit leiser, aber vernehmlicher Stimme etwas zu seinen Kameraden sagte; wahrscheinlich nahm er von ihnen Abschied.
Im Gefecht mag niemand gern einen Verwundeten ansehen, und so beeilte auch ich mich instinktiv, mich von diesem Schauspiel zu entfernen, befahl, ihn so schnell wie möglich nach dem Verbandplatz zu bringen, und begab mich zu den Geschützen; aber ein paar Minuten darauf wurde mir gesagt, Welentschuk verlange nach mir, und so ging ich denn zu dem Fuhrwerk hin.
Auf dem Boden des Karrens, mit beiden Händen sich am Rand festhaltend, lag der Verwundete. Sein gesundes, breites Gesicht hatte sich in den wenigen Minuten vollständig verändert: Er schien magerer und um mehrere Jahre älter geworden zu sein; seine Lippen waren schmal und blass und mit sichtlicher Anstrengung zusammengepresst; den hastigen, stumpfen Ausdruck seines Blickes hatte ein klarer, ruhiger Glanz abgelöst, und auf der blutigen Stirn und Nase lagen bereits die Züge des Todes.
Obwohl selbst die kleinste Bewegung ihm unerträgliche Schmerzen verursachte, bat er doch, man möchte von seinem linken Beine den Geldtscheres5 abnehmen.
5Tscheres ist ein gürtelartiges Beutelchen, das die Soldaten gewöhnlich unterhalb des Knies tragen.
Ein furchtbar peinliches Gefühl rief bei mir der Anblick seines nackten, weißen, gesunden Beines hervor, als der Stiefel von ihm heruntergezogen und der Tscheres abgebunden wurde.
»Es sind drei und ein halber Rubel darin«, sagte er zu mir, als ich den Tscheres in die Hand nahm; »bitte, nehmen Sie die in Verwahrung!«
Das Fuhrwerk setzte sich in Bewegung; aber er ließ es noch einmal anhalten.
»Ich habe für den Leutnant Sulimowsky einen Mantel gearbeitet. Er hat mir zwei Rubel gegeben. Für anderthalb Rubel habe ich Knöpfe gekauft, und der halbe Rubel steckt bei mir zu Hause in dem Beutel mit den Knöpfen. Geben Sie ihm das ab!«
»Schön, schön!«, sagte ich; »werde nur wieder gesund, Bruder!«
Er gab mir keine Antwort; das Fuhrwerk setzte sich in Bewegung, und er begann von Neuem in einer ganz entsetzlichen, herzzerreißenden Weise zu stöhnen und zu ächzen. Jetzt, wo er mit den irdischen Dingen fertig war, fand er, wie es schien, keinen Grund mehr, sich Zwang aufzuerlegen, und hielt es nun für erlaubt, sich diese Erleichterung zu verschaffen.
IX
»Wohin willst du? Komm zurück! Wo willst du hin?«, rief ich dem jungen Rekruten zu, der seine Reservezündrute unter den Arm genommen hatte und mit irgendeinem Stöckchen in der Hand höchst kaltblütig hinter dem Wagen herging, auf dem der Verwundete wegtransportiert wurde.
Aber der Rekrut warf nur einen lässigen Blick nach mir zurück, murmelte etwas vor sich hin und ging weiter, sodass ich Soldaten nachschicken musste, ihn zurückzuholen. Er nahm sein rotes Mützchen ab und sah mich mit einem dummen Lächeln an.
»Wo wolltest du denn hin?«, fragte ich ihn.
»Ins Lager.«
»Warum?«
»Aber … Welentschuk ist doch verwundet«, sagte er, wieder lächelnd.
»Was geht dich das an? Du hast hier zu bleiben.« Er blickte mich erstaunt an; dann drehte er sich gleichmütig um, setzte seine Mütze auf und begab sich auf seinen Platz.
Das Gefecht hatte im Ganzen einen glücklichen Verlauf genommen: Die Kosaken hatten, wie verlautete, eine prächtige Attacke gemacht und drei Tataren gefangen genommen; die Infanterie hatte sich mit Holz versorgt und nur sechs Verwundete verloren; bei der Artillerie betrug der Abgang von der Mannschaft nur den einen, Welentschuk, und außerdem zwei Pferde. Dafür war der Wald in einer Ausdehnung von ungefähr drei Werst niedergeschlagen und der Platz so gesäubert, dass er gar nicht wiederzuerkennen war; an der Stelle, wo früher ein dichter Waldsaum zu sehen gewesen war, tat sich jetzt eine gewaltige Lichtung auf, bedeckt von rauchenden Wachtfeuern und von der Kavallerie und Infanterie, die sich nach dem Lager zu in Bewegung setzten. Obwohl der Feind nicht aufhörte, uns mit Artillerie- und Infanteriefeuer zu verfolgen, bis ganz zu dem Flüsschen mit der Begräbnisstätte, das wir am Morgen passiert hatten, wurde der Rückzug doch glücklich bewerkstelligt. Ich begann schon an die Kohlsuppe und an die Grütze mit Hammelfleisch zu denken, die mich im Lager erwarteten, als die Nachricht kam, der General habe befohlen, es solle an dem Flüsschen eine Schanze gebaut werden und das dritte Bataillon des K.-Regimentes und eine Korporalschaft der vierten Batterie bis morgen in derselben verbleiben. Die Fuhrwerke mit dem Holz und den Verwundeten, die Kosaken, die Artillerie, die Infanterie mit den Gewehren und mit Holzkloben auf den Schultern, alle zogen lärmend und singend an uns vorbei. Auf allen Gesichtern malte sich die Munterkeit und Freude, die durch die glücklich überstandene Gefahr und durch die Hoffnung auf Erholung hervorgerufen war. Nur wir und das dritte Bataillon mussten auf diese angenehmen Gefühle noch bis zum folgenden Tag warten.
X
Während wir Artilleristen noch mit den Geschützen beschäftigt waren, die Protzen und Munitionswagen aufstellten, Pfähle zum Anbinden der Pferde einschlugen, hatte die Infanterie schon die Gewehre zusammengestellt, Wachtfeuer angezündet, aus Ästen und Maisstroh Hütten gebaut und kochte nun ihre Grütze.
Es fing an zu dämmern. Am Himmel krochen bläulich-weiße Wolken dahin. Der Nebel, der sich zu feinen Tröpfchen verdichtet hatte, nässte die Erde und die Mäntel der Soldaten; der Horizont zog sich zusammen, und die ganze Umgegend hüllte sich in düstere Schatten. Die Feuchtigkeit, die ich durch die Stiefel hindurch und hinten am Hals spürte, die ununterbrochene Bewegung und das Gespräch, an dem ich mich nicht beteiligte, der klebrige Schmutz, in dem meine Füße ausglitten, und der leere Magen riefen bei mir nach einem Tag voll physischer und seelischer Ermattung eine höchst bedrückte, unangenehme Gemütsstimmung hervor. Welentschuk kam mir nicht aus dem Sinn. Die ganze schlichte Geschichte seines Soldatenlebens trat mir vor die Seele, und ich vermochte diese Bilder nicht zu verscheuchen.
Seine letzten Augenblicke waren ebenso klar und ruhig gewesen wie sein ganzes Leben. Er hatte zu ehrenhaft und schlicht gelebt, als dass sein treuherziger Glaube an ein zukünftiges, himmlisches Leben im entscheidenden Augenblick hätte wankend werden können.
»Euer Gnaden«, sagte Nikolajew, der zu mir herantrat, »haben Sie die Güte, zum Hauptmann zu kommen; er lässt Sie zum Tee bitten.«
Ich drängte mich hinter Nikolajew her mühsam durch die zusammengestellten Gewehre und Wachtfeuer hindurch und gelangte endlich zu Bolchow. Mit Vergnügen dachte ich an ein Glas heißen Tees und an ein fröhliches Gespräch, das meine düsteren Gedanken vertreiben würde. »Nun, hast du ihn gefunden?«, erscholl Bolchows Stimme aus einer Maishütte, in der ein Lichtchen brannte.
»Ich habe ihn hergebracht, Euer Wohlgeboren!«, antwortete Nikolajew mit seiner Bassstimme.
In der Hütte saß Bolchow auf einem trockenen Filzmantel, mit aufgeknöpftem Rock und ohne Mütze. Neben ihm siedete ein Samowar und stand eine Trommel mit kalten Speisen. Ein Bajonett mit einem Licht war in die Erde gesteckt. »Nun, was sagen Sie dazu?«, sagte er mit Stolz, indem er seinen Blick über seine behagliche Einrichtung hingleiten ließ. In der Tat war es in der Hütte so hübsch, dass ich beim Tee die Nässe, die Dunkelheit und Welentschuks Verwundung vollständig vergaß. Wir redeten von Moskau, von Dingen, die mit dem Krieg und dem Kaukasus in gar keiner Beziehung standen.
Nach einer jener Pausen, wie sie auch in den lebhaftesten Gesprächen manchmal vorkommen, sah mich Bolchow lächelnd an.
»Ich glaube, unser Gespräch heute Vormittag ist Ihnen sehr sonderbar vorgekommen?«, sagte er.
»Nein. Wieso? Es schien mir nur, als seien Sie zu offenherzig; es gibt aber doch Dinge, die wir alle wissen, von denen man aber nie reden darf.«
»Warum sollte man nicht davon reden? Ja, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dieses Leben mit dem elendesten, ärmlichsten Leben, nur ohne Gefahren und ohne den Dienst, zu vertauschen, so würde ich mich keinen Augenblick bedenken.«
»Warum kehren Sie denn nicht nach Russland zurück?«, fragte ich.
»Warum?«, wiederholte er. »Oh, daran habe ich schon längst gedacht. Aber ich kann jetzt nicht eher nach Russland zurückkehren, ehe ich nicht den Anna- und den Wladimirorden erhalten habe, den Annaorden am Hals und den Major; darauf habe ich, als ich hierher ging, gerechnet.«
»Warum kehren Sie denn nicht zurück, wenn Sie sich für den hiesigen Dienst nicht geeignet fühlen, wie Sie selbst sagen?«
»Aber wenn ich mich nun noch unfähiger fühle, nach Russland in demselben Zustand zurückzukehren, in dem ich hierhergekommen bin? Das ist auch eine der in Russland bestehenden, von Passet, Slepzow und anderen noch mehr befestigten Traditionen, dass man nur nach dem Kaukasus zu gehen braucht, um mit Auszeichnungen überschüttet zu werden. Und alle Leute erwarten und verlangen das von uns; ich aber bin nun schon zwei Jahre hier und habe an zwei Expeditionen teilgenommen und doch nichts erhalten. Trotzdem jedoch besitze ich so viel Ehrgeiz, dass ich um keinen Preis von hier weggehen will, ehe ich nicht Major mit dem Wladimir- und dem Annaorden am Hals bin. An diese Denkweise habe ich mich schon so gewöhnt, dass ich mich ärgere, wenn Gnilokischkin eine Auszeichnung erhält und ich nicht. Und dann, wie soll ich in Russland meinem Dorfschulzen, dem Kaufmann Kotelnikow, dem ich mein Getreide verkaufe, meiner Tante in Moskau und all diesen Herrschaften unter die Augen treten, wenn ich zwei Jahre im Kaukasus gewesen bin, ohne irgendwelche Auszeichnung erhalten zu haben? Allerdings sind mir diese Herrschaften höchst gleichgültig, und ihrerseits machen sie sich aus mir gewiss ebenfalls herzlich wenig; aber das liegt nun einmal in der Natur des Menschen, dass sie mir gleichgültig sind und ich mir doch um ihretwillen meine besten Lebensjahre, mein ganzes Lebensglück und meine ganze Zukunft verderbe.«
XI
In diesem Augenblick ließ sich von draußen die Stimme des Bataillonskommandeurs vernehmen: »Mit wem reden Sie denn da, Nikolai Fedorowitsch?«
Bolchow nannte meinen Namen, und gleich darauf kamen drei Offiziere in die Hütte hereingekrochen: der Major Kirsanow, sein Bataillonsadjutant und der Kompagniechef Trossenko.
Kirsanow war ein kleiner, korpulenter Mann mit einem schwarzen Schnurrbärtchen, roten Backen und ölig glänzenden Äuglein. Diese Äuglein waren der auffälligste Teil seines Gesichtes. Wenn er lachte, blieben von ihnen nur zwei feuchte Sternchen übrig, und diese Sternchen nahmen, im Verein mit den gespannten Lippen und dem ausgestreckten Hals, manchmal einen recht seltsamen Ausdruck von Stumpfsinn an. Kirsanow führte sich und hielt sich im Regimente besser als jeder andere: Seine Untergebenen schimpften nicht auf ihn, und seine Vorgesetzten achteten ihn, wiewohl die allgemeine Meinung über ihn dahin ging, dass es mit ihm nicht weit her sei. Er verstand seinen Dienst, war pünktlich und eifrig, hatte immer Geld, besaß einen Wagen, hielt sich einen Koch und verstand es, sehr natürlich den Stolzen zu spielen.
»Wovon reden Sie denn da, Nikolai Fedorowitsch?«, fragte er im Eintreten.
»Wir sprachen von den Annehmlichkeiten des hiesigen Dienstes.«
Aber in diesem Augenblick bemerkte Kirsanow mich, den Fähnrich; um mich daher seine Bedeutung fühlen zu lassen, tat er, als hätte er Bolchows Antwort nicht gehört, richtete seinen Blick auf die Trommel und fragte:
»Nun, sind Sie müde geworden, Nikolai Fedorowitsch?«
»Nein, wir …« begann Bolchow.
Aber wieder verlangte wohl die Würde des Bataillonskommandeurs, dass dieser den Redenden unterbrach und eine neue Frage stellte: