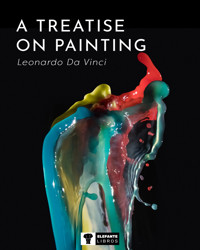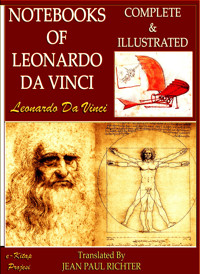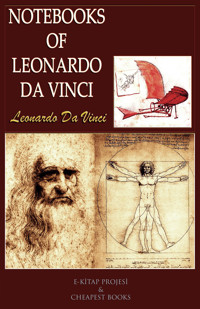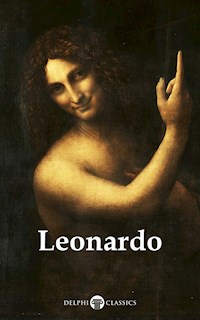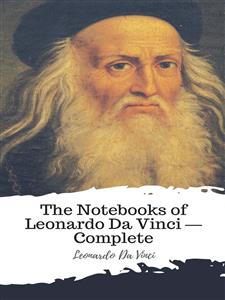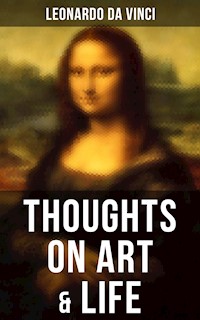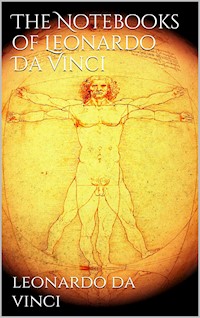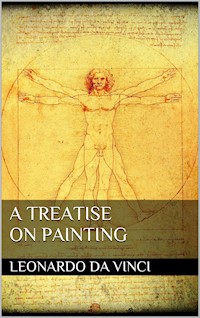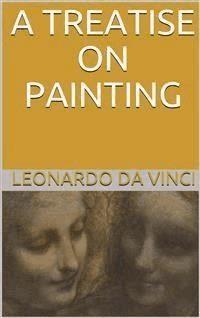1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In "Leonardo da Vinci: Gedanken über Kunst und Leben" entfaltet der Meister der Renaissance seine Überlegungen zu den komplexen Verflechtungen von Kunst, Natur und menschlichem Leben. Der Leser wird in die tiefgründigen Reflexionen eines Mannes eingeführt, der nicht nur Maler, sondern auch Wissenschaftler, Erfinder und Philosoph war. Da Vinci kombiniert in seinem literarischen Stil analytische Schärfe mit poetischen Bildern, wodurch seine Gedanken lebendig und ansprechend werden. Durch seine einzigartigen Perspektiven auf die menschliche Kreativität und die Wahrnehmung der Welt gibt er Einblicke, die weit über seine Zeit hinausreachen und bis heute inspirierend wirken. Leonardo da Vinci, geboren 1452 in Vinci, war nicht nur ein genialer Künstler, sondern auch ein vielseitiger Wissenschaftler, dessen Neugier und Innovationsgeist ihn zu einem der bedeutendsten Denker der Geschichte machten. Sein unermüdlicher Drang, die Welt um sich herum zu verstehen, spiegelt sich in jedem seiner Werke wider. Die Zusammenstellung seiner Gedanken aus verschiedenen Schaffensperioden bietet einen einzigartigen Einblick in die Motivation und die philosophischen Überlegungen, die hinter seinen weltberühmten Kunstwerken und Erfindungen stehen. Dieses Buch ist nicht nur für Kunstliebhaber von Bedeutung, sondern auch für alle, die nach einem tieferen Verständnis von Kreativität und Menschlichkeit streben. Da Vinci's Überlegungen ermutigen den Leser, die Grenzen des Bekannten zu überschreiten und die eigene schöpferische Kraft zu erkennen. Ein unverzichtbares Werk für jeden, der die Essenz der Renaissance begreifen möchte. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Leonardo da Vinci: Gedanken über Kunst und Leben
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
Die lange Dunkelheit des Mittelalters hob sich über Italien und weckte ein nationales, wenn auch geteiltes Bewusstsein. Schon waren zwei unterschiedliche Tendenzen erkennbar. Die praktische und rationale Tendenz sollte sich bald im bürgerlichen Leben von Florenz und den lombardischen Städten äußerlich vor Augen halten, während sie in Rom bereits die zivile Organisation der Wahlkurien geschaffen hatte. Die Novelle war ihr literarischer Triumph. In der Kunst drückte sie sich einfach, direkt und kraftvoll aus. Dem gegenüber stand die andere große Strömung im italienischen Leben, die mystische, religiöse und spekulative, die seit frühester Zeit durch die Nation gezogen war und durch das mittelalterliche Christentum neuen Auftrieb erhielt, der den ekstatischen Mystizismus anfachte und die Bevölkerung der Bergstädte in Raserei versetzte. Die umbrische Malerei ist davon inspiriert, und die glühenden Worte von Jacopone da Todi drückten in der Poesie dieselbe religiöse Inbrunst aus, die das Leben in Florenz und Perugia in Taten bezeugte.
Aus dem Verhältnis und Konflikt dieser beiden Kräfte, der rationalen und der mystischen, entwickelte sich Italien. Ihre spätere Vereinigung in den großen Persönlichkeiten sollte das künstlerische Temperament der Renaissance bilden. Die praktische Seite gab ihr das feste Fundament des Rationalismus und der Realität, auf dem sie ruhte; die mystische Seite leitete ihr Bestreben, das Unwirkliche in idealer Schönheit darzustellen.
Der erste Sprössling dieser Verbindung war Leonardo. Seit dem Niedergang der antiken Kunst hatte kein Maler mehr die menschliche Gestalt vollständig zum Ausdruck bringen können, denn die unvollkommene Beherrschung der Technik stellte noch immer ein Hindernis dar. Leonardo war der erste, der seine Persönlichkeit vollständig von diesen Zwängen befreite und die Linie zum Ausdruck von Gedanken werden ließ, wie es vor ihm noch niemandem gelungen war. Dies war jedoch nicht sein einziger Triumph, sondern vielmehr das Fundament, auf dem weitere Errungenschaften ruhten. Obwohl er schon als Denker bemerkenswert war, wollte er seine Gedanken lieber in den Dienst der Kunst stellen und die Kunst zur Dienerin der Schönheit machen. Leonardo sah die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie er selbst war. Er betrachtete sie durch die Atmosphäre der Schönheit, die seinen Geist erfüllte, und färbte ihre Schatten mit dem Geheimnis seiner Natur. Zu all dem kam noch sein Geburtsrecht als Maler hinzu. Ein brennender Wissensdrang, der sein Handeln im Leben leitete, trieb ihn voran. Im Bewusstsein dieses dominierenden Impulses hat er sich selbst in einer platonischen Allegorie fantasievoll beschrieben. Auf dem Weg zu einer großen Höhle war er unter überhängenden Felsen hindurchgegangen. Auf Knien, durch die Dunkelheit spähend, hatten ihn Angst und Verlangen überwältigt – Angst vor der bedrohlichen Dunkelheit der Höhle und Verlangen, , ob sich darin Wunder befanden.
Schon in seinen frühesten Jahren zeigten sich bei Leonardo die Anlagen zur Größe. Doch die Reife seines Genies entwickelte sich unbeeinflusst von äußeren Einflüssen. Die gewaltigen Kräfte seiner Zeit, denen er im Leben begegnete, nahm er kaum zur Kenntnis. Nach dem ersten verheißungsvollen Auftreten seiner Knabenzeit in den toskanischen Hügeln verbrachte er seine Jugend in Florenz unter Verrocchio als Meister, im Kreise jener, deren Namen später die Seiten der italienischen Kunstgeschichte erhellen sollten. Er muss damals die leidenschaftlichen Predigten Savonarolas gehört haben, doch – anders als Botticelli – blieb er taub für dessen Mahnungen. Er muss Lorenzo den Prächtigen gesehen haben. Doch im mediceischen Kreis bot sich dem jungen Maler wenig Gelegenheit; er musste sich erst im Ausland einen Namen machen. Der Glanz von Mailand unter Il Moro, damals der glänzendste Hof Europas, zog ihn an. Dorthin begab er sich, seine Fähigkeiten in einem bemerkenswerten Schreiben anpreisend, in dem er vieles zu leisten versprach, jedoch vor allem den Wunsch äußerte, ein großes Denkmal zum Ruhm der Sforza zu errichten. Er verbrachte Jahre an diesem Hof, beschäftigt mit seinen vielfältigen Unternehmungen – Malerei, Bildhauerei, Ingenieurskunst, ja selbst mit der Ausrichtung von Festlichkeiten –, doch sein größeres Vorhaben war dem Scheitern geweiht, verstrickt in den Untergang Ludovicos. Selbst diesem begegnete er mit Gleichmut. „Visconti ins Gefängnis geschleppt, sein Sohn tot, … der Herzog hat seinen Staat, seinen Besitz, seine Freiheit verloren und nichts von dem vollendet, was er unternahm“, war sein einziger Kommentar zum Ende seines Gönners, niedergeschrieben am Rand eines Manuskripts. Nach dem Sturz des Herzogs von Mailand begannen seine Wanderjahre durch Italien. Eine Zeitlang erwog er, in den Dienst eines orientalischen Fürsten zu treten. Stattdessen trat er in den Dienst Cäsar Borgias, als militärischer Ingenieur, und der größte Maler seiner Zeit wurde zum Inspekteur der Festungen eines Despoten. Doch seine ruhelose Natur hielt ihn nicht lange dort. Nach seiner Rückkehr nach Florenz trat er in Konkurrenz zu Michelangelo; doch selbst der Dienst seiner Vaterstadt konnte ihn nicht halten. Sein Ruhm hatte die Aufmerksamkeit eines neuen Mäzens der Künste erregt, des Fürsten jenes Staates, der seinen ersten Herrn besiegt hatte. In diesem letzten Unternehmen verließ er Italien – nur um drei Jahre später in Amboise, im Schloss des französischen Königs, zu sterben.
Leonardos inneres Wesen blieb von den Menschen, denen er begegnete, ebenso unberührt wie von den Ereignissen, die damals Europa erschütterten. Allein übte er Einfluss auf andere aus und blieb dabei für alle ein Rätsel. Die begabteste aller Nationen verstand ihren größten Sohn nicht. Isabella d'Este, die erste Dame ihrer Zeit, die vergeblich versuchte, ein Werk aus seiner Hand zu bekommen, erfuhr, dass sein Leben wechselhaft und unbeständig sei, dass er nur für den Tag lebe und sich ausschließlich seiner Kunst widme. Seine eigenen Gedanken zeigen ihn in einem anderen Licht. „Ich möchte Wunder vollbringen“, schrieb er. Und an anderer Stelle rief er aus: „Du, o Gott, verkaufst uns alle Wohltaten zum Preis unserer Mühen ... So wie ein gut verbrachter Tag den Schlaf angenehm macht, so macht ein gut genutztes Leben den Tod angenehm. Ein gut verbrachtes Leben ist lang.“
Leonardos ästhetische Ansichten sind für seine Lebens- und Kunstphilosophie von großer Bedeutung. Die Gedanken eines Arbeiters über sein Handwerk sind immer interessant. Das gilt umso mehr, wenn sie keine Spur von literarischem Selbstbewusstsein enthalten, das ihren Ausdruck beeinträchtigen könnte. Er hielt diese Gedanken im Moment ihrer Entstehung fest, denn eine ständige Gewohnheit der Beobachtung und Analyse war ihm schon früh zur zweiten Natur geworden. Seine Ideen wurden so fragmentarisch niedergeschrieben, wie sie ihm in den Sinn kamen, vielleicht ohne die Absicht, sie der Welt zu veröffentlichen. Aber sein Kunstideal hing trotzdem eng mit dem System zusammen, das er scheinbar so willkürlich verworfen hatte. Seine Methode gibt seinen Schriften ihre einzige Einheit. Sie war mehr als eine Methode: Sie war ein dauerhafter Ausdruck seines eigenen Lebens, der ihm half, eine für das neue Zeitalter charakteristische Philosophie der Schönheit zu entwickeln.
Er hatte nach einer wissenschaftlichen Grundlage für die Kunst gesucht und sie in der Nachahmung der Natur gefunden, die auf rationaler Erfahrung beruhte. Diese Idee war zum Teil aristotelisch geprägt und vom Zeitgeist durchdrungen, obwohl Leonardo im üblichen Sinne des Wortes kein Gelehrter und schon gar kein Humanist war. Seine eigene Innovation in der Ästhetik bestand darin, dass er eine rationale und kritische Erfahrung als notwendige Grundlage forderte, deren Erwerb sich aus dem permanenten Zustand des Geistes ergeben sollte. Er hatte seine eigenen Fähigkeiten geschult, alle natürlichen Phänomene kritisch zu beobachten: Erst durch Erfahrung ausprobieren und dann zeigen, warum ein solches Experiment so funktionieren muss, wie es funktioniert, lautete sein Rat. Das Auge, so führte er als Beispiel an, sei als eine Sache definiert worden; durch Erfahrung habe er festgestellt, dass es eine andere sei.
Mit Nachahmung in der Kunst meinte Leonardo aber nicht die sklavische Reproduktion der Natur. Als er schrieb, dass „der Maler mit der Natur wetteifert und konkurriert“, war er auf der Spur einer eher aristotelischen Idee. Diese entwickelte er jedoch kaum weiter und verwendete die Natur nur teilweise im Sinne des Stagiriten, nämlich als inneres, nach außen hin zum Ausdruck gebrachtes. Die Idee der Nachahmung, wie sie sich ihm darstellte, war zweierlei. Es ging nicht nur um die äußere Wiedergabe des Bildes, die leicht zu erreichen war. Die eigentliche Schwierigkeit für den Künstler lag darin, den inneren Charakter und die Persönlichkeit vor Augen zu halten. Leonardo war fest davon überzeugt, dass jeder Gedanke einen äußeren Ausdruck hatte, an dem der geübte Betrachter ihn erkennen konnte. Jeder Mensch, schrieb er, habe so viele Körperbewegungen wie Ideen. Darüber hinaus drücke sich der Gedanke nach außen proportional zu seiner Kraft über den Einzelnen und seine Lebenszeit aus. Indem er also Körpergesten einsetzte, um Gefühle und Ideen darzustellen, konnte der Maler den Betrachter, den er in die Gegenwart sichtbarer Emotionen versetzte, beeinflussen. Er behauptete, dass Kunst nur von geringem Nutzen sei, wenn sie nicht in der Lage sei, die Gedanken ihres Gegenstands wiederzugeben. Die Malerei sollte daher darauf abzielen, den inneren Geisteszustand durch die eingenommene Haltung wiederzugeben. Mit anderen Worten handelte es sich um einen natürlichen Symbolismus, in dem das Symbol keine bloße Konvention war, sondern die tatsächliche äußere Projektion des inneren Zustands des Geistes. Die Kunst bot hier eine Gleichung zwischen innerer Absicht und äußerem Ausdruck, wobei das eine ohne das andere nicht vollständig war.
Darüber hinaus war Leonardos Auffassung von der Malerei, beeinflusst vom platonischen Denken, als intellektueller Zustand oder Verfassung nach außen projiziert. Der Maler, der seine Kunst ausübte, ohne über ihre Natur nachzudenken, war wie ein Spiegel, der unbewusst das vor ihm Vorhandene vor Augen hielt. Obwohl Malerei ohne „manuelle Handlung” nicht realisiert werden konnte, mussten ihre wahren Probleme – Probleme des Lichts, der Farbe, der Pose und der Komposition, des primitiven und abgeleiteten Schattens – alle vom Verstand ohne körperliche Arbeit erfasst werden. Darüber hinaus wurde die wissenschaftliche Grundlage der Kunst dadurch geschaffen, dass sie auf einer genauen Kenntnis der Natur beruhte. Selbst die Erfahrung war nur ein Schritt auf dem Weg dorthin. „Es gibt nichts in der ganzen Natur, das ohne Grund ist”, schrieb er. „Wenn man den Grund kennt, braucht man die Erfahrung nicht.”
Auch in der Kunstgeschichte betonte er, dass die Natur der Maßstab für ihre Qualität sei. Ein natürliches Phänomen habe die Kunst ins Leben gerufen. Das erste Bild der Welt sei „eine Linie gewesen, die den Schatten eines Menschen umrandete, den die Sonne an die Wand warf“, bemerkte er in einem fröhlichen Epigramm. Er zeichnete die Geschichte der Malerei in Italien während ihrer Stagnation nach dem Niedergang der antiken Kunst nach, als jeweils jeder Maler nur seinen Vorgänger kopierte, was so lange andauerte, bis Giotto, geboren inmitten karger Berge, die Bewegungen der von ihm gehüteten Ziegen zeichnete und damit allen früheren Meistern überlegen war. Aber seine Nachfolger kopierten nur ihn, und die Malerei versank wieder, bis Masaccio erneut die Natur zum Vorbild nahm.
Eine ganz andere und kämpferische Seite von Leonardos Ästhetik, die ihn dazu zwang, die allgemeinen Grundsätze der Kunst zu formulieren, zeigt sich in seinen Angriffen auf die Poesie und Musik als der Malerei unterlegen. In dieser Zeit des humanistischen Triumphs hatte die Literatur in einer nicht ganz arroganten Weise über die anderen Künste geherrscht. Es gab noch einen weiteren Grund für seinen Angriff auf die Poesie. Leonardo ärgerte sich darüber, dass Maler, die selten gebildete Männer waren, sich nicht gegen die Verleumdungen ihrer Kunst verteidigt hatten. Sein Gegenangriff mag dazu gedient haben, seine eigene geringe Bildung zu verbergen. Er diente aber auch einem anderen Zweck. Durch diese Verteidigung machte er seine Vorstellung von den universellen Prinzipien der Schönheit deutlich. Sein erstes Prinzip lautete allgemein, dass die nützlichste Kunst diejenige sei, die am leichtesten vermittelt werden könne. Die Malerei sei für alle verständlich, da sie das Auge anspreche. Während der Maler sich unmittelbar an die Nachahmung der Natur halte, seien die Werkzeuge des Dichters Worte, die in jedem Land unterschiedlich seien. Er vertrat die platonische Auffassung, dass die Poesie eine lügnerische Nachahmung sei, die von der Wahrheit entfernt sei. Er nannte den Dichter einen Sammler der Waren anderer, der sich mit ihrem Gefieder schmückte. Wo die Dichtung der Fantasie nur einen Schatten präsentierte, bot die Malerei dem Auge ein reales Bild; und das Auge, als Fenster der Seele, durch das sich alle irdische Schönheit offenbarte, der Sehsinn, der die Seefahrt entdeckt und die Menschen dazu getrieben hatte, den Westen zu suchen, war der edelste aller Sinne. Die Malerei sprach nur durch das, was sie vollbrachte, die Poesie endete in den Worten, mit denen sie sich selbst lobte. Wenn also die Dichter die Malerei als stumme Poesie bezeichneten, konnte er ihnen entgegenhalten, dass die Poesie blinde Malerei sei. Wie seine Nachfolger konnte sich Leonardo diesem Trugschluss nicht entziehen, der, indem er alles außer der beschreibenden Dichtung übersah, dazu bestimmt war, die Ästhetik zu belasten, bis er von Lessing überwunden wurde.
Leonardo war der Meinung, dass die Vergänglichkeit der Musik sie der Malerei unterlegen machte. Obwohl Dauerhaftigkeit an sich kein absoluter Maßstab war – sonst wären die Werke der Kupferschmiede die höchste Kunst –, konnte sie in einer abschließenden Bewertung doch nicht völlig außer Acht gelassen werden. Musik verging im Moment ihrer Entstehung, während die Malerei das Schöne vor dem Zahn der Zeit bewahrte. „Helena von Troja, die in ihrem hohen Alter in einen Spiegel blickte, fragte sich, wie sie zweimal entführt worden war.“ Sterbliche Schönheit würde somit verschwinden, wenn sie nicht durch die Kunst vor dem zerstörerischen Einfluss von Alter und Tod bewahrt würde.
Leonardo stellte die Malerei der Bildhauerei gegenüber, da er beide Künste ausgeübt hatte und sich für besonders qualifiziert hielt, ihren Wert zu beurteilen. Er hielt die Malerei für die edlere Kunst, da die Bildhauerei körperliche Anstrengung und Mühe erforderte, während ihr von Natur aus Perspektive und Atmosphäre, Farbe und Raumgefühl fehlten. Die Malerei hingegen, die eine Illusion hervorruft, war an sich das Ergebnis tieferer Gedanken. Ein noch umfassenderer Test stand ihm zur Seite, um ihn von ihrer endgültigen Überlegenheit zu überzeugen. Die Kunst, die die meisten Elemente der Vielfalt und Universalität besaß, sei die höchste Vollkommenheit, schrieb er. Die Malerei enthielt und reproduzierte alle Formen der Natur; sie übte ihre Anziehungskraft durch die harmonische Ausgewogenheit der Teile aus, die alle Sinne erfreute. Durch ihre Dualität erfüllte sie den höchsten Zweck. Der Maler war in der Lage, die Schönheit, die ihn verzauberte, zu visualisieren, die Fantasie seiner Träume Wirklichkeit werden zu lassen und dem Ideal in ihm äußeren Ausdruck zu verleihen.
Das Genie Leonardos als Maler zeigte sich darin, dass er das Geheimnis des Lebens entschlüsselte. Wie Miranda hatte er die Schönheit der Welt mit Staunen betrachtet. „Schau dir die Anmut und Lieblichkeit der Männer und Frauen auf der Straße an“, schrieb er. Die gewöhnlichsten Funktionen des Lebens und der Natur faszinierten ihn am meisten. Er beobachtete, wie im Auge Form und Farbe und das gesamte Universum, das es vor Augen hielt, auf einen einzigen Punkt reduziert wurden. „Wunderbares Naturgesetz, das alle Wirkungen zwingt, mit ihrer Ursache im Geist des Menschen mitzuwirken. Das sind die wahren Wunder!“ An anderer Stelle schrieb er wieder: „Die Natur ist voller unendlicher Gründe, die noch nicht in die Erfahrung eingegangen sind.“ Er sah es als Aufgabe des Malers, nicht nur die Naturphänomene als gesetzmäßige Vorgänge zu kommentieren, sondern seinen Geist mit dem der Natur zu verschmelzen, indem er ihre Beziehung zur Kunst interpretierte. Fest verankert in der Realität der erfahrenen Wahrheit, spürte er überall die tiefere Präsenz des Unwirklichen. So wie er sich die inneren Vorgänge des Geistes vorstellte, half ihm seine lebhafte Fantasie, äußere Kleinigkeiten dazu zu nutzen, seinem Wunsch nach mystischer Schönheit überall nachzugehen. Oft beschreibt er, wie er beim Betrachten einer alten, verwitterten Wand Landschaften mit Bergen, Flüssen und Tälern darauf zeichnete. Die ganze Welt war für ihn voller Geheimnisse, die er in seinen Werken vor Augen hielt. Das Lächeln des Bewusstseins, das auf etwas jenseitiges hindeutet, erhellt den Ausdruck der Mona Lisa. Ebenso erkennt man in dem seltsamen Blick von Anna, Johannes dem Täufer und der Jungfrau der Felsen, dass ihre Gedanken in einer anderen Welt weilen.
Leonardo hatte in der Kunst eine Zuflucht vor der Kleinlichkeit seiner materiellen Umgebung gefunden. Wie seine eigenen Schöpfungen hatte auch er das Geheimnis des Innenlebens entdeckt. Der Maler, schrieb er, könne sich eine eigene Welt schaffen und in diesem neuen Reich Zuflucht finden. Aber es dürfe nicht nur eine Welt der Schatten sein. Das Geheimnis, das er so intensiv empfand, musste auf einer realen Grundlage beruhen; alles andere wäre bloßes Schwafeln gewesen. Obwohl er versuchte, die Kluft zwischen dem Realen und dem Irrealen zu überbrücken, lehnte er es ab, Letzteres übernatürlich zu behandeln. Das Geheimnis, das geringere Geister im Okkulten fanden, sah er in der Natur um sich herum. Er leugnete die Existenz von Geistern, genauso wie er die Torheit der Irrlichter früherer Zeiten – Alchemie und schwarze Magie – anprangerte. Mit einem Satz zerstörte er die Anmaßungen der Handlesekunst. „Ihr werdet sehen“, schrieb er, „wie große Heere in einer Stunde niedergemetzelt werden, wo doch jeder einzelne von ihnen andere Handzeichen hat.“
Seine Kunst orientierte sich also am Realismus, ihr Ziel war die Spiritualität. Die Suche nach der Wahrheit und das Streben nach Schönheit waren die beiden Ideale, die er erreichen wollte. Die Intensität dieses Strebens bewahrte ihn vor dem Makel des Egoismus, den ihm seine Distanz zu seiner Umgebung sonst aufgezwungen hätte. Denn sein Charakter wies die für die Renaissance typische Anomalie auf, dass er einen hohen Idealismus mit einer gewissen Verantwortungslosigkeit verband. Er stand auf einer höheren Ebene und erkannte in seiner Lebenseinstellung keine Ansprüche seitens seiner Mitmenschen an. In seinem Wunsch, sich selbst zu übertreffen, der durch diese Isolation des Geistes gefördert und durch den eifrigen Wunsch nach universellem Wissen angespornt wurde, wurde er mit Faust verglichen; aber die Ähnlichkeit ist nur halb richtig. Er war nicht blind für die Grenzen, die ihn umgaben, sein Genie machte ihm ihre Grenzen bewusst. Über die Alten sagte er, dass sie bei dem Versuch, die Natur der Seele zu definieren, das Unmögliche suchten. An anderer Stelle schrieb er: „Nur das Unendliche kann nicht erreicht werden, denn wenn es erreicht werden könnte, würde es endlich werden.“
In Leonardos Persönlichkeit hielten sowohl die Stärke als auch die Schwäche der italienischen Renaissance Einzug. Um ihn zu verstehen, muss man also das Italien jener Zeit kennen. Seine Brillanz, seine Universalität, sein Streben nach Schönheit sind nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite fehlte Italien die solide Kraft eines nationalen Ziels. Die Zwietracht der politischen Uneinigkeit, die sich auf die Kunst auswirkte, legte eine große Schwäche in der Abwesenheit einer konstruktiven Richtung offen, auf die die Kraft der Renaissance hätte ausgerichtet werden können. Die Energie war da, ob sie nun in der Staatskunst, in Entdeckungen, in der Kunst oder in der Literatur zum Ausdruck kam. Aber sie arbeitete nicht auf ein gemeinsames Ziel hin; es gab zwar eine innere Einheit der Kräfte und Methoden, aber eine äußere Uneinigkeit der Ziele. Die Tyrannei kleiner Despoten konnte kein angemessenes Ideal bieten, nach dem man streben konnte. Kein Herrscher und keine Stadt außer Venedig konnte lange Zeit den Patriotismus der Nation symbolisieren. Nur die venezianischen Maler verherrlichten den Staat in ihren Werken und spürten so die lebendige Kraft eines nationalen Ehrgeizes, der sie über sich selbst erhob. Aber anderswo gab es wenig, was diese Hingabe an ein gemeinsames Land wecken konnte, die als Hintergrund notwendig war, um die größten Werke zu schaffen. Daher blieb die italienische Kunst, die innerhalb bestimmter Grenzen lebte, über diese hinaus verkümmert. Die Überzeugung, dass Kunst dazu da war, ideale Schönheit auszudrücken, dass ihr Hauptzweck darin bestand, das Auge und die Sinne zu erfreuen, unabhängig vom erzielten Ergebnis, erwies sich als unzureichender Ausgleich für alles, was ihr genommen worden war. Das Kunstideal wurde immer mehr zu einem Gewissen und einem Selbstzweck, zu einem inneren Impuls zum Handeln und zu einem äußeren Ziel.
Die wahre Größe des Künstlers hängt zu jeder Zeit von seinen Qualitäten als Repräsentant ab. Sein wahrer Verdienst besteht darin, seiner Nation und seiner Zeit einen idealen Ausdruck zu verleihen. In dem Maße, in dem ihm dies gelungen ist und der Geist seines Landes in seinem Werk vor Augen gehalten wird, in dem Maße, in dem er das Beste und Beständigste darin dargestellt hat, hat er Größe erreicht. Das ist nicht immer oder oft bewusst so gemeint. Es ist unfair, in den Werken von Malern oder Dichtern nach tiefen Gedanken zu suchen. Keine Kunstform ist das beste Mittel, um abstrakte Gedanken zu vermitteln, da jede ihre eigene Ausdrucksweise hat, die unabhängig von der reinen Vernunft ist. Aber Maler und Dichter drücken, je nachdem, wie groß sie sind, mehr aus als nur sich selbst. Ariosto, der nur unterhalten will, hält mit spielerischem Witz und Skepsis den prächtigen Luxus und die Lebensfreude am Hof der Renaissance vor Augen. Die Sorgfalt, mit der er jede Zeile meißelt, beweist, dass seine wahre Ernsthaftigkeit und sein Gewissen in seiner künstlerischen Absicht liegen. Ohne Ariostos Witz hat Paolo Veronese eine ähnliche Seite in der Malerei dargestellt, obwohl ihn seine venezianische Herkunft dazu veranlasste, den Ruhm der Republik zu feiern. Dichter und Maler drückten weit mehr aus, als sie selbst ahnen konnten. Wendet man diesen Test auf die Künstler der Renaissance an, wird sich jeder einzelne davon beeinflussen lassen – so wie die Schwäche der späteren Bologneser Schule darin besteht, dass sie über einen gewissen technischen Verdienst hinaus so wenig bedeutten und darstellten. Aber die edelsten Maler – Michelangelo und Raffael, Tizian und Leonardo – besaßen nicht nur ein solides technisches Können, sondern hielten auch einen Aspekt des Lebens und der Kultur ihres Volkes vor Augen. In Michelangelo verwirklichte sich die Größe Italiens, das vergeblich gegen erdrückende Unterdrückung kämpfte. Er drückte das Höchste darin aus und hielt in seinem Blick auf das Leben die erhabenste Seite seines Idealismus, vermischt mit tiefem Pessimismus, vor Augen; denn, in Strenge gehüllt, sah er die Menschheit in heroischer Traurigkeit. Raphael hingegen sah überall nur schöne Sanftheit. Die Tragödien des Lebens berührten den jungen Maler nicht, der alle Kämpfe und Leiden aus seinem Blickfeld verdrängte und trotz des Elends, das sein Volk heimgesucht hatte, sich noch an der sinnlichen Schönheit der Welt erfreuen konnte. Die Renaissance hatte noch eine andere Seite, die weder von Schönheit noch von heroischer Größe abhängig war, aber durch ihre eigenen Qualitäten an beidem teilhatte. Tizian, der den lebendigen Menschen in Aktion malte, den vielseitigen Menschen, der gleichermaßen empfänglich für die Wertschätzung idealer Schönheit und heroischer Impulse war, sich aber dennoch von der Zweckmäßigkeit leiten ließ, hielt diesen praktischeren Aspekt des Lebens vor Augen. In seinen Porträts drückte er die Staatskunst aus, für die die Italiener jenseits der Alpen eine Möglichkeit fanden, da sie ihnen in Italien verwehrt war; und Tizian empfand sogar Venedig als zu eng für den Spielraum seiner Kunst.
Aber vor Tizian, vor Raffael, vor Michelangelo hielt Leonardo den Rationalismus und das Geheimnisvolle, die Subtilität und die philosophische Spekulation seiner Zeit fest. In seinem Werk nur den individuellen Gedanken des Genies zu sehen, hieße vielleicht, seine wichtigste Seite zu verkennen; denn der Ausdruck seines Geistes, sowohl in seiner Brillanz als auch in seinen Grenzen, ist typisch für den Geist seiner Zeit. Die italienische Renaissance spiegelte sich in ihm wider, wie es selten eine Epoche im Lebenswerk eines einzelnen Menschen zum Ausdruck gebracht hat. Er verkörperte die Vereinigung von Praxis und Theorie, von Gedanken, die in den Dienst des Handelns gestellt wurden. Er fasste die verschiedenen Aspekte in seiner eigenen Individualität zusammen. Intellektuell repräsentierte er die Vielseitigkeit, die durch tiefes Denken und eine aus Erfahrung gewonnene Beobachtungsgabe erreicht wurde, die sich auf alle Bereiche erstreckte. Als Künstler hatte er eine lebhafte Fantasie, aus der seine Kraft, Schönheit zu schaffen, entsprang. Aber trotz seiner praktischen Veranlagung blieb er ein Träumer in einer Zeit, die mehr von harter Realität als von goldenen Träumen geprägt war. Gerade seine Grenzen, sein übermäßiger Individualismus, seine mangelnde Ausdauer, sein fehlender Patriotismus und sein Gefühl der Überlegenheit der Kunst gegenüber der Nationalität sind charakteristisch für die italienische Renaissance.
Die Verbindung von Realität und Mysterium in Leonardo wurde oft von Genies anderer Bereiche geteilt. Seine eigene besondere Größe entsprang dem Ausdruck des scheinbaren Widerspruchs, durch die Kraft der Realität die Welt des Mysteriösen zu erreichen, in der Kunst. Wie Hamlet war es die Verbindung des Realen mit dem Irrealen, die ihn anzog, die Welt, wie er sie sah, und die Welt, wie er sie sich vorstellte. Es war nur ein anderer Ausdruck des ewigen Ideals von Wahrheit und Schönheit.
L. E.
Amerikanische Botschaft London, 1906
I: GEDANKEN ÜBER DAS LEBEN
Über die Werke von Leonardo
Begonnen in Florenz im Haus von Piero di Braccio Martelli, am 22. März 1508; und dies soll eine Sammlung ohne bestimmte Reihenfolge sein, zusammengestellt aus vielen Papieren, die ich hier kopiert habe, in der Hoffnung, sie später jeweils an ihrem Platz nach den verschiedenen behandelten Themen anzuordnen. Und ich denke, dass ich, bevor ich dieses Werk vollendet habe, dasselbe noch viele Male wiederholen muss; also, lieber Leser, tadele mich nicht, weil die Themen zahlreich sind und das Gedächtnis sie nicht alle behalten kann, und sage nicht: Das werde ich nicht schreiben, weil ich es bereits geschrieben habe; und wenn ich nicht in diesen Fehler verfallen wollte, müsste ich jedes Mal, wenn ich etwas kopieren möchte, um mich nicht zu wiederholen, den gesamten vorangegangenen Text noch einmal lesen, zumal die Zeitabstände zwischen dem Schreiben so lang sind.
Sein Wissensdurst
2.
Nicht lauter brüllt die stürmische See, wenn der Nordwind ihre schäumenden Wellen zwischen Skylla und Charybdis schlägt; noch Stromboli oder der Ätna, wenn die schwefelhaltigen Flammen, den großen Berg mit Gewalt zerreißen und aufsprengen und mit den Flammen, die sie ausspucken, Steine und Erde durch die Luft schleudern; noch wenn die feurigen Höhlen des Ätna das Element, das sie nicht zurückhalten können, wieder an den Ort zurück schleudern, von dem es gekommen ist, und dabei alles, was sich ihrer Wut in den Weg stellt, mit sich reißen ... So wanderte auch ich, getrieben von meinem großen Verlangen und meiner Sehnsucht, die Vermischung seltsamer und vielfältiger Formen zu sehen, die die schöpferische Natur hervorgebracht hat, eine Zeit lang zwischen den dunklen Felsen umher und gelangte zum Eingang einer großen Höhle, vor der ich lange Zeit in Staunen und Unwissenheit über ein solches Gebilde stehen blieb. Ich beugte meinen Rücken zu einem Bogen, stützte meine linke Hand auf mein Knie und schirmte mit der rechten Hand meine niedergeschlagenen Augen und zusammengezogenen Augenbrauen ab. Ich beugte mich erst zur einen Seite, dann zur anderen, um zu sehen, ob ich etwas erkennen könnte, aber die dichte Dunkelheit machte dies unmöglich; und nachdem ich einige Zeit dort geblieben war, erwachten zwei Gefühle in mir, Angst und Verlangen – Angst vor der dunklen und bedrohlichen Höhle, Verlangen zu sehen, ob es darin etwas Wunderbares gab.