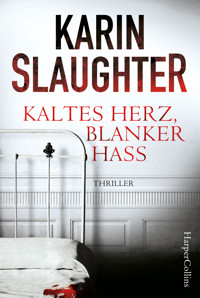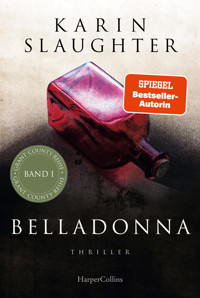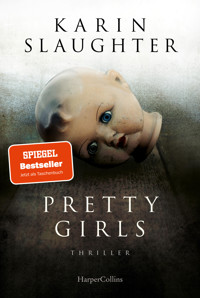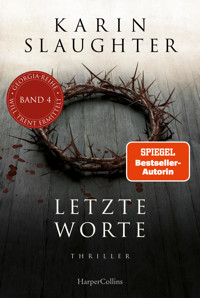
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Georgia-Serie
- Sprache: Deutsch
Als Special Agent Will Trent in Grant Count ankommt, erwarten ihn eine Riege an Polizisten, die alles tun, um sich gegenseitig zu beschützen, und eine Vielzahl an offenen Fragen bezüglich des Todes eines Häftlings. Der vermeintliche Mörder hat gestanden – und sich dann in seiner Zelle umgebracht. Detective Lena Adams scheint ebenfalls Geheimnisse vor Will zu haben, und Gerichtsmedizinerin Sara Linton, Witwe des toten Polizeichefs Jeffrey Tolliver, ist davon überzeugt, dass Lena den geistig zurückgebliebenen Verdächtigen in den Selbstmord getrieben hat. Wem kann Will Trent noch trauen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch:
Grant County, Atlanta: Am Ufer eines Sees werden die Schuhe und die Abschiedsnotiz eines Mädchens gefunden. Doch die Leiche beweist: Es kann kein Selbstmord gewesen sein, der Messerstich in ihrem Nacken weist auf düstere Machenschaften hin. Detective Lena Adams steht nur wenige Stunden später dem vermeintlichen Mörder gegenüber. Der Junge wird nach einem heftigen Kampf inhaftiert, er gesteht die Tat – und bringt sich kurz darauf in seiner Zelle um. Mit seinem eigenen Blut steht an die Wand geschrieben: »Ich war’s nicht.« Für Sara Linton ist klar: Lena Adams trägt Schuld an seinem Tod. Sie nimmt Kontakt zum Georgia Bureau of Investigation auf, um Lena ein für alle Mal aus dem Verkehr zu ziehen …
Zur Autorin:
Karin Slaughter ist eine der weltweit berühmtesten Autorinnen und Schöpferin von über 20 New York Times-Bestseller-Romanen. Dazu zählen »Cop Town«, der für den Edgar Allan Poe Award nominiert war, sowie die Thriller »Die gute Tochter« und »Pretty Girls«. Ihre Bücher erscheinen in 120 Ländern und haben sich über 40 Millionen Mal verkauft. Ihr internationaler Bestseller »Ein Teil von ihr« ist 2022 als Serie mit Toni Collette auf Platz 1 bei Netflix eingestiegen. Eine Adaption ihrer Bestseller-Serie um den Ermittler Will Trent läuft derzeit erfolgreich auf Disney+, weitere filmische Projekte werden entwickelt. Slaughter setzt sich als Gründerin der Non-Profit-Organisation »Save the Libraries« für den Erhalt und die Förderung von Bibliotheken ein. Die Autorin stammt aus Georgia und lebt in Atlanta. Mehr Informationen zur Autorin gibt es unter www.karinslaughter.com
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel Broken bei Delacorte Press, an imprint of The Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc., New York.
© 2010 by Karin Slaughter
Ungekürzte Ausgabe by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
© 2012 für die deutschsprachige Ausgabe by Blanvalet Verlag München, in der Verlagsgruppe Randomhouse GmbH
Die Rechte an der Nutzung der deutschen Übersetzung von Klaus Berr liegen beim Blanvalet Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, US
Satz und E-Book-Konvertierung von GGP Media GmbH, Pößneck
Covergestaltung von Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung unter Verwendung von Midjourney
ISBN 9783749907977
www.harpercollins.de
Widmung
Für Victoria
Prolog
Allison Spooner wollte in den Ferien aus der Stadt raus, aber sie wusste nicht, wohin sie fahren sollte. Es gab auch keinen Grund hierzubleiben, aber wenigstens war es billiger. Wenigstens hatte sie ein Dach über dem Kopf. Wenigstens funktionierte in ihrer Wohnung hin und wieder die Heizung. Wenigstens bekam sie in der Arbeit eine warme Mahlzeit. Wenigstens, wenigstens, wenigstens … Warum ging es in ihrem Leben immer um das Wenigste? Wann würde mal eine Zeit kommen, da es anfing, um das Meiste zu gehen?
Der Wind wurde stärker, und sie ballte in den Taschen ihrer dünnen Jacke die Fäuste. Es regnete kaum, es war eher ein feuchtkalter Dunst, der sich auf den Boden senkte, wie vor der Nase eines Hundes. Die eisige Kälte, die vom Lake Grant kam, machte es noch schlimmer. Sooft der Wind auffrischte, kam es ihr vor, als würden winzige, stumpfe Rasierklingen ihr die Haut ritzen. Eigentlich war man hier in South Georgia, nicht am verdammten Nordpol.
Während sie auf dem baumbestandenen Ufer nach sicherem Tritt suchte, kam es ihr vor, als würde jede Welle, die am Schlamm leckte, die Temperatur um ein weiteres Grad absenken. Sie fragte sich, ob ihre leichten Schuhe stabil genug waren, um Frostbeulen an ihren Zehen zu verhindern. Im Fernsehen hatte sie einen Mann gesehen, der alle Finger und Zehen an die Kälte verloren hatte. Er hatte gesagt, er sei dankbar, überhaupt noch am Leben zu sein, aber die Leute sagten doch alles, nur um ins Fernsehen zu kommen. So wie Allisons Leben im Augenblick lief, würde die einzige Sendung, in die sie es je schaffen würde, die Abendnachrichten sein. Man würde ein Foto zeigen – wahrscheinlich das grässliche aus ihrem Highschool-Jahrbuch – und daneben die Wörter »Tragischer Tod«.
Allison erkannte durchaus die Ironie der Tatsache, dass sie für die Welt tot wichtiger wäre. Lebend scherte sich niemand einen Dreck um sie – die wenigen Dollar, die sie gerade noch so zusammenkratzen konnte, der beständige Kampf, im Studium mitzukommen und zugleich all die anderen Verantwortlichkeiten in ihrem Leben zu bewältigen. Nichts davon würde für irgendjemanden von Bedeutung sein, außer sie landete erfroren am Seeufer.
Wieder frischte der Wind auf. Allison drehte der Kälte den Rücken zu, spürte, wie ihre eisigen Finger ihr in den Brustkorb stachen, auf die Lunge drückten. Ein Zittern lief durch ihren Körper. Ihr Atem stand als Wolke vor ihr. Sie schloss die Augen. Der Sprechgesang ihrer Probleme drang zwischen ihren klappernden Zähnen hervor.
Jason. Uni. Geld. Auto. Jason. Uni. Geld. Auto.
Das Mantra durchbrach den kalten Wind. Allison öffnete die Augen. Sie schaute sich um. Die Sonne ging schneller unter, als sie gedacht hatte. Sie drehte sich zum College um. Sollte sie zurückgehen? Oder sollte sie weitergehen?
Sie entschloss sich weiterzugehen und zog den Kopf gegen den heulenden Wind ein.
Jason. Uni. Geld. Auto.
Jason. Ihr Freund hatte sich, scheinbar über Nacht, in ein Arschloch verwandelt.
Uni. Sie würde vom College fliegen, wenn sie nicht mehr Zeit zum Studieren fände.
Geld. Sie würde sich kaum das Leben sichern, geschweige denn zur Uni gehen können, wenn sie ihre Arbeitsstunden noch weiter reduzierte.
Auto. Als sie es heute Morgen anließ, hatte es angefangen zu qualmen, was keine große Sache war, weil es seit Monaten qualmte, aber diesmal war der Rauch durch die Lüftungsschlitze ins Innere gedrungen. Auf der Fahrt zum College wäre sie beinahe erstickt.
Allison stapfte weiter und fügte ihrer Liste »Frostbeulen« hinzu, während sie um die Biegung des Sees ging. Wann immer sie blinzelte, hatte sie das Gefühl, ihre Lider würden durch eine dünne Eisschicht schneiden.
Jason. Uni. Geld. Auto. Frostbeulen.
Die Angst vor Frostbeulen schien am drängendsten zu sein, obwohl sie widerwillig zugeben musste, dass ihr, je mehr sie darüber nachdachte, umso wärmer wurde. Vielleicht schlug ihr Herz schneller, oder sie ging schneller, als die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwand und sie erkannte, dass ihr Jammern über den Tod in der Kälte Wirklichkeit werden würde, wenn sie sich, verdammt noch mal, nicht beeilte.
Allison stützte sich mit einer Hand an einem Baum ab, um ein Gewirr von Wurzeln zu überqueren, die im Wasser verschwanden. Die Rinde war feucht und fühlte sich unter ihren Fingerspitzen schwammig an. Ein Gast hatte heute Mittag einen Hamburger zurückgehen lassen, weil er meinte, das Brötchen sei zu schwammig. Es war ein kräftiger, schroffer Mann in voller Jagdausrüstung gewesen, von dem sie nie erwartet hätte, dass er ein Wort wie »schwammig« überhaupt in den Mund nehmen würde. Er hatte mit ihr geflirtet, und sie hatte zurückgeflirtet, und als er ging, gab er ihr bei seiner Rechnung von zehn Dollar ein Trinkgeld von fünfzig Cent. Er hatte ihr tatsächlich zugezwinkert, als er zur Tür hinausging, so als hätte er ihr einen Gefallen getan.
Was für ein Leben wollte Allison für sich? Ein Leben, wie es in ihrem Blut geschrieben stand. Ihre Mutter hatte so eines gelebt. Ihre Großmutter hatte es gelebt. Ihre Tante Sheila hatte es gelebt, bis sie eine Schrotflinte auf ihren Onkel Boyd richtete und ihm damit beinahe den Kopf abgeschossen hätte. Alle drei Spooner-Frauen hatten an dem einen oder dem anderen Punkt alles für einen wertlosen Mann weggeworfen.
Allison hatte es bei ihrer Mutter so oft miterlebt, dass sie zu der Zeit, als Judy Spooner zum letzten Mal im Krankenhaus war, ihr ganzes Inneres zerfressen vom Krebs, über nichts anderes mehr nachdenken konnte als über die Verwüstungen im Leben ihrer Mutter. Sie sah sogar verwüstet aus. Sie war erst achtunddreißig Jahre alt, doch ihre Haare wurden bereits schütter und grau. Ihre Haut war stumpf. Ihre Hände waren wie Klauen nach den Jahren der Arbeit in der Reifenfabrik – die Reifen vom Band nehmen, den Druck prüfen und sie wieder aufs Band legen, dann den nächsten Reifen und den nächsten und den nächsten, zweihundert pro Tag, bis jedes Gelenk in ihrem Körper schmerzte, wenn sie abends ins Bett kroch. Achtunddreißig Jahre alt, und der Krebs war ihr willkommen. Die Erlösung war ihr willkommen.
Das waren so ziemlich die letzten Worte, die Judy zu Allison gesagt hatte, dass sie froh sei zu sterben, froh, dass sie nicht mehr allein sein müsse. Judy Spooner glaubte an den Himmel und die Erlösung. Sie glaubte, dass eines Tages goldene Straßen und prächtige Häuser die Kieseinfahrt und den Wohnwagen im Trailer-Park ihres irdischen Lebens ersetzen würden. Allison glaubte nur, dass sie ihrer Mutter nie genug gewesen war. Judys Glas war immer halb leer, und all die Liebe, die Allison im Lauf der Jahre in ihre Mutter gegossen hatte, hatte sie nie ganz ausgefüllt.
Judy war viel zu tief im Dreck versunken gewesen. Der Dreck eines aussichtslosen Jobs. Der Dreck eines wertlosen Mannes nach dem anderen. Der Dreck eines Babys, das sie daran hinderte weiterzukommen.
Das College sollte Allisons Rettung sein. Sie war gut in den wissenschaftlichen Fächern. Wenn man ihre Familie betrachtete, schien das unverständlich, aber irgendwie begriff sie, wie Chemikalien funktionierten. Sie verstand die Grundlagen der Synthese von Makromolekülen. Die Kenntnis der synthetischen Polymere flog ihr praktisch zu. Und das Wichtigste: Sie konnte lernen. Sie wusste, dass es irgendwo auf der Welt ein Buch mit einer Antwort darin gab, und der beste Weg, diese Antwort zu finden, war, jedes Buch zu lesen, das sie in die Finger bekam.
Im Abschlussjahr der Highschool hatte sie es geschafft, sich von den Jungs und der Sauferei und dem Meth fernzuhalten, die Dinge, die so ziemlich jedes Mädchen ihres Alters in ihrer kleinen Heimatstadt Elba, Alabama, ruiniert hatten. Sie wollte nicht enden wie eines dieser seelenlosen, ausgelaugten Mädchen, die Nachtschicht arbeiteten und Kools rauchten, weil sie elegant aussehen wollten. Sie wollte nicht enden mit drei Kindern von drei verschiedenen Männern, bevor sie überhaupt dreißig Jahre alt wurde. Sie wollte nicht jeden Morgen aufwachen und die Augen nicht öffnen können, weil irgendein Mann sie in der Nacht zuvor verprügelt hatte. Sie wollte nicht tot und allein in einem Krankenhausbett enden wie ihre Mutter.
Zumindest hatte sie sich das so vorgestellt, als sie Elba vor drei Jahren verließ. Mr. Mayweather, ihr Naturwissenschaftslehrer, hatte alle Fäden gezogen, die er konnte, damit sie in einem guten College aufgenommen wurde. Er wollte, dass sie so weit wie möglich wegging von Elba. Er wollte, dass sie eine Zukunft hatte.
Grant Tech befand sich in Georgia, und es war, was die Entfernung anging, nicht so weit weg, wie es gefühlsmäßig weit weg war. Das College war riesig im Vergleich zu ihrer Highschool, die eine Abschlussklasse von neunundzwanzig Schülern hatte.
Allison hatte die erste Woche auf dem Campus mit der Frage zugebracht, wie es möglich war, sich in einen Ort zu verlieben. Ihre Klassen waren voll mit Jugendlichen, die mit einer Vielzahl von Möglichkeiten aufgewachsen waren und keinen Gedanken daran verschwendet hatten, nicht direkt nach der Highschool aufs College zu gehen. Keiner ihrer Kommilitonen kicherte höhnisch, wenn sie die Hand hob, um eine Frage zu beantworten. Sie glaubten nicht, man würde sich verkaufen, wenn man einem Lehrer tatsächlich zuhörte und versuchte, etwas anderes zu lernen, als sich künstliche Fingernägel aufzukleben und sich Haarverlängerungen einzuflechten.
Und die Umgebung des Colleges war hübsch. Elba war ein Elendsquartier, sogar fürs südliche Alabama. Heartsdale, die Stadt, in der die Grant Tech sich befand, fühlte sich an wie eine Stadt, die man sonst nur im Fernsehen sah. Jeder pflegte seinen Garten. Im Frühling säumten Blumen die High Street. Völlig Fremde winkten einem zu, ein Lächeln auf dem Gesicht. Und in dem Diner, in dem sie arbeitete, waren die Stammgäste freundlich, auch wenn sie wenig Trinkgeld gaben. Die Stadt war nicht so groß, dass sie sich verloren vorkam. Leider war sie nicht groß genug, um Jason aus dem Weg zu gehen.
Jason.
Sie hatte ihn in ihrem Anfangsjahr kennengelernt. Er war zwei Jahre älter, erfahrener und weltgewandter. Seine Vorstellung eines romantischen Rendezvous beschränkte sich nicht auf einen Kinobesuch und eine schnelle Nummer in der letzten Reihe, bevor der Geschäftsführer einen hinauswarf. Er führte sie in richtige Restaurants mit Stoffservietten auf den Tischen. Er hielt ihre Hand. Er hörte ihr zu. Beim Sex verstand sie endlich, warum die Leute es »Liebe machen« nannten. Jason wollte nicht einfach nur etwas Besseres für sich selbst. Er wollte auch etwas Besseres für Allison. Sie glaubte, dass das, was sie miteinander hatten, eine ernsthafte Sache wäre; die letzten zwei Jahre ihres Lebens hatte sie damit verbracht, mit ihm etwas Gemeinsames aufzubauen. Und dann hatte er sich plötzlich in einen völlig anderen Menschen verwandelt. Plötzlich war alles, was an ihrer Beziehung so großartig gewesen war, der Grund, warum sie in die Brüche ging.
Und wie es auch bei ihrer Mutter gewesen war, hatte Jason es irgendwie geschafft, ihr die Schuld für alles in die Schuhe zu schieben. Sie sei kalt. Sie sei distanziert. Sie sei zu fordernd. Sie habe nie Zeit für ihn. Als wäre Jason ein Heiliger, der den ganzen Tag nur darüber nachdachte, was Allison glücklich machen könnte. Sie war nicht diejenige, die mit Freunden auf nächtelange Sauftouren ging. Sie war nicht diejenige, die sich im College mit merkwürdigen Leuten einließ. Sie war, verdammt noch mal, nicht diejenige, die sich von diesem Trottel aus der Stadt hatte einwickeln lassen. Wie konnte das Allisons Schuld sein, wenn sie diesem Kerl noch nie ins Gesicht gesehen hatte?
Allison zitterte wieder. Bei jedem Schritt, den sie an diesem verdammten See entlangging, kam es ihr vor, als würde das Ufer noch einmal hundert Meter länger werden, nur um ihr eins auszuwischen. Sie schaute hinunter auf die nasse Erde unter ihren Füßen. Seit Wochen stürmte es. Eine Sturzflut hatte Straßen weggespült, Bäume umgerissen. Mit schlechtem Wetter hatte Allison noch nie gut umgehen können. Die Dunkelheit nagte an ihr, zog sie nach unten. Sie machte sie launisch und weinerlich. Die ganze Zeit wollte sie nur schlafen, bis die Sonne wieder herauskam.
»Scheiße!«, zischte Allison, als sie ausrutschte und sich gerade noch fangen konnte. Ihre Hosenbeine waren schlammverklebt fast bis zu den Knien, die Schuhe so gut wie durchweicht. Sie schaute auf den aufgewühlten See hinaus. Der Regen hängte sich ihr an die Wimpern. Sie strich sich die Haare mit den Fingern zurück, während sie das dunkle Wasser anstarrte. Vielleicht sollte sie ausrutschen. Vielleicht sollte sie sich in den See fallen lassen. Wie würde es sein, sich selbst loszulassen? Wie würde es sich anfühlen, sich von der Unterströmung immer weiter in die Mitte des Sees ziehen zu lassen, wo sie keinen Boden mehr unter den Füßen hatte und sie keine Luft mehr bekam?
Es war nicht das erste Mal, dass sie darüber nachdachte.
Wahrscheinlich war es das Wetter, der unaufhörliche Regen und der trübe Himmel. Im Regen wirkte alles noch viel deprimierender. Und einige Dinge waren deprimierender als andere. Letzten Donnerstag hatte die Zeitung einen Artikel über eine Mutter mit ihrem Kind gebracht, die zwei Meilen vor der Stadt in ihrem VW Käfer ertrunken waren. Kurz vor der Third Baptist Church überschwemmte eine Sturzflut die Straße und riss sie mit. Wegen des Designs der Karosserie konnte der alte Käfer schwimmen, und auch dieses neuere Modell war geschwommen. Zumindest am Anfang.
Die Mitglieder der Kirchengemeinde, die eben von ihrem wöchentlichen gemeinsamen Potluck-Abendessen kamen, bei dem jeder etwas mitbrachte und auf einen Tisch stellte, wussten nicht, was sie tun sollten, weil jeder Angst hatte, selbst von der Flut erfasst zu werden. Voller Entsetzen sahen die Leute zu, wie der Käfer sich auf der Oberfläche drehte und dann nach hinten kippte. Wasser strömte in den Innenraum. Mutter und Kind wurden von der Strömung mitgerissen. Die Frau, die von der Zeitung interviewt wurde, sagte, sie werde für den Rest ihres Lebens abends beim Einschlafen und morgens beim Aufwachen die Hand des kleinen Dreijährigen sehen, die immer wieder aus dem Wasser herausschnellte, bevor das arme Kind schließlich in die Tiefe gezogen wurde.
Auch Allison konnte nicht aufhören, an das Kind zu denken, obwohl sie in der Bibliothek gewesen war, als es passierte. Obwohl sie die Frau und das Kind und auch die Dame nicht kannte, die mit der Zeitung gesprochen hatte, sah sie, sooft sie die Augen schloss, immer diese kleine Hand aus dem Wasser herausragen. Manchmal wurde die Hand größer. Manchmal war es ihre Mutter, die die Hand Hilfe suchend nach ihr ausstreckte. Manchmal wachte sie schreiend auf, weil die Hand sie in die Tiefe zog.
Wenn sie ehrlich war, musste sie sagen, dass ihr schon lange vor dem Zeitungsartikel dunkle Gedanken durch den Kopf gegangen waren. Sie konnte nicht alles aufs Wetter schieben, doch mit Sicherheit hatten der ständige Regen und die unerbittlich graue Wolkendecke in ihrem Gemüt ihre ganz eigene Art der Verzweiflung heraufbeschworen. Um wie viel einfacher wäre es, wenn sie jetzt aufgäbe? Warum sollte sie nach Elba zurückkehren und zu einer zahnlosen, abgehärmten alten Frau mit achtzehn Kindern werden, da sie doch einfach in diesen See gehen und einmal ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen könnte?
Sie wurde so schnell wie ihre Mutter, dass sie beinahe spürte, wie ihre Haare ergrauten. Sie war genauso schlimm wie Judy – sie glaubte, sie wäre verliebt, obwohl der Kerl nur daran interessiert war, was sie zwischen ihren Beinen hatte. Ihre Tante Sheila hatte letzte Woche am Telefon so etwas in der Richtung gesagt. Allison hatte sich über Jason beklagt, weil sie sich wunderte, dass er ihre Anrufe nicht erwiderte.
Ein Zug an ihrer Zigarette, und dann beim Ausatmen: »Du klingst genau wie deine Mutter.«
Ein Messer in der Brust wäre schneller, sauberer gewesen.
Das Schlimmste war, dass Sheila recht hatte. Allison liebte Jason. Sie liebte ihn viel zu sehr. Sie liebte ihn so, dass sie ihn zehnmal am Tag anrief, obwohl er nie abhob. Sie liebte ihn so sehr, dass sie alle zwei Minuten auf ihrem blöden Computer auf Empfangen klickte, nur um nachzusehen, ob er eine ihrer unzähligen E-Mails beantwortet hatte.
Sie liebte ihn so sehr, dass sie jetzt mitten in der Nacht hier draußen war und die Drecksarbeit erledigte, zu der er selbst nicht den Mut hatte.
Allison ging noch einen Schritt auf den See zu. Sie spürte, wie ihr Absatz zu rutschen anfing, aber der Selbsterhaltungstrieb ihres Körpers übernahm, bevor sie hinfiel. Dennoch leckte das Wasser an ihren Schuhen. Ihre Socken waren bereits durchnässt. Ihre Zehen waren mehr als taub, so kalt, dass ein scharfer Schmerz bis zum Knochen zu stechen schien. Würde es so sein – ein langsames, betäubendes Gleiten durch eine schmerzlose Röhre?
Sie hatte Angst vor dem Ersticken. Das war das Problem. Als Kind hatte sie das Meer geliebt, aber als sie dreizehn Jahre alt wurde, hatte sich das geändert. Ihr idiotischer Cousin Dillard hatte sie im örtlichen Schwimmbad unter Wasser gedrückt, und jetzt nahm sie nicht einmal mehr gerne Vollbäder, weil sie Angst hatte, Wasser in die Nase zu bekommen und in Panik zu geraten.
Wenn Dillard hier wäre, würde er sie wahrscheinlich in den See stoßen, ohne dass sie ihn darum bitten müsste. Als er sie damals das erste Mal unter Wasser hielt, hatte er nicht einen Funken Reue gezeigt. Allison hatte das Mittagessen wieder von sich gegeben. Ihr Körper hatte gebebt vor Schluchzen. Ihre Lunge hatte gebrannt, und er hatte nur »Haha« gesagt wie ein alter Mann, der einen von hinten in den Arm zwickte, nur um einen aufkreischen zu hören.
Dillard war Sheilas Sohn, ihr einziges Kind, das noch enttäuschender für sie war als sein Vater, falls das überhaupt möglich war. Er schnüffelte so viel Lack, dass seine Nase immer eine andere Farbe hatte, wenn man ihn sah. Er rauchte Crystal. Er bestahl seine Mama. Als Letztes hatte Allison gehört, dass er im Gefängnis war, weil er versucht hatte, einen Schnapsladen mit einer Wasserpistole auszurauben. Als die Polizei kam, hatte ihm der Verkäufer bereits einen Baseballschläger über den Schädel gezogen. Als Folge davon war Dillard noch blöder als zuvor, aber eine gute Gelegenheit hätte er sich trotzdem nicht entgehen lassen. Er hätte Allison mit beiden Händen einen kräftigen Schubs gegeben, sodass sie kopfüber ins Wasser stürzte, während er sein kleines Lachen von sich gab: »Haha.« Unterdessen hätte sie mit den Armen um sich geschlagen und vergeblich gegen das Ertrinken angekämpft.
Wie lange würde es dauern, bis sie ohnmächtig würde? Wie lange würde Allison in Todesangst leben müssen, bevor sie stürbe? Sie schloss wieder die Augen und versuchte, sich vorzustellen, wie das Wasser sie umgab, sie schluckte. Es wäre so kalt, dass es sich anfangs warm anfühlen würde. Ohne Luft konnte man nicht lange überleben. Man wurde ohnmächtig. Vielleicht überkam einen Panik, die eine Art hysterischer Ohnmacht zur Folge hatte. Oder vielleicht fühlte man sich sehr lebendig – euphorisiert vom Adrenalin, wie ein Eichhörnchen in einer Papiertüte.
Hinter sich hörte sie einen Ast knacken. Allison drehte sich überrascht um.
»O Gott!« Allison rutschte wieder aus, doch diesmal stürzte sie wirklich. Sie fuchtelte mit den Armen. Ein Knie gab nach. Der Schmerz raubte ihr den Atem. Mit dem Gesicht klatschte sie in den Schlamm. Eine Hand packte sie am Hinterkopf, zwang sie, unten zu bleiben. Allison atmete die bittere Kälte der Erde, den nassen, triefenden Dreck.
Instinktiv wehrte sie sich, kämpfte gegen das Wasser an und gegen die Panik, die ihr Gehirn überflutete. Sie spürte, wie ihr ein Knie ins Kreuz gerammt wurde und sie auf der Erde festnagelte. Ein brennender Schmerz schoss ihr ins Genick. Allison schmeckte Blut. Das war nicht sie. Sie wollte leben. Sie musste leben. Sie öffnete den Mund, um es aus Leibeskräften aus sich herauszuschreien.
Doch dann – Dunkelheit.
MONTAG
1. Kapitel
Zum Glück bedeutete das Winterwetter, dass die Leiche auf dem Grund des Sees gut erhalten sein würde, die Kälte am Ufer allerdings fuhr einem so in die Knochen, dass man Mühe hatte, sich zu erinnern, wie der August gewesen war. Die Sonne auf dem Gesicht. Der Schweiß, der einem den Rücken hinunterlief. Wie die Klimaanlage im Auto Nebel aus den Düsen blies, weil sie mit der Hitze nicht mehr mithalten konnte. Sosehr Lena sich auch zu erinnern versuchte, an diesem verregneten Novembermorgen wollten Gedanken an die Wärme einfach nicht kommen.
»Gefunden«, rief der Leiter des Tauchtrupps. Er dirigierte seine Männer vom Ufer aus, die Stimme gedämpft vom beständigen Rauschen des strömenden Regens. Als Lena die Hand hob, um zu winken, lief ihr Wasser in den Ärmel des dicken Parkas, den sie sich schnell übergeworfen hatte, als der Anruf sie um drei Uhr nachts erreichte. Es regnete nicht stark, aber unaufhörlich, trommelte beharrlich auf ihren Rücken, klatschte auf den Regenschirm, den sie auf der Schulter abstützte. Die Sicht betrug etwa zehn Meter. Alles dahinter war von einem dunstigen Nebel verhüllt. Sie schloss die Augen, dachte an ihr warmes Bett, den wärmeren Körper, der den ihren umschlungen hatte.
Das schrille Klingeln eines Telefons um drei Uhr in der Früh war nie ein gutes Geräusch, vor allem, wenn man Polizistin war. Mit pochendem Herzen war Lena aus dem Tiefschlaf aufgewacht, ihre Hand hatte automatisch nach dem Hörer gegriffen und ihn sich ans Ohr gedrückt. Sie war die ranghöchste Detective mit Rufbereitschaft, und deshalb musste sie ihrerseits überall in South Georgia andere Telefone klingeln lassen. Das ihres Vorgesetzten, das des Coroners, das der Feuerwehr und der Rettung, das des Georgia Bureau of Investigation, um die Agenten wissen zu lassen, dass man auf öffentlichem Grund eine Leiche gefunden hatte, das der Georgia Emergency Management Authority, der Behörde zur Koordinierung von Notfalleinsätzen, die eine Liste mit einsatzwilligen zivilen Freiwilligen führte, die bereit waren, auf kurzfristige Alarmierung hin nach einer Leiche zu suchen.
Nun waren sie alle hier am See versammelt, aber die Schlauen warteten in ihren Fahrzeugen, die Heizung auf höchste Stufe gestellt, während der kalte Wind die Karosserie schaukelte wie eine Kinderwiege. Dan Brock, der Besitzer des örtlichen Begräbnisinstituts, der auch als Coroner der Stadt fungierte, schlief in seinem Transporter, den Kopf an der Nackenlehne, den Mund weit offen. Sogar die Notfallsanitäter saßen geschützt in ihrem Krankenwagen. Lena sah ihre Gesichter durch die Fenster in den Hecktüren spähen. Hin und wieder wurde eine Hand herausgestreckt, eine Zigarette glühte im dämmrigen Morgenlicht.
Lena hatte eine Beweismitteltüte in der Hand. Sie enthielt einen Brief, den man in Ufernähe gefunden hatte. Das Papier war von einem größeren Blatt abgerissen worden – liniertes Papier, in etwa DIN-A5. Die Wörter waren in Großbuchstaben geschrieben. Mit Kugelschreiber. Eine Zeile. Keine Unterschrift. Nicht der übliche gehässige oder klägliche Abschied, sondern klar und deutlich: ICHWILLESVORBEIHABEN.
In vielerlei Hinsicht sind die Ermittlungen bei einem Selbstmord schwieriger als bei einem Mord. Bei einem Ermordeten gibt es immer jemanden, dem man die Schuld geben kann. Es gibt Spuren, die einen zum Täter führen können, ein klares Muster, das man darlegen kann, um der Familie zu erklären, warum ihnen die geliebte Person entrissen worden ist. Oder wenn schon nicht warum, dann wer der Mistkerl ist, der ihr Leben ruiniert hat.
Bei Selbstmorden ist das Opfer der Mörder. Die Person, auf der die Schuld lastet, ist auch die Person, deren Verlust am tiefsten empfunden wird. Sie ist nicht mehr da, um sich den Anschuldigungen wegen ihres Todes zu stellen, der natürlichen Wut, die jeder empfindet, wenn er einen Verlust erlitten hat. Was die Toten stattdessen hinterlassen, ist eine Leere, die all der Schmerz und der Kummer in der Welt nie werden füllen können. Mutter und Vater, Schwestern, Brüder, Freunde und andere Verwandte – alle stehen mit leeren Händen da und finden niemanden, den sie für ihren Verlust bestrafen können.
Und die Menschen wollen immer bestrafen, wenn ein Leben unerwartet genommen wird.
Das war der Grund, warum es hier Aufgabe der Ermittler war, dafür zu sorgen, dass jeder Zentimeter des Fundorts und des Schauplatzes des Todes penibel vermessen und aufgezeichnet wurde. Jede Zigarettenkippe, jeder Papierfetzen, jedes Stück weggeworfenen Mülls musste katalogisiert, auf Fingerabdrücke überprüft und für eine Analyse ins Labor geschickt werden. Im Anfangsbericht wurde auch das Wetter notiert. Die verschiedenen Beamten und das Notfallpersonal wurden in einer separaten Liste registriert. Falls Schaulustige vorhanden waren, wurden Fotos gemacht. Autokennzeichen wurden überprüft. Das Leben des Selbstmordopfers wurde so gründlich durchleuchtet wie das eines Mordopfers: Wer waren ihre Freunde? Wer waren ihre Liebhaber? Gab es einen Ehemann? Einen Freund? Eine Freundin? Gab es wütende Nachbarn oder neidische Arbeitskollegen?
Lena wusste nur, was sie bis jetzt gefunden hatten: ein Paar Frauensportschuhe in Größe 8, darunter der Abschiedsbrief. Im linken Schuh lag ein billiger Ring – zwölfkarätiges Gold mit einem leblosen Rubin in der Mitte. Der rechte Schuh enthielt eine weiße Swiss-Army-Armbanduhr mit falschen Diamanten anstelle der Ziffern. Unter diesem Schuh lag der zusammengefaltete Zettel.
ICHWILLESVORBEIHABEN.
Kein großer Trost für die Hinterbliebenen.
Plötzlich stieß, Wasser aufspritzend, einer der Taucher durch die Seeoberfläche. Sein Partner tauchte neben ihm auf. Beide mussten gegen den Schlick auf dem Seegrund ankämpfen, um die Leiche aus dem kalten Wasser und in den kalten Regen zu zerren. Das tote Mädchen war klein und zierlich, was ihre Anstrengungen übertrieben wirken ließ, aber Lena sah schnell den Grund dafür. Eine schwere Kette war um ihre Taille gewickelt und mit einem leuchtend gelben Vorhängeschloss befestigt, das ihr wie eine Gürtelschnalle ziemlich tief vor dem Bauch hing. An der Kette waren zwei Waschbetonblöcke befestigt.
Manchmal erlebte man bei der Polizeiarbeit Wunder. Die Frau hatte offensichtlich sicherstellen wollen, dass sie es nicht mehr aus dem See herausschaffte. Ohne das Gewicht der Waschbetonblöcke hätte die Strömung die Leiche wahrscheinlich in die Mitte des Sees getrieben, was es so gut wie unmöglich gemacht hätte, sie zu finden.
Lake Grant war ein etwa dreizehnhundert Hektar großes, künstlich angelegtes Gewässer, das an einigen Stellen bis zu hundert Meter tief war. Unter der Oberfläche standen verlassene Häuser, kleine Hütten und Schuppen, wo früher Menschen gelebt hatten, bevor das Gebiet in ein Wasserreservoir umgewandelt wurde. Es gab dort unten Geschäfte und Kirchen und eine Baumwollspinnerei, die den Bürgerkrieg überlebt hatte, nur um während der Depression geschlossen zu werden. Das alles war ausgelöscht worden von dem herabstürzenden Wasser des Ochawahee River, damit das Grant County eine zuverlässige Stromquelle erhielt.
Der Großteil des Sees gehörte dem National Forest Service, deutlich über vierhundert Hektar, die um den See lagen wie eine Kapuze. Eine Seite grenzte an das Wohngebiet, wo die Wohlhabenderen lebten, die andere ans Grant Institute of Technology, einer kleinen, aber aufstrebenden staatlichen Universität mit fast fünftausend Studenten.
Sechzig Prozent des achtzig Meilen langen Seeufers gehörte der State Forestry Division. Die bei Weitem beliebteste Stelle war diese hier, Lover’s Point, wie die Einheimischen sie nannten. Hier durften Camper ihre Zelte aufstellen. Teenager kamen hierher, um Partys zu feiern, und hinterließen oft leere Bierflaschen und benutzte Kondome. Hin und wieder gab es einen Anruf wegen eines Feuers, das irgendjemand hatte außer Kontrolle geraten lassen, und einmal war ein tollwütiger Bär gemeldet worden, der sich dann aber als altersschwacher Labrador erwies, der sich vom Lagerplatz seines Herrchens fortgeschlichen hatte.
Gelegentlich wurden hier auch Leichen gefunden. Einmal war ein Mädchen lebendig begraben worden. Mehrere Männer, Teenager, wie vorauszusehen gewesen war, waren ertrunken, als sie diverse Mutproben vollführten. Im letzten Sommer hatte ein Kind sich das Genick gebrochen, als es kopfüber in das flache Wasser der kleinen Bucht sprang.
Die beiden Taucher hielten inne und ließen das Wasser von ihren Anzügen tropfen, bevor sie ihre Arbeit wiederaufnahmen. Schließlich, nach zustimmendem Nicken von allen Umstehenden, wurde die junge Frau höher aufs Ufer gezogen. Die Waschbetonblöcke hinterließen tiefe Furchen in dem sandigen Boden. Es war halb sieben in der Früh, und der Mond schien zu blinzeln, als die Sonne langsam über den Horizont stieg. Die Türen des Krankenwagens gingen auf. Die Sanitäter fluchten über die bittere Kälte, als sie die Rollbahre herauszogen. Einer hatte einen Bolzenschneider über der Schulter. Er knallte mit der Hand auf die Motorhaube des Transporters des Coroner, und Dan Brock schreckte hoch und fuchtelte mit den Armen. Er schaute die Sanitäter streng an, blieb aber, wo er war. Lena konnte es ihm nicht verdenken, dass er keine Lust hatte, sich in den Regen zu stürzen. Das Opfer würde nirgendwo mehr hingehen außer in die Leichenhalle. Blinklichter und Sirenen waren hier nicht nötig.
Während Lena zu der Leiche lief, faltete sie die Beweismitteltüte mit dem Abschiedsbrief sorgfältig zusammen, steckte sie in ihre Parkatasche und zog einen Stift und ihr Spiralnotizbuch heraus. Den Regenschirm zwischen Hals und Schulter eingeklemmt, notierte sie sich Uhrzeit, Datum, Wetter, Anzahl der Sanitäter, Anzahl der Taucher und Anzahl der Fahrzeuge und Polizisten sowie eine kurze Beschreibung der Umgebung, wobei sie auch auf die ernst feierliche Stille der Szenerie und das völlige Fehlen von Schaulustigen einging – all die Details, die sie später genauso in ihren Bericht würde tippen müssen.
Das Opfer war ungefähr so groß wie Lena, etwa eins dreiundsechzig, aber viel zierlicher. Ihre Handgelenke waren zart wie Vogelknochen. Die Fingernägel waren unregelmäßig abgenagt. Sie hatte schwarze Haare und extrem weiße Haut. Vermutlich war sie Anfang zwanzig. Ihre geöffneten Augen waren matt wie Baumwolle. Der Mund war geschlossen. Die Lippen waren schartig, als hätte sie nervös darauf herumgekaut. Vielleicht hatte aber auch ein Fisch Hunger bekommen. Ohne die Zugkraft des Wassers war die Leiche einfacher zu manövrieren, und so waren nur drei Sanitäter nötig, um sie auf die Rollbahre zu hieven. Schlick vom Seegrund bedeckte sie vom Kopf bis zu den Zehen. Wasser troff aus ihrer Kleidung – Bluejeans, ein schwarzes Fleece-Shirt, weiße Socken, keine Schuhe, eine offene, dunkelblaue Aufwärmjacke mit dem Nike-Logo auf der Vorderseite. Die Rollbahre schwankte, und ihr Kopf kippte von Lena weg.
Lena hörte auf zu schreiben. »Moment mal«, rief sie, weil sie spürte, dass hier irgendwas nicht stimmte. Sie steckte ihr Notizbuch in die Tasche und ging einen Schritt auf die Leiche zu. Im Nacken des Mädchens hatte sie etwas aufblitzen sehen – etwas Silbernes, vielleicht eine Halskette. Algen bedeckten Hals und Schultern des Mädchens wie ein Leichentuch. Mit der Spitze ihres Kugelschreibers schob Lena die glitschigen grünen Tentakel weg. Unter der Haut des Mädchens bewegte sich etwas, es kräuselte das Fleisch, wie der Regen die Wasseroberfläche kräuselte.
Auch den Tauchern fiel die Bewegung auf. Sie alle bückten sich, um genauer hinzusehen. Die Haut flatterte wie in einem Horrorfilm.
»Was zum …«
»O Gott!« Lena schrak zurück, als eine kleine Elritze aus einem Schlitz im Hals des Mädchens glitt.
Die Taucher lachten, wie Männer eben lachen, die nicht zugeben wollen, dass sie sich fast in die Hose gemacht hätten. Lena dagegen legte sich die Hand aufs Herz und hoffte, dass niemand mitbekommen hatte, wie ihr das Herz beinah aus der Brust gesprungen wäre. Sie atmete tief durch. Die Elritze zappelte im Schlamm. Einer der Männer hob sie auf und warf sie wieder in den Fluss. Der Leiter des Tauchtrupps riss den unvermeidlichen Witz, dass etwas hier fischig sei.
Lena warf ihm einen strengen Blick zu, bevor sie sich über die Leiche beugte. Der Schlitz, aus dem der Fisch gekommen war, befand sich im Nacken, knapp rechts neben der Wirbelsäule. Sie schätzte, dass die Wunde maximal zweieinhalb Zentimeter breit war. Das geöffnete Fleisch war im Wasser geschrumpelt, doch vor einiger Zeit musste die Verletzung sauber und präzise gewesen sein – ein Schnitt, wie er von einem sehr scharfen Messer verursacht wurde.
»Jemand muss Brock wecken«, sagte sie.
Jetzt war es plötzlich keine Selbstmordermittlung mehr.
2. Kapitel
In seinem dem County gehörenden Lincoln Town Car rauchte Frank Wallace nie, aber die Sitzbespannung hatte den Nikotingestank aufgenommen, der aus jeder seiner Poren sickerte. Er erinnerte Lena an Pig Pen aus dem Peanuts-Comic. Egal wie sauber er war oder wie oft er seine Kleidung wechselte, der Gestank folgte ihm wie eine Staubwolke.
»Was ist los?«, fragte er barsch und ließ ihr nicht einmal die Zeit, die Autotür zu schließen.
Lena warf den feuchten Parka auf den Wagenboden. Zuvor hatte sie zwei T-Shirts übereinander angezogen und darüber noch eine Jacke. Trotzdem und obwohl die Heizung auf voller Leistung lief, klapperten ihre Zähne noch immer. Es war, als hätte ihr Körper die ganze Kälte gespeichert, während sie draußen im Regen stand, und würde sie erst jetzt, da sie im Warmen war, wieder freigeben.
Sie hielt die Hände an den Lüftungsschlitz. »O Gott, es ist eiskalt.«
»Was ist los?«, wiederholte Frank. Demonstrativ schob er seinen schwarzen Lederhandschuh zurück, damit er auf die Uhr schauen konnte.
Lena zitterte unwillkürlich. Sie schaffte es nicht, ihrer Stimme die Aufregung nicht anmerken zu lassen. Kein Polizist würde es einem Zivilisten gegenüber je zugeben, aber Morde waren in der Arbeit die aufregendsten Fälle. Lena war randvoll mit Adrenalin, und es wunderte sie, dass sie die Kälte überhaupt spürte. Mit klappernden Zähnen sagte sie zu ihm:
»Es ist kein Selbstmord.«
Frank wirkte noch verärgerter. »Ist Brock derselben Meinung?«
Brock war wieder zurück in seinem Transporter und schlief, während die Kette durchtrennt wurde, das sahen sie beide, weil sie sogar aus dem Auto heraus seine schwarzen Backenzähne erkennen konnten. »Brock kann doch seinen Arsch nicht von einem Loch im Boden unterscheiden«, keifte sie zurück. Sie rieb sich die Arme, um ein wenig Wärme in den Körper zu bekommen.
Frank zog seinen Flachmann heraus und gab ihn ihr. Sie nahm einen schnellen Schluck, und der Whiskey brannte sich durch ihre Kehle in den Magen. Auch Frank nahm einen kräftigen Zug, bevor er sich den Flachmann wieder in die Jackentasche steckte.
»Im Nacken ist ein Messerstich«, sagte sie.
»In Brocks?«
Lena warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Im Nacken des toten Mädchens.« Sie bückte sich und suchte in ihrem Parka nach der Brieftasche, die sie in der Jackentasche der jungen Frau gefunden hatte.
»Könnte selbst beigebracht sein«, sagte Frank.
»Unmöglich.« Sie hielt sich die Hand in den Nacken. »Die Klinge drang ungefähr hier ein. Der Mörder stand hinter ihr. Hat sie wahrscheinlich überrascht.«
Frank murmelte: »Hast du das aus einem Lehrbuch?«
Lena sagte nichts darauf, was sie normalerweise nicht schaffte. Frank war seit vier Jahren Interims-Polizeichef. Alles, was in den drei Städten passierte, die das Grant County umfasste, fiel in seine Zuständigkeit. Madison und Avondale hatten die üblichen Probleme mit Drogen und häuslicher Gewalt, aber Heartsdale sollte eigentlich problemlos sein.
Das College war hier angesiedelt, und die wohlhabenden Einwohner meldeten jeden Anfangsverdacht eines Verbrechens sofort.
Dessen ungeachtet hatten komplizierte Fälle die Tendenz, Frank zu einem Arschloch zu machen. Genau genommen konnte das Leben im Allgemeinen Frank zu einem Arschloch machen. Dass sein Kaffee kalt wurde. Dass der Motor seines Autos nicht gleich beim ersten Versuch ansprang. Dass die Mine seines Kugelschreibers eintrocknete. Frank war nicht immer so gewesen. Sicherlich hatte er, seit Lena ihn kannte, schon immer eine Neigung zum Mürrischen gehabt, aber in letzter Zeit war sein Verhalten gefärbt von einer subtilen Wut, die jederzeit durchbrechen konnte. Alles machte ihn wütend. In einem Augenblick konnte bei ihm aus beherrschbarer Irritation unverhohlene Gemeinheit werden.
Zumindest in dieser speziellen Angelegenheit war Franks Widerwille einleuchtend. Nach fünfunddreißig Jahren Polizeiarbeit war ein Mord das Letzte, was er jetzt noch am Hals haben wollte. Lena wusste, dass er die Nase voll hatte von dem Job und von den Leuten, mit denen er deswegen zu tun hatte. In den letzten sechs Jahren hatte er zwei seiner engsten Freunde verloren. An einem See sitzen wollte er nur noch im sonnigen Florida. Eigentlich sollte er eine Angelrute und ein Bier in der Hand haben, nicht die Brieftasche eines toten Mädchens.
»Sieht unecht aus«, sagte Frank, als er die Brieftasche öffnete. Lena stimmte ihm zu. Das Leder war zu glänzend. Das Prada-Logo war aus Plastik.
»Allison Judith Spooner«, sagte Lena, als er versuchte, die durchweichten Plastiktaschen auseinanderzuziehen. »Einundzwanzig. Der Führerschein stammt aus Elba, Alabama. Ganz hinten steckt ihr Studentenausweis.«
»College.« Frank hauchte das Wort mit einem Anflug von Verzweiflung. Es war schlimm genug, dass man Allison Spooner auf staatlichem Grund und Boden gefunden hatte. Dass das Mädchen zusätzlich aus einem anderen Staat kam und Studentin des Grant Tech war, würde für erhöhte politische Aufmerksamkeit sorgen.
»Wo hast du die Brieftasche gefunden?«, fragte er.
»In ihrer Jackentasche. Schätze, eine Handtasche hatte sie nicht. Oder der Mörder wollte, dass wir ihre Identität erfahren.«
Er schaute sich das Führerscheinfoto des Mädchens an.
»Was ist?«
»Sieht aus wie die kleine Bedienung, die im Diner arbeitet.«
Das Grant Diner lag vom Polizeirevier aus am entgegengesetzten Ende der Main Street. Die meisten Beamten gingen zum Mittagessen dorthin. Lena hielt sich allerdings fern. Entweder brachte sie sich etwas von zu Hause mit, oder aber sie aß gar nichts.
»Hast du sie gekannt?«, fragte sie.
Er schüttelte den Kopf und zuckte zugleich die Achseln.
»Sie hat gut ausgesehen.«
Frank hatte recht. Ein schmeichelhaftes Führerscheinfoto hatten nicht viele, aber Allison Spooner hatte mehr Glück gehabt als die meisten. Ihre weißen Zähne zeigten ein breites Lächeln. Die Haare waren nach hinten gekämmt, sodass man ihre hohen Wangenknochen sah. Sie hatte Fröhlichkeit in den Augen, als hätte eben jemand einen Witz gemacht. Das alles stand in scharfem Kontrast zu der Leiche, die sie aus dem See gezogen hatten. Der Tod hatte ihre Vitalität ausgelöscht.
»Wusste gar nicht, dass sie Studentin war«, sagte Frank.
»Normalerweise arbeiten sie nicht in der Stadt«, gab Lena zu. Die Studenten des Grant Tech arbeiteten entweder auf dem Campus oder gar nicht. Sie hatten so gut wie keinen Kontakt mit den Städtern, und die Städter gaben sich Mühe, nicht in Kontakt mit ihnen zu kommen.
»Das College ist über die Thanksgiving-Ferien geschlossen. Warum ist sie nicht zu Hause bei ihrer Familie?«, gab Frank zu bedenken.
Darauf hatte Lena keine Antwort. »In der Brieftasche sind vierzig Dollar, ein Raubmord war es also nicht.«
Frank schaute trotzdem in das Fach, und seine dicken, behandschuhten Finger fanden die mit Seewasser zusammengeklebten Zwanziger und Zehner. »Vielleicht war sie einsam. Und hat beschlossen, ein Messer zu nehmen und allem ein Ende zu setzen.«
»Dann hätte sie ein Schlangenmensch sein müssen«, beharrte Lena. »Du wirst es sehen, wenn Brock sie auf dem Tisch hat. Sie wurde von hinten erstochen.«
Er seufzte erschöpft. »Was ist mit der Kette und den Waschbetonsteinen?«
»Wir können in Mann’s Hardware in der Stadt nachfragen. Vielleicht hat der Mörder sie ja dort gekauft.«
Er versuchte es noch einmal. »Bist du dir sicher wegen der Messerwunde?«
Sie nickte.
Frank starrte wieder auf das Führerscheinfoto. »Hat sie ein Auto?«
»Wenn sie eines hat, ist es nicht in der näheren Umgebung.« Sie kehrte noch einmal zu ihrer Mordthese zurück.
»Wenn sie die zwei Zehnkiloblöcke und die schwere Kette nicht durch den Wald geschleppt hat …«
Frank klappte die Brieftasche zu und gab sie ihr zurück.
»Warum wird eigentlich jeder Montag immer noch beschissener?«
Darauf hatte Lena keine Antwort. In der letzten Woche war es nicht viel besser gewesen. Eine junge Mutter und ihre Tochter waren von einer Sturzflut mitgerissen worden. Die ganze Stadt war noch immer in Aufruhr über den Verlust. Kein Mensch konnte sagen, wie die Leute auf den Mord an einer jungen, hübschen Studentin reagieren würden.
»Brad versucht, jemanden vom College aufzutreiben, der Zugang zur Registratur hat und uns Spooners Heimatadresse geben kann.« Brad Stephens war endlich vom Streifenpolizisten zum Detective aufgestiegen, aber seine neue Arbeit unterschied sich kaum von der alten. Er machte noch immer die Laufarbeit.
»Sobald die Spurensicherung abgeschlossen ist«, bot Lena an, »kümmere ich mich um die Todesbenachrichtigungen.«
»Alabama hat zentrale Zeit.« Frank schaute auf die Uhr.
»Ist wahrscheinlich besser, die Eltern direkt anzurufen, als so früh schon die Polizei von Elba aufzuscheuchen.«
Lena schaute auf die Uhr. Hier war es fast sieben, was in Alabama kurz vor sechs bedeutete. Wenn es in Elba so war wie im Grant County, dann hatten die Detectives zwar die ganze Nacht Rufbereitschaft, an ihren Schreibtischen saßen sie jedoch erst ab acht Uhr morgens. Normalerweise stand Lena erst um diese Zeit auf und schaltete die Kaffeemaschine ein. »Wenn ich wieder auf dem Revier bin, rufe ich anstandshalber auch noch bei den Kollegen an.«
Im Auto wurde es still – bis auf das Prasseln des Regens auf Blech. Ein Blitz zuckte quer über den Himmel. Lena schreckte instinktiv zusammen, aber Frank starrte nur auf den See hinaus. Die Taucher hatten keine Angst vor den Blitzen. Sie wechselten sich am Bolzenschneider ab und versuchten, das tote Mädchen von den Waschbetonblöcken zu befreien.
Franks Handy klingelte, ein schrilles Trillern, das klang wie ein Vogel, der irgendwo im Wald saß. Er meldete sich mit einem barschen »Ja?«. Er hörte ein paar Sekunden zu und fragte dann: »Was ist mit den Eltern?« Frank murmelte ein paar Verwünschungen. »Dann geh wieder rein, und find’s heraus.« Er klappte das Handy zu. »Trottel.«
Lena nahm an, dass Brad vergessen hatte, die Informationen über die Eltern zu besorgen. »Wo wohnte Spooner?«
»Taylor Drive. Nummer sechzehneinhalb. Brad soll sich dort mit uns treffen, falls er es schafft, sein Gehirn einzuschalten.« Er startete den Motor und legte den Arm auf Lenas Rückenlehne, während er mit dem Auto zurückstieß. Der Wald war dicht und feucht. Lena stützte sich mit der Handfläche am Armaturenbrett ab, während Frank langsam zur Straße zurückfuhr.
»Sechzehneinhalb heißt wahrscheinlich, dass sie in einer Garagenwohnung lebt«, bemerkte Lena. Viele der Einheimischen hatten ihre Garagen und Werkzeugschuppen in Wohnraum umgewandelt und verlangten dafür von den Studenten exorbitante Mieten. Aber die meisten Studenten wollten unbedingt außerhalb des Campus wohnen, sodass sie jeden Preis zahlten.
»Der Vermieter heißt Gordon Braham«, sagte Frank.
»Hat Brad das herausgefunden?«
Sie fuhren so heftig über eine Bodenerhebung, dass Franks Zähne aufeinanderschlugen. »Seine Mutter hat es ihm gesagt.«
»Na ja.« Lena suchte verzweifelt nach etwas Positivem, das sie über Brad sagen konnte. »Er zeigt Initiative, indem er herausgefunden hat, wem das Haus und die Garage gehören.«
»Initiative«, wiederholte Frank spöttisch. »Der Junge wird sich eines Tages noch mal den Kopf wegschießen lassen.«
Lena kannte Brad seit über zehn Jahren. Frank kannte ihn noch länger. Für sie beide war er noch immer der trottelige Junge, der Teenager, der mit seiner Waffe, die er zu hoch über der Hüfte trug, völlig deplatziert aussah. Brad hatte einige Jahre in Uniform hinter sich und die richtigen Tests bestanden, die ihm die goldene Plakette eines Detective einbrachten, aber Lena war lange genug bei der Truppe, um zu wissen, dass es einen Unterschied gab zwischen einer Beförderung auf dem Papier und einer Beförderung auf der Straße. Sie konnte nur hoffen, dass in einer Kleinstadt wie Heartsdale Brads Mangel an Straßenschläue nichts zur Sache tat. Berichte schreiben und Zeugen befragen beherrschte er sehr gut, aber auch nach zehn Jahren am Steuer eines Streifenwagens sah er in den Menschen immer noch eher das Gute als das Schlechte.
Lena hatte im Job gerade mal eine Woche gebraucht, um zu erkennen, dass es so etwas wie einen durch und durch guten Menschen nicht gab.
Sie selbst eingeschlossen.
Doch sie wollte jetzt keine Zeit mit Gedanken über Brad verschwenden. Sie betrachtete die Fotos in Allison Spooners Brieftasche, während Frank durch den Wald fuhr. Es gab eine Aufnahme von einer orangefarben gescheckten Katze, die in einem Streifen Sonnenlicht lag, und einen Schnappschuss von Allison und einer Frau, ihrer Mutter, wie Lena vermutete. Das dritte Foto zeigte Allison auf einer Parkbank. Rechts von ihr saß ein Mann, der ein paar Jahre jünger wirkte als sie. Er trug eine tief in die Stirn gezogene Baseballkappe und hatte die Hände tief in den Taschen seiner weiten Hose. Links von Allison saß eine ältere Frau mit strähnigen blonden Haaren und zu viel Make-up im Gesicht. Ihre Jeans waren hauteng. Die Augen strahlten Härte aus. Sie mochte dreißig oder dreihundert Jahre alt sein. Alle drei saßen dicht beisammen. Der Junge hatte Allison Spooner den Arm um die Schultern gelegt.
Lena zeigte Frank das Foto. Er fragte: »Familie?«
Sie betrachtete das Foto und konzentrierte sich dabei auf den Hintergrund. »Sieht aus, als wäre das Foto auf dem Campus aufgenommen worden.« Sie zeigte es Frank. »Siehst du das Gebäude dahinten? Ich glaube, das ist das Studentenzentrum.«
»Für mich sieht die Frau nicht aus wie eine Collegestudentin.«
Er meinte die ältere Blonde. »Sieht aus wie eine von hier.« Sie hatte das unmissverständlich billige, blond gebleichte Aussehen eines in der Kleinstadt aufgewachsenen Mädchens. Von der nachgemachten Brieftasche einmal abgesehen, wirkte Allison, als befände sie sich auf der gesellschaftlichen Leiter einige Stufen weiter oben. Es passte irgendwie nicht, dass die beiden Freundinnen sein sollten. »Vielleicht hatte Spooner ein Drogenproblem?«, vermutete Lena. Nichts überwand Grenzen so einfach wie Methamphetamin.
Schließlich waren sie wieder auf der Hauptstraße. Die Hinterräder drehten ein letztes Mal im Schlamm durch, als Frank auf den Asphalt fuhr. »Wer hat den Fund eigentlich gemeldet?«
Lena schüttelte den Kopf. »Der 911er-Anruf kam von einem Handy. Die Nummer war unterdrückt. Weibliche Stimme, aber sie wollte ihren Namen nicht nennen.«
»Was hat sie gesagt?«
Lena blätterte behutsam in ihrem Notizbuch, damit die feuchten Seiten nicht zerrissen. Sie fand die Mitschrift und las sie laut vor. »Weibliche Stimme: ›Meine Freundin ist seit heute Nachmittag verschwunden. Ich glaube, sie hat sich umgebracht.‹ Notrufbeamter: ›Wie kommen Sie darauf, dass sie sich umgebracht haben könnte?‹ Weibliche Stimme: ›Sie hatte letzte Nacht Streit mit ihrem Freund. Sie sagte, sie würde am Lover’s Point ins Wasser gehen.‹ Der Beamte versuchte, sie in der Leitung zu halten, aber sie legte danach auf.«
Frank sagte nichts. Sie sah seinen Kehlkopf arbeiten. Er ließ die Schultern so tief hängen, dass er aussah wie ein Kleinkrimineller, der sich am Lenkrad festklammerte. Seit Lena in sein Auto gestiegen war, wehrte er sich gegen die Möglichkeit, dass es sich hier um Mord handeln könnte.
»Was denkst du?«, fragte sie.
»Lover’s Point«, wiederholte Frank. »Nur jemand aus der Stadt würde es so nennen.«
Lena hielt das Notizbuch vor die Lüftungsschlitze der Heizung, um die Seiten zu trocknen. »Der Freund ist wahrscheinlich der Junge auf dem Foto.«
Frank ging auf ihren Gedankengang nicht ein. »Da kam also der 911er-Anruf, und Brad ist zum See gefahren und hat was gefunden?«
»Der Zettel lag unter dem rechten Schuh. Allisons Ring und die Armbanduhr steckten in den Schuhen.« Lena bückte sich wieder zu den Beweismitteltüten, die tief in den Taschen ihres Parkas steckten. Sie durchwühlte die Habseligkeiten des Opfers und fand den Zettel, den sie Frank zeigte.
ICHWILLESVORBEIHABEN.
Er starrte die Schrift so lange an, dass sie sich Gedanken machte, weil er nicht mehr auf die Straße achtete.
»Frank?«
Ein Rad streifte den Asphaltrand. Frank riss das Steuer herum. Lena hielt sich am Armaturenbrett fest. Sie würde den Teufel tun und seinen Fahrstil korrigieren. Frank war nicht der Mann, der sich gern korrigieren ließ, vor allem nicht von einer Frau. Vor allem nicht von Lena.
»Komischer Abschiedsbrief«, sagte sie. »Auch wenn es nur ein vorgetäuschter ist.«
»Kurz und prägnant.« Frank behielt eine Hand am Lenkrad, während er seine Jackentasche durchsuchte. Er setzte seine Lesebrille auf und starrte auf die verschmierte Tinte. »Sie hat nicht unterschrieben.«
Lena schaute auf die Straße. Er fuhr schon wieder auf der rechten Begrenzungslinie. »Nein.«
Frank steuerte wieder in Richtung Mittellinie. »Sieht das für dich aus wie die Handschrift einer Frau?«
Darüber hatte Lena noch gar nicht nachgedacht. Sie betrachtete den einzelnen Satz, der mit breiten, runden Großbuchstaben geschrieben war. »Sieht ordentlich aus, aber ich könnte nicht sagen, ob das eine Frau oder ein Mann geschrieben hat. Wir könnten einen Handschriftexperten fragen. Allison ist Studentin, also gibt es wahrscheinlich Vorlesungsmitschriften und Aufsätze oder Tests von ihr. Ich bin mir sicher, wir finden etwas, womit wir den Satz hier vergleichen können.«
Frank ging auf keinen ihrer Vorschläge ein. Stattdessen sagte er: »Ich denke gerade an die Zeit, als meine Tochter in ihrem Alter war.« Er räusperte sich ein paarmal. »Auf das i hat sie immer Kringel gemalt anstelle von Punkten.«
Lena sagte nichts. Ihre ganze Karriere lang hatte sie mit Frank gearbeitet, aber über sein Privatleben wusste sie nicht mehr als sonst jemand in der Stadt. Von seiner ersten Frau hatte er zwei Kinder, aber das war inzwischen viele Ehefrauen her. Sie waren aus der Stadt weggezogen, und anscheinend hatte er keinen Kontakt mehr mit ihnen. Seine Familie war ein Thema, über das er so gut wie nie redete, und im Augenblick fror Lena zu sehr und war viel zu aufgeregt, um damit anzufangen.
Sie richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Fall.
»Also, irgendjemand hat Allison in den Hals gestochen, sie an Waschbetonblöcke gekettet, in den See geworfen und dann beschlossen, es aussehen zu lassen wie einen Selbstmord.« Lena schüttelte den Kopf über diese Dummheit. »Mal wieder ein kriminelles Genie.«
Frank schnaubte zustimmend. Sie spürte, dass seine Gedanken bei anderen Dingen waren. Er nahm die Brille ab und starrte auf die Straße.
Obwohl sie es nicht wollte, fragte sie: »Was ist denn los?«
»Nichts.«
»Wie viele Jahre fahre ich jetzt schon mit dir, Frank?«
Er machte noch einmal ein grunzendes Geräusch, gab dann aber nach. »Der Bürgermeister versucht, mich festzunageln.«
Lena spürte einen Kloß in der Kehle. Clem Waters, der Bürgermeister von Heartsdale, versuchte schon seit einiger Zeit, Franks Position als Interims-Polizeichef in eine Dauerstellung umzuwandeln.
»Eigentlich will ich den Job überhaupt nicht, aber es ist auch niemand sonst da, der sich darum reißt.«
»Nein«, pflichtete sie ihm bei. Kein Mensch wollte diesen Job, nicht zuletzt deswegen, weil keiner dem Mann, der ihn zuvor innegehabt hatte, je das Wasser würde reichen können.
»Die Vergünstigungen sind gut«, sagte Frank. »Nettes Ruhestandspaket. Bessere Krankenversicherung, bessere Pension.«
Sie schaffte es zu schlucken. »Das ist gut, Frank. Jeffrey hätte gewollt, dass du den Job annimmst.«
»Er hätte gewollt, dass ich mich zur Ruhe setze, bevor ich einen Herzinfarkt bekomme, weil ich einen Junkie über den Campus jagen muss.« Frank zog seinen Flachmann heraus und bot ihn Lena an. Sie schüttelte den Kopf und sah zu, wie er einen großen Schluck trank, den Kopf in den Nacken gelegt und nur ein Auge auf die Straße gerichtet. Lena schaute weiter auf seine Hand. Sie zitterte noch immer leicht. In letzter Zeit zitterten seine Hände oft, vor allem morgens.
Ohne Vorwarnung wurde aus dem stetigen Rhythmus des Regens ein hartes Stakkato. Der Lärm hallte durchs Auto, füllte den Innenraum aus. Lena drückte die Zunge an ihren Gaumen. Eigentlich sollte sie Frank jetzt sagen, dass sie kündigen wollte, dass in Macon ein Job auf sie wartete, wenn sie den Absprung schaffte. Sie war ins Grant County gezogen, um in der Nähe ihrer Schwester zu sein, aber ihre Schwester war nun schon fast zehn Jahre tot. Ihr Onkel, der einzige lebende Verwandte, war im Ruhestand nach Florida gezogen. Ihre beste Freundin hatte eine Stelle in einer Bibliothek im Norden angenommen. Ihr Freund lebte zwei Stunden entfernt. Es gab nichts, was Lena noch hier hielt, außer ihrer eigenen Trägheit und der Loyalität zu einem Mann, der inzwischen vier Jahre tot war und sie wahrscheinlich sowieso nicht für eine gute Polizistin gehalten hatte.
Frank drückte die Knie gegen das Lenkrad, während er den Deckel wieder auf den Flachmann schraubte. »Ich werde ihn nicht annehmen, außer du sagst, dass es okay ist.«
Sie drehte überrascht den Kopf. »Frank …«
»Ich meine es ernst«, warf er dazwischen. »Wenn es für dich nicht okay ist, dann sage ich dem Bürgermeister, er kann ihn sich sonst wohin schieben.« Er kicherte heiser, und Lena meinte, den Schleim in seinen Bronchien rasseln zu hören.
»Vielleicht nehme ich dich ja mit, damit du den Ausdruck auf dem Gesicht des kleinen Wichsers siehst.«
Sie zwang sich zu sagen: »Du solltest den Job annehmen.«
»Ich weiß nicht, Lee. Ich werde so verdammt alt. Die Kinder sind alle erwachsen. Meine Frauen sind alle weggezogen. An vielen Tagen frage ich mich, warum ich in der Früh überhaupt noch aufstehe.« Noch einmal kicherte er heiser. »Kann sein, dass du eines Tags mich im See findest und die Uhr in meinen Schuhen. Das meine ich ernst.«
Sie wollte die Erschöpfung in seiner Stimme nicht hören. Frank war zwanzig Jahre länger als Lena bei der Truppe, aber sie konnte seinen Überdruss nachempfinden, als wäre es ihr eigener. Das war der Grund, warum sie jede freie Minute in Vorlesungen im College verbracht und versucht hatte, einen Bachelor-Abschluss in Forensik zu machen, damit sie bei der Spurensicherung arbeiten konnte und nicht mehr auf Verbrecherjagd gehen musste.
Mit den frühmorgendlichen Anrufen, die sie aus dem Schlaf rissen, konnte Lena umgehen. Sie konnte auch mit den blutbesudelten Tatorten und den Leichen und dem Elend umgehen, mit dem der Tod jeden Augenblick des eigenen Lebens färbte. Nicht mehr aushalten konnte sie allerdings, immer an vorderster Front stehen zu müssen. Es war zu viel Verantwortung. Es war zu viel Risiko. Man brauchte nur einen einzigen Fehler zu machen, und der konnte das Leben kosten – nicht einen selbst, sondern einen anderen Menschen. Es konnte passieren, dass man verantwortlich war für den Tod von jemandes Sohn. Jemandes Ehemann. Jemandes Freund. Man fand ziemlich schnell heraus, dass der Tod eines anderen Menschen unter der eigenen Verantwortung viel schlimmer war als das Gespenst des eigenen Todes.
»Hör zu«, sagte Frank, »ich muss dir was sagen.«
Lena sah ihn an, seine unvermittelte Offenheit wunderte sie. Seine Schultern hingen noch mehr, und seine Fingerknöchel waren weiß, so heftig klammerte er sich am Lenkrad fest. Sie ging die lange Liste der möglichen Themen durch, die sie bei der Arbeit in Schwierigkeiten bringen konnte, doch was dann aus seinem Mund kam, verschlug ihr den Atem. »Sara Linton ist wieder in der Stadt.«
Lena schmeckte Galle und Whiskey in ihrer Kehle. Einen kurzen, panischen Augenblick lang fürchtete sie, sich übergeben zu müssen. Lena konnte Sara nicht gegenübertreten. Die Anschuldigungen. Das schlechte Gewissen. Schon der Gedanke, durch ihre Straße zu fahren, war zu viel für sie. Lena fuhr immer die lange Strecke zur Arbeit, um nicht an Saras Haus vorbeizukommen, nicht an dem Elend, das in ihr hochkochte, sobald sie nur an diese Straße dachte.
Frank redete leise und sachlich weiter. »Ich habe es in der Stadt gehört, deshalb habe ich ihren Dad angerufen. Er sagte, dass sie heute kommt, um Thanksgiving mit ihnen zu verbringen.« Er räusperte sich. »Ich hätte es dir gar nicht gesagt, aber ich habe die Patrouillen vor ihrem Haus verstärkt. Du siehst es auf dem Dienstplan und wunderst dich – na ja, jetzt weißt du es.«
Lena versuchte, den sauren Geschmack in ihrem Mund hinunterzuschlucken. Es fühlte sich an, als würden Scherben durch ihre Kehle rutschen. »Okay«, sagte sie mit belegter Stimme. »Danke.«
Frank überfuhr ein Stoppschild und bog scharf auf die Taylor Road ab. Lena hielt sich am Türgriff fest, aber das war eine automatische Reaktion. In Gedanken war sie damit beschäftigt, wie sie Frank mitten in einem Fall um Urlaub bitten konnte. Sie würde sich die ganze Woche nehmen und nach Macon fahren, sich vielleicht ein paar Wohnungen anschauen, bis die Thanksgiving-Ferien vorüber waren und Sara wieder in Atlanta war, wohin sie gehörte.
»Schau dir diesen Trottel an«, murmelte Frank, während er auf die Bremse trat.
Brad Stephens stand an seinem Streifenwagen. Er trug einen hellbraunen, rasiermesserscharf gebügelten Anzug. Sein weißes Hemd strahlte förmlich unter der blau gestreiften Krawatte, die wahrscheinlich seine Mutter heute Morgen zusammen mit dem Rest seiner Kleidung für ihn herausgelegt hatte. Was Frank offensichtlich am meisten störte, war der Regenschirm in Brads Hand. Er war leuchtend pink bis auf das gelb aufgestickte Mary-Kay-Logo.
»Sei nicht zu streng mit ihm«, sagte Lena, doch Frank schwang sich bereits aus dem Auto. Er spannte seinen eigenen Regenschirm auf – ein riesiges schwarzes Zeltdach, das er sich von Brock im Bestattungsinstitut geliehen hatte – und stürzte auf Brad zu. Lena blieb im Auto und sah zu, wie Frank den jungen Detective herunterputzte. Sie wusste, wie es sich anfühlte, der Adressat von Franks Tiraden zu sein. Er war ihr Ausbilder gewesen, als sie mit dem Streifendienst anfing, dann ihr Partner, als sie es zur Detective schaffte. Wenn Frank nicht gewesen wäre, hätte sie den Job schon in der ersten Woche wieder hingeschmissen. Dass seiner Überzeugung nach Frauen nicht in den Polizeidienst gehörten, machte sie verdammt entschlossen, ihm das Gegenteil zu beweisen.
Und Jeffrey war ihr Puffer gewesen. Lena hatte schon vor langer Zeit erkannt, dass sie dazu neigte, ein Spiegel desjenigen zu sein, mit dem sie es gerade zu tun hatte. Wenn Jeffrey das Sagen hatte, machte sie alles genau richtig – oder zumindest so richtig, wie sie konnte. Er war ein guter Polizist, ein Mann, dem die Gemeinde vertraute, weil sich in allem, was er tat, sein Charakter zeigte. Das war der Grund, warum der Bürgermeister ihn überhaupt eingestellt hatte. Clem wollte die alten Strukturen aufbrechen, Grant County ins einundzwanzigste Jahrhundert führen. Ben Carver, der scheidende Polizeichef, war ein Gauner gewesen, wie er im Buche stand. Frank war seine rechte Hand gewesen und stand ihm in nichts nach. Unter Jeffrey hatte Frank seine Gewohnheiten geändert. Das hatten sie alle. Zumindest so lange, wie Jeffrey lebte. Schon in der ersten Woche unter Franks Verantwortung schlich sich der alte Schlendrian wieder ein. Anfangs nur langsam und schwer zu entdecken. Das Ergebnis eines Alkoholtests verschwand, was einen von Franks Jagdfreunden vor dem Führerscheinverlust bewahrte. Ein ungewöhnlich vorsichtiger Marihuana-Dealer wurde plötzlich mit einer Riesenmenge Stoff im Kofferraum seines Autos geschnappt. Strafzettel verschwanden. In der Asservatenkammer fehlte Geld. Beschlagnahmungen wurden fadenscheinig. Der Wartungsvertrag für die Dienstfahrzeuge ging an eine Werkstatt, bei der Frank Teilhaber war.
Wie bei einem Dammbruch führten diese kleinen Risse zu größeren Schäden, bis das ganze Ding aufplatzte und jeder Polizist der Truppe etwas tat, das er nicht tun sollte. Das war einer der wichtigsten Gründe, warum Lena gehen musste. In Macon ging es nicht so locker zu. Die Stadt war größer als die drei Städte von Grant County zusammengenommen, insgesamt eine Bevölkerung von etwa einhunderttausend Menschen. Die Leute gingen vor Gericht, wenn sie sich von der Polizei ungerecht behandelt fühlten, und meistens gewannen sie auch. Macons Mordrate gehörte zu den höchsten des Staates. Einbrüche, Sexualdelikte, Gewaltverbrechen – für einen Detective gab es dort viele Möglichkeiten, aber noch mehr für einen Spurensicherungsspezialisten. Lena war nur noch zwei Kurse von ihrem Kriminologieabschluss entfernt. Beim Sammeln von Spuren und Indizien gab es keine Abkürzungen. Man bestäubte Oberflächen, um Fingerabdrücke zu bekommen. Man saugte Teppiche ab, auf der Suche nach Fasern. Man fotografierte Blut und andere Flüssigkeiten. Man katalogisierte die Indizien. Dann übergab man alles einem anderen Spezialisten. Die Labortechniker waren verantwortlich für die wissenschaftlichen Tests. Die Detectives waren dafür verantwortlich, die Verbrecher dingfest zu machen. Lena würde nichts anderes sein als eine bessere Putzfrau mit einer Marke und staatlichen Sozialleistungen. Sie könnte den Rest ihres Berufslebens mit der Bearbeitung von Tatorten zubringen und dann jung genug in den Ruhestand gehen, um ihre Pension mit privater Ermittlungsarbeit aufzustocken.
So würde sie zu einem dieser verfluchten Privatdetektive werden, die immer ihre Nase in Sachen steckten, die sie nichts angingen.