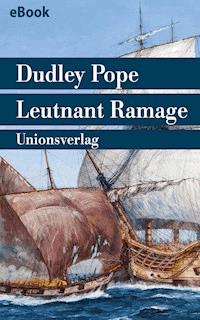
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Man schreibt das Jahr 1796: Auf allen Weltmeeren ist die britische Marine mit Napoleon und seinen Verbündeten in blutige Gefechte verstrickt. Nicholas Ramage ist Leutnant auf der Fregatte Sibella, die vor der italienischen Küste von einem französischen Linienschiff versenkt wird. Ramage übernimmt das Kommando über die Schiffbrüchigen und rettet auch die bezaubernde italienische Adlige Marchesa di Volterra. Fast fällt er einem hinterhältigen Komplott seiner Neider zum Opfer, doch Kommodore Nelson durchkreuzt das heimtückische Spiel und schickt ihn mit neuem Auftrag auf See. Das erste Abenteuer der berühmten Serie um Leutnant Nicholas Ramage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Das erste Abenteuer der berühmten Serie um Leutnant Nicholas Ramage. Man schreibt das Jahr 1796: Auf allen Weltmeeren ist die britische Marine mit Napoleon und seinen Verbündeten in blutige Gefechte verstrickt. Nicholas Ramage verliert sein Schiff und steht plötzlich mitten im Zentrum eines heimtückischen Spiels.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Dudley Pope (1925–1997) ging im Alter von sechzehn Jahren zur Handelsmarine. Nach einer Verletzung wurde er Journalist für maritime Themen. Der Autor C. S. Forester empfahl ihm, Schriftsteller zu werden. Nach durchschlagendem Erfolg lebte er ab 1953 auf seiner Segeljacht.
Zur Webseite von Dudley Pope.
Eugen von Beulwitz (1889–1969) war nicht nur Übersetzer, sondern auch Kapitän. Neben der Serie um Leutnant Nicholas Ramage übersetzte er auch die Abenteuerreihe um Horatio Hornblower von Cecil Scott Forester.
Zur Webseite von Eugen von Beulwitz.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Dudley Pope
Leutnant Ramage
Seefahrer-Roman
Aus dem Englischen von Eugen von Beulwitz
Die Seefahrten des Leutnant Ramage
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1965 unter dem Titel Ramage im Verlag Weidenfeld & Nicolson, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1966 im Amadis Verlag, Karlsruhe.
Originaltitel: Ramage
© 1965 by The Ramage Company Ltd
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Paul Wright
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30845-9
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.05.2024, 00:52h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
LEUTNANT RAMAGE
1 – Ramage war ganz benommen und suchte vergeblich …2 – Ramage erkletterte wieder die Hängemattskästen auf der Verschanzung …3 – Seit mehr als einer halben Stunde erstreckte sich …4 – »Geben Sie mir die Karten, Jackson.« Der Amerikaner …5 – Jackson beobachtete, wie der obere Rand der Sonne …6 – Ramage schlenderte einen silbern schäumenden Pfad entlang …7 – »Commandante! Conmandante!« Irgendwer schüttelte ihn wach. Dank der …8 – Später am Tag lag Ramage im Sand der …9 – Jackson legte ein paar Bodenbretter längsschiffs über die …10 – In der Cala Grande holten die Seeleute die …11 – Ein unrasierter, verschlagen dreinblickender Diener führte Ramage in …12 – Da der strahlende Mond ein scharf gezeichnetes Mosaik …13 – Am nächsten Morgen wurde Ramage in halb wachem …14 – Die Möwen schrien immer lauter und wagten sich …15 – Als Ramage am folgenden Morgen vom Messesteward mit …16 – Der Kommandantensalon der Trumpeter diente heute als Gerichtssaal …17 – Fünfzehn Minuten später erschien ein Posten in der …18 – Ehe die Kapitäne noch ihren Weg um den …19 – Ramage stand auf den schlüpfrigen Stufen des Kais …20 – »Wir weisen Sie hiermit an und geben Ihnen …21 – Ramage erkannte voraus schon den hohen Turm der …Anmerkungen
Mehr über dieses Buch
Über Dudley Pope
Über Eugen von Beulwitz
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Dudley Pope
Zum Thema England
Zum Thema Meer
Zum Thema Schmöker
Zum Thema Abenteuer
1
Ramage war ganz benommen und suchte vergeblich, die Gedanken zu erhaschen, die ihm durch den Kopf schossen. Das Ganze war wohl nur ein böser Traum. Noch ein Weilchen, und er erwachte wie immer in der Sicherheit seiner Kammer. Im Augenblick allerdings umgab ihn ein grässlicher Lärm wie unaufhörlicher Donner. Davon wurde er allmählich wach, aber er öffnete nur zögernd und widerwillig die Augen. Es wollte ihm gar nicht gefallen, aus seinem wunschlos glücklichen Dahindämmern in das harte, grelle Licht der Wirklichkeit zurückzukehren. Seine Unruhe verwandelte sich bald in ernste Besorgnis, als er gewahr wurde, dass der unaufhörliche Donner das Feuer feindlicher Breitseiten war, das nur zuweilen durch das heisere Gebell der eigenen Zwölfpfündergeschütze unterbrochen wurde. Ihm folgte jedes Mal das vertraute Gerumpel der Lafettenräder, das klang, als ob ein Karren über eine Holzbrücke rollte, wenn der Rückstoß so ein Geschütz zurücktrieb, bis es die dicken Haltebrooken knirschend unter der plötzlichen Spannung zum Stehen brachte.
Als er allmählich auch wieder Gerüche zu unterscheiden begann und den scharfen Brodem des Pulverqualms beißend in der Nase spürte, hörte er eine Stimme immer wieder sagen: »Mister Ramage, Mister Ramage – wachen Sie auf, Sir!«
Der da rief, war ein Junge; seine Stimme klang verängstigt, ja fast hysterisch, und hatte einen scharfen Cockney-Akzent.
»Mister Ramage, mein Gott, so wachen Sie doch endlich auf!«
Das war eine Männerstimme. Und dann begannen sie, ihn mit vereinten Kräften zu schütteln. Sein armer Kopf schmerzte, als hätte ihn ein Keulenhieb getroffen. Das gewaltige Bumsen und Rumpeln, das seine Quälgeister unterbrach, musste wieder von einem Zwölfpfünder stammen, der in nächster Nähe gefeuert hatte und vom Rückstoß binnenbords gejagt wurde.
Ramage öffnete die Augen. Seine Glieder wollten ihm noch nicht gehorchen, und er merkte jetzt erst zu seiner Bestürzung, dass er mit dem Gesicht auf den Planken an Deck lag. Diese Planken boten, so gesehen, ein ungewöhnliches Bild. Er bemerkte, als fiele es ihm zum ersten Mal auf, dass das ständige Scheuern mit Sand und Steinen im Laufe der Zeit zwischen den härteren Rippen des Holzes kleine Täler oder Senken herausgefressen hatte. Vor allem aber musste gleich jemand das Blut aufwischen.
Das Deck ist ja voller Blut! Als er in Gedanken diesen Satz formte, stellte er erschrocken fest, dass er bei Bewusstsein war. Und doch fühlte er sich immer noch so unbeteiligt, als blickte er aus dem Masttopp auf seinen Körper herab, der zwischen zwei Geschützen hingestreckt an Deck lag. Mit seinen abgespreizten Armen und Beinen wirkte er wie eine zerfetzte Stoffpuppe, die auf dem Kehrichthaufen gelandet ist.
Wieder wurde er heftig geschüttelt und dann auf den Rücken gerollt. »Los, Mister Ramage, kommen Sie zu sich, Sir, wachen Sie auf!«
Zögernd öffnete er die Augen. Minutenlang schien sich alles um ihn zu drehen, dann erst erkannte er ihre Gesichter, aber sie wirkten immer noch unendlich fern, als ob er sie durch ein umgedrehtes Fernrohr betrachtete. Erst als er sich mit aller Kraft konzentrierte, gelang es ihm, das Gesicht des Jungen schärfer ins Auge zu fassen.
»Was ist?« O Gott, war das seine Stimme? Dieses heisere Krächzen wirkte ja wie ein Scheuerstein, den man über ein trockenes Deck zieht. »Was ist denn los?« Die Anstrengung des Sprechens belebte mit einem Schlag die Erinnerung an das, was geschehen war. Seine Frage war sehr töricht gewesen; denn als an jenem sonnigen Septembernachmittag im Jahre 1796 die Barras, ein französisches Linienschiff mit 74 Geschützen, Seiner Majestät Fregatte Sibella, die mit nur 28 Geschützen bestückt war, unter Land in die Enge getrieben hatte, da war in der Tat alles los …
»O Gott, o Gott, Sir, es ist schrecklich«, stammelte der Junge. »Alle sind tot, Sir, ein Schuss hat den Kommandanten getroffen – er ist …«
»Eins nach dem anderen, mein Junge. Wer hat dich geschickt?«
»Der Bootsmann, Sir. Ich soll Ihnen sagen, dass Sie jetzt das Kommando haben, Sir. Die anderen sind alle tot. Der Meistersmaat sagt, es seien vier Fuß Wasser im Raum, und die Pumpen seien alle kaputt. Sir – können Sie denn nicht auf das Achterdeck kommen, Sir? Ich will Ihnen ja auch helfen.«
Die drängende, verängstigte Stimme des Jungen, vor allem aber seine Worte, »dass Sie jetzt das Kommando haben, Sir«, verhalfen Ramage rasch zu einem klaren Kopf. Aber was er da hören musste, machte ihn schaudern. Jeder junge Leutnant träumte davon, eines Tages eine Fregatte im Gefecht führen zu dürfen – aber so hatte er sich das gewiss nicht vorgestellt. Schrecklich, wie es nur ein paar Hundert Meter entfernt immer wieder losdonnerte – als ob ein mythischer Gott diese Blitze durch den armen Rumpf der Fregatte jagte, um das Schiff und die Menschen darauf zu zerschmettern. Dieser Albtraum war das französische Linienschiff Barras mit ihrer Breitseite von 35 schweren Geschützen. Und die krampfhaften Hustentöne dicht in der Nähe rührten offenbar von den paar Kanönchen her, die von der aus ganzen 14 solcher leichten Rohre bestehenden Breitseite der Fregatte noch übrig waren.
Nein, so sah der Traum eines Leutnants von Schlachtenruhm und Ehre bei Gott nicht aus. Auch, dass man ihm das Kommando aufdrängte, obwohl er durch einen Schlag auf den Kopf halb bewusstlos war und noch längst nicht zu sich kommen wollte, hatte in seinen Vorstellungen keinen Platz. Wie schöner war es doch, an Deck zu liegen …
»Los, Sir, ich helfe Ihnen auf.«
Ramage schlug abermals die Augen auf. Jetzt stand ein Matrose neben ihm – ein Landsmann aus Cornwall, Higgins, Briggins oder so ähnlich hieß er.
Higgins – oder hieß er Briggins? – stank nach Schweiß, aber was machte das schon. Der Geruch war widerwärtig und scharf, aber er brannte wenigstens nicht in der Nase wie der Pulverqualm. Als sie ihn auf die Füße stellten, schloss er rasch die Augen, dass sich nicht wieder alles um ihn drehte. Higgins oder Briggins machte gerade einem anderen Matrosen die Hölle heiß: »Los, nimm seinen Arm um deinen verdammten Hals, sonst fällt er wieder zusammen. So, jetzt marschier mit ihm los, du irischer Trottel!«
Ramage schlenkerte abwechselnd kraftlos die Beine nach vorn, während sie ihn, auf der einen Seite der Mann aus Cornwall und auf der anderen der Ire, über Deck schleppten. Offenbar hatten die beiden große Erfahrung darin, einen betrunkenen Bordkameraden aus dem Wirtshaus zu schaffen. Vor ihnen her tanzte der Junge durch den Qualm, der die Decks durchzog und sich zu seltsamen Gebilden formte, wenn durch die Geschützpforten ein Lüftchen hereindrang. Jetzt erkannte er ihn; es war der Bursche des Ersten Offiziers – des gefallenen Ersten Offiziers, verbesserte er sich.
»Verdammt! Was nun? Wie kriegen wir ihn den Niedergang hinauf?«
Die Treppe vom Großdeck hinauf zur Laufbrücke und zum Achterdeck hatte acht Stufen – Ramage bildete sich etwas darauf ein, dass er das noch wusste –, sie war für einen Mann gerade breit genug. Acht Stufen, das hieß, dass man neun Schritte machen musste, bis man oben war – jede dieser Stufen unterstand jetzt ihm.
Ramage erschrak über die Torheit dieses Einfalls und gab sich darüber Rechenschaft, dass er bis jetzt nicht ernstlich versucht hatte, sich zusammenzureißen: Die beiden Matrosen konnten ihn nicht mehr weiterschleppen, er war fortan allein auf sich gestellt. Wenn er die acht Stufen erstiegen hatte, war er auf dem Achterdeck, und dort gehörte er hin, weil er jetzt Kommandant war. Dutzende von Männern blickten zu ihm auf, weil sie seine Befehle erwarteten.
»Eine Balje her«, sagte er und befreite sich aus dem Griff der beiden Männer.
»Hier, Sir.«
Er wankte ein paar Schritte weiter und kniete neben der Balje nieder. Wenn vor einem Gefecht Klarschiff angeschlagen wird, stellt man kleine Wasserbütten neben die Geschütze, damit die Männer die Schwämme zum Auswischen der Läufe nass machen können. Als Ramage jetzt den Kopf ins Wasser tauchte, ächzte er vor Schmerz und ertastete mit den Fingern am Hinterkopf eine starke Schwellung und einen langen Hautriss. Die Wunde war nicht tief, aber sie ließ keinen Zweifel, warum er bewusstlos geworden war. Wahrscheinlich rührte sie von einem umherfliegenden Holzsplitter her. Wieder tauchte er den Kopf in die Balje, spülte den Mund mit Wasser und spuckte es aus. Dann strich er sich die nassen Haare aus der Stirn, holte ein paar Mal tief Atem und stand auf. Die rasche Bewegung machte ihn wieder schwindlig, aber er fühlte sich jetzt doch schon kräftiger, seine Beinmuskeln versagten ihm jedenfalls nicht mehr den Dienst.
Am Fuß des Niederganges machte er halt. Plötzliches Grauen krampfte ihm förmlich den Magen zusammen, denn oben erwartete ihn ein blutiges Chaos. Dennoch galt es jetzt, Entscheidungen zu treffen, bei denen es um Tod oder Leben ging, und dann die entsprechenden Befehle zu geben. Und das traf nun ausgerechnet ihn, der unter Deck gewesen war und fast das ganze Gefecht hindurch nur einen Teil der Geschütze befehligt hatte. Dabei hatte sich sein Eindruck von der Lage auf das wenige beschränkt, das durch die Geschützpforten zu erkennen war, und gegen Ende zu war er ja bewusstlos gewesen.
Während er mühsam die Stufen nahm, entdeckte er überrascht, dass er mit sich selbst sprach wie ein Kind, das etwas auswendig lernt: »Der Kommandant, der Erste und der Zweite Offizier müssen gefallen sein, jetzt bin also ich an der Reihe. Es war der Bootsmann, der mir durch den Jungen melden ließ, ich hätte jetzt das Kommando, also muss der Steuermann ebenfalls tot sein. Gott sei Dank lebt wenigstens der Bootsmann noch. Hoffentlich ist auch der Arzt noch am Leben und nüchtern geblieben.«
Wie viele Geschütze der Sibella haben eigentlich während der letzten paar Minuten gefeuert? Höchstens vier oder fünf, und alle vom Großdeck aus. Das heißt, dass an Oberdeck alle Geschütze und Karronaden ausgefallen sind. Wenn in Feuerluv nur vier oder fünf Geschütze feuern können, wie viele Männer der Besatzung sind dann noch übrig? Bei der letzten Sonntagsmusterung waren es 164, die »hier« riefen.
Noch zwei Stufen, und ich habe es geschafft. Wieder hat die Barras eine Breitseite gelöst. Seltsam, dieses Geschützfeuer klingt über dem Wasser genau wie Donner. Ratsch – das gab ein Loch im Segel, und mit entsetzlichem Krachen schlugen andere Kugeln in die Bordwand, dass das arme Schiff bis zum Kiel erzitterte.
Wieder Schreie, wieder neue Tote.
Sein Kopf tauchte über der Laufbrücke auf, die über das ganze Schiff reichte und die Back mit dem Achterdeck verband. Da sah er, dass es bald dämmern musste. Gleich darauf war er oben und taumelte unsicher an die Reling. Das Schiff war kaum wiederzuerkennen. Die Karronaden auf beiden Seiten der Back waren aus ihren Gleitlafetten gerissen, und die Leichen daneben verrieten, dass die Bedienungen gefallen waren, als das geschah. Schiffsglocke und Kombüsenschornstein waren verschwunden. Von der Steuerbordverschanzung waren große Stücke zerstört; Dutzende gezurrter Hängematten lagen an Deck verstreut. Sie waren aus den Finknetzen oben auf der Reling geflogen, wo sie für gewöhnlich verstaut waren.
Als er sich umwandte und einen Blick achteraus warf, musste er sehen, dass auch hier die Karronaden aus den Lafetten geflogen waren und dass an der Steuerbordseite wiederum Tote lagen. Das achtere Gangspill war halb weggeschossen, sodass die vergoldete Krone, die es schmückte, schräg hinunterhing. Vor dem Kreuzmast, dort wo sich das doppelte Ruderrad befunden hatte, an dem immer zwei Rudergänger standen, gähnte ein Loch im Deck. Die Kugeln hatten Stücke aus dem Kreuzmast und dem Großmast gerissen. Der Fockmast sah auch nicht viel anders aus. Wo man hinsah, lagen Tote. Ramage hatte den Eindruck, dass ihrer mehr waren, als die ganze Besatzung Leute zählte. Und doch rannten noch Männer da und dort herum – andere wieder bedienten unten die paar Geschütze, die noch feuern konnten. Vier oder fünf Seesoldaten hockten in der Höhe des Kreuzmastes hinter der Verschanzung und luden gerade ihre Musketen.
Und die Barras? Ramage hielt durch eine Geschützpforte nach ihr Ausschau und bat den Bootsmann, der eben herbeigeeilt war, einen Augenblick zu warten. Mein Gott, wie schrecklich war der Anblick, den dieses Schiff bot! Wie eine Silhouette hob es sich gegen den Westhorizont ab, hinter dem die Sonne zehn Minuten zuvor verschwunden war. Das gewaltige Linienschiff wirkte wie eine riesige Inselfestung mitten im Meer, schwarz, drohend und allem Anschein nach unverwundbar. Von der Sibella hatte sie jedenfalls nichts zu fürchten, sagte sich Ramage mit bitterem Gefühl. Im Augenblick hatte sie nur das Großmarssegel stehen und lief in etwa fünfhundert Metern Abstand auf Parallelkurs mit der Sibella.
Ramage warf einen Blick nach Backbord. Fast querab und nur ein paar Meilen entfernt erhob sich dort die massige Halbinsel Argentario aus der See, ein wuchtiger Felsen, der mit dem italienischen Festland nur durch zwei schmale Dämme verbunden war. Der Monte Argentario selbst, der höchste der Berggipfel, peilte im Augenblick nur wenig achterlicher als querab. Die Barras war von See her aufgelaufen und hatte die Sibella hier unter Land gestellt wie ein Räuber, dem sein Opfer nicht entgehen kann, weil es eine Wand im Rücken hat.
»Ja, Bootsmann, was ist?«
»Gott sei Dank, dass Sie am Leben sind, Sir. Ich dachte schon, Sie seien auch tot. Sind Sie wohlauf, Sir? Sie sind ja über und über voll Blut.«
»Das war nur ein Schlag gegen den Kopf … Wie ist denn die Lage?« Das Gesicht des Bootsmanns war vom Pulverqualm geschwärzt, der rinnende Schweiß hatte längs der Hautfalten Streifen gezogen, sodass dort die gebräunte Haut zum Vorschein kam. Der Mann bot so fast einen komischen Anblick, weil man unwillkürlich an den bekümmerten Ausdruck eines Bullenbeißers dachte.
Er gab sich augenscheinlich alle Mühe, in ruhigem Ton zu sprechen und nichts von dem zu vergessen, was dem neuen Kommandanten gemeldet werden musste. Zunächst wies er mit der Hand nach achtern. »Sie können die Bescherung dort selbst sehen, Sir. Das Ruderrad ist zerschossen, Pinne und Kopf des Ruderschaftes desgleichen. Steuertakel lassen sich nicht scheren, weil man sie nirgends mehr anschlagen kann. Jetzt steuert sich das Schiff einigermaßen selbst, wir helfen natürlich mit Schoten und Brassen, dass es auf Kurs bleibt. Die Paternosterpumpe ist zerschossen, bleibt also nur noch die Pumpe vorn unter der Back. Der Meistersmaat sagt, wir hätten vier Fuß Wasser im Raum, und es stiege schnell. Der Fockmast kann jeden Augenblick über Bord gehen, das sehen Sie ja selbst. Ich könnte nicht sagen, was ihn noch hält. Der Großmast ist an zwei Stellen gesplittert – die Kugeln stecken noch drin – und der Kreuzmast an drei.«
»Wie hoch sind die Mannschaftsverluste?«
»Wir haben fünfzig Tote und an die sechzig Verwundete. Eine Salve kostete den Kommandanten und den Ersten Offizier das Leben. Der Arzt und der Zahlmeister …«
»Genug davon! Wo ist der Meistersmaat? Lassen Sie ihn gleich holen.«
Als sich der Bootsmann abgewandt hatte, warf Ramage wieder einen Blick nach der Barras. Hatte sie nicht ein wenig nach Backbord gedreht, nur ein paar Grad, sodass ihr Kurs jetzt um eine Kleinigkeit mit dem der Sibella konvergierte? Er glaubte sogar, unterscheiden zu können, wie die Männer drüben etwas an den Großmarsbrassen holten. Wollten sie etwa noch näher heran?
Die Sibella lief etwa vier Knoten und gierte bis zu vier Strich. Wenn man achtern Segel kürzte, steuerte sie ganz bestimmt besser, weil sie dann vom Vormarssegel gezogen wurde.
»Bootsmann, lassen Sie das Groß- und das Kreuzmarssegel aufgeien, und setzen Sie dafür das Sprietsegel.«
Wenn am Groß- und Kreuzmast keine Segel mehr zogen, konnte der Wind das Heck des Schiffs nicht mehr herumdrücken. Das Sprietsegel, das vorn unter dem Bugspriet gesetzt wurde, half dafür dem Vormarssegel, wenn es bei dem leichten Wind auch fast zu klein war, um die Fahrt fühlbar zu beschleunigen.
Während der Bootsmann seine Leute mit lauten Kommandos ans Werk schickte, kam schon der Meistersmaat herbei. Der Mann hatte anscheinend sich selbst mit noch mehr Talg beschmiert als die konischen Holzpfropfen, die er in die Bordwand hämmerte, um die Schusslöcher einigermaßen zu stopfen.
»Machen Sie Ihre Meldung.«
»Über vier Fuß Wasser im Raum – Pumpen unbrauchbar, sechs oder mehr Treffer zwischen Wind und Wasser, mindestens drei Treffer unter der Wasserlinie – müssen beim Überholen eingeschlagen haben, Sir.«
»Gut, peilen Sie noch einmal die Bilge, und machen Sie mir sofort darüber Meldung.«
Vier Fuß Wasser … Mathematik war Ramages schwache Seite, er versuchte krampfhaft zu rechnen, dabei war die nächste Breitseite der Barras jeden Augenblick zu erwarten. Vier Fuß Wasser – der Tiefgang der Sibella war etwas über fünfzehn Fuß, und jede sieben Tonnen Ladung, die sie an Bord nahm, drückten sie einen Zoll tiefer ins Wasser. Wie viele Tonnen machten also diese vier Fuß Wasser aus, die jetzt dort unten die Bilge durchspülten? Ach, was tut es schon, dachte er ungeduldig, wichtig ist nur, was der Meistersmaat zu melden hat.
»Bootsmann, nehmen Sie ein paar Mann, und kappen Sie die Anker. Aber die Männer sollen sich dabei in Acht nehmen. Wir können keine Ausfälle mehr brauchen.«
Es konnte nicht schaden, wenn man einiges Gewicht über Bord gab, um das einströmende Wasser auszugleichen. Die Anker wogen etwa fünf Tonnen; wenn er sie opferte, hob sich die Sibella etwas über einen halben Zoll aus dem Wasser. Das war fast lächerlich zu nennen, aber man gab den Leuten damit wenigstens etwas zu tun. Jetzt, da so viele Geschütze außer Gefecht waren, lief ja ein großer Teil der Mannschaften untätig an Deck herum und wartete auf Befehle. Wenn er beschädigte Geschütze über Bord werfen ließ, konnte er das Schiff natürlich noch um vieles leichter machen, aber mit der beschränkten Zahl von Leuten, die er zur Verfügung hatte, hätte das zu lange gedauert.
Der Meistersmaat trat wieder vor ihn hin. »Fünf Fuß im Raum, Sir. Je tiefer das Schiff sinkt, desto mehr Schusslöcher kommen unter Wasser.«
Und, dachte Ramage, desto größer wird auch der Druck des einströmenden Wassers. »Können Sie die Schusslöcher nicht dichten?«
»Die meisten sind zu groß, Sir – vor allem aber sind sie so aufgesplittert. Wenn wir die Fahrt stoppen könnten, dann wäre es möglich, ein Lecksegel darüber auszuholen …«
»Wann haben Sie die Bilge vorher zum letzten Mal gepeilt?«
»Vor kaum einer Viertelstunde, Sir …«
Das hieß, dass das Wasser im Raum in fünfzehn Minuten um einen Fuß stieg! Wenn das Schiff durch sieben Tonnen Wasser einen Zoll tiefer gedrückt wurde, wie viele Tonnen mussten dann einströmen, bis es einen Fuß tiefer ging? Zwölf Zoll mal sieben Tonnen – gibt vierundachtzig; das hieß, dass in höchstens fünfzehn Minuten vierundachtzig Tonnen Wasser eingeströmt waren. Wie viel Wasser vertrug das Schiff noch, ehe es unterging oder kenterte? Das wusste Gott allein, davon stand nichts in den Seemannschaftsbüchern. Auch der Meistersmaat wusste es nicht. Auch die Leute, die dieses Schiff geplant hatten, hätten es nicht gewusst, selbst wenn sie in Rufweite gewesen wären. Sie allein sind jetzt an der Reihe, Leutnant Ramage – los, zeigen Sie, was Sie können!
»Meistersmaat – peilen Sie die Bilge alle fünf Minuten, und machen Sie mir jedes Mal Meldung. Holen Sie sich Leute zu Hilfe, um die Schusslöcher zu stopfen, alle, die noch ein paar Fuß über dem Wasserstand im Raum unten liegen. Stopfen Sie Hängematten hinein, tun Sie alles, um das Einströmen von Wasser zu verringern.«
Ramage trat, wie es seine Gewohnheit war, am vorderen Ende des Achterdecks an die Reling, denn dort war während der längsten Zeit seines Seemannslebens sein Platz gewesen, wenn er auf Wache war.
Was wissen wir?, dachte er. Die Barras kann tun, was sie will; sie ist die Katze, wir sind die Maus. Wir können ja nicht manövrieren, sie aber braucht nur um ein weniges heranzuscheren. Wie viele Strich? Höchstens zwei. Wann stoßen wir dann zusammen?
Wieder diese verdammte Rechnerei! Ramage war richtig böse. Achthundert Meter war die Barras noch entfernt, als sie den Kurs änderte. Diese achthundert Meter waren die Basis eines Dreiecks, der Kurs der Barras war die Hypotenuse, der Kurs der Sibella lag ihr als Kathete gegenüber. Frage: Wie lang war diese Kathete? Die Formel fiel ihm nicht ein, er konnte nur schätzen, dass sie am Ende nach etwa einer Meile mit der Sibella zusammenschor und kollidierte – wenn sie nicht vorher ihren Kurs änderte. Die Fregatte machte wenig über drei Meilen Fahrt. Sechzig Minuten durch drei? In zwanzig Minuten also waren sie längsseits; bis dahin war es fast Nacht. Wieder zuckten längs der Bordwand der Barras rote Blitze auf, wieder folgte der Donner. Die Franzosen feuerten nicht geschlossen; wahrscheinlich wurde bei ihnen jedes Geschütz einzeln durch einen Offizier gerichtet, denn sie hatte ja keinen ernsthaften Widerstand zu befürchten. Keiner der französischen Schüsse traf den Rumpf, das Geräusch zerreißender Leinwand verriet, dass es die Franzosen auf die Masten und Spieren der Sibella abgesehen hatten.
Wäre er der Kommandant der Barras, was würde er tun? Die Sibella außer Gefecht setzen, das natürlich war seine erste Pflicht; darum feuerte er jetzt nach ihrer Takelage. In den letzten wenigen Minuten vor Dunkelwerden bot sich dann wohl die Gelegenheit, längsseits zu scheren und die Sibella im Triumph nach Toulon einzubringen. Außerdem weiß er ja genau, dass er uns während der letzten paar Hundert Meter in Rufweite hat. Da wird er uns auffordern, uns zu ergeben. Er weiß genau, dass wir gegen Enterer nichts machen können …
Ramage musste sich eingestehen, dass er sich in einer fast lächerlichen Lage befand: Das Schiff, das er jetzt führte, steuerte sich ohne einen Mann am Ruder ganz allein – aber das machte letzten Endes nichts aus, denn ehe noch eine Stunde um war, musste er sich ohnedies ergeben. Da er nicht kämpfen konnte und da sein Schiff voll Verwundeter war, gab es für ihn keine andere Möglichkeit.
Und du, Nicholas Ramage, sagte er sich verbittert, da du ja der Sohn des in Unehre gefallenen Zehnten Earls of Blazey, Admiral der Weißen Flagge, bist, du darfst wenig Gnade von der Admiralität erwarten, wenn du dich einem französischen Schiff ergibst, ganz gleich, warum das geschehen mag. Von den Sünden der Väter werden ja nach den Worten der Bibel noch die Kinder und Kindeskinder heimgesucht.
Wenn man sich an Deck der Sibella umsah, fiel es einem wirklich schwer, an Gott zu glauben: Da, dieser zerrissene Leichnam, dessen Beine noch in blutigen Seidenstrümpfen steckten und dessen Füße mit eleganten silberblitzenden Schnallenschuhen bekleidet waren, das war der tote Kommandant dieser Fregatte. Und neben ihm lag wahrscheinlich sein Erster Offizier, der jetzt endlich nicht mehr zu katzbuckeln brauchte. War es nicht eine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet diesem Mann der Kopf abgerissen wurde, dass jenes ewig lächelnde Gesicht zerfetzt war, mit dem er sich bei seinen Oberen einzuschmeicheln pflegte? Das Deck glich in der Tat einem Schlachthaus. Ein Matrose, nackt bis auf seine Hose, lag hingestreckt über der zerschossenen Lafette einer Karronade, als wollte er sie liebend in seine Arme schließen. Sein Haar war noch in einen langen Zopf aufgebunden, und um die Stirn trug er einen Streifen Stoff, damit ihm der Schweiß nicht in die Augen rann – ihm war der Leib von oben bis unten aufgerissen. Neben ihm lag ein anderer, anscheinend unverletzt, bis man entdeckte, dass ihm ein Arm aus dem Schultergelenk gerissen war.
»Bitte um Befehle, Sir.«
Das war der Bootsmann. Befehle – weiß Gott, er hatte wieder geträumt, während die Männer, die noch am Leben waren, vertrauensvoll ein Wunder von ihm erwarteten, das ihnen das Leben retten sollte und das sie davor bewahrte, bis an ihr Ende in französischer Gefangenschaft zu schmachten. Dabei war ihm so hundeelend zumute. Er riss sich zusammen, so gut es ging, um zu überlegen, und bemerkte gerade in diesem Augenblick, dass der Fockmast schwankte. Wahrscheinlich hatte er schon eine ganze Weile geschwankt, denn der Bootsmann hatte sich ja schon gewundert, dass er nicht längst über Bord gegangen war. Über Bord gegangen …
Richtig! Warum war ihm das nicht längst eingefallen? Er hätte am liebsten Hurra gerufen. Hurra, Leutnant Ramage ist aufgewacht, jetzt haltet euch klar, ihr Männer, und pass auch du auf, Barras, was nun geschieht … Ganz plötzlich fühlte er sich so beschwingt, als hätte er reichlich getrunken. Unbewusst rieb er mit der Rechten die Narbe, die er an der Stirn trug.
Der Bootsmann blickte ihn bestürzt an und brachte Ramage dadurch zu Bewusstsein, dass er fröhlich grinste.
»Gut, Bootsmann«, sagte er lebhaft, »machen wir uns ans Werk. Ich möchte zunächst, dass alle Verwundeten an Deck gebracht werden, ganz gleich, wie es ihnen geht. Lassen Sie sie alle auf das Achterdeck holen.«
»Aber, Sir …«
»Sie haben fünf Minuten Zeit.«
Der Bootsmann zählte schon volle sechzig Jahre, sein Haar, soweit noch vorhanden, war weiß. Er war sich darüber klar, dass die Verwundeten hier an Oberdeck jeden Augenblick durch eine Breitseite der Barras hingeschlachtet werden konnten. Offenbar, dachte Ramage, war ihm entgangen, dass die Barras jetzt nur noch in die Takelage der Sibella feuerte. Seit einer Weile bestrich der Franzose ihre Decks nicht mehr mit Kartätschen. Anscheinend glaubte man drüben, dass genügend Männer gefallen seien. Wenn es ihm einfiel, seine Breitseiten wieder in ihren Rumpf zu jagen, dann hatten die Verwundeten unter Deck genauso zu gewärtigen, dass sie von den schrecklichen Holzsplittern getroffen wurden, die die Kugeln aus der Bordwand rissen – er hatte Stücke gesehen, die über fünf Fuß lang waren.
Verwundete an Deck. Jetzt etwas anderes: die Boote. Ramage lief an die Heckreling und blickte über Bord. Die Sibella hatte noch immer einige ihrer Boote im Schlepp. Man hatte sie bei Klarschiff zu Wasser gebracht, damit sie im Gefecht keinen Schaden nahmen. Zwei Boote fehlten, aber die übrigen vier reichten für sein Vorhaben aus. Die Verwundeten, dann die Boote – jetzt waren Proviant und Wasser an der Reihe.
Der Bootsmann war wieder zur Stelle.
»Wir werden das Schiff bald aufgeben«, sagte ihm Ramage. »Leider müssen wir die Verwundeten an Bord lassen. Es stehen uns vier Boote zur Verfügung. Bitte suchen Sie vier zuverlässige Männer aus. Jeder von ihnen soll die Verantwortung für eines der Boote übernehmen. Sagen Sie ihnen, sie sollen sich je zwei oder, wenn sie wollen, auch mehr Leute aussuchen. Sie selbst sorgen dafür, dass Säcke mit Hartbrot und Wasserfässer an den achtersten Geschützpforten an Steuerbord für sie bereitgestellt werden. Einen Kompass und eine Laterne brauchen wir auch für jedes Boot. Stellen Sie sicher, dass jede Laterne brennt und dass genügend Riemen in den Booten sind. In drei Minuten treffen wir uns wieder hier an dieser Stelle – ich gehe unter Deck in die Kajüte.«
In der Kajüte war es dunkel, Ramage musste sich bücken, um nicht an die Decksbalken zu stoßen. Der Schreibtisch des Kommandanten war gleich gefunden. Ein Glück, dass keine Zeit mehr gewesen war, die Einrichtung in der Last zu verstauen, als Klarschiff angeschlagen wurde. Jetzt sprach er mit lauter Stimme vor sich hin, um sicher zu sein, dass er ja nichts vergaß. Erstens, sagte er, brauche ich den Operationsbefehl des Admirals, zweitens das Briefbuch und das Befehlsbuch des Kommandanten, drittens die Gefechtsanweisungen und schließlich noch – verflucht, ja, das Signalbuch war natürlich nicht da, das hatte wohl einer von den Fähnrichen, und die waren alle tot. Aber gerade das Signalbuch mit seinem Geheimcode durfte den Franzosen unter keinen Umständen in die Hände fallen.
Tastend suchte er nach der rechten oberen Schublade, hatte er doch oft gesehen, dass der Kommandant dort seine geheimen Dokumente unterbrachte. Sie war verschlossen, verdammt – und doch wohl selbstverständlich. Er aber hatte weder seinen Säbel noch eine Pistole zur Hand, um sie mit Gewalt aufzubrechen. In diesem Augenblick tauchte hinter ihm ein Licht auf und zauberte huschende Schatten auf die Wände der Kajüte. Hastig wandte er sich um, da hörte er eine näselnde Stimme sagen: »Kann ich Ihnen behilflich sein, Sir?«
Das war der Bootssteuerer des toten Kommandanten, ein hohlwangiger bleicher Amerikaner namens Thomas Jackson. Er hielt in der einen Hand eine Gefechtslaterne, in der anderen eine Pistole.
»Ja, öffnen Sie dieses Schubfach.«
Jackson steckte die Pistole in seinen Leibriemen und trat zu einem der Geschütze an der Backbordseite der Kajüte. Seine Lafette war durch einen Schuss zerschmettert worden, und das Rohr lag quer über ihren Trümmern. Im Licht der Laterne sah Ramage bestürzt, dass da drei Tote lagen – offenbar hatte sie der Schuss getötet, der die Kanone zerstörte.
Der Amerikaner kam mit einer blutigen Handspake wieder. Der lange Stiel aus Eschenholz mit dem eisernen Schuh diente sonst dazu, die Lafetten der Geschütze herumzuwuchten, wenn man sie richten wollte.
»Wollen Sie bitte die Lampe halten und etwas zurücktreten, Sir«, sagte er höflich. Er schwang die Handspake, dass ihr beschlagenes Ende die Ecke des Schreibtischs zerschmetterte. Ramage konnte nun das Schubfach mit einer Hand aufziehen und gab Jackson die Lampe mit der anderen zurück.
Er zog die Schublade ganz heraus. Auf einem Stapel von Büchern und Papieren lag ein leinener Umschlag mit einem erbrochenen Siegel. Ramage öffnete ihn und nahm ein zwei Seiten langes Schreiben heraus, das als »geheim« bezeichnet war und die Unterschrift »J. Jervis« trug. Das war offenbar der geheime Operationsbefehl. Er schob das Papier wieder in den Umschlag und steckte diesen in seine Tasche. Dann warf er einen Blick auf die verschiedenen Bücher. Das erste trug die Bezeichnung Briefbuch und enthielt Kopien aller dienstlichen Schreiben, die an Bord der Sibella empfangen und geschrieben worden waren. Das zweite, »Befehlsbuch« genannt, gab in Abschrift alle Befehle wieder, die der Kommandant erhielt oder empfangen hatte. Der letzte Befehl Admiral Jervis’ war allem Anschein nach noch nicht in die Sammlung aufgenommen worden. Ferner fand sich hier das Logbuch des Kommandanten – es pflegte in der Regel kaum mehr zu sein als eine Abschrift der Aufzeichnungen des Steuermanns.
Darunter lag ein ganzes Bündel von Formularen und unterschriebenen Dokumenten. Die Admiralität war offenbar des Glaubens, dass die Schiffe des Königs ohne diese Flut von Papier nicht schwimmen konnten und durch sie erst den nötigen Auftrieb erhielten. »Coopers Aussage über den Verlust von Bier durch Auslaufen« – ach ja, das betraf die fünf Fässer, die man in Gibraltar als schadhaft bezeichnet hatte. Es folgten die »Liste der Belohnungen«, die Führungsliste, die Liste über verbrauchtes Papier und so weiter. Ramage riss diesen ganzen Wust in Stücke. Auch die Gefechtsanweisungen fanden keine Gnade, sie fielen ebenfalls der Vernichtung anheim. Jetzt war der dünne Band mit den Kriegsartikeln an der Reihe, jenen Gesetzen, denen die Navy unterstand. Sie waren alles andere als geheim, sie mussten ganz im Gegenteil allmonatlich jeder Besatzung laut vorgelesen werden. Mochten die Franzosen damit glücklich werden.
Abgesehen vom Signalbuch und einigen Seekarten, war das alles, was er brauchte.
Nun wandte sich Ramage an Jackson. »Gehen Sie in die Kammer des Steuermanns, und holen Sie alle Karten und Segelanweisungen für das westliche Mittelmeer, die Sie dort finden. Stopfen Sie dieses ganze Zeug in einen mit Schrot beschwerten Segeltuchsack, für den Fall, dass wir uns überraschend davon befreien müssten.«
Im Schiff war es jetzt seltsam ruhig geworden. Als er sich aus der dunklen Kajüte tastete und nach dem Niedergang suchte, der auf das Achterdeck führte, fiel ihm auf, dass die Verwundeten aufgehört hatten zu stöhnen – vielleicht aber waren sie inzwischen alle an Oberdeck und außer Hörweite. Dafür hörte er nun wieder das vertraute Knarren der Masten und Rahen und das Quietschen der Enden, die durch die Blöcke liefen. Dann war da noch ein weniger vertrautes Geräusch: das Schwappen des Wassers unten im Raum, das von einem seltsamen Rumpeln begleitet war. Wahrscheinlich rührte dies von Fässern mit Salzfleisch, Pulver und anderen Vorräten her, die dort unten frei im Wasser herumtrieben.
Das Schiff selbst wälzte sich träge unter seinen Füßen. Alles Leben, die blitzschnelle Reaktion auf die leiseste Bewegung des Ruders, das begeisternde Vorwärtsstürmen, wenn ein stärkerer Windstoß die Segel füllte, das lebhafte Stampfen und Rollen über die Berge und Täler der See – sollte das alles jetzt zu Ende sein?
Als ob die Sibella an einer unheimlichen inneren Blutung litte, rauschten die eingedrungenen Wassermassen unten im Raum von einer Seite zur anderen. Tonne um Tonne warfen sie ihr Gewicht bald nach Steuerbord, bald nach Backbord und verschoben dadurch ständig den Schwerpunkt des Schiffsgewichts und des Auftriebs. Im Endeffekt kam dabei ein fantastisches Gaukelspiel mit der Stabilität des Schiffs heraus.
Mit der Sibella, dachte er unwillkürlich schaudernd, geht es nun zu Ende. Sie gleicht einem großen wilden Tier, das sich tödlich getroffen durch den Dschungel schleppt und nur noch wenige Schritte tun kann. Wenn sie nicht eine plötzliche See nach Steuerbord oder Backbord zum Kentern bringt, dann führt das Gewicht des Wassers, das durch die zerfetzten Schusslöcher hereindringt, das Ende herbei. Sobald nämlich das Gewicht des eingedrungenen Wassers dem Schiffsgewicht entspricht, hat die letzte Stunde der Sibella geschlagen. Das ist ein Naturgesetz, und nur Pumpen, keine Gebete können verhindern, dass es wirksam wird.
Als Ramage auf das Achterdeck kletterte, war ihm einen Augenblick zumute, als betrete er einen Kuhstall. Das halb erstickte Stöhnen und Seufzen der Verwundeten klang in der Tat wie das Muhen und Schnauben von Rindern. Der Bootsmann hatte rasche Arbeit geleistet, denn eben wurden die letzten Verwundeten an Deck gebracht. Ramage trat einen Augenblick beiseite, um zwei hinkenden Männern Platz zu machen, die einen dritten mit sich zerrten. Dieser hatte allem Anschein nach ein Bein gebrochen und sollte sich jetzt zu den anderen gesellen, die in unordentlichen Reihen den vorderen Teil des Achterdecks einnahmen.
Seit Minuten hatte keines der Geschütze der Sibella mehr gefeuert, und der Wind, der durch die Geschützpforten hereinstrich, hatte den Qualm vertrieben, aber der Geruch verbrannten Schießpulvers haftete noch an Ramages Zeug.
Ja, die Barras war genau dort, wo er sie vermutet hatte, etwas vorlicher als querab und etwa fünfhundert Meter entfernt. Er wurde sich plötzlich bewusst, dass sie seit drei oder vier Minuten nicht mehr gefeuert hatte. Das war auch nicht nötig, denn was sie wollte, war erreicht. Man konnte kaum glauben, dass noch keine zehn Minuten verstrichen waren, seit das Linienschiff jene kleine Kursänderung vorgenommen hatte, noch schwerer fiel es zu begreifen, dass es erst vor einer Stunde an der Kimm in Sicht gekommen war.
Ramage hörte das Geschrei der Möwen, die zurückgekehrt waren, als das Feuer schwieg, und nun im Kielwasser der Sibella ihre Kreise zogen. Offenbar hofften sie, dass ihnen der Kochsmaat eine üppige Mahlzeit von Abfällen spendieren würde.
An Backbord querab verschwand die Nordwestspitze der Halbinsel Argentario allmählich in der Nacht, die jetzt den Himmelsdom von Osten her rasch zu verdunkeln begann. Voraus wich das Land im Bogen zurück und verflachte sich zu den Marschen und Sümpfen der Maremmen, die sich fast hundert Meilen südwärts bis vor die Tore Roms erstreckten. Der nächste größere Hafen war Civita Vecchia, fünfunddreißig Meilen weiter südlich; aber den durften auf Anordnung des Papstes weder französische noch britische Schiffe anlaufen.
Seewärts, jenseits und hoch über der Barras, die in der sinkenden Nacht nur noch als Silhouette zu erkennen war, funkelte am Himmel der blassblau leuchtende Hundsstern gleich einem Diamanten auf samtenem Dunkel. Wie viele Monate hatte ihn dieser Stern auf allen Fahrten begleitet und war ihm ebenso vertraut geworden wie der kalte Abwind aus dem Großmarssegel, die Rufe der Ausguckposten und das Knarren der Masten und der Verbände des Rumpfes. Das alles hatte sozusagen zu seinem Leben gehört, aber auch Hunger und Kälte, Hitze und Müdigkeit. Und jetzt? Was war von alldem übrig? Ein zum Wrack geschossenes Schiff, dessen Decks von Leichen übersät waren. Ein paar Minuten hatten dazu genügt, nachdem sich herausgestellt hatte, dass das Segel an der Kimm einem französischen Linienschiff gehörte. Zur Flucht war keine Zeit geblieben. Als die Barras auf sie zuhielt und in der Dünung leise auf und nieder stampfte, als verneigte sie sich in vollendeter Eleganz vor ihrem Gegenüber, da bot sie unter ihren vollen Segeln einschließlich der Leesegel wahrlich einen prachtvollen Anblick. Selbst als sie dann später nach Luv ausgeschert war und die Pforten geöffnet hatte, aus denen die dicken schwarzen Rohre der Geschütze wie drohende Finger herüberwiesen, war sie noch immer vollendet schön gewesen.
Dann aber hatte sie plötzlich graugelbe Qualmwolken ausgespuckt, die rasch zu einer geschlossenen Wand verschmolzen und ihren Rumpf den Blicken verbargen. Als sie bald darauf wieder zum Vorschein kam, wehte nur noch dünner Rauch aus ihren Geschützpforten, die Sibella aber holte weit über, da sie von einem Hagel von Geschossen getroffen worden war, deren Größe zwischen der einer Melone und der einer Orange schwankte. Auf die kurze Entfernung durchschlugen sie glatt drei Fuß dickes massives Holz. Dabei gab es gefährliche Splitter, die dick wie ein Männerschenkel und scharf wie eine Säbelklinge waren.
Gleich die erste Breitseite hatte der Sibella so zugesetzt, dass es schien, als sei sie bereits am Ende. Sie war jedoch unentwegt weitergesegelt. Die Franzosen luden für die nächste Breitseite eine Anzahl Geschütze mit Kartätschen. Ramage musste mit ansehen, wie eines der eigroßen Geschosse einen Mann quer über Deck von einer Bordwand zur anderen schleuderte, als hätte ihn eine unsichtbare Riesenfaust getroffen, andere waren plötzlich schreiend oder stöhnend zusammengebrochen, weil sich der bleierne Tod blitzschnell in ihren Körper gefressen hatte. Weiter hatte er mit angesehen, wie mehrere von den Zwölfpfündem der Sibella von den Kugeln der Barras aus ihren Lafetten gerissen wurden, als wären sie hölzerne Attrappen gewesen. Dann hatte ihn selbst ein Schlag getroffen, dass er das Bewusstsein verlor.
Jetzt war die arme kleine Sibella gründlich zusammengeschossen. Was von ihr blieb, war nur eine lecke hölzerne Schale, erfüllt von Rauch und Feuer, von zerrissenen Leibern und Schmerzensschreien, von trotzigem Gebrüll und Tod. Die Mehrzahl der acht Dutzend Männer, die ihr Leben eingehaucht hatten und mit ihr um die halbe Welt gesegelt waren, lagen tot oder verwundet umher und färbten mit ihrem Blut die Planken rot, die sie so lange zweimal täglich gescheuert hatten.
Ramage zwang sich, der Reling den Rücken zu kehren. Er durfte nicht in den Tag hineinträumen, wenn alles darauf ankam, festzustellen, ob die Barras weiter Kurs hielt. Ihm standen nur noch an die zehn Minuten zur Verfügung, um den Plan auszuführen, der für seine Männer entweder die Rettung oder den Tod bedeutete. Vielleicht – so wollte ihm scheinen – hatten die acht Jahre seines Lebens, die er zur See gefahren war, keinen anderen Sinn gehabt als den, dass er sich diesen zehn Minuten gewachsen zeigte.
Der Bootsmann meldete: »Wir haben die meisten Verwundeten an Deck gebracht, Sir. Ein Dutzend höchstens sind noch unten. Nach meiner Schätzung sind keine fünfzig Mann mehr auf den Beinen.«
Der Meistersmaat wartete bereits. »Wir haben schon sechs Fuß Wasser im Raum, Sir. Weil der Tiefgang zunimmt, kommen immer neue Schusslöcher unter Wasser.«
Ramage merkte, dass in der Nähe einige Dutzend Leute, darunter zahlreiche Verwundete, angespannt auf seine Worte lauschten. »Ausgezeichnet, der alte Kasten schwimmt also noch eine ganze Weile, und kein Mensch braucht zu fürchten, dass er nasse Füße bekommt.«
Das waren schneidige Worte, aber die armen Teufel hatten es bitter nötig, dass er ihnen ein wenig Mut machte. Er warf wieder einen Blick nach der Barras. Ob ihr Kommandant wohl merkte, dass die Sibella steuerlos war?
»Bootsmann, sobald der letzte Verwundete an Deck ist, lassen Sie die unverletzten Leute hier antreten. Schaffen Sie mir außerdem ein paar Dutzend Äxte zur Stelle. Noch eins: Wer war eigentlich Signalfähnrich?«
»Mr Scott.«
»Schicken Sie ein paar Leute los, die nach seiner Leiche suchen sollen. Ich möchte das Signalbuch haben.«
Jackson, der Bootssteuerer aus Amerika, kam mit einem Segeltuchsack herbei.
»Hier drin sind alle Karten und Segelhandbücher des Steuermanns, dazu das Logbuch und die Musterrolle, die ich in der Kammer des Zahlmeisters fand.«
Ramage gab ihm die Dokumente aus der Kajüte mit Ausnahme des Befehls des Admirals. »Stecken Sie auch diese Papiere in den Segeltuchsack. Einige Leute suchen bereits nach dem Signalbuch. Nehmen Sie es in Empfang, wenn es gefunden wird. Und verschaffen Sie mir schnell ein Entermesser.«
»Das Signalbuch, Sir«, sagte ein Matrose und hielt ihm den dünnen, über und über mit Blut besudelten Band entgegen.
»Gib her«, sagte Jackson und steckte das Buch mit in den Sack.
Wieder fasste Ramage die Barras ins Auge. Es blieb nicht mehr viel Zeit.
»Bootsmann! Wo sind die Äxte?«
»Sind bereit, Sir.«
Jackson kam mit einigen Entermessern unter dem Arm herbeigeeilt. »Das Ding da werden Sie auch brauchen können, Sir.«
Er reichte ihm ein Megafon. Der verdammte Kerl dachte wirklich an alles. Ramage ging achteraus und kletterte auf die Hängematten, die oben auf der Verschanzung in ihren Kästen lagen. Hoffentlich fällt es den Froschfressern nicht ein, jetzt zu feuern, dachte er voll Ingrimm. Dann setzte er das Megafon an die Lippen.
»Hört gut zu, Leute, und scheut euch nicht zu fragen, wenn ihr etwas nicht versteht. Wenn ihr meine Befehle bis aufs Kleinste befolgt, dann können wir in den Booten entkommen. Den Verwundeten können wir leider nicht helfen, wir lassen sie daher in ihrem eigenen Interesse zurück, damit sich der französische Schiffsarzt ihrer annehmen kann. Vier unserer Boote schwimmen noch. Wenn ich Befehl gebe, habt ihr nur zwei bis drei Minuten Zeit, sie zu besetzen, dann pullt ihr los, was das Zeug hält.«
»Verzeihung, Sir«, fragte der Bootsmann, »wie können wir das Schiff stoppen, um in die Boote zu gelangen?«
»Das werden Sie gleich hören. Schauen Sie sich den Franzosen dort an.« Er wies mit der Hand nach der Barras. »Er steuert einen konvergierenden Kurs und kommt uns daher immer näher. In acht bis zehn Minuten ist er fast längsseits und klar zum Entern. Und wir können ihn nicht daran hindern.«
In diesem Augenblick holte das Schiff mit träger Bewegung über und erinnerte ihn an das Wasser, das nach wie vor in den Raum strömte.
»Wenn wir unsere Flagge niederholen, kann es uns nicht gelingen, mit den Booten zu entkommen. Also müssen wir die Burschen übertölpeln, um die Zeit zu gewinnen, die wir zur Flucht brauchen. Wenn wir warten, bis die Barras fast längsseits ist, und dann unser Schiff plötzlich stoppen, wird sie wahrscheinlich nicht auf unser Manöver gefasst sein und vorbeilaufen. Aber das muss so schnell gehen, dass der Franzose keine Zeit findet, das Feuer zu eröffnen. Ehe er dann gehalst hat, sind wir längst in den Booten. Die Flaggleine bekommt einer der Verwundeten in die Hand, damit er das Schiff übergeben kann.«
»Verzeihung, Sir«, fragte einer der Seesoldaten, »wie bringen wir es fertig, das Schiff zu stoppen?«
»Dazu gibt es nur ein Mittel. Wir werfen etwas über Bord, sodass das Schiff wie von einem Anker festgehalten wird. Und um völlig sicherzugehen, dass die Franzosen keine Zeit finden, auf uns zu feuern, wollen wir gleichzeitig hart Backbord drehen.«
»Was können wir denn über Bord werfen, Sir?«, fragte der gleiche Seesoldat mit düsterer Miene.
»Wir stoppen das Schiff wie folgt«, antwortete ihm Ramage sachlich, obwohl er sich alle Mühe geben musste, den Mann nicht zu beuteln. Hätte er den Leuten doch nicht erlaubt, Fragen zu stellen! Seine Worte kamen langsam und klar, damit es auf keinen Fall Missverständnisse gab: »Der Fockmast ist fast schon gefallen. Beinahe alle Wanten und Backstags an Steuerbord sind zerschossen. Eine Handvoll Männer mit Äxten haben die übrigen in wenigen Augenblicken gekappt, dann geht der Mast über Bord – natürlich nach der Backbordseite. Das ist unser Anker. Wenn dieser Mast, der mit Rahen und Segeln mehr als fünf Tonnen wiegt, über Bord und ins Wasser fällt, aber von den Backbordwanten noch gehalten wird, dann zieht er den Bug mit unwiderstehlicher Kraft nach Backbord, und das ist es, was wir wollen.
Dabei helfen wir noch nach, indem wir das Kreuzmarssegel und den Besan setzen, sobald der Fockmast über Bord geht. Dadurch erhält das Heck einen Schub nach Steuerbord, während der gestürzte Fockmast den Bug nach Backbord zieht.«
»Aye, Sir, was wird dann aber der Franzose tun?«
»Wenn die Barras fast längsseits ist und wir plötzlich so scharf abdrehen, dass unser Drehkreis kaum größer ist als die Länge unseres Schiffs, dann hat sie nur ein paar Sekunden zur Verfügung, um zu feuern. Wenn sie wirklich feuern sollte – nun, dann bestreicht sie uns der Länge nach. Keiner von euch wird Portsmouth Point wiedersehen, wenn wir auch nur eine halbe Breitseite durch die Heckfenster hereinbekommen.«
Er hatte nur noch wenige Minuten zur Verfügung. Was gab es noch zu sagen? Ja, richtig –
»Nun zu den Booten. Bootsmann, Sie führen den roten Kutter. Meistersmaat, Sie übernehmen den schwarzen Kutter. Sie, der Vormann im Großtopp – Wilson war doch Ihr Name? –, steuern die Gig. Ich selbst übernehme die Barkasse.
Und nun zum Schluss: Ihr dort« – er wies auf ein Dutzend Männer an der Heckreling –, »ihr nehmt die Äxte. Lasst sie euch vom Bootsmann geben, dann geht nach vorn und haltet euch klar, alle noch intakten Wanten und Backstags an Steuerbordseite zu kappen. Verteilt euch gleich richtig und wartet, bis euch der Bootsmann den Befehl gibt. Das wird er tun, sobald er mich in französischer Sprache rufen hört.«
Ramage besann sich darauf, wieder nach der Barras zu sehen. Der Zwischenraum wurde immer kleiner, langsam, langsam verrann die Zeit. »Das ist alles, lassen Sie wegtreten.«
Er gab Wilson ein Zeichen. »Holen Sie sich ein paar Toppsgasten zusammen, und halten Sie sich klar, das Kreuzmarssegel und den Besan zu setzen. Tut nur ja nichts ohne meinen Befehl, dann aber reißt an den Enden, als ginge es um euer Leben. Zuletzt schafft ihr die Boote unter die Stückpforten im Halbdeck, natürlich an Steuerbordseite.«
Die Barras war kaum noch dreihundert Meter entfernt. Also noch knapp fünf Minuten – vorausgesetzt, dachte er – und dabei fühlte er ein Würgen im Hals –, vorausgesetzt, dass sich der Franzose so verhält, wie ich erwarte …
»Bootsmann, Meistersmaat, Wilson …«
Als die drei Männer erschienen, sprang er von dem Hängemattskasten herunter an Deck. »Sobald wir gedreht haben und das Schiff keine Fahrt mehr macht, laufen Sie nach unten und sorgen dafür, dass die Männer in die Boote gehen. Wenn Sie alle an Bord haben, werfen Sie los. Versuchen Sie auf jeden Fall, mit den anderen Booten in Fühlung zu bleiben. Sobald es sich machen lässt, geben wir eine Leine von Boot zu Boot. Einstweilen pullen Sie fünfhundert Schläge nach Norden, dort soll unser Treffpunkt sein. Sie brauchen dazu nur etwa fünf Minuten lang auf den Polarstern zuzuhalten. Noch Fragen?«
Die drei blieben stumm. Der Bootsmann war die Ruhe selbst. Wenn ihm jemand Befehle gab, tat er flink und tüchtig seine Pflicht. Der Meistersmaat war ein Phlegmatiker, und Wilson war ein Draufgänger, der sich nie Gedanken machte.
»Also los, klar zum Manöver!«
Der Bootsmann blieb stehen, als sich die beiden anderen abwandten. Er machte einen verlegenen Eindruck. »Ich wollte, Ihr Herr Papa wäre jetzt hier, Sir.«
»Warum? Haben Sie zu mir kein Vertrauen?«
»Doch, doch«, meinte der Bootsmann hastig, »ich meine – nun, ich war damals bei ihm, Sir. Sie wissen schon. Was danach geschah, war alles grundfalsch, aber er hatte eben seinen Stolz, Sir.«
Mit diesen Worten verschwand er nach vorn. Seltsam, dachte Ramage, er hat nie ein Wort darüber verloren, dass er bei Vater an Bord war. Es war für den Sohn nicht gerade ermutigend, wenn man ihm just in diesem Augenblick ins Gedächtnis rief, »was damals geschehen war«. Dabei hatte der Bootsmann sicherlich nichts anderes im Sinn gehabt, als ihm seine Treue zu bezeigen.
Ramage sah sich um, ob Jackson in der Nähe war, und der Amerikaner meinte grinsend: »Jetzt könnten Sie ja schon mit Ihrem Messer hinüberreichen, Sir.«
Ramage lachte. Seine Geschicklichkeit im Messerwerfen war offenbar allen bekannt – er hatte diese Kunst als Kind in Italien von einem sizilianischen Kutscher seines Vaters gelernt.
Er ging nach dem Platz, wo die Verwundeten lagen, und gab dabei acht, dass er nicht über die Toten stolperte, die in grotesken Verrenkungen hingestreckt lagen.
»Lebt wohl, ihr Männer, in Greenwich werden wir uns bald wiedersehen. Wir müssen euch verlassen, aber wir lassen euch nicht im Stich.« (Ob sie den Unterschied verstanden?) »Wir haben nur noch ein halbes Dutzend Geschütze, damit können wir nicht mehr kämpfen, sie aber« – dabei zeigte er auf die Barras –, »sie aber können uns entern, sobald sie nur wollen. Sie haben drüben einen Arzt und eine Apotheke, wir nicht. Für euch ist es bestimmt am besten, wenn ihr in Gefangenschaft kommt. Einer von euch bekommt die Flaggleine in die Hand, er soll die Flagge niederholen, sobald wir das Schiff verlassen haben. Dann können die Franzosen unbehelligt an Bord kommen, und euch wird nichts mehr zustoßen. Wir, die unverwundet blieben, nun gut, wir machen uns aus dem Staub, aber eines besseren Tages werden wir wieder kämpfen. Eines ist gewiss, der letzte Kampf der Sibella wird nie in Vergessenheit geraten. Also – ich danke euch – und wünsche euch viel Glück.«
Das war ein recht lahmer Abschied, er fühlte sich dabei vor allem gehemmt, weil ihm die Rührung die Kehle zuschnürte. Darum konnte er die letzten platten Redensarten nur noch mit Gewalt hervorstoßen. Immerhin erntete er von den Männern ein dreifaches Hurra. »Bootsmann – ist vorn alles klar?«
»Aye, aye, Sir.«
»Jackson«, sagte er, »wenn die Franzosen jetzt feuern und wenn mir dabei etwas zustößt, dann unterrichten Sie sofort den Bootsmann und vernichten den Brief, den ich vorhin vor Ihren Augen in die Tasche steckte. Das ist von größter Wichtigkeit. Geben Sie die Flaggleine einem der Verwundeten; sorgen Sie dafür, dass er weiß, was er zu tun hat.«
»Aye, aye, Sir.«
Seltsam, dachte Ramage, wie beruhigend dieser Amerikaner wirkt.
2
Ramage erkletterte wieder die Hängemattskästen auf der Verschanzung. Mein Gott, wie nahe die Barras nun schon war – knappe hundert Meter entfernt und ziemlich querab. Ihre Bugwelle leuchtete wie ein kleines weißes Wölkchen vor ihrem Steven. Er setzte das Mundstück des Megafons ans Ohr und richtete den Trichter auf die Barras – allein er hörte nichts.
Im Augenblick schien es, als hätte der französische Kommandant die Absicht, sein Schiff ohne Hast längsseits zu bringen. So handelte jedenfalls ein guter Seemann. Es hatte keinen Sinn, krachend längsseits zu scheren und zu gewärtigen, dass sich die Rahen der beiden Schiffe ineinander verfingen.
Es sei denn – Ramage schauderte zusammen –, es sei denn, ich irre mich gründlich. Der Franzose muss ja wissen, wie schwer die Schäden der Sibella sind, er kann deutlich genug sehen, wie tief sie schon im Wasser liegt, wie träge sie rollt. Dann ist ihm auch klar, dass er sie niemals nach Toulon einbringen kann. Wenn er jetzt langsam näher kommt, dann hat er doch nur die Absicht, uns den Gnadenstoß zu versetzen – das kann nun jeden Augenblick über uns hereinbrechen. Ein Feuerbrand aus den Stückpforten der Barras wie Sommerblitze am Horizont, und ich samt allem, was von der Sibella noch übrig ist, bin tot.
Ach, wie kam ich mir klug vor, als ich mir einredete, den Franzosen würde seine Ruhmsucht dazu verleiten, die Sibella als Prise nach Hause zu schleppen. In Wirklichkeit machte ich mir das doch nur vor, weil ich leben wollte: Darum ließ ich keine andere Möglichkeit gelten. In dieser Einbildung habe ich jetzt die Verwundeten auf dem Achterdeck so gut wie umgebracht – die Männer, die mich noch vor ein paar Minuten hochleben ließen.
Plötzlich geriet er in solchen Zorn über sich selbst, dass alle Angst wie weggeblasen war. Auch in dieser Lage gab es noch einen Ausweg. Gewiss, er musste dabei ein Glücksspiel wagen, er musste darauf setzen, dass die Barras bis auf Rufweite herankam, ehe sie ihre letzte Breitseite abfeuerte. Im Augenblick war sie noch so weit entfernt, dass man ihn drüben wahrscheinlich nicht hörte, wenn er hinüberrief.
Ramage fiel unversehens der XV. Kriegsartikel ein, der in seiner grausamen Kürze lautete: »Jeder zur Flotte gehörige oder in ihr dienende Mann, der ein Schiff aus Feigheit oder verräterischer Absicht dem Feind ausliefert und dessen überführt wird, ist mit dem Tode zu bestrafen.«
Wenn er zum Feigling oder Verräter werden sollte, dann musste er wenigstens überleben, damit man ihn verurteilen konnte. Bei der Lage, in die er geraten war, wurde das jedoch immer fraglicher.
Wie weit war der Franzose noch weg? In der sinkenden Nacht war das verdammt schwer zu schätzen. Siebzig Meter? Wieder nahm er das Sprachrohr an sein Ohr. Ja, jetzt hörte er die Franzosen, wie sie einander zuriefen. Es war ein gewöhnlicher Befehl und seine Bestätigung. Sie mussten ihrer Sache sehr sicher sein. Wenn sie nur nicht zu früh das Feuer eröffneten. Wenn auf der Barras nur etwas geschehen wollte, das einige Verwirrung und Unsicherheit hervorriefe. Dadurch könnte er Zeit gewinnen. Ramage setzte das Sprachrohr an die Lippen. Ich will das tun, ich will sie aus dem Gleichgewicht bringen, sagte er sich voll Ingrimm.
Im letzten Augenblick hielt er noch einmal inne und rief nach vorn: »Bootsmann! Ich nehme den Befehl zurück, dass Sie kappen lassen sollen, sobald Sie mich französisch sprechen hören. Warten Sie damit, bis ich es ausdrücklich befehle!«
»Aye, aye, Sir.«
Er hob das Megafon von Neuem an den Mund und rief zu dem Franzosen hinüber: »Bon soir, messieurs!«
Nach einer Pause, die ihm wie eine Ewigkeit vorkam, vernahm er mit dem Mundstück am Ohr die Antwort: »Comment?«, die vom Achterdeck der Barras herübertönte. Er konnte sich denken, wie erstaunt sie drüben waren, dass man ihnen hier einen guten Abend wünschte. Weiter, weiter, er musste sie in Atem halten.
»O detto: Buona sera.«
Er hätte beinahe laut gelacht, als er sich die Gesichter der Franzosen vorstellte, wenn sie nun auf Italienisch hörten, dass er ihnen eben in ihrer Muttersprache guten Abend gewünscht hatte.
»Comment?«
Nun war die Barras nur noch fünfzig Meter entfernt. Ihre Bugwelle war in der Dunkelheit deutlich zu erkennen, auch das Filigran ihrer Takelage hob sich scharf gegen den Nachthimmel ab, während er noch vor wenigen Minuten nur als Schatten zu ahnen gewesen war.
Der entscheidende Augenblick war gekommen. Abermals hob er das Megafon an die Lippen, dabei schoss es ihm durch den Kopf, dass er nun ernstlich im Begriff war, sich dem XV. Kriegsartikel auf Gnade und Ungnade auszuliefern. Dennoch galt es, um Leben und Freiheit zu ringen, solange es ging. Er rief auf Englisch: »Mr Frenchman – unser Schiff sinkt.«
Dieselbe Stimme antwortete: »Was Sie sagen?«
»Ich sagte: Unser Schiff sinkt!«
Er merkte, wie Jackson aufgeregt von einem Fuß auf den anderen trat. An Bord der Sibella herrschte plötzlich Totenstille. Er merkte vor allem, dass die Verwundeten keinen Laut von sich gaben. Die Sibella selbst war ein Geisterschiff. Keine Menschenseele stand am Ruder, die Besatzung war stumm und von Spannung geladen.
Endlich hörte er durch sein Megafon, wie jemand auf Französisch sagte: »Das ist doch nur eine List.« Es war die Stimme eines Mannes, der offenbar Autorität genoss und sich jetzt zu einer schwierigen Entscheidung durchgerungen hatte. »Wollen Sie sich ergeben?«
In größter Hast wandte sich Ramage dem Bootsmann zu und rief mit gedämpfter Stimme: »Bootsmann – los, kappen!«
Er musste es vermeiden, die Frage des Franzosen klar zu beantworten. Wenn er das Schiff in aller Form übergab, aber mit dem Rest der Besatzung das Weite suchte, dann erboste sich die Admiralität bestimmt genauso wie die Franzosen, weil er durch dieses Verhalten gegen den allgemein anerkannten Ehrenkodex verstieß.
Also setzte er das Megafon aufs Neue an die Lippen: »Wir sollen uns ergeben? Wie denn? Unser Ruder ist zerstört, wir können nicht mehr steuern.«
Die dumpfen Schläge der Äxte waren deutlich zu hören; hoffentlich drang das Geräusch nicht bis zur Barras hinüber. Es ging nicht anders, er musste es mit seiner eigenen Stimme übertönen oder den Franzosen wenigstens von dem Lärm ablenken.
»Wir können nicht mehr steuern, die meisten unserer Leute sind tot oder verwundet, das Schiff sinkt schnell – unser Kommandant ist auch gefallen …«





























