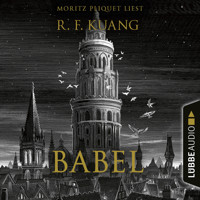Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Telescope Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Dirk-Boris Rödel führt den Leser in siebzehn magischen Kurzgeschichten in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, wo ein mordgeübter Landsknecht auf ein sterbendes kleines Mädchen trifft, zu einer Sippe von Steinzeitmenschen, die sich am Rande eines Moores von einer furchteinflößenden Hexe Beistand gegen übermächtige Angreifer erflehen, und immer wieder in tiefe Wälder, in denen der Leser auf Hexen, Geister, Einhörner und schließlich sogar auf Erlkönigs Tochter trifft.Die Magie-durchtränkten Geschichten pendeln stets zwischen den beiden großen Polen Tod und Liebe - mal schlägt das Pendel zur einen, mal zur anderen Seite aus. Und manchmal werden Tod und Liebe eins .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dirk-Boris Rödel
Liber Thanatamor
Das Buch von Tod und Liebe
Impressum
© Edition Outbird
Imprint im Telescope Verlag
www.edition-outbird.de
www.telescope-verlag.de
Herausgeber: Tristan Rosenkranz
Lektorat: Tristan Rosenkranz
Coverlayout: Holger Much
Autorenfoto: Tobias Kircher
„Magie, tu was Du willst!“
Ein sehr persönliches Vorwort
„Es hat in unserer Mitte Zauberer und Zauberinnen, aber niemand weiß es“, sagte einst Hugo von Hofmannsthal. Nun, zärtlich und liebevoll möchte ich Herrn von Hofmannsthal hier in Teilen widersprechen. Nicht was den Teil mit den Zauberern und Zauberinnen anbelangt. Denn, das ist zumindest meine ganz persönliche, subjektive Erfahrung vor allem der vergangenen Jahre, es gibt sie selbstverständlich, jene magischen Menschen, die diese Aura haben, diese Ausstrahlung, diese Magie eben, die den Raum erfüllt, sobald sie ihn betreten, mag es zum Guten oder zum Bösen sein.
Doch dass es niemand weiß, dass es diese Menschen gibt, das sehe ich so nicht. Im Gegenteil. Denn je mehr man sich des leise fließenden und schaffenden Wirkens in der Welt bewusst wird und jener, die sich dieser Ströme bedienen – oder derer sich die Ströme bedienen – und sich dafür öffnet, umso mehr wird man immer mehr all der Menschen gewahr, die all dies sehr wohl zur Kenntnis nehmen und zu einem, wie auch immer gearteten, Teil ihres Lebens gemacht haben.
Magie – was ist das? Schon das Wort klingt, ja, nach Zauber und Schönheit. Ganz sicher wird sie nicht zustande gebracht von zauberstabschwingenden Leuten in wallenden Roben, auch wenn ich ein großer Fan von Harry Potter bin.
Während frühere, evolutionistische Deutungen Magie als etwas tendenziell Primitives, Atavistisches und dunklem Aberglaube Verhaftetes ansahen, gehen neuere magische Weltbilder und Konzepte davon aus, dass alle Geschehnisse und alle Dinge in Vergangenheit, Gegenwart sowie in der Zukunft untrennbar miteinander in Verbindung stehen.
Alles ist eins, wie unten so oben … und wenn wir, jeder und jede Einzelne von uns, selbst ein Teil dieses großen, komplexen Ganzen sind, so müssten jede und jeder von uns auch die Möglichkeit haben, gewisse Dinge zu beeinflussen, manchmal nur dadurch, dass wir uns von den Wellen treiben lassen, auch wenn dazu Mut gehört. Doch dann können wunderbare, magische Dinge passieren …
Allein die Tatsache, dass ich nun, im Januar 2020, hier sitze und das Vorwort zu diesem Buch von Dirk-Boris Rödel schreiben kann, gehört für mich persönlich zu dieser Alltagsmagie, die von selbst tätig wird, wenn man sie nur lässt.
„Magie, tu was Du willst“, sagt Peter S. Beagles glückloser Zauberer Schmendrick in „Das letzte Einhorn“ und bewirkt nicht zufälligerweise immer dann Großes …
Kennengelernt haben Dirk-Boris und ich uns in den alten, von den sagenumwobenen Fluten des Neckar umflossenen Gemäuern des Universitätsstädtchens Tübingen, wo wir beide unter anderem Empirische Kulturwissenschaft studierten, ein Fach, das anderswo noch „Volkskunde“ heißt. Danach verloren wir uns für Jahrzehnte aus den Augen.
Vor einigen Jahren tauchte Dirk-Boris dann plötzlich unverhofft wieder in meinem Leben auf (oder ich in seinem?), als einer jener wunderbaren magischen Menschen, die Teil meines Lebens sind, seit ich bewusst die für viele Jahre von mir verschlossene Tür zur Kunst wieder geöffnet hatte und die unerwartete, beglückende und teilweise in ihrer Stringenz schon fast wieder erschreckende Erfahrung gemacht habe, dass sich die Wege jener, die gemeinsam wirken sollen, wie von selbst kreuzen.
So ist auch dieses Buch, in dem der Autor siebzehn unterschiedlichste, teils grausame, teils mysteriöse, aber stets tief empfundene und fesselnde Erzählungen versammelt hat, nicht unser erstes gemeinsames Werk. Dass ich nun für das „Liber Thanatamor“ sowohl das Cover erschaffen durfte als auch das Vorwort schreiben, hat auch damit zu tun, dass wir beide ein vitales Interesse für das große Feld der Magie haben und diesbezüglich instinktiv wissen, was der andere fühlt und meint.
Im vorliegenden Werk, dies darf ich wohl verraten, ohne allzu sehr zu spoilern, hat Dirk-Boris Rödel seine magische Weltsicht in Geschichten und Erzählungen verpackt, ähnlich wie es übrigens schon der Crowley-Vertraute Kenneth Grant in seinem Buch „Gegen das Licht“ getan hat, für das ich ebenfalls das Cover beisteuern durfte. Natürlich lassen sich die vorliegenden siebzehn Geschichten auch ohne diese Brille genießen, doch man sollte der Magie immer ein Türchen im Herzen offen lassen, nicht wahr?
Denn dass sie existiert, die Magie, beweist allein schon die Existenz dieses Buches. Und dies ist, wie ich finde, ein wunderbarer, ein ermutigender, eben ein herrlich magischer Gedanke.
Holger Much, Albstadt, Januar 2020
- Dramen -
Das Hexenmädchen von Brucricj
Draußen toste der erste Wintersturm des Jahres um den Landsitz und ich konnte hören, wie der Wind an den großen Bäumen im Garten rüttelte und ums Haus heulte. Bereits am Nachmittag hatte leichter Schneefall eingesetzt, und nun, um elf Uhr in der Nacht, fegte ein wahrer Blizzard über Lydford. Hier am westlichen Rand des Dartmoor in der Grafschaft Cornwall waren solche Schneestürme eher selten. Umso mehr genoss ich das prasselnde Kaminfeuer, das leise und gemütlich vor sich hin knisterte und eine behagliche Wärme ausstrahlte, während ich in meinem Lieblingssessel die Zeitung studierte, eine gute Pfeife in der Linken und ein Glas Cognac auf dem Beistelltisch rechts neben mir.
Die abendliche Zeitungslektüre war mir eine liebe Gewohnheit geworden, ebenso wie die Pfeife und das Glas Branntwein, die ich mir als kleines Laster im Alter erlaubte. Diese drei Dinge schlossen für mich nicht jeden, aber doch die meisten Tage ab, und waren umso genussvoller, je unwirtlicher das Wetter draußen tobte – und in stürmischen Nächten wie dieser empfand ich die wohlige Wärme des offenen Feuers, den süßlich-würzigen Rauch des Perique-Tabaks und den feinen Geschmack eines Cognacs aus einer kleinen Brennerei an der Loire als eine besondere Wohltat.
Ich wollte gerade meine Zeitungslektüre beenden um mich zu Bett zu begeben, als mir beim Zusammenlegen der Zeitung etwas ins Auge sprang – ein Wort, eine Überschrift, irgendetwas hatte für den Bruchteil einer Sekunde meine Aufmerksamkeit erhascht, viel zu kurz, als dass es bis zu meinem Bewusstsein hätte vordringen können. So blätterte ich die Zeitung erneut auf und ließ meinen Blick über die Seiten gleiten, danach Ausschau haltend, welche Reportage, welcher Bericht es war, der mir da ins Auge gesprungen war. Bei einer Notiz unter der Rubrik „Aus aller Welt“ wurde ich schließlich fündig. Kein Zweifel; diese kurze Meldung war es, die meine Neugier erregt hatte, doch nun, da ich sie las, konnte ich mir keinen Reim darauf machen, weshalb sie für mich von Relevanz sein sollte. Ich studierte die Meldung, nur wenige Sätze lang, ein zweites und drittes Mal, und obwohl ich mich des Gefühls nicht erwehren konnte, dass etwas darin lag, was mich berührte, konnte ich nicht sagen, was es war. Schließlich rückte ich meine Lesebrille zurecht und studierte sie ein viertes Mal, Wort für Wort, suchend, welche Information darin etwas in meinem Unterbewusstsein zum Schwingen gebracht hatte. Die Nachricht selbst war wenig spektakulär, der ganze Abschnitt las sich wie folgt:
Ungeklärtes Viehsterben in Siebenbürgen, Rumänien
In der Region Banat im rumänischen Siebenbürgen geben zahlreiche bislang ungeklärte Todesfälle bei Rindern, Schweinen, Gänsen und weiterem landwirtschaftlichen Nutzvieh den Veterinären Rätsel auf. Zum Einen konnte bislang kein bekannter Erreger wie Schweinepest, Vogelgrippe oder BSE als Auslöser für das Massensterben unter den Tieren nachgewiesen werden, zum Anderen scheinen die stark gehäuften Todesfälle ausschließlich auf landwirtschaftliche Betriebe rund um die Ortschaft Brucricj beschränkt zu sein. Die Landwirtschaft in dieser Region war bereits im Sommer des vergangenen Jahres durch eine ungewöhnlich lange Trockenzeit stark in Mitleidenschaft gezogen worden, die wenigen Niederschläge fielen allesamt in Form starken Hagels, der die spärlichen Erträge der Bauern in dieser Region gänzlich zunichte machte. Viele Betriebe in und um Brucricj müssen nun um ihre Existenz bangen. Das rumänische Landwirtschaftsministerium verhängte vorsorglich eine Sicherheitszone rund um Brucricj.
Ratlos legte ich die Zeitung beiseite und nahm meine Lesebrille ab. „Brucricj …“, murmelte ich leise vor mich hin – und nun, da ich den Ortsnamen ausgesprochen hatte dämmerte es mir; der Name klang seltsam vertraut, obwohl ich immer noch kein Bild vor Augen hatte. War ich dort schon mal gewesen, in Brucricj in Siebenbürgen? Aber wann wäre das gewesen? Es musste lang, sehr lange her gewesen sein. Ich versuchte, mich zu erinnern.
Ich war gerade zwanzig Jahre alt geworden, als ich eine beträchtliche Erbschaft machte, die es mir ermöglichte, ein sorgenfreies Leben zu führen und vor allem zu reisen! – zu reisen wohin ich wollte, ohne mir um meinen Unterhalt Gedanken machen zu müssen. Meine finanzielle Situation hätte es mir schon damals erlaubt, die luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe und die komfortabelsten Züge zu nutzen, doch nicht aus Geiz, sondern aus schierer Abenteuerlust und jugendlichem Übermut fuhr ich oft gerade auf den heruntergekommensten Seelenverkäufern über die Meere oder ließ mich auf Ochsenkarren über holprige Landstraßen kutschieren, oft ohne überhaupt danach zu schauen, wohin der Weg führte.
Ich wählte stets den Weg, der mir das größte Abenteuer versprach, und mehr als einmal hatte ich mehr Glück als Verstand, dass ich meine Sorglosigkeit nicht teuer bezahlen musste. Stets bei mir trug ich damals eine Kladde, in der ich mir wie in einem Tagebuch meine Erlebnisse notierte und besonders merk- und denkwürdige Begebenheiten niederschrieb. Rom, Paris oder St. Petersburg – solche Orte interessierten mich damals nicht und ich machte einen Bogen um die Metropolen der Welt. Mich faszinierten die Gegenden, in die möglicherweise kein Brite je zuvor seinen Fuß gesetzt hatte, die Ortschaften, in denen man Dinge entdecken konnte, die jedem anderen Reisenden verborgen blieben. Und so musste ich wohl irgendwann in diesem Ort gelandet sein, Brucricj … Doch immer noch stellte sich nach inzwischen nun immerhin mindestens sechzig Jahren keine brauchbare Erinnerung ein.
Nachdenklich starrte ich ins Kaminfeuer, während draußen nach wie vor der Sturm wütete. Feuer … eine Flamme … ein Sturm und eine Flamme … ich begann, mich zu erinnern und langsam formte sich ein erstes Bild; eine Kerosinlampe, deren Flamme ein fahles Licht abgab, ein Sturm … und eine Hütte. Nein, keine Hütte – ein … ein Häuschen. Ein Bahnwärterhäuschen.
Ja, das war es! Ich hatte nun das Bild vor Augen, wie ich vor über sechzig Jahren im rumänischen Brucricj beim Schein einer Kerosinlampe in einem Bahnwärterhäuschen saß, während draußen ein Schneesturm tobte. Ich versuchte, mich an Details zu erinnern. Ich saß an einem Tisch und da war … da war der Bahnwärter, und der Zugführer. Und noch ein dritter Mann war am Tisch … dann verschwamm die Erinnerung wieder vor meinem geistigen Auge.
Ungeduldig legte ich die Zeitung beiseite, erhob mich aus meinem ledernen Ohrensessel und begann, auf und ab zu gehen, während ich an meiner Pfeife zog. Wie war ich in das Bahnwärterhäuschen geraten, was hatte ich dort verloren? War da noch ein dritter Mann gewesen? Wer war das gewesen? Ich blieb stehen, schloss die Augen und ließ das Bild tiefer in mein Bewusstsein sinken … und langsam, langsam hefteten sich weitere Bruchstücke meiner Erinnerung daran.
Plötzlich hatte ich die Stimme des Lokführers im Ohr: „Ein Haltesignal, ich weiß nicht, was los ist. Wir dürfen nicht weiterfahren, vielleicht gibt es eine Störung.“
Dann sah ich den Bahnwärter vor mir, eine hagere Gestalt mit eingefallenem, bartstoppeligem Gesicht und einer alten, schlecht sitzenden dunkelblauen Bahnwärter-Uniform: „Durch den Sturm sind Bäume auf die Schienen gefallen, ihr könnt nicht weiter. Leute aus dem Ort sind schon dabei, die Gleise zu räumen, aber das dauert sicher noch die ganze Nacht. Kommt rein, ich hab Wurst und Schnaps!“
So war es also gewesen; ich war auf einer Zugfahrt durch Rumänien in diesem kleinen Ort gestrandet, weil umgestürzte Bäume uns an der Weiterfahrt gehindert hatten, und der Bahnwärter hatte uns in sein Häuschen eingeladen.
Nun sah ich den Tisch vor mir, um den wir saßen; der Bahnwärter goss uns von einem starken, selbst gebrannten Schnaps ein und schnitt uns von einer dunkelroten, fettigen Wurst auf. Plötzlich hatte ich, nach all den Jahren, wieder den Geschmack der ranzigen Wurst im Mund. Ich griff unwillkürlich nach meinem Cognacglas und nippte daran.
Ovidiu! Unvermittelt kam mir der Name wieder ins Gedächtnis. Der dritte Mann am Tisch hieß Ovidiu. „Schenk unseren Gästen mehr Schnaps ein, Ovidiu, und gib ihnen von dem Brot, es steht hinter dir!“, hörte ich im Geiste die Stimme des Bahnwärters. Dieser Ovidiu war wohl ein Freund des Bahnwärters gewesen und zusammen vertrieben sie sich die langen Nächte im Bahnwärterhaus mit Schnaps und fettiger Wurst.
Nun hatte ich ein recht vollständiges Bild vor Augen, wie wir damals zu viert in diesem Häuschen saßen und, wie ich mich erinnere, einen lustigen Abend verbrachten. Es muss noch mehr Reisende in dem Zug gegeben haben, aber ob die im Zug geblieben waren, ob sie im Dorf übernachteten und warum nur der Zugführer und ich mit dem Bahnwärter und seinem Freund beisammen saßen – das könnte ich heute nicht mehr sagen.
Dennoch war ich noch nicht so recht glücklich mit dem Bild. Irgendetwas … irgendetwas fehlte noch, etwas wichtiges, hatte ich den Eindruck. Ich griff ein weiteres Mal zur Zeitung und las die Notiz über das Viehsterben erneut durch. Da war noch etwas in der Zeitungsmeldung, was mir bekannt vorkam.
Ich setzte mich wieder in den Sessel und schloss die Augen. Wir hatten zusammen Schnaps getrunken, wir hatten fettige Wurst und trockenes Brot gegessen … aber über was hatten wir geredet? Es gab ein Thema, ein bestimmtes Thema, jemand hatte etwas erzählt … aber was?
Wieder ließ ich den Blick über die Zeitungsnotiz schweifen und suchte darin den Schlüssel. Schweine … Gänse … hatte es etwas mit dem dritten Mann am Tisch zu tun, mit Ovidiu?
Ich schloss die Augen und rief mir erneut die Szenerie von mir mit den drei anderen Männern am Tisch ins Gedächtnis. Ich weiß, dass ich mir, egal wohin es mich auf meinen Reisen verschlug, stets gern Geschichten der Leute vor Ort anhörte. Hatte ich das auch in Brucricj getan, hatte ich den Bahnwärter und Ovidiu nach Geschichten gefragt? Ich spürte wieder das Brennen des Selbstgebrannten im Rachen, ich roch das Kerosin der Funzel, die von der Decke hing, und schließlich hörte ich mich fragen: „Gibt es denn irgendetwas Besonderes hier in Brucricj?“
„Hier gibt es gar nichts!“, lallte der Zugführer, schon reichlich betrunken, „das ist einfach ein langweiliges Kaff, in dem kein Zug halten würde, wenn nicht gerade die Gleise blockiert wären!“
„Es ist ein ruhiger Ort“, antwortete der Bahnwärter leicht beleidigt, „wir mögen es sehr gerne so.“
Ich war immer noch unzufrieden mit der Erinnerung. War das alles? Hatten die beiden mir wirklich nichts erzählt damals? In meiner Erinnerung versuchte ich, den Abend noch einmal Revue passieren zu lassen. Wir sprachen über Weltpolitik und über Frauen, über Reisen … irgendwann lag der Zugführer schnarchend mit dem Kopf auf dem Tisch. Dann blitzte eine weitere Erinnerung in meinem Gehirn auf:
Der Bahnwärter – an seinen Namen kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern – beugte sich zu mir über den Tisch. „Du hast vorher nach Geschichten gefragt. Ovidiu kann dir eine Geschichte erzählen. Ovidiu – komm, erzähl ihm vom Hexenmädchen!“
Die Erinnerung hatte mich elektrisiert – das war es gewesen! Das war es, woran ich die ganze Zeit versucht hatte, mich zu erinnern – die Geschichte vom Hexenmädchen!
Ich war plötzlich hellwach, obwohl es bereits weit nach Mitternacht war. Ich konnte mich daran erinnern, wie der Bahnwärter Ovidiu bedrängte, mir die Geschichte zu erzählen und wie er nach viel gutem Zureden und noch mehr Schnaps schließlich nachgab. Doch dann stockte meine Erinnerung wieder. Da war ein Markt und es ging um ein Schwein, oder um mehrere Schweine – weiter kam ich nicht. Wie ich es auch anstellte, ich bekam die Geschichte einfach nicht mehr zusammen.
Frustriert sank ich tiefer in meinen Sessel. „Warum hab ich mir die Sachen denn damals nur nicht aufgeschrieben!“, schalt ich mich selbst – und schlug mir mit der Hand vor die Stirn. Aber das hatte ich doch gemacht! Die Kladde! Darin hatte ich mir doch damals alles aufgeschrieben! Ich ließ meinen Blick über die Bücherwand schweifen, aber ich wusste, dass sie nicht in meiner Bibliothek war … wo hatte ich die Kladde damals hin geräumt? Ich glaubte mich zu erinnern, dass ich sie zuletzt vor vielen Jahren in einer hölzernen Reisetruhe auf dem Dachboden gesehen hatte.
Ungeachtet der Uhrzeit erhob ich mich, stieg die knarrende Holztreppe hinauf, entriegelte die Tür zur Dachluke und stieg in den Raum unters Dach, wo es bitterkalt war. Ich tastete nach dem Lichtschalter, und eine nackte Glühbirne erhellte den großen Raum gerade so weit, dass man sich notdürftig orientieren konnte. Auf dem Dachboden standen weit mehr Kisten und Kartons als ich gedacht hatte, dennoch hatte ich die hölzerne Truhe rasch entdeckt. Ein Umzugskarton, ein defekte Lampe und ein Stapel alter Zeitungen lagen auf ihr, und auch wenn es mich in meinem fortgeschrittenen Alter ein wenig Mühe kostete, die Sachen beiseite zu legen, hatte ich die Truhe bald frei geräumt. Mit einem Lappen wischte ich notdürftig den dicken Staub vom Deckel, bevor ich ihn anhob. Obenauf lag ein Säbel aus Afghanistan, darunter ein seidenes Gewand aus Indien, das die Zeit nicht gut überstanden hatte, und ein alter britischer Militärmantel. In Zeitungspapier eingewickelt fand ich eine chinesische Schale, daneben einen mongolischen Dolch und eine kleine Statue des ägyptischen Gottes Thoth.
Ich widerstand der Versuchung, mich von diesen Erinnerungsstücken ablenken zu lassen und forschte weiter in der Truhe nach der Kladde. Schließlich wurde ich fündig, doch meine Erinnerung hatte mich insofern getäuscht, dass ich auf meinen Reisen nicht nur eine, sondern mehrere Kladden vollgeschrieben hatte; sechs Stück fand ich in der Truhe. Direkt unterhalb der Glühbirne stand ein alter Sessel auf dem Dachboden, verstaubt und mit löchrigem Bezug. Ich legte das indische Gewand darüber, hüllte mich in den Militärmantel und setzte mich, die Kladden auf meinen Schoß gelegt. Das fahle Licht, die Kälte, der Sturm, der gegen das Dach brauste – mir war, als befände ich mich wieder in jenem zugigen Bahnwärterhäuschen in Siebenbürgen, vor so vielen Jahren. Ich schlug die oberste Kladde auf und Wehmut überkam mich beim Anblick der ersten Seiten – war das einmal meine Schrift gewesen? Große, raumgreifende Buchstaben füllten die Seiten, mit mutigem Schwung und jugendlicher Energie niedergeschrieben.
Ich massierte mir gedankenverloren meine faltigen, gichtgeplagten Hände … inzwischen sah meine Handschrift wahrlich anders aus. Auf, ermahnte ich mich, nicht faul sein! Du musst eine Geschichte finden! Doch das war tatsächlich nicht so einfach. Zwar war meine Schrift gut lesbar und alle Einträge waren datiert, doch ich konnte mich nicht erinnern, in welchem Jahr ich durch Rumänien gereist war. So blieb mir nichts übrig, als eine Kladde nach der anderen zu durchblättern, um einen Anhaltspunkt zu finden. Den Gedanken, dass die Sammlung möglicherweise nicht vollständig war und vielleicht gerade die Kladde mit der gesuchten Geschichte fehlen könnte, wollte ich gar nicht erst aufkommen lassen. Immer wieder blieb ich an einzelnen Seiten hängen; Geschichten aus Turkmenistan und Weißrussland, aus Syrien, aus Marokko, aus Litauen und von der Seidenstraße buhlten um meine Aufmerksamkeit und versuchten, mich in ihren Bann zu ziehen. Später, später, mahnte ich mich selbst, das kann ich alles später lesen. Nun war ich nur auf eine Geschichte aus, doch ich durchblätterte eine Kladde nach der anderen, ohne fündig zu werden. Dann schließlich, in der sechsten Kladde, fand ich wonach ich gesucht hatte. Der Eintrag vom 15. Januar 1949 lautete:
„Gestern musste ich hier in einem Ort namens Brocric oder Bruchrich einen Stopp einlegen, da durch Sturmschäden die Bahngleise unpassierbar wurden. Bis tief in die Nacht saß ich mit dem Lokomotivführer, dem Bahnwärter und einem seiner Freunde zusammen und musste viel zu viel von einem abscheulichen Schnaps trinken und fettige Wurst essen, wovon mir heute Morgen schrecklich übel war. Eine Alte aus dem Dorf hat mir heute dann eine Art Tee zubereitet, der sehr bitter schmeckte, aber tatsächlich rasch geholfen hat. Auch meine Kopfschmerzen sind dadurch fast gänzlich verschwunden. Das ist gut, denn noch vor einer Stunde hätte ich es nicht vermocht, auch nur eine Zeile niederzuschreiben, und dabei wollte ich unbedingt eine denkwürdige Geschichte zu Papier bringen, die der Bahnwärter und sein Freund mir gestern Nacht erzählt hatte. Ich hatte mir bereits gestern Nacht Notizen dazu gemacht, doch als sie sahen, dass ich mir ihre Geschichte aufschrieb, reagierten die beiden sonst sehr freundlichen Männer gänzlich ungehalten, rissen die entsprechenden Seiten aus meinem Notizbuch und verbrannten sie sofort.“
Tatsächlich waren zwei oder drei Seiten vor diesem Eintrag offenbar aus der Kladde gerissen worden. Ich blätterte um und las weiter:
„Das hier ist also die Geschichte, die mir die beiden gestern Nacht erzählten. Von einem weiß ich nur den Vornamen (Ovidiu), sein Alter schätze ich auf ungefähr sechzig, der Bahnwärter wird nicht viel jünger sein. Besonders der erste, Ovidiu, bekreuzigte sich ungezählte Male, während er mir die Geschichte vortrug, und schwor mehrmals bei der heiligen Jungfrau und allen Heiligen, das sich alles genau so zugetragen habe. Ich versuche sie hier in seinen Worten wiederzugeben, so gut ich mich daran erinnere:
„Das, was ich dir jetzt erzähl, hat sich vor drei Jahren zugetragen, und ich schwör bei der heiligen Mutter Gottes, dass alles genau so passiert ist! Ich bin auf den Markt gegangen, ich geh oft auf den Markt, und an dem Tag bin ich also wieder auf den Markt gegangen. Und ich kenn jeden auf dem Markt, ich geh oft da hin. Aber an dem Tag war da ein neuer Marktstand mit einem Mädchen, einer jungen Frau, hübsch war die, unglaublich schön, eine Schönheit! Sie war nicht von hier, das hab ich gleich gesehen, sonst hätt ich sie gekannt, die wär mir aufgefallen, so schön wie die war. Gar nicht wie ein Bauernmädchen, viel hübscher. Und an ihrem Stand, an ihrem Marktstand, da hat sie ein kleines Gatter gehabt, da war eine Sau drin und eine Gans, aber was für eine Sau und eine Gans! So eine prächtige Sau hast du noch nie gesehen, und ich auch nicht, und ich züchte Sauen, immer schon, aber so eine prächtige Sau hab ich meinen Lebtag nicht gesehen. Und die Gans genauso, die war groß und fett, eine prächtige Gans! Da hab ich zu dem Mädchen gesagt, verkauf mir die Sau, mit der kann ich züchten, aber sie hat gesagt, die Sau kann ich dir nicht verkaufen, aber ich verkauf dir was zum Füttern, das mischst du unters Futter und dann werden deine Sauen so fett wie meine! Das hab ich gemacht und hab ihr das abgekauft, ein Beutel war das mit einem Pulver, das soll ich den Sauen ins Futter mischen, so hat sie’s mir gesagt. Das hab ich ihr abgekauft und bin damit nach Hause und hab’s den Sauen unters Futter gemischt, weißt du, und dann haben sie’s gefressen. Und die ersten Tage, da ging’s den Sauen prächtig, richtig aufgeblüht sind die und haben Gewicht zugelegt, da hab ich gedacht, das wirkt richtig gut, das Pulver, aber was das genau war, das hab ich nicht gewusst. Aber als ich dann am siebten Tag zu den Sauen in den Stall bin, da lagen alle am Boden, alle tot, nicht eine war noch am Leben. Da hab ich nach dem Mädchen gesucht als ich das nächste Mal auf den Markt bin, da hab ich geschaut, wo ich sie finde, und sie stand wieder am selben Platz mit ihrer Sau und der Gans. Und ich war ordentlich zornig, weißt du, mir waren alle Sauen weggestorben, was hätt ich denn da machen sollen, also bin ich zu ihr hin und hab ihr gesagt was mit meinen Sauen passiert ist. Ordentlich wütend war ich, als ich zu ihr hin bin, aber wie sie mich angeschaut hat, bei allen Heiligen, da war meine Wut wie weggeblasen, das war ganz eigenartig, die hat einen angeschaut, da konntest du ihr nicht böse sein. Und sie hat gesagt, dass das auf keinen Fall an ihrem Futter liegen könnt, dass mir die Sauen weggestorben seien, sie tät ja ihren Sauen das selbe füttern und ich würd doch sehen, wie gut es denen ging. Und das hab ich ja auch gesehen, dass es denen gut ging. Das sei bestimmt eine Krankheit gewesen, hat sie mir gesagt, und da könnte das Futter auch nichts dran machen, dann sei das halt so. Aber ob ich keine Gänse hätte, hat sie mich dann gefragt, und ob ich nicht möcht, dass meine Gänse genauso gut wachsen wie ihre. Und ich hab ihre Gans angeschaut und die sah prächtig aus, eine prächtige Gans. Da hat sie gesagt, auch dafür kann sie mir was fürs Futter verkaufen, und das soll ich den Gänsen ins Futter tun, dann würden meine Gänse bald so gut aussehen wie ihre. Ich hab ihr geglaubt, dass das mit den toten Sauen nicht an ihrem Futter hat liegen können, weil ihrer Sau ging’s ja gut, deshalb hab ich dann das Futter für die Gänse von ihr gekauft, das war wieder so ein Pulver. Und es war wieder dasselbe wie bei den Sauen: Erst ging’s den Gänsen prächtig, und am siebten Tag hat keine mehr gelebt. Da war ich völlig verzweifelt, weil jetzt hatte ich keine Sauen und keine Gänse mehr. Ich wollt wieder hin zu dem Mädchen, zu der jungen Frau, und ich hab den Schulmeister dazu gefragt, was er davon hält und hab ihm alles erzählt. Der Schulmeister, das war ein kluger Mann, der war schon alt und der wusste viel. Letztes Jahr ist er gestorben, Gott hab ihn selig. Der hat zu mir gesagt, Ovidiu, hat er gesagt, da ist was Unnatürliches im Spiel, das ist nicht geheuer, und dass ich da gut auf mich aufpassen sollte, hat er gesagt, dass mir selbst nichts zustößt. Und dann hat er gesagt, ich soll wieder auf den Markt zu dem Mädchen hin und mit ihr reden, aber nichts von ihr kaufen, und er würd sich in der Nähe verstecken und alles beobachten, damit er einschreiten könnt, wenn was passieren würd. Und so haben wir’s dann auch gemacht. Ich bin wieder auf den Markt und hab das Mädchen, die junge Frau, gleich wieder gefunden und der Schulmeister hat sich hinter einer großen Regentonne versteckt und alles beobachtet. Und wieder war’s wie beim Mal davor, kaum war ich zu ihr getreten und wollt sie zur Rede stellen, da war mein Zorn weg und ich hab ihr alles geglaubt, was sie erzählt hat, und dass die toten Gänse nichts mit ihr und ihrem Pulver zu tun hätten. Und dann hat sie mir erzählt, sie hätt ein drittes Pulver, wenn ich mir das in den Wein mischen würd, dann würd ich dreißig Jahr jünger aussehen, und gesund halten würd’s einen dazu noch. Ihr eigener Vater würd das auch trinken und die Leut würden allweil denken, er sei ihr Bruder, so jung und stattlich würde der aussehen, und sie selbst würd das auch nehmen, und sie sei doch wohl nicht hässlich, und das hat ja auch gestimmt. Und dann sagte sie mir, wenn ich das nehmen würd, dann würd ich bald so stattlich aussehen, dass ich mir eine reiche Witwe angeln könnt, dann bräucht ich eh keine Sauen und Gänse mehr und bräucht auch nicht mehr zu arbeiten.
Und der Schulmeister hatte sich alles aus seinem Versteck angesehen gehabt und mitgehört, und das war auch gut, denn der hat gesehen, dass rund um den Stand des Mädchens ein Kreis gezogen war und in dem Kreis waren Zeichen in die Erde geritzt gewesen, das waren wohl Hexenzeichen. Mir war das nicht aufgefallen, aber der Schulmeister hat das gesehen. Und noch was hat er gesehen, weil er nämlich von den Lippen lesen konnte, und da ist ihm aufgefallen, dass das, was er gehört hat, gar nicht das war, was das Mädchen tatsächlich gesagt hat. Als sie mir nämlich gesagt hat, dass mich das Pulver jung und gesund machen würd, da haben ihre Lippen tatsächlich gesagt: Das bringt dich um und du wirst qualvoll sterben wie deine Sauen und deine Gänse. Da haben sich mir alle Nackenhaare aufgestellt, als der Schulmeister mir das später erzählt hat. Jedenfalls ist er aus seinem Versteck hervorgesprungen und hat dabei die Regentonne umgestoßen, und das Wasser aus der Tonne ist über den Boden gelaufen und hat den Kreis und die Zeichen fort gespült. Und kaum waren die Zeichen am Boden fortgespült, da hat sich die schöne Frau verwandelt, und ich schwöre bei der Mutter Gottes, das ist wirklich so passiert! Sie ist geschrumpft, gut um die Hälfte, und statt der schönen blonden Haare hatte sie moosbewachsenes, graues, strähniges Haar, ihre glatte Haut sah plötzlich aus wie altes, schimmliges Leder und ihr Gesicht war abscheulich, halb verfault, mit schwarzen Augen wie Kohlestücke, und sie hat gekeift und gefaucht wie eine Katze und ist wie ein Tier auf allen Vieren vom Markt gerannt, aus dem Dorf und in den Wald hinein. Und in ihrem Gatter hatte sich die stattliche Sau in eine Ratte verwandelt und die Gans in eine Krähe, die sind der Hexe hinterher. Das ist alles wirklich so geschehen, das schwör ich bei der heiligen Jungfrau und allen Heiligen!“
An diesem Punkt übernahm der Bahnwärter die Erzählung:
„Das war das Hexenmädchen, die Fata Vrajitoare, die geht seit langer Zeit um bei uns im Dorf, aber bevor Ovidiu ihr begegnet ist, war es lange ruhig. Seither ist es wieder schlimmer geworden.
Die Hexe war früher ein Mädchen, ein besonders hübsches Mädchen, sie arbeitete als Magd bei einem Bauern hier im Dorf, da war sie wohl so 14 Jahre alt, fast noch ein Kind. Das muss wohl schon drei-, vierhundert Jahre her sein, so genau weiß das keiner mehr. Und der Bauer, also der hat ihr wohl Gewalt angetan, immer wieder, und da ist das Mädchen zu seinen Eltern gegangen und zum Pfarrer und hat ihnen gesagt, was passiert ist und hat um Hilfe gebeten, aber keiner hat ihr geglaubt oder hat’s wahrhaben wollen. Und alle haben sie weggeschickt und ihr gesagt, sie soll nicht so dreckige Geschichten über den Bauern erzählen und sie soll dankbar sein, dass er ihr Arbeit gibt. Eines Tages, es heißt, da hätte sie gerade das Gatter von den Schweinen repariert, da hat er sich ihr wieder genähert, und sie hatte gerade einen Hammer in der Hand, um das Gatter zu richten. Wahrscheinlich hat sie ihn gar nicht mit Absicht erschlagen, wahrscheinlich hat sie sich vor Schreck rumgedreht und ihn dabei mit dem Hammer am Kopf erwischt, als er von hinten nach ihr gegriffen hat. Jedenfalls war er tot und das Mädchen ist angeklagt und verurteilt worden, und oben am alten Richtplatz hat man sie dann erhängt. Die ganze Zeit, so erzählt man sich, hätte sie geweint und ihre Unschuld beteuert und um Gnade gefleht, bis sie ihr dann die Schlinge um den Hals gelegt hatten. Da hat sie verstanden, dass es keine Hoffnung mehr gab, und da soll sie am Galgen alle verflucht haben, das ganze Dorf und alle Bewohner, die weggeschaut und ihr nicht geholfen hätten und sie nun zu Unrecht richten würden, obwohl jeder wusste, was der Bauer für einer war.
Nachdem sie dann tot war, haben die Dörfler sie vom Galgen genommen, und eigentlich hätte man sie auf dem Friedhof beisetzen müssen, aber das haben sie sich nicht getraut, wegen dem Fluch. Vielleicht wollten sie auch nicht beim Gang auf den Friedhof immer dran erinnert werden, dass sie ihr Unrecht getan hatten. Darum haben sie sie im Wald verscharrt, aber das war ein großer Fehler, denn sie haben sie nicht mit dem Kopf nach unten begraben, damit sie im Grab bleibt. Deshalb ist sie ein Strigoi geworden, ein Wiedergänger, und ist aus ihrem Grab aufgestiegen und hat das Dorf heimgesucht, wie sie’s gesagt hat, und hat das Vieh getötet, die Menschen krank gemacht und gemacht, dass das Wetter die Ernte verdirbt. Das ist bis heute so; wenn im Nachbarort die Sonne scheint, ist bei uns Hagel und wenn’s im Dorf zwei Meilen weiter regnet, fällt bei uns kein Tropfen. Das macht alles das Hexenmädchen, das ist wirklich so! Ja, dann haben die Dorfleute damals schon gesagt, man muss sie halt wieder ausgraben und umdrehen, mit dem Gesicht nach unten, oder das Herz heraus nehmen oder einen Pfahl rein treiben, damit sie im Grab bleibt, aber keiner konnte sich mehr dran erinnern, wo sie sie verscharrt hatten. Bis heute hat keiner das Grab des Hexenmädchens gefunden, und deshalb können wir nichts gegen sie tun. Vielleicht denkst du jetzt, warum ziehen dann die Leute nicht fort von hier, und viele haben das auch gemacht. Aber das Hexenmädchen lässt keinen gehen, wer auch immer das Dorf verlassen hat, ist bald drauf krank geworden, gestorben oder hat ein schlimmes Unglück erfahren. Schreibst du das alles auf? Du darfst das nicht aufschreiben, man darf ihren Namen nicht aufschreiben, sonst ruft man sie!““
Damit endete der Eintrag. Der nächste Eintrag in der Kladde war bereits eine Woche später datiert, als ich im Hafen von Mangalia am Schwarzen Meer ein Schiff bestieg.
Ich blickte auf. Ich hatte, ohne es zu bemerken, die ganze Nacht auf dem Dachboden verbracht. Mich fröstelte und ich rieb mir die Arme, schmiegte mich in den alten Militärmantel, um mich ein wenig zu wärmen. Durch eine kleine Dachgaube drang zögerlich ein sanftes Licht, der Morgen dämmerte, die Sonne ging auf, der Schneesturm schien sich gelegt zu haben.
Die Kladde hatte ich wieder geschlossen und blickte nachdenklich auf ihren stockfleckigen Umschlag. Nun wusste ich also, was mich an der Zeitungsnotiz gefesselt hatte; war vielleicht doch etwas dran an der Geschichte vom Hexenmädchen? War sie verantwortlich für das Viehsterben, von dem die Zeitung berichtete? Hat sie immer noch nicht ihren Frieden gefunden, übt sie immer noch Rache an den Menschen von Brucricj? Oder war es reiner Zufall, dass gerade in diesem Ort eine Tierepidemie ausgebrochen war, dass gerade dort im selben Jahr ungewöhnliche Wetterphänomene die Ernte verdorben hatten, hatte all das ganz natürliche Ursachen, ohne jegliche Hexerei und übernatürliche Auslöser?
Ich blätterte durch die Kladden, durch die Geschichten, die mir die Menschen in all diesen Ländern erzählt hatten; von Geistern und Dämonen, von Heiligen, von seltsamen Visionen und von Wundern … Als junger Mann war all das für mich kurzweilige Unterhaltung gewesen, amüsante Anekdoten. Nun überlegte ich mir; wie viel davon war Fantasie? Was davon war womöglich real? Nachdenklich stieg ich die Holztreppe hinab und schloss die Dachluke über mir. „Es gibt vielleicht doch mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, Horatio“, murmelte ich zu mir selbst, „als unsere Schulweisheit sich träumen lässt …“
Der Waldmann und die Vogelscheuche
„Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal den Wald verlassen habe“, sagte der Waldmann.
„Es ist lange her, dass du mich besucht hast“, antwortete die Vogelscheuche.
„Ja, das ist lange her. Ich sollte öfters herkommen, es ist schön hier.“
Es war noch früh am Morgen und der Waldmann saß neben der Vogelscheuche im Feld auf dem Hügel, von dem man ins Tal und auf das Dorf blicken konnte. Er spürte die ersten Strahlen der Frühlingssonne auf seinem kurzen, schwarzen Fell, das seinen ganzen Körper bedeckte, und fühlte im Nacken die Kühle des Waldes, der an das Feld angrenzte. Mit seinen Krallen puhlte er sich zwischen den scharfen Reißzähnen.
„Ich war mir nicht sicher, ob du überhaupt noch hier sein würdest.“
„Wo sollte ich denn hin?“, fragte die Vogelscheuche lachend, „Du weißt doch, wie lange ich schon hier bin.“
„Es ändert sich alles so schnell inzwischen ... und so viele von uns sind nicht mehr hier. Da kann man sich nicht sicher sein“, sagte der Waldmann, während er auf das Dorf starrte. Dann wandte er sich an die Vogelscheuche, die starr neben ihm stand: „Und außerdem ist es ja auch wirklich nicht so, dass du hier angebunden wärst. Gehst du immer noch nachts umher?“
Die Vogelscheuche rührte sich nicht, lediglich ein leichter Windhauch wehte ab und zu durch ihr löchriges, rot kariertes Hemd.
„In den dunkelsten Nächten, ja, wenn der Mond nicht zu sehen ist, ja dann gehe ich manchmal hinunter ins Dorf ... ich schaue in ihre Fenster, sehe ihnen bei ihrem Leben zu ... Es ist so seltsam.“
„Was meinst du, was ist seltsam? Ihr Leben?“
„Ja ... sie verstehen es nicht. Sie tun alles so zielstrebig, als wüssten sie genau was sie tun, dabei halten sie sich nur mit Belanglosigkeiten auf. Manchmal gehe ich auch auf ihren Friedhof und höre den Toten zu ...“
„Du kannst mit ihren Toten sprechen? Das wusste ich nicht“, sagte der Waldmann.
„Nicht direkt sprechen ... aber ich höre sie. Und ich höre immer dasselbe. Sie alle haben das Leben nicht verstanden, während sie noch auf Erden wandelten, nicht einer von ihnen. Sie haben es erst begriffen, als sie auf der anderen Seite waren.“
„Das ist tragisch“, sagte der Waldmann, „aber was ist so schwer daran zu verstehen? Jeder Schmetterling, jedes Eichhörnchen versteht es doch.“
„Ich glaube, sie machen sich einfach zu viele Gedanken um alle möglichen Nichtigkeiten“, sinnierte die Vogelscheuche, „und dabei übersehen sie das, worauf es ankommt. Ja, ich denke, das ist ihr Problem.“ Der Waldmann zupfte sich einen Halm und stocherte damit zwischen seinen Zähnen.
Stunden vergingen, während sie schweigend zusammen ins Tal blickten.
„Sie glauben übrigens immer noch, dass du kleine Kinder holst“, unterbrach schließlich die Vogelscheuche die Stille.
„Das hab ich noch nie gemacht“, erwiderte der Waldmann und wedelte mit seinem linken Wolfsohr eine Fliege weg. „Mein Großvater hat einmal eines geholt, das ist viele hundert Jahre her ... es war in diesem Winter, in dem der Schnee so hoch lag, dass er alles bedeckte und man kein Aas im Wald finden konnte. Da hat ihn der Hunger ins Dorf getrieben und er hat sich ein Menschenkind geholt, das am Tag zuvor an den Blattern gestorben war.“