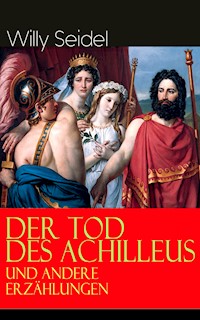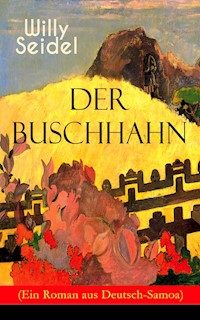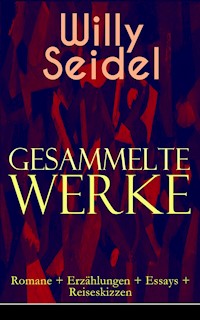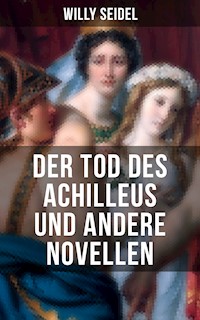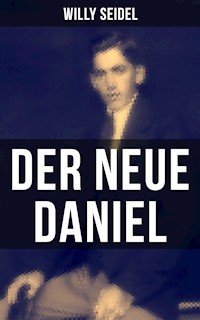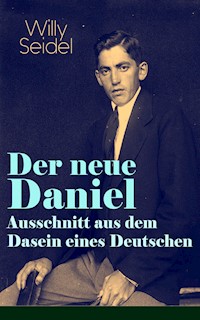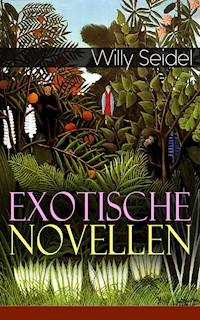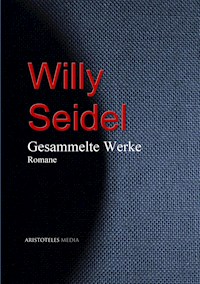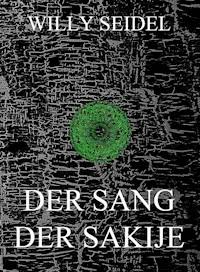4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den Zwanzigerjahren beschäftigte sich Seidel intensiv mit okkultem Gedankengut, demgegenüber er allerdings stets eine gewisse Distanz bewahrte. Daraus entstanden seine Gruselgeschichten, von denen hier exemplarisch einige veröffentlicht werden. So finden sich hier die Erzählungen Alarm im Jenseits und Licht in der Finsternis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 698
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Gruselerzählungen 1
Willy Seidel
Licht in der Finsternis
e-book 7
Gruselerzählungen 1
Willy Seidel - Licht in der Finsternis
Erscheinungstermin 01.10.2025
© Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
Titelbild: Archiv Andromeda
Vertrieb neobook
Herausgeber
Erik Schreiber
Gruselerzählungen 1
Willy Seidel
Licht in der Finsternis
Alarm im Jenseits
I
Im Bankenviertel gibt es eine vornehme Seitenstraße, und in dieser steht eingeklemmt ein Haus, das wohl um 1800 herum entstanden ist. Es hat eine Fünffensterfront nach Norden. Es ist sehr reserviert, dies Haus. Vom 1. Stock ab ist es stilrein; unten jedoch gähnt ein mit Firmenschildern gepflasterter Toreingang zu einem Hinterhof, wo es nach Hotelküchenmüll und Benzin duftet, denn dort hat sich die Filiale einer Auto- und Motorradfabrik eingenistet. So ist das Haus im Erdgeschoss eine Hölle von Gerüchen und Geräuschen. Sein Bauch ist geschändet: durchtobt von neuzeitlichem Geknatter und dem Eilmarsch kolonnenhaft hindurchströmender Bureaufiguren, die es einsaugt und ausspeit ... Klettert man aber im Hof die schmale Treppe zum ersten Stock hinauf, so versinkt das alles hinter einem wie ein wüster Traum. Man sieht eine vergitterte Glastür und daran Spaß beiseite einen Klingelzug. Man setzt ihn in Bewegung. Es scheppert umständlich in eine Stille hinein, in der es von Anno 1800 gemunkelt hat noch Sekunden, bevor du kamst. Diese hundertdreiundzwanzigjährige Stille hält erschrocken den Atem an und gebiert dann, wenn du Glück hast, in entlegener Ferne so etwas wie einen schlürfenden Schritt, der näher und näher kommt ... Ein Schatten erscheint hinter dem Milchglas, ein verkrümmtes Skelett; spärliche Regsamkeit raschelt an klirrenden Riegeln, und unter dürrem Hüsteln entpuppt sich ein von fünfundsiebzig Lenzen belastetes Frauenzimmer und sieht dich aus wässrig blauen Hundeaugen schier vorwurfsvoll an ...
Das ist die alte Afra, ein mit Isarwasser getauftes, vom Glück von jeher gemiedenes Wesen. Sie schnupft auf und sucht das Geräusch, das dabei entsteht, mit ihrer lachsfarben verbrühten Hand abzudämpfen. Sie merkt, dass sie die Resonanz nur verstärkt, und senkt die vernarbte Hand in die Schürzenfalte. Es ist große Resignation in dieser Geste. Gebeugt steht sie da und glotzt, ohne eine Spur von Neugier. Sie hört dein Begehren an mit der stupiden Devotion eines bezahlten Klageweibes, dem Mangel an Beschäftigung die Kehle rosten und das Hirn erschlaffen ließ. Es ist keine Flunkerei: es gibt noch greise Faktota trotz unserer selbstgefälligen Schnelllebigkeit die wie beseelte Möbelstücke wirken, zierlich dastehen in aller Abgewetztheit, und an die man sich lehnen möchte im Gefühl, sie müssten anfangen leise zu knirschen ...
„Ah ...“, sagt sie endlich, und es dämmert ihr, dass sie mich schon einmal erblickt haben müsse. Zum Einheitsbild verschmolzen, kehren in ihren ausgebleichten Augen meine fünf Doppelgänger wieder, die jedes Mal dasselbe Begehren hatten und dieselbe sture Geduld. Ich bin der Herr mit der „Wohnung“.
Ich raffe den ermatteten Rest meiner Energie zusammen und sage, mit dem Zeigefinger das Skelett bedrohend, sehr laut:
„Aber heute ist es mir zu dumm, Fräulein Afra. Heute muss ich endlich Frau Bibescu wegen der Zimmer sprechen.“
Selbst geschwungene Fäuste, fühle ich, in Begleitung eines Tobsuchtsanfalls, würden keinen Wirbel in dieser bleiernen Atmosphäre auslösen. In ihren bleichen Augen rührt sich nichts; sie betrachtet mich wie ein Einsiedlerkrebs durch die trübe Aquariumsscheibe hindurch, distanziert und dumpf. Genau wie ein solcher kriecht sie auch zurück und spricht entsagungsvoll ihr gewohntes Sprüchlein:
„Ich will schauen, ob die Gnäfrau aufg'standen is ...“
Sie schleicht hinweg, und man hört eine Tür quietschen. Es klingt, als ob man einen kaum geborenen Säugling erwürge ... so leise und jämmerlich. Das Begehren des Herrn „mit der Wohnung“ begegnet dumpfem Gemurmel. In ferner Ecke des Aquariums sitzt ein Pulp in seinem Auslug und wird nun von dem Einsiedlerkrebs durch Betasten zager Organe oder Bruchstücke im Dialekt zögernd informiert ...
Endlich taucht sie wieder auf und trägt ein Lächeln an den Mundkanten. All die behaarten Leberfleckchen lächeln mit. Sie spricht und hält die lachsfarbenen Hände dabei parallel den Schürzenfalten: „Heut ham S' Glück, Herr. Die Gnäfrau is disponiert. Hocken S' Ihnen derweil in 'n Salong. Die Gnäfrau kommt in zehn Minuten ... hat s' g'sagt.“
Auf borstigen Filzschlappschuhen strebt sie in steifer Luftlinie einer Tür zu, in deren Rahmen sie sich aufbaut. Ich begreife die Ermunterung und schreite hinein. Die Tür schließt sich.
Ein prächtiges, ein mächtiges Zimmer ist's, darin ich sitze, schier ein Saal. Es ist Halbdunkel, weil die gelben Damaststores an den zwei Fenstern herabgelassen sind. Ich befinde mich in Gesellschaft großer, trotziger Möbel, deren Schlummer ich störe. Es riecht nach Staub. An der Wand steht ein Gebäude aus Mahagoni, mit Schnörkeln und Schnecken, die Meisterleistung eines Handwerkers, der vor sechzig Jahren blühte. Vor mir als spiegelnde Wüste dehnt sich ein Tisch, an dem zwanzig Gespenster bequem tafeln könnten ohne Besorgnis, sich mit den Ellenbogen zu genieren. Um diesen Tisch gruppieren sich frühviktorianische Stühle, hochlehnig, steif, die schlicht geschweifte Armstützen öffnen. Diese Gruppe ist in das gelbe Dämmerlicht der Stores getaucht und empfängt mich mit Ansprüchen, die leise knacken. Oder gehen diese Geräusche von dem Möbel aus, auf dem ich sitze? Ist es mein Pulsschlag, der die mit geblümter Cretonne überzogene, britisch geräumige Polsterung zum Protest anregt? „Ein Besuch“, denkt das Möbel und wird kritisch. Ich beruhige es, indem ich es streichle. An den Wänden dämmern, halb verwischt durch die Mausoleumsbeleuchtung, Schabstiche, von längst verdorrter Hand in Rosa und Hellblau koloriert: nacktbusige englische Backfische, deren ländliches Gemütsleben durch zerbrochene Krüge und entflogene Piepvögel erschüttert ist und die verschollene Zähren vergießen. Auf anderen Bildern ist ihre Unschuld durch stürmische Herren mit prall sitzenden Wildlederhosen in Frage gestellt. Diese Unschuld klagt in altmodischen Symbolen zu den Wattewölkchen zärtlicher Himmel hinauf. Und immer wieder ist es der gleiche veilchenblaue Augenaufschlag der Hamilton ...
Ich werde ganz versonnen; die „Gnäfrau“ lässt auf sich warten. Endlich klinkt der Messinggriff der hohen weißen Tür, und etwas Dunkles, Feistes rauscht an mir vorüber mit den in österreichischem Akzent geäußerten Worten: „Kleinen Moment, Herr Doktor ... Ich mach' sofort Licht ...“
Sie zerrt an den Schnüren der gelben Stores; das grelle Asphaltlicht des heißen Julimittags dringt ruckweise herein. Unter brüchigem Schnurren vergewaltigt sie den Mechanismus; bald ist der Raum voll trockener Sonne, die von den gegenüberliegenden Fenstern des erzbischöflichen Palais reflektiert wird. Der Glanz erobert sich noch die eine Hälfte der Mahagoniwüste; wir beide bleiben im hellen Dämmer sitzen. Feist und dunkel rauscht sie zurück und bietet sich der Betrachtung dar. Es ist die Üppigkeit einer Odaliske, die zunächst an Frau Bibescu auffällt. Ihr Leib ist von tief violettfarbenem Hausgewand aus Schillersamt umhüllt. Darüber pendelt eine Garnierung von haarsträubend verwahrlosten echten Spitzen; sie quellen überall hervor, es ist ein Reichtum. Der Busen, eine undefinierbare, mattschimmernde Masse, wird vom Hausgewand mild gebändigt, ohne jedoch Einschränkungen zu erliegen. Im Gegenteil: Er kennt keine Grenzen, wie die Liebe.
Die Züge sind regelmäßig wie bei einer augusteischen Gemme; heller Bernstein. Man kennt die Leere, die oft in der Symmetrie „klassischer Antlitze“ haust. Der blasse Mund (oder ist es nur der Teint, der die Lippen blass erscheinen lässt?) zeigt porzellanweiße Zähne in erstarrtem Lächeln. Die fein geschnittene Römernase bläht die Nüstern; lichtziegelrot blitzt es auf, wenn sie in schalkhaften Momenten den Kopf zurückwirft. Diese Nüstern sind das einzige Rege in dem sonst toten Gesicht. Denn die Augen, so grell sie auch rollen unter bläulichen Liderkuppeln, behalten den Ausdruck bei des nicht ganz Bei-der-Sache-Seins, des Zurückspähens in den Osten: animalisch, melancholisch, entlegen ... Niedere, glatte Stirn tritt aus blauschwarzer Frisur, die sich im Nacken zu erstaunlichem Knoten schlingt. Dies Haar ist echt und hat den Glanz von Rabenfedern. An dem Modellierwachs flacher Ohrmuscheln hängt, Blutstropfen gleich, Granatschmuck. Er klirrt leise, sobald der Kopf auf bewegtem Busen ins Schaukeln kommt ...
II
„Sie haben Glück, Herr Doktor. Sie sind der einundzwanzigste Herr, der die Zimmer will. Warum Sie sie wahrscheinlich bekommen, werden Sie erfahren, wenn wir uns ... näher kennen. Sie wer'n es mir zugutehalten, dass ich ein wenig misstrauisch bin, es ist Lindas wegen ... Wer Linda ist? Nun, Linda ist meine Tochter; ein Prachtkind, ein talentiertes ... Ich zeig' sie Ihnen nachher ... Schüchtern ist sie ja. Aber heißes Blut hat sie geerbt von mir; tchaa ...! Ich bin zwar jetzt eine enttäuschte alte Person; aber auch ich war einmal knusprig ...“
„Nun, nun; das kann unmöglich lange her sein!“
Sofort entfährt ihr ein gurrendes Kehlgelächter; licht blitzen die Nüstern. Ich nehme die Wirkung wahr und werde distanzierter. „Handelt es sich um dieses Zimmer hier?“, frage ich.
Sie nimmt Strenge an. „O nein, Herr Doktor. Dieses Zimmer ist ein Sanktum; hier wohnt mein Mann.“
„Aber Sie sind doch verwitwet, gnädige Frau ...“
„Ich bin Witwe und bin es auch nicht, Herr Doktor. Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass es so einen Zustand gibt.“ Sie flüstert, und ihr Gesicht, die Kamee, spiegelt sich verschwommen in der Tischplatte; ihr Zischeln lässt einen matten Hauch darüber huschen. „Hier“, und sie blickt sich um wie ein witternder Falke, mit ruckweisen Profilstößen, „lebt und webt er. Glauben Sie mir, er würde sehr zürnen, wenn so etwas wie ... ein Nachfolger es sich hier bequem machte ... Er ist eifersüchtig!“ spricht sie mit sonorer Altstimme, laut, vernehmlich. Die bläulichen Augäpfel rollen, leises Echo des Wortes bebt nach in verstecktem Klirren alten Porzellans. Es ist, als zucke ein vergrabener Pulsschlag durch den greisen Mahagoniturm des Büfetts. „Er kontrolliert mich! Neulich“ und der mattschimmernde Busen gewinnt, von einem pfeifenden Seufzer gehoben, an Plastik „fand er so viele Worte für seine Entrüstung, dass Linda kaum folgen konnte auf der Schiefertafel. Dabei schreibt sie schnell. Es ist ein Kreuz.“
Ich finde mich sofort zurecht. „Aha“, sage ich. „Dann muss man ihm eben, im selben Tempo, zu verstehen geben, dass er sich, den Teufel auch, verständlicher manifestieren soll. Es ist überhaupt billig, aus dem Jenseits heraus zu schelten. Man bringt die eigenen Argumente so schwierig an. Und versucht man's doch, so verschanzt er sich hinter dem großen Schweigen, wie?“
Sie blickt mich schier entgeistert an. Sie rückt näher herzu, mir wird wieder schwül. Doch sie meint es diesmal nicht so, o nein; sie fühlt sich verstanden und ist fast außer sich darüber.
„Ich hab' mir's gleich gedacht, als ich Ihre Dichterstirne sah, Herr Doktor“, murmelt sie hingerissen, „dass da ein Mensch gekommen sei, ein seltener, der meine ganz schaurig-schöne Situation begreift ... Ihnen sag' ich alles, und was wird sich erst Linda freuen, das Kind, das zutrauliche ... Also hören Sie. Mein Mann schmeißt mit Invektiven, das stimmt. Lediglich weil ich einen Freund hab'. Denken Sie, und ganz platonisch. Ein alter Herr, nah an Siebzig! Bitt' Sie, ist das ein Grund für meinen Mann? So ein bisserl ist der alte Herr ja noch zärtlich; aber was kann da weiter herausspringen, bei siebzig Jahr'! Nur ein paar Ausdrücke hat er, wissen Sie, wie ein Kind, wenn es was möcht' ... und diese Ausdrücke: da könnt' ich tiefsinnig werden! Die hat er von meinem Mann! ›Ganz mein Mann‹, sag' ich dann zu ihm! Und dann freut er sich, das Dummerl, und ist ganz zufrieden ... Vorkommen tut nie etwas, weil ich treu bin, und es fällt mir nicht schwer ... Aber es scheint, dass der Jenseitige kein Urteil hat. Eine beschlagene Brille, sozusagen. Er glaubt einfach, er wird betrogen, und dann schimpft er ohne Sinn und Verstand ...“ Sie tupft sich die Augen mit dem Taschentuch.
„Nun ja“, meine ich. „In diesem Fall haben Sie's aber doch leicht. Warum sagen Sie nicht einfach zu Linda: ›Leg' die Schreibtafel weg!‹? Dann ist er doch gestraft! Dann ist ihm der einzige Weg abgeschnitten, auf dem er sich bemerkbar machen kann ...“
Sie starrt mich an, schier atemlos. Nichts rührt sich in der Kamee ihres Gesichts. Sie sieht drein wie ein hellenistisches Mumienporträt. Der Mund steht halb offen, wie gelähmt. Übermäßig viel neue Ideen (fühle ich) gibt es nicht in diesem Hause; und die meine war sehr neu. Endlich dringt es ihr geflüstert aus der Kehle, hilflos bestürzt und halb fragend:
„Aber ich bitt' Sie: Ich darf ihm doch den Rapport nicht erschweren ...?“
Dies ist irgendwie sehr rührend. Mein Zynismus verraucht wie Fleckwasser. Es ist toll: eine Frau, die einem Phantom die Treue hält! Eine Bukarester Odaliske, die ihre Erotik knebelt, um einen Geist nicht zu verkürzen! Die ganz listig zu Werk geht, damit er, an dem sie alles zu messen fortfährt, nichts erfahre und auf spukhafte Weise, mittels automatischer Schrift, seinen Unmut lüfte! Dies alles ist so dunkel, dass ich mich aufs Warten verlege. Vielleicht, und ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, zielt das tolle Garn, das sie spinnt, doch auf mich; vielleicht will sie Eindruck machen. ›Bin ich nicht begehrenswert, wenn man sich noch im Jenseits darüber aufregt, dass ich einen platonischen Ersatz mir suche für das verschollene Handfeste? Blassen Ersatz für feurig Legitimes? Ich soll Linda die Tafel wegnehmen, soll mich der Brücke berauben?‹ So ähnlich, fühle ich, läuft ihr Gedankengang. Auf einmal beugt sie sich wieder vor und sagt verschmitzt lächelnd wie ein ungezogenes Kind: „Sie haben ja recht, Herr Doktor. Strafe muss sein, und ab und zu krieg' ich auch einen Zorn und lass ihn einen ganzen Tag nicht heran an die Tafel. Wenn er ganz besonders deutlich gewesen ist. Dann hat er zwei Tage Zeit, sich sein Benehmen zu überlegen. Was er dann schreibt, ist eitel Sirup und Zucker. Bonbons krieg' ich zu lutschen und entschuldigen tut er sich ellenlang, so dass die Tafel nicht ausreicht und Linda von vorn wieder anfangen muss zu wischen, das gute Kind, das geduldige. Aber eigentlich überläuft's mich.“ Sie seufzt pfeifend und der Schillersamt schlägt Wellen, „Wenn er recht tobt. Eifersucht beweist Liebe. Allzu viel Schmeichelei geht mir auch auf die Nerven. Deshalb verzeih' ich ihm schnell, nur damit er wieder keck wird und Temperament zeigt. Davon leb' ich.“
„Wie lange schon, gnädige Frau? Ich meine, wie lange ist es her, dass ... ehem ...“
„Dass er in den anderen Zustand eingetreten ist? Sechs Jahr', Herr Doktor; aber so springlebendig ist Ihnen der Mann, dass er sich ungeschwächt weiter manifestiert ... ›Du brauchst mich, Pamela‹, so heiß' ich nämlich, ›als Witwentrost‹ ruft er ... Wissen S', ich bin nämlich unpraktisch veranlagt, weil meine Stärke die Empfindung ist und weniger das Rechnen; und so gibt er mir Tipps. Mein Freund, der Baron Meerveldt ach du Gütiger, jetz' ist mir der Name doch ausgekommen; aber Sie sind ja diskret, Herr Doktor, mit Ihrem Dichterköpfchen, Ihrem feing'schnittnen also der Baron sagt mir zwar oft, die Tipps vom Seligen taugen nichts; ist aber halt schon nah an Siebzig! So halt' ich mich zum goldenen Mittelweg und nehm' vom Baron ein bisserl und vom Seligen ein bisserl und richt' mich halt ein mit dem Gerstel und mit der Wohnung, die was mein Kapital ist ... Auch Lindas wegen muss ich das schon, das Kind darf nichts entbehren ... Nicht schlecht geschimpft hat mein Seliger, dass ich mir Mieter nehmen muss. Fallt ihm doch der Baron schon schwer, der hinten am Gang haust. ›Nimm dir eine alte reiche Frau hinein,‹ hat er gerufen, ›die was sich zurückziehen will von der Welt und pünktlich zahlt.‹ Ich wer' doch kein Kloster machen aus meiner Klause. ›Nein‹, hab' ich trotzig geschrieben, und Linda hat's dreimal dick unterstrichen. O mein Gott, was war da der Mann bös'. Eine ganze Woche hat die Verstimmung gedauert. Aber beruhigen Sie sich, Herr Doktor.“ Sie lächelt mich schmelzend an und legt mir, weiß Gott, die mollig-schlanken, von bunten synthetischen Steinen beladenen Finger auf das zuckende Knie. „Sein S' nur ganz ruhig. Sie kriegen die Zimmer. Sie schon! Ich steh' Ihnen gut dafür!!“
Hier endet das erstaunliche Gespräch, denn ich finde es an der Zeit, mich umzusehen, wo und wie ich mich einzurichten habe.
III
Die mir zugedachten Räume liegen neben dem geschilderten Empfangssalon. Sie bestehen aus einem schlauchartigen Saal mit zwei Straßenfenstern. Vorn ist er bei Sonnenschein also mäßig hell und hinten, am Korridoreingang, mystisch dunkel. Ist trübes Wetter, so versagt der Reflex der südlich liegenden konvexen Scheibenquadrate des erzbischöflichen Palais, und der ganze Schlauch liegt in fröstelndem Kellerlicht. Das Schlafzimmer ist eine lächerliche Kammer, ein Anhang nur, gänzlich verbaut: ein abgestumpftes Dreieck. Die dicke Mauer lässt es trotz des hohen französischen Fensters wie eine Gefängniszelle wirken. Immerhin herrscht in diesen Räumen eine versunkene, entrückte Pracht, beispiellos taub gegen unsere schnelllebige Zeit.
In beiden Räumen hängen Kronleuchter aus reifenförmig gereihtem Tropfglas, das oben und unten durch facettierte Kugeln abgelöst wird. Sie hängen als massive, funkelnde Drohungen über meinem Schädel, wenn ich mich darunter stelle. Sie sind verstaubt und voll Fliegendreck; knipst man sie abends an, so geben sie ein transparentes Licht, das jede Ecke des Gemaches gleichmäßig mit trübem Gold bestreut. Es ist, als habe Herr Bibescu den gesamten Hausrat eines Kasinos aufgekauft aus den Zeiten, da die Queen seufzend in ihren Pompadour greifen musste, um die ersten Eskapaden ihres Sohnes zu begleichen. Trotz ihres vierzigjährigen Aussehens herbergen die Möbel jedoch jene Bequemlichkeit, die dem Briten von jeher eignete. Ein Teetisch auf silbernen Rädchen steht kokett innerhalb fünf kranzartig gruppierter, fetter Klubsessel. Sie sind mit gelbem Samt überzogen und abgeschabt; immerhin federn sie noch mächtig; beansprucht, schnaufen und quietschen sie wie eine entschlummerte Tafelrunde beleibter Greise. An der mit zitronenfarbiger Tapete bezogenen endlosen Wand brüstet sich, gleich einem spendierfreudigen Gastgeber diskret zurückgerutscht, doch nicht minder mächtig das Sofa. Es allein schon ist ein Hohn auf die Wohnungsnot, bietet es doch einer ganzen Familie Platz, sich ungeniert darauf fortzupflanzen oder in Frieden zu sterben. An den drei Fenstern hängen dieselben Damaststores wie nebenan. In der Ecke, nächst der Tür, steht ein zylindrischer weißer Biedermeierofen, mit Messingreifen geschmückt. Damit ist die Aufzählung erschöpft; das ist das “möblierte Zimmer“. Was mir sonst noch fehlt (und das ist so ziemlich das Wesentliche) habe ich selber zu beschaffen. Ich besitze Mobiliar für drei normale Zimmer, gottseidank. Aber schon jetzt fühle ich: dieser unverschämte Saal wird es schlucken und kaltstellen, zur Bagatelle verdammen.
Das Schlafzimmer enthält Bett und Waschkommode. Für einen Kleiderschrank ist kein Platz. Bei Dunkelheit ist es Turnerei und Eiertanz, ins Bett zu finden. Aber mit den zwölf Glühbirnchen hat man die Direktive, wenn man auch in der verschwenderischen Lichterpracht unwillkürlich auf Lakaien rechnet, denen man Unterhosen und Strümpfe zuwerfen könnte ... Die Lakaien bleiben aus ...
In der ersten Nacht kann ich nicht einschlafen und stehe im Saal. Da liegt nun mein Hausrat, Füllsel eines großen Möbelwagens, auf dem spiegelblanken Parkett. Noch ist es eine einzige Wirrnis: aus einer Barrikade vertrauter Schränke, Truhen, Kommoden wächst ein Berg von Büchern, einem erstarrten Erdrutsch ähnelnd. Die fünf beleibten Sessel, provisorisch weggeräumt, stehen an die Wand gedrückt in gerader Reihe. Dort mokieren sie sich, das ist klar; bilden eine Abwehrphalanx gegen das eingedrungene Neue aber ihr werdet euch schon vertragen und einen Kompromiss eingehen! Die erste Brücke zwischen euch baut der Lüster ...
Ja, der Lüster! Da hängt dieser protzige Lichterberg, doch nicht in einer Theaterkuppel über Hunderten von Köpfen. Nein: er hängt nur über dem Gedächtnis von Puderzöpfen, Perücken, Haarbeuteln und Scheiteln, die sich seit hundertdreiundzwanzig Jahren unter ihm geregt; diese geistern noch durch den knapp zwei Meter tiefen Luftzwischenraum, der ihn vom Parkett trennt. Dieses gibt den Glanz als verschwommenen Schimmer zurück.
Die Damaststores sind vorgezogen, es ist tiefste Nacht, jener kälteste Moment des Lebens zwischen halb drei und halb vier; ich stehe unter meinen Büchern; tot blinken die Deckel, hieroglyphenhaft die wohlbekannten Titel. Intimstes steht oder liegt da, nackt und vereinsamt unter der Bestrahlung. Zuweilen webt ein Knistern durch den Raum: die aufeinander geschachtelten Bücherbretter zirpen einander die Frage zu: „Ist dies endlich die letzte Station?“ Ich wandle in Pumps umher; das Geräusch meines zagen Schleichens hallt marschschrittmäßig von den Wänden wider. Endlich begreife ich's: Die Uhr muss hervor, muss strammstehen; Dienst tun. Sie muss die einhundertdreiundzwanzig Jahre fortspinnen, emsig verlängern; sonst stagniert hier alles, und ich sinke samt all diesen Gegenständen in die Zeit zurück wie in Triebsand.
Ich zerre das Möbel unter den anderen hervor. Es ist eine schmucklose Standuhr aus Birkenmaser; sie hat eine tiefe Gongstimme, wie ein Familienarzt. Den Teufel: als ich sie in die Ecke gepflanzt, Pendel und Gewichte eingehängt habe und nun den Schlüssel einsetze, schnurrt sie bockig und haucht mit widerlichem Gerassel ihren Geist aus. Keine Gongstimme spricht mir melodische Beruhigung zu und mahnt mich sanft an mein allmähliches Verbröckeln, sondern mit hemmungslos umherwirbelnden Zeigern krepiert sie mir vor der Nase, als habe ihr die Atmosphäre die Kehle eingedrückt. Das Geschnarr schlägt brutal in die Stille. Schwer erschrocken höre ich das Geräusch abebben und versickern. Man will hier keine Zeit. In der ganzen Umgebung nistet die Zeitlosigkeit und streckt ihre Schattenfaust zu mir herein ...
Mit einem misstrauischen Blick auf die Uhr, die ihren alten Beruf dort weiter zu heucheln scheint, ziehe ich mich, von plötzlichem Frösteln gepackt, zurück. Ich knipse den Saallüster aus und gewinne, mit Hilfe eines fadendünnen Lampenstrahls von draußen, den Weg ins Schlafzimmer. Kaum bin ich dem Schacht von Raum entronnen, so spricht es aus der Finsternis hinter mir drein wie ein Kichern. Rührt sich, im Schutz der Schwärze, die Zunge der Dinge? Nervös lausche ich. Dies Haus ist so voll von Ungesagtem ... Hat mich das verrückte Weib angesteckt? Oder diese lebend geisternde Mumie, die Afra? Wieder höre ich das Kichern doch nein, es ist ein halbes Ächzen darin. Ich stelle auch fest, dass es nicht aus dem eben verlassenen Saal kommt, sondern anderswoher. Es kommt aus der Wand hinter dem Kopfende meines Bettes hervor. Nach Untersuchung dieser Wand stelle ich eine Tapetentür fest, geschickt, schier unsichtbar eingefügt, und mache mir klar, dass das Schlaf- und eigentliche Wohnzimmer von Frau Bibescu an das meine grenzt. Offenbar redet sie im Schlummer. Doch halt: es sind zwei Stimmen. Die ihre und eine andere, quäkende. Es ist ein Zwiegespräch, offenbar mit Linda, der Tochter, die ich bis jetzt noch nicht zu Gesicht bekommen habe. Ich muss dies Geräusch hören, ob ich will oder nicht; um wenigstens eine kostenlose Unterhaltung herauszuschlagen, spitze ich das Ohr.
„... no, und wie schaut er denn aus? So red' doch, Mutter!“
„Blond ist er. Blond.“
„Uh jeh! Ich hab' mir schon gedacht, dass du auf einen Blonden fliegst.“
„Mein Kind, deine Ausdrucksweise ist, unter uns gesagt, bisserl ordinär.“ Scharf: „Ich flieg' nicht. Merk' dir das.“
„No ja.“
„Unerhört, von der Mutter zu sagen, ›sie fliegt‹. Der Herr ist nicht unsympathisch. Das ist mein Empfinden. Weiteres findet sich.“
„Wie alt ist er denn beiläufig?“
„Beiläufig no so an dreißig, dreißig-fünf herum ...“
„Drum ...“
„Jetzt gewöhnst dir das blöde ›Drum‹ ab. Überlass das doch der Afra! Er könnt' auch älter sein, solang' er zahlt. Interesse für das Automatische hat er. Wegen Horoskop und Sternzukunft fühl' ich ihm noch auf den Zahn.“
„Du bist ihm natürlich gleich mit Papa ins Gesicht gesprungen, Mutter. Das vertragt doch nicht jeder. Da wird er kopfscheu.“
„Da haust' daneben. Er hat gleich zugegriffen. Vielleicht ist er selbst medial. Hätt'st sehn sollen, wie atemlos interessiert ...“
„Ja was noch. Aus Höflichkeit. Innerlich hat er sich gedacht: ›Jetz' das ist einmal eine spinnige Person, eine zudringliche ...‹“
Ein unmelodisches Aufkreischen im andern Bett: „Was sagst du da wieder! Fratz, unverschämter ...“
Eine heftige Erwiderung, gar nicht mehr in Tuschelform: „Is ja wahr! Ich darf immer an die Türritzen hinhängen! Nie stellst du mich jemand vor! Ich hätt's anders gemacht, gewiss ja! Staad hätt'st sein müssen, Mutter, und schön schweigsam vom Wetter red'n. Gleich herausgekehrt, die Privatgeschichten, und übermorgen zieht er aus. Wirst sehn. Das hab' ich nachher von der ›guten Tochter‹. Ich will auch einmal ein zweibeinig's Mannsbild sehn. Immer der alte Trottel von Baron ...“
Jetzt entsteht ein großes Matratzenknacken und ein Geräusch wie ein Klaps auf etwas Unbekleidetes. Ein Schnaufen klingt auf wie ein Schluchzen, und daraus gebiert sich die mütterliche Stimme, etwas heiser: „Von wem du das nur hast! Die ordinären Ausdrück'. Von mir nicht und vom Papa nicht. Und der hört dich, hört dich! Der ist gegenwärtig hier im Zimmer; schier spür' ich ihn; wie er sich schämen muss in sein' Zwischenzustand, sein' hilflosen, dass er dir keine runterhaun kann!“ Klatsch; kissendumpfes Wimmern oder ersticktes Gelächter? „So ein vornehmer Mann, der Baron Meerveldt! So ein diskreter! Und das gütige Interesse für seine kleine Linda! ›Welch ein interessanter Fall‹ ist sein drittes Wort ... Und was tut der Fratz, der ausgekochte? Nennt ihn einen Trottel! Aber pass auf, du! Pass auf!“
„Ich pass schon auf, Mutter“, erwidert jetzt die weinerliche Stimme. „Aber schau, ich kenn' schon deine Anpreiserei, und wenn die Leute scharf wer'n und was sehn woll'n, sperrst du mich hier ein oder schiebst mich ab in die Kunstakademie ... Ich möcht' anmal an anständigen Akt sehn. In der Akademie ham s' bloß so an dreckigen Lausbub'n. Eine Künstlerin möchtest machen aus mir, und psychopathisch bin ich auch, und da darf ich nix, aber auch gar nix ...“
„Du bist halt zu jung. Wenn er's nicht spannt, darfst schon anmal spitz'n, wenn er sich wascht oder so ... Aber sonst hast mich als Modell, merk' dir das. Und für die Mannsbilder: zu was hast denn nachher den Parthenonfries in dem teuren Kunstbuch da, und die Vasenbilder?“
„Herrschaft ja, Mutter, aber schau: Du bist halt doch bisserl reif schon?! Weißt, die Linie ...“
„Linie?! Aber ich bütte! Dein Papa war ganz narrisch drauf! Und war der kein Künstler; ich bütte!?“
„Ja no ... damals ... du bist halt ein wenig dick wor'n; du hockst zu viel zu Haus ... und mich lasst' mithocken ...“
Pause. Die Entrüstung verschlägt Frau Bibescu anscheinend den Atem. Endlich kommt ihr die Stimme zurück.
„Ihr seid's grausam, ihr Kinder. Hast ja recht. Immerhin: meine Fesseln ... schau her.“
„Ja, die gehn“, spricht die Tochter anerkennend.
„Und das da ... und so ...“
„No ja. “ Die Tochter kichert. „Aber ich kann doch nicht ewig immer dasselbe abmal'n. Mit an Zirkelmaß ging's schneller. Und mit den Porträts von dir hab' ich's auch dick jetzt ...“ Abgrundtief seufzend: „Ich möcht' anmal was anders mal'n!!“
„Nachher stellst dich selbst vor'n Spiegel hin.“
„Aber das geht doch nicht. Man malt dann daneben.“
„Rembrandt hat sich auch selbst hergenommen, wenn er kein entspröchendes Modell zur Hand g'habt hat ...“
„Und was hat er gemalen? Immer nur sein' alten Schnauzbart. Mit Barett und Helm ...“
„Du musst deine Bewegung erwischen. Schau her, so!“ Das Parkett knarrt leise. Offenbar hat Frau Bibescu das Bett verlassen. Eine Weile entsteht Schweigen während dieser Pantomime. Ein leises, triumphierendes, von leichtem Asthma behindertes Zischeln: „Schau, das hat dein Papa auch so gern g'habt. In diesem Augenblick hat er mir zugeschaut; ich fühl's. Bisserl Schwung hat deine Mutter noch, wie? Fünfzig Jahr', ich bitt' dich! Noch ganz elastisch, wie, für eine alte Frau? Das kopierst einfach vor'm Spiegel, mein Kind; und nachher fängst das Bild aus'm Gedächtnis ein und malst es hin mit dem Bleistift. Wenn man so eine Figur hat ... Und ein bisserl Ridmus ...“
Offenbar versuchte es nun auch die Tochter. Das Schweigen wird dann unterbrochen durch ihren prustenden Ausruf:
„Meinst wirklich, Mutter ... so geht's?“
„Wart', ich hol' dir die Tunika ...“
Eine Erschütterung des Bodens: Frau Bibescu bewegt sich auf die Wand zu, an der ich lausche. Dann höre ich einen leichten Aufschrei, so aus der Nähe mir ins Gesicht, dass ich zurückpralle: „Jessas!! die Tür ist offen.“ Es raschelt kurz hinter der Tapetentür; dann schnappt drinnen eine zweite Klinke ein, und jedes Geräusch von drüben wird erstickt wie mit Watte. Die Garderobe der Damen, entdeckte ich somit, ist in die Wand eingebaut; steht sie nach innen offen, dann hört man alles. Ob sie heute Nacht durch Zufall offen stand, wage ich nicht zu entscheiden. Ich habe das starke Bedürfnis nach einem Schnaps. Drüben geht das Gespräch als ganz entferntes, kaum hörbares Murmeln weiter, dann versinkt es in die sausende Stille, die ein herzhafter Schluck Martell in meinem Kopf erzeugt. Eine Lässigkeit ergreift Besitz von mir. Durch den Hintergrund dieser zerrinnenden Empfindung spukt es von blassen Gliedern, von nackten, schwellenden Hüften, von östlicher Buntheit und großer Verachtung für Zeit. Denn wo ist da noch ein Zeitbegriff, wenn man sich mitten in der Nacht, in rabenschwarzer Stille, tuschelnd und kindlich-lüstern unterhält mit Gesprächsbrocken, die gewöhnlich nur mittags gedeihen? Mit Vorstellungsfetzen, die gemeinhin nur dann plastisch werden, wenn grelle Sonne ihr Flammengitter, durch Jalousien hindurch, auf seidene Kissen zeichnet?
IV
Ich erwache ein wenig verdutzt. Ein großes Schnurren, Rumoren und Poltern geschieht kaum drei Meter unter mir. Das ist das zwanzigste Jahrhundert mit seinem scheußlich grellen Menschenaufwasch und seinen vier- bis vierzehnpferdigen Motorrädern, die unten auf der Straße, gerade unter der „Flucht meiner Fenster“, von Jünglingen in Golfhosen begutachtet werden. Zuweilen klemmt sich einer im Jockeisitz auf ein metallenes Biest, das Gestank und Krach von sich spritzt, und schnurrt ab. Aufatmend denkt man: Gottlob, einer weniger, dann kommt er schon wieder um die Ecke herumgefegt und füllt die „stille Seitenstraße“ von neuem mit Detonationen. Es hört sich an wie ein frisch-fröhliches Konzert fabrikneuer Maschinengewehre. Man streichelt die Tiere, stochert in ihnen herum, gibt ihnen Ölinjektionen und lässt sie dann, zur Abwechslung, leer laufen. Ich stehe in Pyjamas in einem der französischen Fenster, und der Ritz der halbgeöffneten Damastportiere blendet mich. Die bauchigen Scheiben Seiner Eminenz von drüben beschießen mich mit funkelnden Lanzen. Vom Asphalt spült eine Welle von Benzin- und Teergeruch herauf. Wo habe ich doch schon solchen Lärm gehört, solche Gerüche gespürt? Ua, schammâm!! Zieht ein geisterleises Gebrüll vorüber mit Hitze und orientalischer Sonne ... Haremsweiber ... Melonen ... Aha, das Frühstück. Ein schönes Melonenfrühstück ...
Es klirrt hinter mir. Welch neckische Telepathie! Ich schnelle herum: da steht die alte Afra vollkommen ratlos mitten in dem unaufgeräumten Möbelkram, wie eine Sibylle zwischen Trümmern, und hält in ihren hölzernen Händen ein Tablett wie eine Opfergabe. Zuweilen schnupft sie auf, dann beben die Hände, dann gibt es das silberne Glöckchenspiel. Ihre ausgebleichten Augen fangen meinen Blick auf; ihre Oberlippe, von grauen Härchen geschmückt, wie eine Kellerwand von Schimmelfädchen, zieht sich in langsamem Grinsen auseinander. All die Leberfleckchen und Daunenwarzen geraten in trägen Fluss. Und dann entringt sich ihrem verdorrten Brustkasten folgende morgendliche Begrüßung, heiser und monoton:
„Dreimal waar i scho' herin g'wen, Herr Dokta; un' jetz' woaß i imma no net, wo i dees Zoigs hitoa sui ...“
„Danke schön, Afra. Hätten Sie's halt auf den Teetisch gestellt.“
Sie dreht sich stumm nach Nordnordwest.
„Am Dätisch?“
„Ja freilich. Der ist doch wie gemacht dafür.“
„Drum“, spricht sie befriedigt. Ein mystisches Wort. Sie folgt der Suggestion und ladet alles fein säuberlich, mit viel Vorsicht in den Knochenfingern, darauf ab. Ich raffe einen Klubsessel heran und mache mich ans Schmausen: zwar keine Melonen, aber ein Ei mit Semmeln und sehr dünnem Kaffee. Sie steht stockstill, die Hände parallel den Schürzenfalten, wie ein Grenadier. Ich fühle, dass sie einiges auf dem Herzen hat; dass sie reden will. Sie räuspert sich mehrmals und schnupft auf, wobei sie mich wohlwollend betrachtet. Ich blicke sie fragend an; das alte Wesen fühlt nun die Zunge gelöst.
„I hamas scho denkt, dass Sie am Dätisch ees'n wuin“, bekennt sie mit knarrendem, nun etwas höherem Organ. „Drum hob' i ›drum‹ g'sagt.“ Sie meckert und schnalzt an den Stockzähnen. Mit dem Daumen über die Schulter: „Raama S' heit no ei?“
„Ja freilich, Afra; ich räume heute noch ein. Den Dienstmann hole ich mir gleich nachher.“
„Am Promenadenplatz is oana; da Zacherl. Den kunnten S' glei braucha.“
„So, so. Danke.“
„I hol' Eana 'n Zacherl. I muaß eh umi zem Eihol'n.“
Pause. Sie ist ohne Zweifel angeregt. Ein neuer Mieter!
„Na, nehmen Sie schon Platz, Afra. Ich hoffe, wir vertragen uns gut.“
Das alte Wesen lässt sich auf der Kante eines entfernteren Sessels nieder, mit mädchenhaftem Zieren, voll verschollener Gesten. Sie fährt mit den Händen an ihrem schwarzen Kammgarnfähnchen herab, als sei es ein bauschiger Faltenrock von Anno Eins. „Hom S' guat g'schlaffa, Herr Dokta?“
„Nicht besonders.“
„Dees glaab' i scho', Herr Dokta.“ Etwas wie Verschmitztheit erwacht in den ausgebleichten Augen. „Dees wer'n S' no oft erlem, doß die zwoa an Krach mach'n bei der Nacht. D' Linda is a Luda; de is ganz spinnat. Mondsucht hot's, hoaßt's; und die Gnäfrau is aa net vüi besa.“
„So, so. Ich bin mit den Damen noch nicht näher bekannt.“
„Dees derf'n S' g'wiß glaam, Herr Dokta, dos i net hetz'n wui. Oba i moan halt, es ko nix schad'n, wann i Sie a biserl vorbereit'. Damit S' net erschreg'n. De zwoa san ganz narret. I waar scho längst weg von den Plotz. I find' oba nixen mehr; i bi an olta Pason un' ko' den Deanst grad' no dakraft'n. Die Gnäfrau is Eana a ganz a Scharfe. De lost ka Mannsbild net so leicht aus, des wo si eifonga lasst. A so g'schwuin redt's' daher. Un' oziag'n tuat sie si zum Reißausnema. Und tean tuat's nixn den liaben, langen Dog; nur bei der Nacht werd's munta ...“
Sie schnappt den Mund zu, verschließt ihn hermetisch und blickt mich sanft erwartungsvoll an. Ich beschließe, eine durchaus neutrale Haltung einzunehmen. Da beugt sie sich vor und flüstert schärfer:
„A Skandal is. Net amal katholisch san die. San Sie katholisch, Herr Dokta?“
Ich bin protestantisch getauft, will ihr jedoch die Enttäuschung nicht bereiten, dass sie einem Ketzer gegenübersitzt. So sage ich denn:
„Ich bin ein Christ.“
„Dees is a no was“, sagt sie zaghaft, doch tolerant. „Aber de Gnäfrau is a Jüdin! Jawui!“ Sie schwillt vor Begeisterung über diese Erkenntnis, die ihr offenbar gelegentlich selber gelungen. „Jud'n san dees! Un' ganz schlimme! Orderdax oder wia ma's hoaßt! Wo's herkema, woas ka Mensch! De sperr'n si ei mit da Schreibtafa un' ruaf'n an Geist! Ganz hoamli, ganz staad! D' Linda, dees Luada, schreibt Botschaft'n auf, und de Gnäfrau kriagt Mordskrämpf, weil's fest glaabt an den Schmarr'n!! I hob's mein Kaplan g'sagt, ›Hochwürd'n,‹ sag' i, ›de zwoa zaabr'n da herin und do muaß i zuschaug'n! ‹ Sag' i. Sagt a: ›Afra,‹ hat'r g'sagt, ›do muaßt di net kümmern drum,‹ sagt a, ›unser Herrgott lasst si net oschaug'n weg'n zwoa spinnete Weibsbild'r‹, sagt a. ›Mir is ja a gleich,‹ sag' i, ›bal's ma nur mein Glaam net vaderb'n. Aba muaß dees sei, doß de Jud'n ...‹ ›Psch,‹ sagt a, ›do koscht nix mach'n, Afra. Gibt halt solchene Leit', de wo ums Verreck'n net krischtkatholisch wer'n wuin‹, sagt a; ›sie haben ihren Lohn dahin.‹ Aba, wie g'sagt, mir is gleich, und Eana ko ja a nix pasir'n als an gebülten Menschen ... I hob's Eana nur vazält, dass S' im Büld san ... Und wos mit der Bibescu i'rm erschten Mo is, den wo s' allwei' zitiert ...“
Weiter kommt die Gute nicht. Denn es klopft sehr spitz und dringend (wer hätte jenen molligen Fingern solche Eindringlichkeit zugetraut!) und ohne mein „Herein“ abzuwarten, füllt Frau Bibescu den Rahmen der Tür aus.
Ihr Antlitz blickt hoheitsvoll. Und sich an Afra wendend, die schnell in die Höhe geht, spricht sie scharf akzentuiert: „Also hier find' ich Sie, Afra ...“ Ihr Blick ist gar nicht gemütlich; der Satz atmet sich nicht so recht aus und bleibt, von schneidendem Fragezeichen belastet, als Damoklesschwert in der Luft hängen. Die Alte strebt denn auch, steif, auf ihren borstigen Filzschlappschuhen der Tür zu; sie murmelt etwas von „in Rua los'n“ und „gar so eilig“, und Frau Bibescu lässt sie passieren wie der Alte Fritz die Veteranenparade.
Hierauf schließt sich die Tür, und ich bin wieder mit dem wogenden Schillersamt allein, der sanfte Wellen schlägt und auf mich zuschwimmt wie ein seltenes Meeresgeschöpf, rar von Farbe und gefallsüchtig. Strotzend von Huld, quellenden Sirup in jeder Pore, lässt sie sich auf dem von Afra soeben verlassenen Sessel nieder; nicht auf der Kante nur wie jene, sondern sie schmiegt Mächtig-Sphärisches in Wohlig-Ausgebuchtetes, geht mit dem Sessel restlose Vermählung, ja: Verlötung ein, so dass ich mir die Mühe einer Loslösung mit womöglich dabei geschaffenen schelmischen Komplikationen schon schaudernd im Voraus ausmale. Da heißt es kein „Gestatten Sie?“ oder „Störe ich?“; nein, sie sitzt; und sie wird nach menschlichem Ermessen auch noch sitzen, wenn der Dienstmann Zacherl kommt ... Mit zwei Fingern stützt sie die Stirn, jeder Zoll hingegossene „Bedeutung“. Ein Lächeln, offenlippig und inhaltslos, jeder Verheißung voll, die eine schläfrige Phantasie stellen mag, bleibt auf dem klassischen Antlitz stehen. Und dann spricht sie mit tiefem Blick aus den leuchtend schwarzen Augen, so halb von unten herauf, mit einem Senkblick voll tastender Suggestion: „Na? ... Gut geschlummert an fremdem Ort, Herr Doktor?“
O Gott, denke ich. Nun, ich muss mich zusammennehmen und auf den Kitsch eingehen; vielleicht finden sich später Mittel und Wege ...
„Ausgezeichnet“, sage ich also mit fröhlicher, morgenfrischer Stimme. „Sie auch, gnädige Frau?“
Ihr Blick scheint an einem imaginären Senkblei zu zupfen; er wird leicht forschend; dann kommt es etwas zögernd: „Nun, es tut sich ... Ich als enttäuschte, alte Frau schlaf schlecht, und dann kommt noch, wissen Sie, dazu, dass Linda zuweilen an Phobie leidet, an Kinderschreck, sagt der Arzt ... Sie schmunzeln, Herr Doktor, aber auch schlafwandeln tut das Kind ... Phantasie hat sie Ihnen enorm ...“ Ihre Augen irren im Zimmer umher. „No, das schaut aber noch aus hier ... Die Afra holt Ihnen einen Dienstmann ... ich wer's ihr sag'n ... Aber ich will nicht vorgreifen, vielleicht hab'n Sie das schon besprochen mit ihr ...?“ Sie sieht mich blank fragend an. Ich bin überzeugt, sie hat vorhin an der Tür geklebt, und ihre Abgebrühtheit setzt mich in Erstaunen. Ich schweige gespannt; ich bin neutral.
Sie hat sich zu ihrem Thema herangewurmt. „Wenn Sie etwas wünschen, Herr Doktor, sag'n Sie's lieber schon gleich mir selbst; die Afra is auch halt nicht mehr die Jüngste, fabulierlustig und ein bisserl blöd, wie sie halt wer'n mit siebzig ...“ Sie gibt drei mokante Pusterchen aus ihren ziegelroten Nüstern von sich. „Abergläubisch ist sie Ihnen und ein wenig schreckhaft, da muss ich sie halt zusammenstauchen von Zeit zu Zeit, dann steht sie wieder stramm ... Ich hab' sie so mehr aus Mitleid bei mir, das alte Mensch; die Inflation ist an ihrem Tiefsinn schuld ... aber schmeiß'n Sie sie nur raus, wann sie Ihnen zuviel wird ...“ Dies kommt stockend, in singend-anheimstellendem Tonfall, hervor. Dabei wandern die schwarzen Augen unablässig. „Bücher, Barmherziger, Bücher ... Gelt, ich leih' mir was aus ...“ Plötzlich lüstern: „Hab'n Sie beiläufig was ... Okkultes?“
„Auch das, gnädige Frau.“
„Scharmant, bitt' Sie, scharmant ...“ Pause. Dann wie nebenbei: „Sie hat Ihnen gewiß erzählt, dass ich Jüdin bin?“
Ich verschlucke mich und kämpfe mit einem Hustenanfall. „Das brauche ich mir von niemandem erzählen zu lassen, gnädige Frau. Zudem bin ich absolut vorurteilslos.“
„Mit Ihr'm Köpferl, Ihr'm blonden ...“ (Oh nein, protestiert mein Magennerv!) „Ist ja wahr, Sie schau'n nicht aus wie ein Feuerfresser ... Lieb schaun Sie aus ... und ein feingebildeter Mann sind Sie auch ... Natürlich bin ich mosaisch, erzmosaisch ...“ Hier kommt Haltung in sie. Es ist erstaunlich: das Molluskenhafte ihres Wesens strafft sich; sie wird Mrs. Siddons; die kommende Eröffnung steift diese quellende Masse empor wie gerinnender Gips ... „Wissen Sie, dass man bei mir zu Haus in Bukarest noch Portugiesisch redet, noch die Sprache des Camôes? Wissen Sie, dass ich vom Stamme der reinrassigen Sephardim bin? Uralter Adel, ich bitt' Sie! hätt' sonst mein Mann die hunderttausend Porträts gemacht von mir? Wissen Sie, dass der Mann sich Ihnen nachmittagelang hier hineingehockt hat ins Nordlicht und mein Profil studiert und meine Händ' und meine Füß' mit Schuhnummer 34?! Pamela, stell' dich einmal so hin, sagt er, dass ich das erwischen kann, und das ... In der Nationalgalerie, da häng' ich dutzendweis'! Gelt, da staunen Sie ... so ein Buchgelehrter ... Durch und durch kannte mich der Mann, und deshalb lebt er noch ...“
›Toll‹, so geht meine wirrwerdende Überlegung. ›Jetzt erscheint der Gemahl wieder am Horizont. Was tu' ich nur, um's Himmels willen ...‹ Laut sage ich: „Ja, es muss ihm schwer geworden sein, zu scheiden.“
„Schwer ist kein Ausdruck“, erwiderte die tragische Maske. „Offne Wundflächen werden das, wenn so verschweißte Seelen auseinanderreißen ...“ Das Keuchen der Macbeth spielt wie schwüler Wind über die Bühne. Und während ich noch schier betäubt verharre, von ihrer aggressiven Geste vor den Kopf geschlagen, ich armes Publikum, wechselt die Tonart ins Scherzo hinüber. Gurrend beginnt sie zu verhandeln. Der Mietpreis (in Devisen, ich bitte Sie!) die Sicherstellung für Abnutzung der Möbel, Garantien, Trinkgelderfragen, und „wenn Damen heraufkommen, nur Qualität, und nur unter Tags“, Kündigungsfrist und das ganze öde Tausenderlei ... Sie beherrscht die Materie, das muss man ihr lassen. Wochen voll intensiver Überlegung müssen vorangegangen sein. Bis auf Heller und Pfennig bis auf Naturkatastrophen und Putsche Gott in Ehren, stellt sie sich sicher. Wer kann die Mauer einrennen, die sie um sich baut! Und das Resultat ist schließlich meine ächzende Zustimmung und schweißtriefende Mithilfe bei der Zangengeburt eines Kontraktes, der mich mit Haut und Haaren in ihre Hände liefert. Wer kann auch dieser öligen Suada und diesem Geschütz von „Wenns“ und „Abers“ unbeschadet widerstehen! Eine volle Stunde raufen wir uns herum. Dann klopft es massiv. Der Dienstmann Zacherl erscheint.
V
Nun habe ich mich endlich eingerichtet.
Die Uhr ist repariert und teilt mir aus der Ecke mit sonorer Altstimme, auch ungefragt, die Zeit mit. Sie sagt es vorsichtig, um niemanden zu verletzen. Denn jünger wird man nicht. Und die Zeit rauscht ...
Ich habe nun die ganze Etage erforscht und weiß, woran ich bin. Nie noch gab es in Mitteleuropa ein Gelass gleich diesem. Vorn zwei Säle, was sage ich: Hallen! Diesen beigeordnet meine Schlafzelle und das durch die Garderobe zwischen Tapetentüren davon abgetrennte Schlaf-, Wohn- und Spintisiergemach dieser erstaunlichen Frauen ... Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, einen Blick hineinzuwerfen, ebenso wenig wie mir der Anblick Lindas, des begabten Wesens, annoch zuteil geworden ist. Man hört sie wohl, im Gang, im Treppenflur; man hört eine quäkende, blutarme Stimme, die imstande ist, sich durch die meterdicken Wände hindurchzuschrauben ... einen Korkzieher von einer Stimme, der vom Rost der Alltäglichkeit knarzt. Einmal bin ich auch draußen auf der Wendeltreppe fast über einen Kobold gestolpert. Er hat sich, leise zischend, verflüchtigt. Das kann sie unmöglich gewesen sein.
Ich hege allerhand romantische Ideen in Bezug auf Linda. Eine sechzehnjährige Ausgabe der Mutter: à la bonheur! Da muss etwas daran sein! Orientalisch, was denn, und rassig-grazil! Eine eifersüchtig verborgen gehaltene Perle! Rehschlank; massiv, wo es sich gehört; von allen Rüchlein Arabiens umwittert! No! Vom Stamm der Sephardim ein Reis, Jasminblüte aus Bukarest!
Was sagt mir die Stimme! Was bedeutet schon der Klang einer Stimme! Sie ist halt erkältet, sagt mir mein Herz, und auch von Kummer bedrückt. Suggestiv und hysterisch; was bei andern ihres Alters normale Backfischlaunen sind, wächst bei ihr ins Extrem. Ein Medium, mit geheimnisvollen Kräften begabt, eine vibrierende Nervenbrücke zur andern Welt! Welche Sensation! Ein Instrument für eine geisterhafte Energie, um darauf zu spielen; eine bebende Klaviatur für den heißgeliebten Vater, der nicht rasten will!
Im Allgemeinen denke ich nur beim Kaffee oder abends an Linda. Im Grunde genommen ist meine Neugier weder akut noch aktiv; sie ist eine milde Würze des halben Traumdaseins, das ich führe, und besteht eher aus einer sanften Erwartung. Sie ist verteufelt geschickt darin, sich nie sehn zu lassen. Zweimal habe ich inzwischen versucht, die alte Afra auszuholen. Sie hat auch bereitwillig zur Information angesetzt, war gerade dabei, ihren Sermon abzubeten nach einem vielversprechenden Auftakt von ungefähr folgenden Worten: „D' Linda! Ja mei! Wissen S', Herr Dokta, i wui net hez'n; oba doß d' Linda a Luda is, a ganz an ausg'schamts, des derf'n S' g'wiß glaam. D' Linda ...“ Weiter kam sie leider nicht, denn jedes Mal wurde sie in diesem Moment „dringend“ von Frau Bibescu „benötigt“ und verschwand murmelnd, mit hölzernen Abwehrbewegungen der vernarbten Hände ... Das Mysterium vertieft sich und glimmt wie Zunder in mir fort.
Ich begann dies Kapitel mit einer Schilderung der Wohnung. Stellt man sich in den Korridor, so entdeckt man noch eine Glastür. Sie gehört zu einem Alkoven von etwa zwei Meter im Geviert, der dem großen Empfangssalon, „dem Zimmer Herrn Bibescus“, dem nie benutzten kühl-prächtigen Raum, als Garderobe scheinbar angegliedert war. Jetzt ist das Räumchen Rumpelkammer tollster Art; vollgepfropft mit Möbeln, Matratzen, Bildern; besonders hervorstechend sind halb verwischte Kohleakte, zerknüllt zwischen Mintonporzellan und verdorrten Fächerpalmen ... Überall winken die schwarzen Augen der Gattin herab; zahllos sind die fetten Schultern und uferlosen Hüften, darüber sie neckisch oder melancholisch schimmern. Herr Bibescu hat viel Kohle zerpulvert, um dies sein Lieblingsthema in allen Variationen der Nachwelt zu erhalten. Welch ein Gedanke, das Original dieser orgienhaften Skizzen lebend und höchst lebendig! in nächster Nähe, Tür an Tür, zu wissen! Mir durch nichts vorenthalten als durch dreieinhalb Millimeter schäbigen Schillersamts! Doch die Entsagung wird mir erleichtert durch die Erwägung, dass auch der beste Jahrgang einmal firn wird ...
Vom Korridor aus, nach Süden, geht es ins Ungewisse. Denn ein endloser Gang beginnt, doppelt so lang schier als eine rechtschaffene Kegelbahn. Er wird durch Glasfenster vom Hof aus beleuchtet. An seiner Innenseite liegen zwei Kammern, die nur indirektes Licht erhalten. Nach diesen Kammern kommt ein Gemach, darin Afra haust und in einem Behälter aus schwärzlichem, zerbeultem Blech plätschernd hantiert. Das Ding erinnert der Form nach an eine Badewanne. Dann kommt die „Gelegenheit“, ein finsterer, bedrückender, ängstlicher Ort, und an diese schließt sich, last and least, die Küche an. Hier speisen die drei Weiblichkeiten zu Mittag und zu Abend, höre ich; vermutlich sind das die Momente des Tages, wo Frau Bibescu den Magen siegen lässt über ihr aristokratisches Empfinden und Stuhl an Stuhl mit dem Volke schmaust. Oder vielleicht soll das Volk kontrolliert werden, wie viel es schmaust, auf dass man es zügeln könne ...
Wäre ich mein Leser, so hätte ich mich schon bass darüber gewundert, dass der Baron in dieser Geschichte noch nicht aufgetaucht ist. Ich, als Berichterstatter, weiß es besser: er ist unpässlich, würde sich aber nach Genesung ein Vergnügen daraus machen, dem neuen Mitmieter vorgestellt zu werden. Gazevorhänge vor den beiden erwähnten Kammern am Gang verhüllen das Krankenlager. Wann er sich lüftet, ist mir unerfindlich. Abends, wenn ich eine gelegentliche Pilgerschaft, einen Ausflug nach Süden, unternehmen muss, beleuchtet er sich mit sanfter Ampel. Von all diesen menschlichen Amphibien ist er entschieden das lautloseste. Alles, was ich entdecke, ist ein Schattenriss, aus dem eine Hakennase springt. Zuweilen räuspert er sich bellend; mit Trompetenstößen schnäuzt er sich. Sonst hört und sieht man nichts von ihm ...
Dies ist die Situation, dies die Bühne; und was ich nun schildern will, bringt Katastrophe und Lösung. Denn all dies Ungelöste verlangt irgendwie nach einer Explosion, nach einem Windstoß, der diesen zauberisch-boshaften Sumpf mit seinen lemurenhaften Bewohnern, zeitlosen Möbeln und halben Menschen von Grund aus aufpeitscht und in die grelle Beleuchtung des heutigen Tages zerrt ...
Es sind ungefähr zwei Wochen seit meinem Einzug verflossen, und ich habe mich an das Milieu gewöhnt. All diese Unwahrscheinlichkeiten sind mir jetzt bekannt; renne ich gegen sie an, so deute ich sozusagen nicht einmal mehr nach der Hutkrempe, sage nicht mehr „Pardon!“, sondern springe sachlich und etwas unwirsch mit ihnen um. Ich soll jedoch gewahr werden, dass dies alles erst die Oberfläche ist. Denn die alte Afra passt die Gelegenheit ab und gräbt dann ein erstklassiges Skelett aus.
Das ereignet sich so: Ich stehe wieder einmal am Fenster; es ist Samstagmorgen gegen acht Uhr. Da kommen, offenbar aus unserm Hause, zwei Gegenstände ins Rollen: zwei Paradiesvögel von seltener Farbenpracht ... Ich blicke steil auf sie herab. Nein, es sind keine ausgestopften Erstaunlichkeiten; ihre Fortbewegung ist nicht mechanisch. Sie wandeln watschelnd. Sie überqueren die Straße. Ich kann sie von hinten sehen: ein junges und ein älteres Exemplar. Beiden eigentümlich sind sehr deutliche Schaukelbewegungen der unteren Partie. Beide tragen sie große Hüte aus rieselnden Straußenfedern und sackähnliche Seidengewänder. Der Eindruck des Exotischen entsteht dadurch, dass hier der Mutter Natur nachgeholfen, dass sie triumphierend übertrumpft wird durch die Zusammenstellung der Farben: Giftgrün schmiegt sich in Rosa, Karmin schreit auf unter Violett, und was sich an Bändern, Rosetten und Schleifchen dazwischen genistet hat, ist unsagbar mannigfach. Gerade als ich mir klarmache, dass das jüngere Exemplar, zart keimende Form der Mutter, niemand anders sein könne als Linda, schnappen zwei Sonnenschirme auf, blendende, feuerfarbene Räder, und entziehen mir den Anblick zur Hälfte. Vier winzige Schnallenschuhe, weit auseinandergesetzt, tasten darunter weiter wie die Füße von vorsichtig sondierenden Insekten; dann wallen die beiden Seidengewänder um die Ecke, dann erlischt das Phänomen ...
Ich starre noch eine Zeitlang entgeistert auf die leere Straße, die noch soeben Schauplatz eines Märchens war. Das Wunder kroch mir unter der Nase weg, das zeitlose Wunder. Es entstand in einer neuzeitlichen, von Motoren durchschnurrten Gegend, begab sich auf den Asphalt des zwanzigsten Jahrhunderts ... Da klinkt hinter mir die Tür, und die alte Afra ist im Zimmer. Sie ist sehr weit weg. Aber die Etage gehört ihr; sie baut sich dort auf; sie spürt Genugtuung. Meine Aufmerksamkeit durch nochmaliges Aufschnupfen in ihre Richtung lenkend, spricht sie knarrend:
„Brauchen S' wos, Herr Dokta?“
„Nein, danke, Afra ...“
„Drum. Weil S' net g'litten ham.“ Sie fühlt wohl, dass ihre Anwesenheit einer handfesteren Erklärung bedarf. Sie blickt listig auf und schnalzt an den Stockzähnen. „De zwoa san weg!“
„Ja, ich habe sie eben fortgehen sehen.“
„Ham S' as g'sehn? So! Muaß ma net grad nauslacha, wie de zwoa auftaggelt san ...?“
„Etwas eigenartig gekleidet, das stimmt.“
„Dees moan i aa“, spricht sie kichernd. Sie ist bis zur Mitte des Zimmers gediehen. „Derf i mi hihocka zu Eana?“
„Ja, bitte, Afra, nehmen Sie nur Platz.“
„So. Heunt ko s' mi net nausjag'n, weil s' net do is. Jetz' ko i Eana was vazäh'n vom erschten Mo von der. Ham S' des kloane Kammerl scho g'sehn, Herr Dokta? Des wo am Korridor draust is?“
„Die kleine Rumpelkammer? Der Alkoven?“
„Den moan i. A halbs Johr is her, do hot a si drin affg'hängt.“
„Aufgehängt ...?“
„Der Herr Bibescu. Jawui. Des hätt'n S' Eana net tramma loss'n, gelten S', Herr Dokta!“ Sie flüstert heiser und rutscht näher. „Wia–r–i nei-kimm zum Afframma, steht a hint' im Eck. ›Wia is jetz' dees,‹ sog i, ›Herr Bibescu? Suchan S' wos?‹ sog i. Sogt a nixen un schaugt un schaugt, un i nix wia naus. Wia s' an naustea ham, war a scho' blau. Un sie de hot Eana an Deaader g'spuit, net zum Sag'n. G'schrian hot s' wia–r–a Rooß. Ganz Staad un hoamli is a herganga un hot si affg'hängt. Jetz' da schaung S', gelten S', Herr Dokta?“ Sie kneift den Mund triumphierend zu, und ihre ausgebleichten Augen haben einen warmen Funken. Herr Bibescu tut ihr leid, sicherlich; aber die ganze schauerliche Tatsache wird von einer milden, unausrottbar soliden Schadenfreude überglänzt. Ich muss hinter den Grund kommen.
„Ja, aber, Afra, das ist doch sehr tragisch!“
„Für eam scho“, pflichtet die Sibylle bei. „Bal si oana affhängt, is scho dragisch für eam. Oba er hot scho g'wißt, wia–r–a si rächa ko; des Weibsbüld hot' an neig'hezt in Schuld'n und Schuld'n, grod grauslich, grod doß sie si Kleider kaffa ko un' Barrfengs vo Baris un' irene Liebhob'r imponir'n ko damit, un' mishond'lt hot s' ean un auszog'n aff's Hemmad, un grod nur zol'n hat'r derfa un' zuschaug'n, wia sie's triem hot ... Jetz' nacha hot s' nixen mehr g'hobt, un aus d'r Wohnung hätt'n s' as aa 'nausschmeiß'n wuin, is oba net ganga, weil da Baron eig'sprungen is ...
Der Baron wissen S', Herr Dokta is aa–r–a Spiritist. An olter Oasiedl'r un' Jungg'sell, der zolt d' Mieten jetzat un'n Lämsund'rholt, sinst kinnten s' gornet egsesdir'n, de zwoa. Wos Sie selm zol'n, Herr Dokta, dees zol'n S' draaf, g'wiß wohr. Den ham de zwoa eig'fongt, un bol s' a Sizung ham, de zwoa, und'rholt er si aa mit'n Herrn Bibescu. Z'erscht“ das alte Wesen meckert „ham sie si owoi zakriegt, oba jetzat san s' Spezeln ...“
Ich verfalle unwillkürlich in ihre Ausdrucksweise, und es entfährt mir in wasserklarem Hochdeutsch:
„Ja, was wäre denn nachher jetzt dieses!“
Ich schlage mir kopfschüttelnd aufs Knie, irgendwie angesteckt von der leeren Verschmitztheit, die in ihren ausgebleichten Augen lauert: angesteckt mit einer hoffnungslos übermächtigen Lust, nachzugeben und gegen mein besseres Selbst ein wenig zu meckern ... „So, Herr Dokta,“ spricht sie plötzlich salbungsvoll, gleichsam bekümmert über meine Frivolität ... „jetz' muss i eihol'n ... G'wiß wohr, gelten S', da schaug'n S', doß solchene Sach'n gibt ... da derfat mo' scho' grod Obacht gäm, doß mo' koan Schad'n nimmt am Glaam ... oba de glaam fest dro, doß'r no hier ischt als Geischt ... do kunnt' m'r schier irr wer'n ... Gelten S', Herr Dokta, Sie sag'n nixen zu dera Pason, doß i Eana wos vazält hob', wia des zugeganga–r–is, doß a si afig'hängt hot ...“ In ihrer Miene drückt sich plötzlich Unruhe und ein Schatten sklavischer Bestürzung aus; ihre Augen, milchigblau, drehen sich nach den dämmrigen Zimmerecken hin. „I kunnt' mein Posten valier'n ...“
„Seien Sie ganz ruhig, Afra“, spreche ich mit wiedergewonnener Würde. „Ich lasse mir nichts anmerken.“
„Is scho recht“, sagt sie und trollt ab, mit hölzernem Händeschwenken ...
In der Nacht, die diesem Tag folgt, habe ich ein schauriges Erlebnis. Mir ist, als wache ich auf. Es muss gegen vier Uhr sein. Es herrscht ein milchig graublaues Licht in der Wohnung, so ein greisenhaft unproduktives Licht, wie von einem Schachtlämpchen im Hades. Die Augen der alten Afra und die dumme Angst vor der Ratte, die nicht sterben will: der Erinnerung. Und woran? An etwas fragwürdig Glaubensfeindliches, Nacktes, durch keine Beichte Wegzuklingelndes ...
Eine perverse Neugier packt mich. „Ich will doch sehen“, sage ich zu mir, „ob das stimmt; das mit ... dem Alkoven.“
Eigentlich fürchte ich mich, gleichzeitig aber treibt es mich magisch, den Schleier wegzureißen, hinter dem dieser psychische Abfallhaufen modert. Ich trete in meinen Saal; überall dieses graublaue Licht. Die Tür zum Korridor steht offen; die ganze Wohnung ist halb hell. „Jetzt herrscht das Odlicht ...“, denke ich schaudernd. „Man weiß nicht, dass ich wach bin.“ Die Zeitlosigkeit des Unbelauschten, jäh in geheimem Wandel Überrumpelten. Plötzlich fängt die Standuhr in der Ecke an zu schnarren, mit hässlichem Laut, und ich sehe die Zeiger abwirbeln, so schnell, dass sie einen Dunst auf dem Zifferblatt erzeugen. Sie haucht eine Kältewelle herüber wie ein Ventilator. Ich wundere mich nicht im Geringsten, dass sich das Phänomen von damals wiederholt; ich umgehe sie nur wie ein verdächtiges Tier.
Und dabei beobachte ich mich selbst, sehe mich gleichsam von außen, was ich tue. Mein Gesicht schimmert papieren. Ich schiebe mich weiter und spähe lauernd in den Korridor: die Tür ... die Alkoventür ...
Sie scheint geschlossen, doch hinter ihrem Milchglas glimmt ein trüber, grünlicher Schimmer, und dieser Phosphorschimmer scheint die Quelle und der Ursprung all dieser seltsam gleichmäßig verteilten Halbhelle zu sein. Ich nähere mich. Da drinnen steht (das weiß ich) Herr Bibescu, mit der Gardinenschnur um den geschwollenen Hals; es ist wie im Kuckucksanschlagspiel. Er ist beileibe nicht tot. Dies sind seine Stunden, wo er Alleinherrscher der Wohnung ist. Er ist höchst lebendig, von Energien geladen; er bändigt die eigene Tatkraft dadurch, dass er sich (ha, jetzt habe ich das Wort!) anhängt! Nicht aufhängt! Meine Haare sträuben sich. Wie, wenn er sich belauscht spürte?! Wenn er sich losmachte? Wenn er hervorstürzte und mich den Gang hinunterjagte, ganz nach hinten, und mich dort stellte und anspränge?
Und es geschieht, geschieht: Es raschelt drinnen. Es poltert im Alkoven: die aufeinandergestapelten Möbel knarren, als ob sich jemand den Weg bahne. Der Schein im Milchglas wird heller ... Schon klirrt das Glas, als tappten blinde Hände nach der Klinke ... Ich schreie auf. Mein eigener Schrei weckt mich auf. Oder war es das schmetternde Räuspern des schlaflosen Barons? ...
Ich stehe in Pyjamas mitten auf dem Gang. Spatzengeschilpe tönt aus dem Hof. Sonst ist es totenstill. Nur mein Blut saust, saust ... die fern verdonnernden Wirbel des Acheron. Taumelnd finde ich zurück in mein Bett und erwarte, nach einem Schluck Martell, weitäugig die Geburt der Frühe und der gewohnten Geräusche, der einlullend-beruhigenden Sachlichkeit, in die sich die Dinge zu kleiden beginnen ...
VI
Das große Ereignis tritt ein: Ich lerne Linda kennen. Und zwar auf etwas ungewöhnliche Weise: Als ich eines Tages um sechs Uhr nach Hause komme und dabei etwas leiser als sonst in den Korridor getreten bin, geschieht ein großes Geraschel und kurzes Schnaufen, wie das eines überraschten Tieres. Die Geräusche sind bei meinen Büchern in der hellen Dämmerung des hinteren Teiles; sehen kann ich noch nichts. Das Wesen gebraucht die Klubsessel zur Deckung. Ich spähe dahinter: da sitzt ein blauschwarzer, sehr dicker Zopf wie eine halb entrollte Schlange auf einem sehr bunten, zusammengezogenen Körper. Unterhalb der Stelle, wo ich die Schulter errate, bläht sich rhythmisch das Kleid von heftig lautloser Atmung kleiner Brüste.
„Na, kommen Sie schon heraus, Fräulein Linda“, sage ich warm. „Sie können sich ruhig meine Bücher ansehen, Sie brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben.“
Sie erhebt sich und wendet langsam und scheu ihr Profil zu mir. Mit der „Rose Saarons“ ist es nichts; das sehe ich ein. Kein Reis und Zweiglein von der überreichen Herbstblüte der Alten. Sondern etwas Neuartiges, schier erschütternd Hässliches. Ja, Fräulein Bibescu hat ein Ponyprofil, kein Zweifel. Eine massive Nase, platt auf der Oberlippe aufliegend, kleine, engstehende, etwas schielende Augen, ein verdrücktes Kinn. Die Stirn ist schmal und von zwei kindlichen Falten zerschnitten, der Mund groß, wenn auch mit schönen Zähnen. Einige Fransen hängen gewellt über dies Antlitz herein, backfischhafte Simpelfransen ... Was es sonst zu sehen gibt, ist weniger hoffnungslos. Die Figur ist schlank und äußerst biegsam, Hände und Füße edel. Das Haar ist erstaunlich. Jetzt, da sie aufrecht steht, kriecht die Zopfschlange bis unter die Kniekehlen. Sie schluckt auf und blinzelt mich aus ihren kleinen Augen an; sie glitzern wie Regen am Fensterglas. Dann sagt sie fast flüsternd:
„Herr Doktor, auf Ehr': ich hab' wirklich nichts wollen da herin; die Mutter hat mich g'schickt, ich soll ihr was Okkult's holen, und da war'n Sie net da, und da hab' ich mir gedacht, ich schau einmal so nach ...“
„Gewiss“, sage ich sehr neugierig. „Ich habe nichts dagegen.“ Schon will sie hinaus rascheln, da werfe ich ein Lasso mit den Worten: „Hier, warten Sie doch. Trinken Sie ein Gläschen? Nein? So. Sie kriegen den ›Schönen Menschen‹ hier, eine Fundgrube von Modellen. Den dürfen Sie dann mitnehmen; aber jetzt wollen wir einander kennenlernen!“
Zögernd lässt sie sich nieder, aber doch sehr erleichtert. Das Gesicht, dessen Haut trübfarbig und spröd scheint, wie die eines Kellerpilzes, mit zwei, drei kleinen Pockennarben, die durchaus nicht als Grübchen passieren wollen, überzieht sich mit Rosenschimmer ... Es zuckt darin. Der Busen ebbt ab, die Stoffalten zerrieseln wie Hafenwellen. Ich blicke tief in die kleinen, missfarbenen Augen; sie verschleiern sich leicht. Nach einem letzten Kampf mit tierischer Scheu, einem letzten Schnaufer und Hüftenregen im Stuhl, hat sie sich bewältigt und wird zur Persönlichkeit, mit der man reden kann. Sie setzt mehrmals zum Sprechen an; dann entringt es sich ihr:
„Der ›Schöne Mensch‹, das kann ich grad gut brauchen. Zum Kopieren und Lernen. Reizend von Ihnen, dass Sie mir das leih'n woll'n.“
„Keine Ursache. Ihre Frau Mutter lobte Ihr Talent; das muss man fördern.“
„Was die Mutter spricht, ist ein Schmarrn“, erwidert sie fast heftig. „Die Mutter hätt' müss'n geboren sein auf der Dult (Jahrmarkt). Die preist mich jedem an ... net zum Aushalten schier, als ob ich der Has' wär' mit zwaa Köpf ... Schauen S', Herr Doktor, ich bin ein Hascherl, ich renn' in der Nacht umeinand', und sie sperrt mich ein. Gesünder werd man net davon und auch net schöner. Und warum tut das die Mutter? Nur weil ich den Vater hör' und schreiben muss, was der Vater sagt. Und dann noch wegen dem Baron. Wenn Sie eine Ahnung hätt'n, Herr Doktor, wie die zwaa mich umeinanderreißen zwischen sich, als ob ich ein Kautschukmanderl wär' ...“
„Wie ist denn das?“, frage ich und lege etwas suggestive List in meine Stimme, „wenn Sie Ihren Vater hören?“
Ihre Augen irren ab. „Hören eigentlich net“, flüstert sie. „Ich empfind' eigentlich nur, dass er da ist und dass er etwas sagt. Und dann packt er meine Hand, und ich muss halt schreiben, was er sagt. Und die zwei machen sich ihren Vers draus.“
„Dann könnten Sie aber auch einmal etwas anderes schreiben? Einmal etwas äußern, was Sie selbst sich ausdenken, und das würde Ihnen ebenso bedingungslos geglaubt und als Botschaft Ihres Vaters betrachtet?“