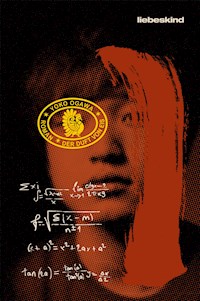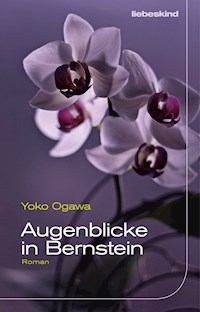8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Liebeskind
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Eine junge Frau nimmt in einem Hotel an einer Gesprächsrunde mit Gehörkranken teil. Zu dem Stenographen, der das Gespräch protokolliert, fühlt sie sich auf geheimnisvolle Weise hingezogen. Von ihm erfährt sie, daß das Hotel einst einer Fürstenfamilie gehörte, deren kleiner Sohn seinerzeit von einem Balkon stürzte. Jahrelang lag das Kind schwerverletzt in einem der Zimmer, in das der Fürst unzählige Blumen pflanzen ließ, da der abendliche Duft der Blüten dem Jungen Erleichterung verschaffte. Als die Frau nun zusammen mit dem Stenographen das Zimmer besichtigt, glaubt sie, den Duft der längst vergangenen Blumen wahrzunehmen. Sie bittet ihn, fortan ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. Doch als der Stenograph mit den Aufzeichnungen beginnt, und die Frau erkennt, daß er hierfür nur eine begrenzte Anzahl von Blättern vorgesehen hat, spürt sie, daß sie ihn bald schon wieder verlieren wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Ähnliche
Yôko Ogawa
Liebe am Papierrand
Yôko Ogawa
Liebe am Papierrand
Aus dem Japanischenvon Ursula Gräfe und Kimiko Nakayama-Ziegler
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
1
Zum ersten Mal bin ich Y in einem kleinen Raum des alten Hotels hinter der Hals-Nasen-Ohren-Klinik begegnet.
Dieses Hotel war früher einmal das Anwesen eines Marquis gewesen und architektonisch ein hochinteressantes Gebäude, aber sonderlich viel Betrieb herrschte dort nie. Es hatte kaum zwanzig Zimmer, ein Restaurant und eine Bar. Ein Anbau beherbergte ein kleines Museum, wo die Sammlung des Marquis zu besichtigen war.
Als ich wegen meines Ohrenleidens in der Klinik lag, beobachtete ich oft von meinem Fenster aus durch die Zweige der Kastanien die ankommenden Gäste. Täglich fuhren nur wenige Wagen vor, und sobald der unterbeschäftigte Portier wieder im Eingang verschwunden war, trat Stille ein wie in einer Kirche nach dem Gottesdienst.
Zwei Tage nach meiner Entlassung aus der Klinik fand in diesem Hotel nachmittags eine Gesprächsrunde statt, zu der man mich eingeladen hatte. Die Drehtür aus farbigem Glas stammte aus längst vergangener Zeit und quietschte leise, als ich sie in Gang setzte, so daß ich für einen Moment glaubte, mein lästiges Ohrensausen habe wieder angefangen. Ich blieb stehen und schloß die Augen. Das Quietschen der Tür schien – wie die Geräusche in meinen Ohren – irgendwie aus großer Tiefe heraufzudringen. Gerade frisch aus der Klinik entlassen, konnte ich noch nicht alle Geräusche richtig einordnen, und es fiel mir nichts Besseres ein, als bei diesem scheinbaren Anflug von Ohrensausen eine Weile die Augen zu schließen.
»Ist etwas mit Ihnen?« Besorgt sprach mich der Portier an.
»Nein, nichts«, antwortete ich mit geschlossenen Augen.
»Geht es Ihnen vielleicht nicht gut ...?«
»Nein, nein, es ist wirklich nichts.«
Die Drehtür in meinem Rücken kam langsam zum Stehen, und damit verschwand auch das trügerische Ohrgeräusch. Das Ganze hatte wahrscheinlich nur ein oder zwei Sekunden gedauert.
»Es geht mir gut«, sagte ich und öffnete die Augen. Aber ein klein wenig schwindlig war mir doch.
Mit zuvorkommendem Lächeln geleitete der Portier mich ins Innere des Hotels.
Als ich den Raum betrat, waren alle anderen Teilnehmer schon anwesend. Er war nicht groß – ein Tisch und acht Stühle fanden gerade noch Platz –, wirkte jedoch durch die Stuckdecke und die mit Schnitzereien versehenen Gardinenstangen beinahe prunkvoll.
Am Tisch saßen mit dem Rücken zum Kamin eine Dame mittleren Alters in einem perlgrauen Kostüm und ein junger Mann, offenbar ein Eurasier. Der Redakteur der Gesundheitszeitschrift, die die Gesprächsrunde veranstaltete, hatte an der Wand Platz genommen. Y saß an einer Ecke des Tischs. Durch das Fenster zur Südseite flutete herbstlicher Sonnenschein in den Raum und tauchte nahezu alles – die Tischdecke, eine Kanne mit Wasser, das goldblonde Haar des jungen Mannes – in ein mildes Licht. Allein der Platz, auf dem Y saß, wirkte leicht schattig, als wäre er in einen Spalt hinter dem Licht gerutscht. Ich entschuldigte mich für mein Zuspätkommen und setzte mich neben Y.
Der Redakteur verbeugte sich höflich.
»Können wir anfangen? Zunächst möchte ich Ihnen im Namen der Zeitschrift Gesundheit heute danken, daß Sie sich für unser Gespräch zum Thema ›Wie ich meine akuten Hörschwierigkeiten überwand‹ die Zeit genommen haben. Unsere Leser haben die Serie ›Wie ich eine schwere Krankheit besiegte‹ bisher mit großem Interesse aufgenommen. Die Artikel über die Basedowsche Krankheit und über Schlafstörungen in der letzten und vorletzten Ausgabe sind auf landesweite Resonanz gestoßen. Diese Runde ist übrigens mit freundlicher Unterstützung der Hals-Nasen-Ohren-Klinik zustande gekommen, und ich hoffe, Ihre Erfahrungen werden einen wertvollen Beitrag zur weiteren Erschließung dieses Problemkreises leisten. Da es um Ihre Gesundheit geht und Hörprobleme zudem eine besonders heikle Angelegenheit sind, fällt es Ihnen als persönlich Betroffene sicher nicht ganz leicht, unbefangen darüber zu sprechen. Selbstverständlich werden weder Ihre Namen noch Fotos von Ihnen veröffentlicht. Sprechen Sie also bitte ganz offen.«
Wir nickten ein wenig verlegen.
»Könnten Sie uns nun etwas über Ihre anfänglichen Symptome berichten? Würden Sie vielleicht den Anfang machen?« Er wandte sich an die Dame in mittlerem Alter. Diese umklammerte die Handtasche auf ihrem Schoß, ließ den Verschluß ein paarmal auf- und zuschnappen und fing an zu erzählen.
»Als ich eines Morgens aufwachte, waren alle Geräusche verstummt.«
In diesem Moment merkte ich, daß Y Stenograph war. Sein Kugelschreiber begann sich exakt in dem Moment über den Schreibblock zu bewegen, als sie zu sprechen anfing. Die beiden Aktionen – das Ansetzen des Kugelschreibers und das Ertönen ihrer etwas nasalen, dünnen Stimme – setzten mit derart perfekter Synchronizität ein, daß es an Zauberei grenzte. Dieser Augenblick hinterließ bei mir den Eindruck einer weißen Taube, die aus einem weißen Tuch hervorgezaubert wird. Aufmerksam beobachtete ich die Lippen der Frau und die Bewegungen seiner Finger.
»Mein erster Gedanke war, der Garten sei zugeschneit und der Schnee habe jedes Geräusch erstickt. Aus meiner Kindheit kann ich mich noch gut an die Stille erinnern, die an einem verschneiten Wintermorgen herrscht. Mir wurde jedoch sofort klar, daß das Unsinn war. Schließlich hatten wir Juni. Was sollte ich tun? Es war ja auch keine gewöhnliche Stille, sondern eher eine weiße Leere, die sich bis in den letzten Winkel meines Gehörs ausdehnte. Ich preßte die Hände auf die Ohren, schüttelte den Kopf, zog an meinen Haaren. Es half alles nichts. Die weiße Leere verstärkte sich nur.«
Den Blick vage auf das Tonbandgerät gerichtet, das in der Mitte des Tisches stand und das Gespräch aufzeichnete, berichtete sie beinahe routiniert von ihrem Leiden, so als sage sie einen einstudierten Text auf. Die ganze Zeit folgte Ys Kugelschreiber ihrer Stimme.
»Ich lag im Bett und bildete mir ein, über Nacht beide Ohren verloren zu haben. Die Ohrmuscheln waren zwar erhalten, aber der wichtigste Teil, das Innere, wäre zu einem Brei geworden, der nun den Gehörgang verstopfte. Ich zitterte so stark, daß ich das Gefühl hatte, mein Skelett könnte jeden Augenblick auseinanderbrechen. Ob dies ein Symptom für einen Hörsturz oder einfach ein psychisches Phänomen war, weiß ich nicht. Schließlich wurde mir auch noch übel. Die unzähligen feinen Nervenfasern in meinem Gehirn schienen sich mit einemmal verkrampft zu haben.«
»Also Taubheit, Zittern und Übelkeit am Anfang«, faßte der Redakteur zusammen.
»Ja.« Sie nickte und nahm einen Schluck Wasser aus ihrem Glas.
Unterdessen blätterte Y eine Seite um. Dabei streiften seine Finger sacht den Rand meines Gesichtsfeldes. Die Dame erzählte weiter, während der Redakteur hin und wieder kurz ihre Worte zusammenfaßte und der eurasische junge Mann höflich zuhörte. In dem Raum waren einzig Ys Hände in Bewegung, so daß bei mir der Eindruck entstand, die Luft zirkuliere allein bei ihnen, während sie im übrigen Raum stillstand. Eigentlich hatte Y nichts Auffälliges an sich. Alles – sein Kugelschreiber, sein Papierblock, seine Aktentasche, seine Armbanduhr, seine Finger – wirkte unscheinbar, ohne besondere Merkmale. Nur seine stenographischen Zeichen fielen aus dem Rahmen.
Ich wünschte mir sehnlichst, einen Blick darauf werfen zu können. Aus seinen fließenden, anmutigen Handbewegungen schloß ich, daß sie geheimnisvoll und wundersam sein mußten. Allerdings waren die Lichtverhältnisse so ungünstig, daß ich von meinem Platz aus nichts zu erkennen vermochte. Ein Schatten lag über seinen Händen. Sosehr ich mich auch bemühte, die blaue Schrift des Kugelschreibers entzog sich meinen Blicken.
Die Dame berichtete weiter, daß sie in der HNO-Station des Krankenhauses, das sie zuerst aufgesucht hatte, so unfreundlich behandelt worden sei, daß ihre Symptome sich verschlimmerten und die Intensität der Geräuschlosigkeit, die sie umgab, weiter zunahm. Erst nach der Behandlung hier in der Klinik sei Besserung eingetreten. Punkt für Punkt ging sie bei ihrem Bericht alles durch, so wie man Stich für Stich eine französische Stickerei anfertigt.
Ich war überwältigt von der Vielzahl an Worten, die ihr für die Schilderung ihres Ohrenleidens zu Gebote standen. Verunsichert fragte ich mich, ob ich überhaupt in der Lage sein würde, meinen Fall angemessen zu beschreiben, wenn ich an die Reihe kam. Hinzu kam, daß meine Ohren sich seit dem Ausbruch der Krankheit nicht mehr wie ein Teil von mir anfühlten, sondern eher den Charakter einer abstrakten Idee angenommen hatten. Die Frau tupfte sich ab und zu die von ihrem zerlaufenden Make-up fettig glänzende Stirn mit einem Taschentuch ab und wischte mit dem Finger Wassertropfen vom Glas.
Nur ein einziges Mal – als die Kellnerin aus Versehen einen Löffel fallen ließ – geriet sie ein wenig aus dem Konzept. Der junge Eurasier, sie und ich hoben im gleichen Augenblick den Kopf, so daß unsere verstörten Blicke sich begegneten. Der Teppichboden hatte das Geräusch zwar gedämpft, doch war es ohnehin eher seine Unvermitteltheit als seine Lautstärke, die uns erschreckte. Der Redakteur und Y schienen es nicht einmal bemerkt zu haben. Wir übrigen hatten offenbar ein anderes Geräuschempfinden.
Nachdem die Kellnerin einen neuen Löffel gebracht und sich zurückgezogen hatte, breitete sich sogleich wieder Stille aus.
»Aha, ich verstehe. Lassen Sie uns nun zum nächsten Fall übergehen.« Der Redakteur hielt einen Moment inne und warf dann dem jungen Eurasier einen Blick zu.
Dieser hatte ein außergewöhnlich schönes Gesicht. Die klaren Formen von Augen, Nase und Kinn zeichneten sich deutlich im Licht ab. Auch seine Ohren hatten eine vollkommene Form. Unvorstellbar, daß mit ihnen etwas nicht in Ordnung sein sollte. Schon bei der geringsten Bewegung bewegte sich sein weiches Haar.
»Am Anfang hatte ich gar keine Symptome.«
Er sprach perfekt Japanisch, als sei es seine Muttersprache.
»Drei Tage nach meiner Immatrikulation an der Universität fand ein Gesundheits-Check-up statt. Beim Hörtest stellte man bei mir eine Anomalie fest und schickte mich sofort ins Krankenhaus, so daß mein Studium nach drei Tagen schon wieder zu Ende war. Nie hätte ich gedacht, daß meine Krankheit sich so lange hinziehen würde.«
»Was für eine Anomalie war das?« fragte der Redakteur.
»Das weiß ich nicht so genau. Der Arzt war ziemlich wortkarg. Er hat eigentlich nichts erklärt und mir lediglich zu einer gründlichen Untersuchung geraten.«
»Konnten Sie beim Hörtest gut hören?«
»Nein. Der Test wurde in einer Ecke der Aula gemacht. Als ich die Kopfhörer aufhatte, vermischten sich die Schritte der anderen Studenten mit der Geräuschkulisse vom Sehtest nebenan, so daß ich sie nicht mehr auseinanderhalten konnte.«
»Aha. Aber im Alltag hatten Sie keine Probleme, oder?«
»Nein. Erst als man mir bei der Untersuchung in der Klinik verschiedene Töne zu hören gab, wurde festgestellt, daß ich fast nichts richtig einordnen konnte, beziehungsweise Töne wahrnahm, die eigentlich nicht vorhanden waren. Allmählich stellte sich dann ein Gefühl ein, als ob tief drinnen in meinen Ohren etwas steckte. Ich glaubte, im Inneren, wo der Gehörgang am engsten ist, etwas Weiches zu spüren. Wie soll ich es beschreiben – nicht hart wie Kork oder so, sondern etwas Weiches, etwa wie die Samen von Pusteblumen.«
Im Vergleich zu der Dame klang sein Bericht ungelenk und abgehackt.
Obwohl ich gefürchtet hatte, der Wechsel der Sprecher könnte Y irritieren, stand sein Kugelschreiber keinen Augenblick lang still.
Da er schräg neben mir saß, konnte ich seinen Gesichtsausdruck nicht erkennen und nahm nur Versatzstücke wahr – die Konturen seiner Schultern, die Farbe seines Anzugs und die Form seiner Finger. Während ich seine Finger beobachtete, war mir, als könne ich seinen Atem spüren. Sein Kaffee wurde kalt, ohne daß er die Tasse einmal anrührte.
»So war es bei mir auch. Ein unangenehmes Gefühl, als ob ein Ohrstöpsel feststeckte«, wandte sich die Dame an den jungen Mann. »Sie sagen allerdings, der Gegenstand im Ohr habe sich bei Ihnen weich angefühlt. Bei mir war es etwas Hartes. Viel härter noch als Kork. Als ich ins Krankenhaus kam, fühlten sich meine Ohren an, als wären sie mit einer abgenutzten alten Münze verschlossen.«
Seltsamerweise trug sie riesige Türkisohrringe, die gar nicht zu ihrem perlgrauen Kostüm paßten und unablässig in ihrem Haar hin- und herbaumelten. Ihr Gewicht zog die Ohren ein wenig in die Länge. Ich hätte mich nie getraut, Ohrringe zu tragen. Mit einem Paar von dieser Größe hätte ich wahrscheinlich an nichts anderes mehr denken können als an meine Ohren. Ihr Geklimper hätte alle anderen Geräusche übertönt.
»Wie war es denn bei Ihnen?«
Unerwartet erteilte der Redakteur mir das Wort, und ich wandte rasch meinen Blick von den Ohrringen ab.
»Ja, dieses Gefühl, als wären meine Ohren verstopft, hatte ich auch.« Meine Stimme klang heiser.
»Würden Sie uns etwas über Ihre ersten Symptome berichten?« bat mich der Redakteur, während er in seinen Unterlagen blätterte. Ich nahm mir vor, möglichst langsam zu sprechen, um es Y leichter zu machen.
»Ja, gerne. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich geheilt bin, da man mich erst vorgestern aus dem Krankenhaus entlassen hat. Wie soll ich sagen ...«
Neugierig, ob er meine Worte richtig aufschrieb, schaute ich absichtlich ein wenig nach unten, um seine Hände zu beobachten, aber wieder konnte ich nichts Genaues erkennen. Immerhin sah ich, daß meine Stimme zügig in Schriftzeichen umgesetzt und auf dem Papier festgehalten wurde. Ich empfand eine gewisse Erleichterung.
»Eines Morgens wurde ich von einem merkwürdigen Geräusch geweckt. Es war kein alltägliches Geräusch, sondern irgendwie anders. Ich blieb eine Weile liegen und lauschte, versuchte es mit anderen mir bekannten Geräuschen zu vergleichen. Dabei kam ich zu dem Schluß, daß es der Klang einer Querflöte – keiner aus Metall, sondern einer Holzflöte – sein mußte. Wie sie bei der altjapanischen Gagaku-Musik benutzt wird. Da das Balkonfenster zwanzig Zentimeter offenstand, vermutete ich, meine Nachbarin übe Querflöte. Sie ist ein recht bekanntes Fotomodell und sieht eigentlich nicht so aus, als würde sie Querflöte spielen, aber was sonst konnte es sein? Ich bildete mir also ein, den Klang einer Querflöte zu hören.«
Wie Schatten folgten Ys Hände meiner Stimme. Sie zögerten nie, überholten mich aber auch nicht.
»Völlig anders als bei mir, nicht wahr? Ich hörte gar nichts, und Sie hörten etwas ganz Bestimmtes«, sagte die Frau.
»Morgens beim Aufwachen ein Model Querflöte spielen zu hören! Was für ein merkwürdiges Symptom«, murmelte der junge Mann.
»Als mir dann klar wurde, daß da niemand Querflöte spielte, erschrak ich erst richtig. Das Geräusch verschwand weder, wenn das Fenster geschlossen war, noch wenn ich mit der Bahn fuhr. Es verstörte mich unglaublich, etwas zu hören, was eigentlich nicht da war.«
»Ja, ich verstehe Sie sehr gut.«
Die Frau nickte mehrmals, wobei ihre Ohrringe heftig schaukelten.
Ich hatte nicht damit gerechnet, daß die Gesprächsrunde so lange dauern würde. Mitten in der Unterhaltung ging die Aufnahmekassette zu Ende. Y wendete sie rasch um und drückte die Aufnahmetaste. Die Strahlen der Sonne, die durch das Fenster fielen, wechselten allmählich die Farbe. Manchmal sah ich, wie draußen jemand aus dem Museum kam und kleine Vögel durch die Bäume huschten.
Der Redakteur fragte pausenlos nach Einzelheiten wie zum Beispiel nach den Medikamenten, ihren Nebenwirkungen, dem Alltag im Krankenhaus, der Krankenhauskost, der Rückkehr ins Alltagsleben und so weiter. Die meiste Zeit sprach die Dame, auch wenn der junge Mann oder ich an der Reihe waren. Häufig fiel sie uns mitten ins Wort und setzte das Gespräch dann im Alleingang fort, während der junge Mann eine Zigarette rauchte und ich auf Ys Hände starrte.
Ich konnte mir selbst nicht erklären, wieso Y derartig meine Aufmerksamkeit erregte, wo doch eigentlich das Thema der Runde so viel wichtiger für mich war. Vielleicht fürchtete ich unbewußt, meine Ohren könnten einen Rückfall erleiden, weil ich sie zum ersten Mal nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus so vielen fremden Stimmen aussetzte. Und versuchte ich mich deshalb von diesen Geräuschen abzulenken? Oder besaßen seine Finger ein geheimnisvolles Etwas, das mich in seinen Bann zog? Gleichviel, es übte eine beruhigende Wirkung auf mich aus, wenn ich seine Finger beobachtete.
Verwunderlich schien mir nur, daß keiner der drei anderen Y wahrzunehmen schien. Völlig unbeeindruckt, als existiere der Stenograph gar nicht, moderierte der Redakteur das Gespräch, während die Frau und der junge Mann berichteten. Keiner würdigte Y auch nur eines Blickes oder richtete das Wort an ihn. Er war einfach da, wie eine von allen unbeachtete antike Vase.
Als die Kaffeetassen abgeräumt waren und chinesischer Tee serviert wurde, ergriff der Redakteur noch einmal das Wort, um eine letzte Frage zu stellen.
»Wie Sie wissen, ist über die Ursachen akuter Erkrankungen des Gehörs noch wenig bekannt. Dennoch möchte ich Sie fragen, ob Sie sich an irgend etwas in Ihrem beruflichen oder privaten Leben vor dem Ausbruch der Krankheit erinnern, das als Auslöser fungiert haben könnte?«
Wie üblich ergriff die Dame als erste das Wort.
»Eigentlich schon. Meine Schwiegermutter – sie war nach einem Schlaganfall fünf Jahre lang bettlägerig – war gerade gestorben. Nachdem die Trauerfeierlichkeiten überstanden waren, ging es los. In den ersten Jahren meiner Ehe habe ich sehr unter ihr gelitten, sie hat mich oft zum Weinen gebracht. Natürlich waren diese fünf Jahre, in denen ich sie pflegte, nicht nur physisch, sondern auch psychisch eine extreme Belastung für mich. Das hat ganz bestimmt zu meinem Hörverlust beigetragen.«
Sie griff nach ihrer noch heißen Teetasse.
Der junge Mann erklärte hingegen nur knapp, er habe keine Ahnung, was sein Hörproblem ausgelöst haben könnte. Nachhakend fragte der Redakteur, ob er beim Abitur oder bei seinen Vorbereitungen für die Universität unter großem Streß gestanden habe, aber der junge Mann schüttelte nur gleichmütig den Kopf.
Ich kam als letzte dran. Da ich mir über einen Zusammenhang zwischen meinem Leben und meinem Ohrenleiden im unklaren war, schwieg ich zunächst und überlegte. War es im Grunde nicht immer so, daß eine Krankheit aus den Unzulänglichkeiten des persönlichen Lebens entstand? Und dieses, je schlimmer sie wurde, ganz überlagern konnte? Gab es überhaupt eine Krankheit, die sich unabhängig von den persönlichen Lebensumständen entwickelte ...? Während ich über diese unergiebigen Dinge nachdachte, warteten Ys Finger reglos wie die Flügel eines ruhenden Schmetterlings auf meine Worte. Als mir einfiel, daß seine Finger zur Bewegungslosigkeit verurteilt waren, solange ich nicht sprach, wurde mir mein Schweigen zu bedrückend.
»Ich weiß es nicht mehr genau. Es war wirklich allerhand passiert, als ich die ersten Anzeichen verspürte. Aber es ist sehr schwierig, die Ereignisse in die richtige Reihenfolge zu bringen und Zusammenhänge herzustellen. Zu entscheiden, was eventuell mit meinem Gehör zu tun hat und was nicht. Manchmal kommt es mir vor, als wären meine Ohren schon von meiner Geburt an so gewesen. Eins steht jedoch fest: Einen Tag, bevor ich die Flöte zum ersten Mal hörte, hatte mein Mann mich verlassen.«
Als ich es aussprach, klang es wie die alltäglichste Sache der Welt. Auch nicht anders, als wenn jemand erzählte, seine Schwiegermutter sei an einem Schlaganfall gestorben. Die Dame sah mich mitfühlend an.
»Das heißt, wir hatten uns getrennt. In der Klinik sagte man mir zwar, daß solche Erlebnisse ein Körper und Psyche stark belastender Streßfaktor seien, dennoch bin ich bis heute nicht überzeugt, daß diese Sache irgendwie mit meinem Ohrenleiden zu tun hat. Eine solche Erklärung ist einfach zu simpel, finden Sie nicht?«
Der Duft des chinesischen Tees breitete sich im ganzen Raum aus. Er ließ mich an dunkelrote Blüten denken und war so erstickend intensiv, daß ich gar keinen Appetit mehr darauf hatte. Ich bildete mir ein, irgendwo im Hotel Wasser rauschen zu hören. Nahm gerade jemand ein Bad oder war das nur eines meiner Ohrgeräusche? Mit meinem unzulänglichen Gehör konnte ich das nicht genau feststellen.
»Vielleicht werden Sie es nicht glauben, aber ich hatte eine Vorahnung. Nein, kein Symptom, eine reine Vorahnung. Lange bevor ich die Flöte hörte, bevor sich irgendein Symptom bemerkbar machte, ahnte ich bereits, daß mit meinen Ohren etwas geschehen würde. Beim Haarkämmen fielen mir eines Morgens im Spiegel meine Ohren auf. So einem Moment mißt man normalerweise keine Bedeutung bei. Aber damals konnte ich meinen Blick nicht abwenden, so seltsam erschienen sie mir. Es war, als sähe ich sie zum ersten Mal im Leben. Ich betastete die zarten Windungen der Ohrmuscheln, verglich die Hautfalten beider Ohren und strich über die Ohrläppchen. Erst bei genauerer Betrachtung erkennt man, was für komplexe und seltsam geformte Organe die Ohren sind. Es störte mich plötzlich, daß ich meine Ohren nur im Spiegel sehen konnte. Ich weiß nicht warum, aber am liebsten hätte ich sie in die Hand genommen und direkt angeschaut. Zu diesem Zeitpunkt wäre ich nie auf die Idee gekommen, daß mein Mann mich verlassen könnte. Wir hatten absolut keine Probleme. Es gab nur diese Vorahnung, die ich ständig verspürte.«
Als ich mir die Hand auf das linke Schlüsselbein legte, hob Y kurz den Kopf und schaute mich an. Erstmals begegneten sich unsere Blicke. Allerdings war es nur ein kurzer Moment, in dem ich Form und Ausdruck seiner Augen nicht erkennen konnte. Sein Blick huschte vorüber wie eine Sternschnuppe.
Eigentlich konnte er doch nur Worte notieren. Wie würde er die Geste, mit der ich mein Schlüsselbein berührt hatte, in Schrift umsetzen?
Die Sonne ging bereits unter, als das Gespräch endete. Die Tür des Museums war geschlossen, und Dämmerung hüllte die Bäume ein. Wir drei lächelten uns verlegen an. Die Dame packte ihr Taschentuch in die Handtasche, und der junge Mann streckte sich ein bißchen.
Der Redakteur bedankte sich mehrfach für das »wertvolle Gespräch«, sammelte die Unterlagen ein und überreichte jedem Teilnehmer ein Honorar. Unterdessen deckte die Kellnerin den Tisch für ein französisches Menü, das aus Hähnchenschenkeln, Pilzen und Brokkoli bestand. Die Getränke – Wein, Bier und Mineralwasser – wurden auf einem Rollwagen hereingefahren.
Ich nahm mir vor, Y beim Essen anzusprechen. Vielleicht würde er mir ja seinen stenographierten Text zeigen. Doch als ich mich nach links zu ihm umwandte, war er nicht mehr da.
Auch seine Aktentasche, der blaue Kugelschreiber, sein Schreibblock und das Tonbandgerät waren verschwunden. Er mußte den Raum lautlos durch die Tür, durch die die Kellnerin ein- und ausging, verlassen haben, während ich die Quittung unterschrieb und mich mit dem Menü beschäftigte. Ich hatte nicht gehört, wie er seine Sachen in die Tasche gepackt hatte, und auch nicht gemerkt, wie er aufgestanden und hinter mir vorbeigegangen war. Es war, als hätte er sich einfach in Luft aufgelöst.
»Ihnen allen noch einmal herzlichen Dank für das Gespräch. Lassen Sie es sich gut schmecken«, sagte der Redakteur und lächelte. Der junge Mann drückte seine Zigarette aus, und die Frau piekte mit der Gabel in ein grünes, festes Brokkoliröschen. Ebenso wie sie Y während des Gesprächs nicht wahrgenommen hatten, bemerkten sie nun auch sein Fehlen nicht. Die Serviette in der Hand, starrte ich auf den Stuhl, auf dem er hätte sitzen sollen. Es war eine traurige Leere. Eine Leere, die die Erinnerung, daß dort jemand gesessen hatte, völlig in sich aufsog. Ich glaubte, an der Stuhllehne eine ganz schwache Einbuchtung auszumachen, aber das war vielleicht nur Einbildung.
2
Offenbar hatte mich die Teilnahme an der Gesprächsrunde derart angestrengt, daß ich kurz darauf wieder in die HNO-Klinik eingewiesen werden mußte. Dieser eine Tag hatte einen Rückfall verursacht, nach dem ich mich so schlecht fühlte wie am Anfang meiner Erkrankung. Obwohl ich nachts schlafen konnte, erholte ich mich nicht. Jedes Geräusch, das an meine Ohren drang, hallte unangenehm. Da ich allein lebte, konnte eigentlich gar nicht so viel Lärm entstehen, aber in meinem Kopf dröhnte es, als würden hundert verstimmte Orgeln gleichzeitig ertönen. Ganz alltägliche Geräusche – wie das Aufschlagen eines Frühstückseis, das Rascheln der Zeitung oder das leise Knuspern beim Abbeißen von einer Scheibe Toast – verbanden sich zu einer qualvollen Kakophonie, die um ein Vielfaches verstärkt in meinen Ohren gellte.
In der Klinik bekam ich wieder mein altes Einzelzimmer – Nummer zwölf, mit Blick auf die Kastanien und die Hotelauffahrt. Der Alltag im Krankenhaus verlief geregelt und eintönig. Jeden Morgen um sieben Uhr kam eine Krankenschwester und zog den Vorhang so behutsam wie möglich beiseite, denn ein allzu rasches Gleiten auf der Vorhangschiene versetzte mir einen Schrecken, als schlüge zischend ein Blitz in mein Kissen ein. Nachdem sie meine Temperatur und meinen Blutdruck gemessen hatte, trug sie diese Werte in ein Krankenblatt ein. Unklar war mir allerdings, was Temperatur, Blutdruck und Pulsschlag mit meinem Gehör zu tun haben sollten, so daß ich die ganze Prozedur als überflüssig empfand. Während dieser Messungen, die wie ein geheiligtes Ritual durchgeführt und niemals vergessen wurden, betete ich inbrünstig, die Schwester möge den Kugelschreiber oder die Manschette des Blutdruckmessers nicht fallen lassen und so unnötige Geräusche verursachen.