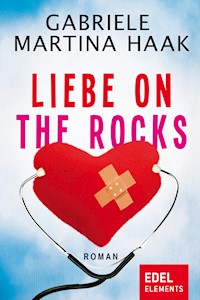
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sophie Lackmann, Mitte Dreißig, peppige Karrierefrau und Pressechefin einer Gentechnikfirma, befällt aus heiterem Himmel plötzlich die Torschlusspanik. Ihr Herzenswunsch: ein Baby – doch weit und breit ist kein Mann in Sicht, der der Vater ihres Wunschkindes werden möchte. Was also tun? Als Frau der Tat durchstöbert Sophie kurzerhand die Samenbanken nach einem geeigneten Kandidaten. Doch was dann passiert, ist einfach unglaublich. Sophie muss erkennen, dass man dem Schicksal selten ungestraft ins Handwerk pfuscht: Sie trifft ihren Traummann nämlich genau in dem Moment, als sie frisch befruchtet ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gabriele Martina Haak
Liebe on the rocks
Roman
Edel eBooks
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Impressum
Kapitel 1
›Verliebte Herzen kann man leicht belügen‹, trällerte es aus dem Autoradio, und Sophie Lackmann konnte, verdammt noch mal, keinen Parkplatz auf der Königsallee finden. Es war kurz nach fünf, und in gut drei Stunden wollte sie in der besten Form ihres Lebens in einem sündhaft teuren kleinen schwarzen Etwas verführerisch im Türrahmen ihrer Wohnung stehen. Hinter ihr würden in der Küche zwei perfekte Margaritas, ein köstlicher Avocado-Dip und heiße Tacos California warten. Und dann würde ihr größter Wunsch in Erfüllung gehen.
Endlich, eine Lücke. Sophies schwarzer Fiat zwängte sich zwischen einen Jaguar und einen Mercedes, und sie stürzte im Businesskostüm zu ›Gerard‹, dem Starcoiffeur in Düsseldorf. Um überhaupt noch einen Termin an diesem Dienstag zu bekommen, hatte Sophie der eingebildeten Schnepfe von Assistentin eine haarsträubende Geschichte über einen Fernsehauftritt erzählen müssen. Eigentlich hatte sie auch noch einen Kosmetiktermin eingeplant – mit vierunddreißig war das ab und an von Nutzen –, aber dazu hatte die Zeit beileibe nicht mehr gereicht.
Jetzt saß sie immerhin zwischen fünfzehn anderen zerzausten Damen wie das Huhn auf der Stange in einem der schwarzen ledernen Wartestühle zum Waschen, was bei Gerard einem Ritual glich und wahrscheinlich allein deshalb den horrenden Preis rechtfertigte. Janine rubbelte auf ihrer Kopfhaut herum und sprühte revitalisierende Wirkstoffe in ihr mit einigem Wohlwollen als dunkelblond zu bezeichnendes, schulterlanges Haupthaar. Dann schwebte Gerard höchstpersönlich herbei und küßte Sophie die Hand.
»Sophie, Liebling, setz dich«, flötete Gerard. »Nun, da werden wir schon etwas zaubern können.« Sophie atmete tief durch.
»Ich möchte es möglichst natürlich, aber mit viel Volumen, eben aufregend«, stammelte sie nach einigen Sekunden, ermutigt durch seinen fragenden Blick.
»Aber sicher, Schätzchen, ganz natürlich, das wollen wir doch alle.«
Das Düsseldorfer Haargenie schnippte seine halbgerauchte Marlboro auf den Marmorboden. Uwe, Gerards Assistent, setzte eilfertig seinen Lackschuh darauf und fegte das störende Corpus delicti leise grinsend auf eine silberne Schaufel. Gerard zückte Kamm und Schere.
»Kopf runter, weiter runter, jetzt hoch, drehen, schütteln«, kamen die knappen Befehle. Zwischendurch fegte Gerards kleine Schere flink durch Sophies wirr umherfliegende Haare, und es war beileibe nicht abzusehen, was daraus werden würde. »Steh auf, Kopf schütteln, nach unten.«
So ging das etwa fünf Minuten, dann entschwebte der Meister. Einfach so, ohne ein Wort zu sagen, ohne Rückversicherung, ob sein Kunstwerk auch gefiele. Der wohl schnellste Haar-Stylist aller Zeiten. Uwe schnappte sich den Föhn, und – kaum zu glauben – nach einer halben Stunde sah Sophie aus wie Pamela Anderson, nur mit kürzeren Haaren in dunkelblond bis hellbraun, und zudem weniger vollbusig. Und so volle geschwungene Lippen besaß Sophie Lackmann auch nicht. Als sie sich kritisch im Spiegel betrachtete, blieb von der Pamela-Anderson-Version nicht allzuviel übrig. Sophie war zwar hübsch, aber nicht so, daß jedem Mann bei ihrem Anblick der Atem stockte. Eher natürlich schön, mit blauen Augen, einer niedlichen Stupsnase und vielen Lachfältchen, dafür mit etwas zu dünnen und zu wenig gelockten Haaren und einem zu knochigen Dekolleté. Mit der Kleidergröße 36 bei 1,70 Meter war Sophie allerdings zufrieden.
»Das müßte genügen«, sagte sie zu sich selber im Goldspiegel, zupfte noch einige kunstvoll drapierte Haarsträhnen zurecht, zahlte ohne Murren hundertachtzig Mark und stürzte zwei Häuser weiter zu ›Feinkost Sperling‹. Mittlerweile war es kurz nach sechs Uhr.
Die Einkaufsliste hatte sie bereits am Abend zuvor zusammengestellt: Limonen, Tacoschalen, eine grüne Chili, Cheddar-Käse, Maiskörner, Avocados, Tomaten, Oregano, Tabasco, Tomatenmark und Schweinehackfleisch. Rind konnte man ja nun wirklich nicht mehr essen.
Warum eine Verkäuferin so viel Zeit braucht, um so wenige Dinge zusammenzusuchen, hatte Sophie noch nie verstanden. Aber heute bekam sie vor Ungeduld rote Pikkel. Eindringlich hatte sie betont, daß sie viel zu spät dran und eigentlich total in Hektik sei. Und diese runde Wurstverkäuferin kratzte in aller Seelenruhe das Hackfleisch aus der Schale!
Warum mußte aber auch David Parker, Direktor der erfolgreichen Gentechnikfirma Gene Dream Germany und Sophies Chef, ihr ausgerechnet heute, an diesem großen Tag, um drei Uhr nachmittags einen Entwurf für einen Pressetext auf den Tisch knallen, der noch zu korrigieren war. Da konnte sie als Pressesprecherin des renommierten Unternehmens schlecht nein sagen. »Lieber Parker, heute nicht, tut mir leid, ich muß zum Friseur und Einkaufen, weil ich heute nacht ein Kind zeugen will«, nein, das hätte sie nicht über ihre Lippen gebracht. Obwohl dieser verdammte Text wirklich bis morgen Zeit gehabt hätte!
David Parker war ansonsten nicht übel, und er wußte ja nun auch wirklich, was er an Sophie hatte, aber manchmal kapierte dieser eiskalte Karrierefuzzy einfach nicht, daß es auch noch andere Dinge gab als den Job. Sie hatte also unerbittlich in die Tasten ihres Laptops gehauen. Glücklicherweise fielen ihr unter Zeitdruck immer die besten Sachen ein, so daß der Text halbwegs fertig war, ehe sie zu Gerard abdüsen mußte. Aber ihren Streßhormonspiegel hätte sie lieber nicht messen wollen. Klamme Finger, flache Atmung – Sophie war nicht gerade entspannt, als sie der Zeitlupen-Verkäuferin zuschaute.
Mit vollen Taschen rannte Sophie im Laufschritt zum Auto. Fett prangte ein Knöllchen an der Windschutzscheibe, und da hätte sie zum erstenmal stutzig werden müssen. Irgendwie verlief der Tag nicht ganz so wie geplant. Aber auf dreißig Mark sollte es heute auch nicht mehr ankommen. Felix wollte gegen halb neun bei ihr sein, falls in der Klinik alles glattliefe.
Diese Hetze ging Sophie gewaltig auf die Nerven, sie hatte schließlich noch viel vor. Heute, Dienstag, den achten Oktober, war es soweit. Heute am 13. Zyklustag sollte nach Adam Riese ihr Eisprung stattfinden, und Felix und Sophie würden ein Kind zeugen. Ein Wochenende wäre für die große Tat wahrhaft besser gewesen, aber ein Eisprung ließ sich nun mal nicht gut planen. So ein Eisprung blieb eben eine unumstößliche biologische Tatsache. Auf der anderen Seite hatte der Dienstag auch Vorteile, denn am Samstag- oder Sonntagabend hätte sich Felix schlecht von der werten Gattin loseisen können.
Also schleppte Sophie keuchend die drei Tüten in den dritten Stock, in ihre liebevoll renovierte Düsseldorfer Altbauwohnung und machte sich ans Werk.
Ein Schuß Rosenöl ins Badewasser, die Avocados ins Mixgerät, Zitrone pressen, Hackfleisch mit Zwiebeln und Knoblauch andünsten. Diese hausfraulichen Tätigkeiten – nicht gerade Sophies größte Stärke – sollte man immer erledigen, bevor man sich badet und die Haare wäscht, sonst stinkt man, als hätte man zwei Stunden in einer Würstchenbude herumgelungert!
Den Rat mit den Haaren hatte ihr Tante Billie schon vor Jahren gegeben, und die kannte sich mit Männern und Rendezvous nun wirklich aus. Mit ihren holden sechzig Jahren war sie die ungekrönte Königin in den diversen Ball-der-einsamen-Herzen-Palästen des Ruhrgebiets. Lebenslustig und sexy. Sophie durfte sie immer als geschätzte Kritikerin in den besten Dessous-Laden Düsseldorfs begleiten, um bei der Wahl der neuen Strapse hilfreich zur Seite zu stehen. Daß sie selbst sich nicht mit den schmalen Strumpfhaltern anfreunden konnte, hielt ihr Tante Billie zwar regelmäßig vor, aber ansonsten waren ihre Beziehungstips und Verführungstricks nicht zu verachten.
»Kind, wenn du für einen verheirateten Lover kochst, darfst du nie nach Essen riechen, sonst fühlt er sich wie zu Hause.« Diese Lektion also hatte Sophie von ihrer geliebten Patentante Billie Hornung gelernt.
Die Haare stellten heute ein Problem dar. Den Geruch würde man nie wieder herausbekommen, aber die hundertachtzig-Mark-Frisur wollte Sophie natürlich auch nicht neu fönen, also ein kleines Tuch um die Pracht geschlungen – so mußte es gehen.
Frische Duftkerzen aufstellen, den Tisch decken, getrocknete Rosenblätter verteilen und die Limonen schneiden. Jetzt ab ins Bad, Beine und Achseln rasieren, Reinigungsmaske ins Gesicht, Feuchtigkeitsgel auf die Augen. Am Vormittag hatte bereits ihre Putzhilfe Martha, eine reizende dreiundzwanzigjährige Tschechin, den hartnäckigen Staub entfernt, frische Bettwäsche aufgezogen und ihrem weißen Bad neuen Glanz verliehen. Darum brauchte sie sich also nicht zu kümmern.
Sophie blieb im Zeitplan und gönnte sich deshalb eine halbe Zigarette, während sie die Margaritas schüttelte. Für den Tequila-Mix nahm sie statt Cointreau einen Triple sec, weil das ihrer Ansicht nach eine Spur frischer schmeckte. Eine Prise Puderzucker verlieh dem Ganzen noch die spezielle Note. Die meisten Margarita-Fans bevorzugten den Frozen Margarita, eine schaumige Masse mit jeder Menge crashed ice. Nicht so Sophie. Als echte Margarita-Kennerin nahm sie ihn on the rocks mit Salzrand.
Sophie hätte vor Freude platzen können. Heute war ihr Tag. Der Tag, auf den sie seit langem wartete. Felix und sie, endlich. Ein neuer Schritt in eine wundervolle Zukunft. In ihren Träumen hatte sie sich diesen Moment schon so oft ausgemalt, daß sie jetzt gar nicht so recht glauben konnte, daß es endlich soweit war.
Sophie hatte Felix vor zwei Jahren auf einer Tagung der deutschen Gynäkologen und Humangenetiker kennengelernt, bei der ihre Firma Gene Dream ein neues gentechnisches Verfahren vorstellte. Felix war ihr sofort aufgefallen. In seinem blassen Gesicht und hinter der intellektuellen Hornbrille blitzten grüne kleine Augen, denen niemals etwas zu entgehen schien. Nicht daß er besonders gut aussehend oder besonders groß oder besonders athletisch gewesen wäre. Er war einfach da, schaute sie mit einem durchdringenden Blick an, und Sophie dachte: »Gottverdammtes Pinselohrschwein. Wer ist der Typ?«
»Das ist Professor Felix Northeim, Chefarzt der Universitätsfrauenklinik hier in Düsseldorf, einer der fortschrittlichsten Mediziner, die wir haben«, so stellte ihn ihr Chef David Parker nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung vor.
»Angenehm, Frau Lackmann, Sie müssen mir mehr über Ihren interessanten Beruf erzählen. David meinte, Sie seien seine beste Kraft in der Presseabteilung, ja eigentlich seine Pressesprecherin«, plauderte Felix lächelnd drauflos und rückte seine Brille zurecht.
»Ich bin in der Tat seine Pressesprecherin, Herr Professor Northeim, und klar, natürlich erzähle ich Ihnen gerne mehr über meine Arbeit.«
»Wäre es Ihnen morgen abend recht, wir könnten in ›Pauls Bistro‹ zusammen essen gehen.«
»Soll ich einen Tisch bestellen?« hatte Sophie beflissen gefragt.
»Einen Tisch? In ›Pauls Bistro‹? Dort kann man nicht reservieren. Aber ich versichere Ihnen, wir bekommen ein stilles Plätzchen, wo wir uns ungestört unterhalten können.«
Felix Northeim strahlte sie an. Aber es war weder ein spöttischer Zug um seinen Mund zu entdecken, noch ein hochnäsiges Blinzeln in den Augen. Es war einfach nur Interesse, und ihr wurde schlagartig klar, daß dies kein reines Arbeitsessen werden würde.
Sie gingen danach noch zweimal aus, ehe Felix Sophie nach Hause begleitete. Sie liebten sich zwischen zehn Uhr und Mitternacht, und dann stieg Felix blitzartig in seine Leinenhose, schnappte sein Jackett und raste zu seiner Frau aufs Land, nach Grevenbroich.
Von da an trafen sich Felix und Sophie zwei- bis dreimal in der Woche, je nachdem wie es sein und manchmal auch ihr Terminkalender zuließ. Ab und zu in seinem Apartment in der Stadt, meist jedoch bei ihr. Felix liebte edlen Luxus, italienische Anzüge, mexikanisches Essen und haßte seine leicht schütteren Haare. Für sie sah er mit seinen sechsundvierzig Jahren einfach umwerfend gut aus, aber das wirklich Beeindruckendste war seine messerscharfe Intelligenz. Ihm konnte man nichts verheimlichen.
Felix überschüttete Sophie mit einem solchen Unmaß an Leidenschaft, daß es ihr manchmal fast den Atem verschlug. Sie fühlte sich noch nie von einem Mann so geliebt wie von Felix, und sie begehrte ihn, wie sie noch nie einen Mann begehrt hatte. Sophie war zum erstenmal in ihrem an prickelnden Erlebnissen keineswegs armen Leben sicher: Der ist es! Der und kein anderer.
In zwei Jahren fiel kein böses Wort. Da gab es keine Vorwürfe, keine verletzten Eitelkeiten. Sie liebten sich in London, in der Schweiz, in den USA, denn Felix konnte vieles möglich machen, was in einer Ehe völlig unmöglich gewesen wäre. Er war ein erfolgreicher Arzt und Wissenschaftler und dementsprechend viel unterwegs. Und wann immer es möglich war, begleitete sie ihn. Sophie hörte seine Vorträge, kannte mittlerweile seine Kollegen, und Felix’ Sekretärin freute sich, wenn sie anrief. Nachts fuhr sie oft Hunderte von Kilometern, nur um ihn zwei Stunden zu sehen und in seinen Armen zu liegen. Und sie bereute nicht eine Sekunde. Felix und Sophie sprachen viel von ihrem gemeinsamen Leben, von Kindern, wollten zusammen alt werden, wenn er seine Frau verlassen hätte. Sie waren sich aber einig, daß man eine solch einzigartige, grandiose Zukunft nicht mit einer ›Leiche im Keller‹, so Felix’ Worte, beginnen konnte. Die Trennung von seiner Frau sollte keine Belastung für die neue Liebe werden. Felix mußte sich unabhängig, möglichst ›atraumatisch‹, wie er es immer nannte, scheiden lassen. Sie wollten beide das Drama vermeiden, schon aus gesellschaftlichen Gründen. Die ›Dolchstoßmethode‹ hätte sicher endloses Getratsche in Düsseldorf heraufbeschworen. Sophie wäre ein dummes Huhn gewesen, wenn sie diese Argumente von Felix nicht logisch hätte nachvollziehen können.
Seine Frau Elke hatte sie einmal bei einem Empfang kennengelernt, als das neue Laborgebäude in Felix’ Klinik eingeweiht wurde: eine Tierärztin mit eigener Praxis, eher der bodenständige Typ, kinnlange strähnige Haare, aschblond, dünn, ein langweiliges Blümchenkleid und mit ihren siebenundvierzig Jahren irgendwie verhärmt. Neben Felix, dem die Lebensfreude aus jeder Pore strahlte, sah sie geradezu sauertöpfisch aus. Aber vielleicht lag es auch daran, daß Felix und sie seit Jahren keinen Sex mehr hatten. Das hatte er Sophie immer geschworen, und sie glaubte ihm. Wie hätte er noch mit seiner Frau schlafen können nach den leidenschaftlichen Nächten mit ihr? Völlig unmöglich! Schrunden am Rücken, zerrissene BHs, umgestürzte Vasen – das war bei ihnen beiden nichts Ungewöhnliches. Es gab kaum einen Quadratmeter in ihrer Wohnung, den sie noch nicht lustvoll ›eingeweiht‹ hatten. Es gab keine sexuellen Tabus zwischen Sophie und Felix. Ihre Beziehung war in der Tat extraordinär und stellte alles in den Schatten, was sie vor Felix an sexuellen Erfahrungen hatte sammeln können. Und dabei war sie auch schon achtzehn Jahre sozusagen auf dem Markt, nachdem ihre Jugendliebe Bernd sie mit sechzehn im Schwimmbad, ganz hinten, beim letzten Busch vor dem Zaun, defloriert hatte.
Felix und Sophie verwöhnten sich oft mit kleinen Überraschungen, mal ein Pfund Sahne, mal ein Video, mal ein Dessert mit gingetränkten Keksen für Felix oder ein aphrodisierendes Liebesmenü mit Austern und Ingwer, wobei er das bei Gott nicht nötig hatte. Felix konnte eigentlich immer, ein Naturphänomen, wobei sie sich nur in besonders eingebildeten Momenten der Illusion hingab, nur sie allein würde ihn derart antörnen. Von präseniler Bettflucht konnte bei ihm keine Rede sein. Und Sophie genoß den ausschweifenden Sex mit jeder Faser ihres Körpers, egal ob es der Quickie im Wäldchen an einem Autobahnrastplatz war oder eine fünfstündige Sinnesorgie im Hotelzimmer. Felix war der beste Liebhaber, den sie je hatte. Felix war Lust pur!
Auf den Tag genau vor zwei Jahren hatten sie sich das erstemal geliebt, und am heutigen Dienstag nun sollte Sophies größter Herzenswunsch in Erfüllung gehen. Sie würden ein Kind machen. Endlich. Sophie würde Weihnachten schwanger sein, wenn alles klappte. Schwanger von dem Mann, den sie fast mehr liebte als sich selbst, dem sie verfallen war mit Haut und Haaren. Sie würden eine richtige Familie gründen.
Sophie hatte sich immer schon Kinder gewünscht, aber zunächst kam das Studium, dann der Einstieg in den Job, und dann waren ihr oft ihre hohen Ansprüche an einen Partner im Weg gewesen. Sebastian war zu spießig, Martin nicht intelligent genug, Werner zu besitzergreifend und Achim ... Na ja, Achim war eine spezielle Geschichte. Sie hatte einfach noch nie das sichere Gefühl gehabt, daß sie es bis an ihr Lebensende mit einem von ihnen hätte aushalten können. Mit Felix war alles anders. Felix war Sophies Traummann. Daran bestand für sie kein Zweifel.
Es klingelte pünktlich um halb neun. Da stand ihr Traummann mit einem Dutzend gelber Rosen und wunderschönen echten Art-déco-Ohrringen. Eine Erinnerung an ihren letzten Kurzurlaub vor vier Monaten, als sie es sich in einem süßen Art-déco-Hotel am Ocean Drive in Miami für drei Tage gemütlich gemacht hatten. »In kleinen Dingen muß man großzügig sein«, sagte Tante Billie immer. Sie fand, wenn ein Mann eine Frau verehrte, dann dürfe er ihr ruhig teure Geschenke machen. Sie anzunehmen, führe keinesfalls zu einem Gesichtsverlust bei emanzipierten Frauen. Dieses alberne ›Heute zahle ich, morgen du‹, entsprach in ihren Augen überhaupt nicht der hunderttausend-Jahre-alten-Evolutionsstrategie, daß ein Mann eine Frau verwöhnen sollte, ihr auch in finanzieller Hinsicht seine Wertschätzung zeigen mußte, um sie für sich zu gewinnen. Mit Felix hatte Sophie die altmodische Billie-Weisheit schätzen gelernt. Er hatte ihr schon einige erlesene Geschenke gemacht.
Während sich der Chauffeur von Felix im ›Alten Hahn‹ um die Ecke wahrscheinlich ein Wiener Schnitzel bestellte, wie so oft, wenn Felix bei ihr war, knutschten sie bereits heftig auf ihrem Sofa. Das wuchtige Korbmöbel war mit bunten Kissen und einem Grandfoulard im provençalischem Muster geschmückt und gab der Wohnung einen eigenwilligen Landhaus-Charme.
»Hallo Süße, einen guten Tag gehabt? O Gott, wie ich mich auf dich gefreut habe, seit heute morgen«, raunte ihr Felix ins Ohr, was ihre gesamte Körperoberfläche augenblicklich mit einer feinen Gänsehaut überzog.
»Ich mich auch.«
»Du weißt hoffentlich, was wir heute feiern? Zwei Jahre mit dir, es erscheint mir wie mein halbes Leben. Wie habe ich es nur je ohne dich ausgehalten?«
»Wahrscheinlich schlecht«, flachste Sophie.
»Entsetzlich schlecht, glaube mir, erst seit ich dich kenne, weiß ich, was Liebe ist, Hingabe und Leidenschaft. Ich habe noch nie eine Frau so sehr begehrt wie Dich. Daß mir das in meinem Alter noch passiert ist, dafür müßte ich dem Schicksal ewig dankbar sein.« Felix seufzte tief.
»Kein Konjunktiv, Felix, du mußt wirklich dankbar sein, denn es war damals der reine Zufall, daß ich auf dem Kongreß aufgetaucht bin. Es hätte nicht viel gefehlt, und wir hätten uns nie kennengelernt.«
»O Himmel, hör schon auf«, lachte er, »irgendwann hätten wir uns getroffen, Sophie. Wir gehören doch zusammen.«
Felix und Sophie sahen sich tief in die Augen. Perfekter hätte das Glück nicht sein können.
»Ich habe übrigens um fünf im Büro angerufen, aber deine Sekretärin meinte, du wärst heute früher gegangen. Muß ich mir Sorgen machen?« fragte Felix mit einem spitzbübischen Lächeln und schaute Sophie über den Brillenrand noch ein wenig intensiver in die Augen.
»Na klar, ich habe dich mit Gerard, meinem Friseur betrogen«, konterte sie, aber gerade als sie in höchsten Tönen von Gerards Verführungskünsten schwärmen wollte, begann Felix seine zärtlichste Kußnummer. Zuerst die Augen, die Nase, den Hals, immer stürmischer, bis ihr nichts mehr zu Gerard einfiel und sie beinahe die aufgewärmten Tacoschalen im Backofen vergessen hätte. Felix hatte ihr Kleid hochgeschoben und seine Hand mit einem lauten Seufzer zwischen ihre Beine gelegt, auf die nackte Haut. Sophie trug nie einen Slip, nur halterlose Strümpfe, wenn Felix zu Besuch zu ihr kam.
Felix schlürfte seinen ersten Margarita und entspannte sich langsam von seinem harten Arbeitstag. Margaritas hinterließen immer diesen leicht salzigen Geschmack, ›so wie ein Bad im türkisblauen Meerwasser, nackt und engumschlungen mit dir‹, pflegte Felix seine Liebe für ›ihren‹ Drink zu umschreiben. Wobei Sophie den Margarita mittlerweile fast besser mixte als Jimmy im Leo’s, ihrer absoluten Lieblingsbar. Und das wollte weiß Gott was heißen.
Felix war direkt aus Amsterdam gekommen, von einer europäischen Tagung über Pränataldiagnostik. Das war ein sehr ehrgeiziges Projekt. Felix war der Vorsitzende der deutschen Abteilung, und während Sophie ihm die Salzkrümel von den Lippen leckte, erklärte er ihr die Vorzüge seiner neuesten Entdeckung. »Bei welchen schweren Erkrankungen darf ein Fötus abgetrieben werden? Na? Wenn sich eine Frau zu einem Test durchringt, kommt erst die Amniozentese, dann die Chromosomenanalyse und dann die Entscheidung. Schwer genug. Für die Frauen ist die Wartezeit zwischen der 12. Schwangerschaftswoche, wenn die Fruchtwasseruntersuchung gemacht wird, und der 16. Woche, wenn sie das Ergebnis bekommen, eine bedrückende Zeit. Und das hat jetzt ein Ende, mein Schatz.«
Felix hatte zusammen mit Kollegen ein Verfahren entwickelt, bei dem diese Untersuchungen in der achten Woche mit einigen Zellen aus einem Bluttropfen der Mutter gemacht werden konnte. Gerade in dieser Phase der frühen Schwangerschaft kreisten offenbar einige Zellen des Fötus im Blut der Mutter, was vor Felix noch keinem Wissenschaftler aufgefallen war. Das war natürlich ein entscheidender Schritt, denn in der 8. Woche konnte man einen Schwangerschaftsabbruch noch unter örtlicher Betäubung ambulant vornehmen, aber in der 16. Woche mußte künstlich eine Geburt eingeleitet werden. Sophie hatte selbst mit Frauen gesprochen, die diese Tortur, nach der Entscheidung, ihr todkrankes Kind abtreiben zu lassen, erlebt hatten. Eine richtige Geburt, mit der Gewißheit, daß man ein Kind zur Welt bringen würde, das bereits tot wäre, oder das innerhalb von Minuten auf dem kalten Kliniktisch sterben würde, einfach grauenhaft.
Sophie liebte Felix besonders, wenn er begeistert über neue Projekte sprach, und hing an seinen Lippen. Das war für sie das Faszinierende an ihrer Beziehung: Sie konnte mit ihm reden und diskutieren. Er verstand ihren Job bei Gene Dream, sie seinen in der Klinik. Die meisten Männer, die sie vor ihm kennengelernt hatte, konnten weder mit ihrem Studium in den USA noch mit ihrem Berufsziel ›Wissenschaftsmanagement‹ etwas anfangen. Und wenn Menschen, vor allem Männer, von Forschung und Molekularbiologie nichts verstanden, langweilten sie sich schnell mit ihr.
Mit Felix war das anders. Sie wälzten nächtelang Ideen. »Intelligenz ist sexy«, raunte er ihr manchmal ins Ohr, und das war fast schon einen Orgasmus wert.
Sophie mixte den zweiten Margarita für Felix und schob Mariah Carey in den CD-Player; auf die standen sie beide total. Tacos waren Felix’ Lieblingsessen, dazu ein wenig Guacamole-Dip; damit konnte man ihn eigentlich, zumindest kulinarisch, immer glücklich machen. Felix streckte sich auf dem weißen Bett aus und räkelte sich nackt in den Kissen. Es war halb elf, und es waren noch knapp zwei Stunden Zeit, ehe er nach Hause fahren mußte.
»Wo hast du das Kondom versteckt?« fragte Felix schmunzelnd.
»Ja wo denn nur? Wo kann es denn nur sein?« Sophie gluckste vor Übermut, hob mit suchendem Blick die Bettdecke und bedeckte Felix mit zärtlichen Küssen. Sie hatte nur noch den champagnerfarbenen BH an und die hellen Strümpfe. Das Kleid hatte ihr Felix schon vor dem zweiten Margarita ausgezogen.
»Das brauchen wir heute nicht, Schatz«, hauchte sie in seine Lenden. Felix sagte nichts. Erst zwei, drei Sekunden später setzte er sich leicht auf und suchte seine Brille.
»Wieso, ist das denn nicht gefährlich, heute am 13. Tag?«
Sophie stutzte. Seit wann hatte Felix ihren Menstruationszyklus im Kopf?
Sanft kraulte sie seine Haare im Nacken, dort wo sie noch voll und dicht waren.
»Nein, heute brauchen wir es nicht, Felix.« Sophie suchte seinen Blick und forschte in seinem Gesicht. Sie kannte ihn zu gut, um nicht zu merken, daß irgend etwas nicht stimmte.
»Wir wollen doch schon lange ein Kind, und wir könnten doch einfach dem Schicksal seinen Lauf lassen, heute an unserem zweiten Jubiläumstag?« Sophie merkte sofort, daß ihre wohlgewählten Worte nicht gerade erektionsfördernd gewirkt hatten.
»Süße, hol ein Kondom, und laß uns hinterher diskutieren!« stöhnte er und widmete sich schnell ihrer rechten Brustwarze. Was war nur los?
»Felix, bitte nur einmal, du weißt doch, wie sehr ich mir ein Kind wünsche.«
»Sophie«, seine Stimme wurde schärfer, »dann streichle mich einfach, faß mich an, oder okay, ich werde aufpassen. Das ist zwar immer noch riskant, du weißt, daß du mich wahnsinnig machst, aber wenn du unbedingt willst ... quäl mich nicht, bitte.« Felix stammelte wie von Sinnen. Irgendwie ergaben seine Wortfetzen keinen Sinn. Vor drei Wochen hatten sie noch bei einem Abendspaziergang auf der Kö vor ›Mamas Traum‹ gestanden, dem Nobel-Babygeschäft von Düsseldorf, und Felix hatte staunend die kleinen Strampelanzüge bewundert. »Ach, wie süß«, hatte er damals gesagt.
»Nein Felix«, und nun wurde Sophies Stimme etwas lauter als gewöhnlich, »so meine ich es nicht. Ich möchte ein Kind. Wir haben doch oft darüber gesprochen. Du hast immer gesagt, daß du einmal ein Kind mit mir haben willst, und da dachte ich, warum nicht jetzt. Wir lieben uns doch. Ich bin vierunddreißig, ich kann doch nicht ewig warten!«
Felix’ Gesichtszüge wurden völlig ruhig. Er setzte sich auf die Bettkante, sah sie an und fragte: »Ist das dein Ernst?« Eine steile Falte bildete sich auf seiner hohen Stirn.
»Ja.«
»Sophie, du solltest wissen, daß man mich nicht erpreßt.«
Er stand auf, suchte seine Hose und wollte sich in der Tat anziehen. Er hätte ihr auch einen Eimer eiskaltes Bergwasser über den Kopf gießen können, und Sophie wäre nicht minder geschockt gewesen.
»Felix, ich verstehe dich nicht, komm laß uns reden.«
»So nicht, Sophie.«
»Felix, wir lieben uns, gib doch dem Schicksal eine Chance. Das ist doch nicht zuviel verlangt. Ich habe dich noch nie um etwas gebeten oder dich gedrängt! Ich habe es ertragen, daß du es immer wieder hinausgezögert hast, mit deiner Frau zu sprechen. Ich habe nichts gesagt, als du Weihnachten mit ihr gefeiert hast und nicht mit mir. Ich habe nichts gesagt, als du im Sommer zwei Wochen mit ihr in die Karibik geflogen bist. Ich habe ...«
Sophies Stimme überschlug sich. Irgendwie brach ausgerechnet in dieser Sekunde ihr mühsam unterdrückter Kummer der letzten Monate heraus. Die Trennung von Felix und seiner Frau war einfach nicht vorangekommen. Dabei hatten sie sich nichts mehr zu sagen. Die Ehe war am Ende. Das hatte er ihr doch so oft eindrücklichst erzählt. Sie hatte dem heutigen Abend so sehr entgegengefiebert, und jetzt das ...
»Sag nichts mehr, was dir morgen leid tun könnte.«
So hatte Felix noch nie mit ihr gesprochen. Sophie saß zitternd im Bett und verstand die Welt nicht mehr. Noch vor wenigen Stunden schien die Zukunft rosig. Es schien alles so einfach. Warum reagierte Felix so hart, so unnahbar, als hätte sie ihm einen unsittlichen Antrag gemacht? Sie forderte ihn ja nicht zu einem Verbrechen auf! Stundenlang hatten sie darüber gelacht und gescherzt, wie es wäre, ein Kind zu haben. Nie hatte Felix gesagt, daß das alles für ihn unvorstellbar war. Nie, nicht ein einziges Mal.
»Du mißbrauchst mein Vertrauen. Du weißt, in meiner Position, ein uneheliches Kind, das ist unmöglich. Schlag dir das aus dem Kopf!« Mit diesen Worten stand er auf. Er zog langsam seine graue Hose und sein hellblaues Hemd an, knöpfte jeden Knopf einzeln sorgfältig zu und band sich die gelb-blau gestreifte Krawatte um. Gerade wollte er sich das dunkelblaue Jackett über die Schulter werfen, da brannte bei Sophie die Sicherung durch. »Felix, wenn du jetzt gehst, dann ...«, ihre Stimme wurde immer leiser, »dann geh, aber komm nie wieder, und laß meinen Wohnungsschlüssel hier!« Ihr Gesicht war schmerzverzerrt. Tränen liefen unaufhaltsam über ihre Wangen und hinterließen kleine Spuren von blauer Wimperntusche.
Der kleine Sicherheitsschlüssel mit dem zierlichen Herzanhänger schlug hart auf dem schönen Parkettboden auf.
Kapitel 2
Den Morgen danach würde Sophie bis an ihr Lebensende nicht vergessen. Wie eine Steinstatue lag sie im Bett und wartete darauf, daß Felix hereinstürmen, sich aufs Bett werfen und seine geistige Verwirrung vom Vorabend unter langen Küssen ungeschehen machen würde. Bis ihr einfiel, daß ihr Wohnungsschlüssel, also eigentlich seiner, irgendwo unter dem Bett liegen mußte, dort, wo er ihn im Eifer des Gefechts hingepfeffert hatte. Als diese Erkenntnis Sophies Hirnwindungen durchdrang, sprang sie auf und rannte ins Bad.
Hier waberte, erkaltet, die mit Rosenöl getränkte Brühe in der Wanne. Zitternd saß die vierunddreißigjährige Karrierefrau auf dem Klodeckel und starrte in die kleinen Öltröpfchen. Sollte sie, Sophie Lackmann, sich so sehr in einem Menschen getäuscht haben? Besaß sie nicht einen Funken Menschenkenntnis? Hatte Felix denn immer nur gelogen, wenn er über ein gemeinsames Kind sprach? Seine Frau, das hatte er doch immer betont, wollte keine Kinder, und die Trennung war nur eine Frage der Zeit. Hatte sie, die durchaus selbstsichere Sophie mit der exzellenten Ausbildung und den rosigen Zukunftsaussichten, sich so sehr blenden lassen? War sie etwa zwei Jahre lang die willige Gespielin des Herrn Professors gewesen?
»Nein, so kann es nicht sein. Das ist doch echte Liebe. Felix wird sicher bald anrufen, und alles wird wieder gut«, versuchte sie sich selbst mit fester Stimme einzureden. Vielleicht fühlte er sich nur überrumpelt. Vielleicht hatte sie einfach den falschen Tag erwischt, war zu dominant mit ihren Tacos und dem sprungreifen Ei dahergekommen? »Beruhige dich, Mädchen, atme tief durch, es wird sich klären«, riet sie sich selbst.
So ähnlich mußte sich auch Vivien Leigh aus ›Vom Winde verweht‹ gefühlt haben. Als Scarlett stand sie vor den Trümmern ihres Zuhauses, vor den Scherben ihrer Ehe mit Rhett Buttler und behauptete dennoch trotzig: »Morgen wird mir schon einfallen, wie ich ihn mir wieder erobere. Schließlich, morgen ist auch ein Tag.«
Nicht daß sich Sophie eingestehen wollte, daß sie mit Männern immer Pech hatte, aber ihre Gedanken drifteten an diesem Morgen gefährlich in die Nähe von Selbstmitleid und Weltuntergangsstimmung. Vielleicht waren ihre Ansprüche nur zu hoch, vielleicht wollte sie nur mehr, als solch ein Y-Chromosom überhaupt in der Lage war zu geben. Auf dem männerspezifischen Y-Chromosom waren soundso nur wenige rudimentäre genetische Informationen. Das hatten Forscher erst kürzlich zweifelsfrei festgestellt. Nur die Bildung der Hoden, die Reifung der Spermien und zum Teil die Körpergröße schienen von Genen des Y-Chromosoms gesteuert zu werden. Genetisch gesehen, keine Glanzleistung. Eine Art Krüppel-Chromosom, hatten Feministinnen in den diversen Fachzeitschriften genüßlich kommentiert. An diesem Morgen fand Sophie, daß sie allesamt recht hatten. Wie konnte ein Mann etwas sagen und etwas anderes meinen, und wie konnte eine Frau, die nicht auf den Kopf gefallen war, darauf hereinfallen?
Bei den meisten Beziehungen war Sophie spätestens nach einem halben Jahr klar, daß die Verbindung endlich sein würde. Wenn es sie morgens schon nervte, wie der augenblickliche Herzallerliebste sein Ei köpfte, dann wußte sie – und wenn sie ehrlich drauf war, konnte sie es sich sogar eingestehen –, daß es nicht mehr lange gutgehen würde. Die besten Rezepte, um sich von einem Freund zu trennen, hatte Sophie alle ausprobiert. Es gab mehrere Möglichkeiten, das Ende einer Liebe zu beschleunigen. Das war ihr schon seit Jahren klar.
1. À la Rosenkrieg: Wenn schon Ende, dann wenigstens Genugtuung bis zur bitteren Neige.
2. Die ehrliche Aussprache: Das ging nur zu Beginn, wenn man schonungslos jede Veränderung der Gefühlslage benannte und nichts verschwieg.
3. So weitermachen wie bisher: Auf den Glücksfall hoffen, daß sich vielleicht der andere entfernte – die Variante für Feiglinge.
4. Die Verzweifelte spielen: »Ich kann nicht mehr, bitte versteh mich.« Depressive Züge entwickeln und unausstehlich werden. Der Nachteil: Das kostete Kraft und dauerte lange.
5. Die Rambo-Nummer: Man ließ sich absichtlich beim Seitensprung erwischen und brauchte nicht mehr viel zu erklären.
6. Die Keine-Leiche-im-Keller-Nummer: Trennung langsam und behutsam, aber deutlich vorbereiten. Nachteil: Das konnte Monate dauern.
Sophie hatte alle Varianten getestet und war zu guter Letzt immer bei Nummer 6 geblieben. Erfahrung, was zu tun war, wenn Männer sich von ihr trennen wollten, konnte sie allerdings nicht vorweisen. Normalerweise reagierte sie sensibler und kündigte die Beziehung auf, ehe es der Liebhaber vielleicht Monate später getan hätte. Bei Felix hatten sie ihre Instinkte verlassen, wobei ja eigentlich nicht gesagt war, daß er sie verlassen hatte. Seine letzten Worte waren gewesen: »Mich erpreßt man nicht.« Was ja soviel heißen mußte, daß die Liebesbeziehung durchaus wieder einzurenken wäre, wenn Sophie reumütig die Baby-Idee zurückziehen würde. Wäre dann nicht wieder alles beim alten?
»Mensch, Sophie, Felix ist der tollste Mann, der dir je über den Weg gelaufen ist, er liebt dich, er bietet dir sexuell und intellektuell genau das, was du brauchst. Reiß dich zusammen und warte einfach noch ein Jahr mit dem Baby. Wer weiß, wie sich die Dinge dann entwickelt haben«, so redete sie auf sich selbst ein und bekam langsam einen klareren Kopf. Warum sollte eine Frau wie sie, einigermaßen attraktiv, intelligent, loyal, warmherzig und sexy, sich die Seele aus dem Leib heulen?
»Gut, ich rufe ihn an, übermorgen vielleicht. Immerhin soll er wissen, daß man mit mir nicht beliebig umspringen kann.«
Doch was wäre zu tun, wenn er, derart schockiert, gar nicht mehr wollte? Nach den vielen Möglichkeiten, wie man sich trennen konnte, wenn man sich trennen wollte, fielen ihr auf die Schnelle nur drei praktikable Varianten ein, was zu tun war, wenn man ›getrennt wurde‹:
1. Fatal attraction: nicht aufgeben und kämpfen.
2. Vogel Strauß: weg und vergessen.
3. Subtile Demontage: den anderen schlecht reden, schlecht denken und am Ende auch schlecht finden. Das hieße: Sie müßte ihr inneres Bild von Herrn Professor Felix Northeim neu einfärben, von rosarot in giftgrün.
Sophie entschied sich am Mittwoch morgen, nachdem sie im Büro angerufen hatte, daß erst mittags mit ihrem Erscheinen zu rechnen sei, für den dritten Ansatz. Der Tag verging wie in Trance – Felix rief nicht an, wie einen ja sowieso nie jemand anrief, wenn man es sich wünschte – und abends sah sie sich ihr gemeinsames Album an. Das war sonst der Trost einsamer Sonntagnachmittage gewesen. Jeder Tag und jede Nacht waren in diesem Tagebuch der Liebe dokumentiert. Datum, einige Bemerkungen, ein Weinetikett, eine Hotelrechnung, ein Foto – Erinnerungen aus einer anderen Welt.
Sophie hatte wenig Übung in Demontage, und deshalb waren ihre ersten Versuche auch eher täppisch. Lächelte er hier vor dem Hotel in Florenz nicht sehr selbstgefällig? Und da: Bevor sie im ›Spago‹ in Beverly Hills gegessen hatten – die Rechnung belief sich auf gut dreihundert Dollar – mußte sie da nicht zwanzig Minuten im Bad warten, bis er mit seiner Frau telefoniert hatte? Hier mußte er einen Tag früher aus München zurückfliegen, weil der Vater seiner Frau gestorben war.
Aber Felix Northeim widerstand der Demontage energisch. Sie liebte ihn einfach viel zu sehr. Dann klingelte das Telefon.
»Hallo Süße, bist du okay?«
»Nein.«
»Soll ich vorbeikommen, ich hätte ein halbe Stunde Zeit.«
»Ja.«
Sophie flitzte ins Bad, schmiß sich in den engen roten Hausanzug, räumte die Küche auf, stellte den Champagner ins Eisfach, zündete die Kerzen an, packte das Album weg und legte seinen – also ihren – Schlüssel auf den Tisch und wartete.
Felix nahm sie in die Arme, hielt sie ganz fest. Er hatte Tränen in den Augen. Sie hatte sich also doch nicht getäuscht.
»Meine Geliebte, du ahnst nicht, wie sehr ich dich liebe, dich begehre, dich brauche. Ich kann ohne dich gar nicht leben.«
Sie hatte doch gewußt, daß der gestrige Abend nur ein böser Traum gewesen war. Felix und Sophie saßen auf der blaugemusterten Ralph-Lauren-Bettdecke. Er hielt ihre Hand und drehte langsam an dem Ring, den er ihr zum Geburtstag im August geschenkt hatte. Ein kleines Herz aus Gold. Felix redete mit einer Stimme, so weich und sexy, mit absolutem Schmelztimbre, daß Sophie den Inhalt seiner Sätze erst allmählich begriff.
»Schatz, ein Kind ist undenkbar. Du bist neun Monate schwanger, womöglich ist dir Sex plötzlich nicht mehr so wichtig. Du wirst dich schrecklich unförmig fühlen, und dann die Geburt, glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche, das ist eine Tortur. Ich erlebe das jeden Tag in der Klinik. Es gibt Frauen, die hassen ihre Männer dafür, was sie ihnen angetan haben. Das ist doch kein Zuckerschlecken.« Felix sprach sanft und leise, aber nichtsdestotrotz eindringlich auf Sophie ein.
Sophie sagte keinen Ton. Ihr rechter Zeigefinger zeichnete wie in Zeitlupe das Muster der Decke nach. Felix streichelte über ihre Haare und sprach weiter.
»Allein diese Verantwortung. Das kann man doch nicht überstürzen, vielleicht später. Außerdem kann ich das meiner Frau jetzt unmöglich antun. Sie plagt sich mit einer verschleppten Bronchitis herum und muß sich schonen. Das mußt du verstehen. Jetzt kann ich mich nicht trennen; du mußt mir Zeit lassen. Außerdem habe ich gerade solch einen Ärger. Sie wollen mir in der Klinik einen zweiten Chefarzt, der vor allem die Geburtshilfe übernehmen soll, an die Seite stellen, stell dir das mal vor – das kostet mich im Moment einfach zuviel Kraft, später, ja vielleicht, später.« Seine Stimme hatte einen bittenden, ja flehenden Unterton bekommen. Er klang so verzweifelt, so schutzbedürftig.
Ihr Herz flüsterte ›ja, du hast recht, mein Geliebter‹; ihr Verstand schrie ›welch schäbige Hinhaltetaktik‹. Sie ließ ihn sich weiter um Kopf und Kragen reden und schaute Felix in die blaßgrünen Augen, und irgendwie war nichts mehr so, wie es einmal gewesen war.
Wie beginnt doch der Film ›Jenseits von Afrika‹ so wehmütig: ›Ich hatte eine Farm in Afrika. Am Fuße der Ngong-Berge.‹ Genauso zart und memorabel, dachte Sophie plötzlich, könnte doch meine Geschichte beginnen: ›Ich liebte einen verheirateten Mann. Und habe fest an die Zukunft geglaubt. Wir hatten zwei wundersame Jahre, so intensiv und unwirklich, daß wir wohl beide an unsere Zukunft geglaubt haben. Es war eine Illusion von unendlicher Freundschaft und Hingabe.‹ Diese Gedanken ließen sie nicht mehr los.
Ihre Freundinnen hatten sie ja gewarnt: ›Es wird bei dir genauso enden, wie es in 99 Prozent der Fälle endet! Er wird sich nie von seiner Frau trennen!‹ Sophie hatte dagegen geglaubt, daß sich am Ende ihre Geduld auszahlen würde. Doch sie hatte eindeutig einen Fehler gemacht. Am Ende siegte wohl immer nur der Schmerz.
»Ich bin die Leiche im Keller«, murmelte sie vor sich hin, als Felix ein Argument nach dem anderen darlegte. Und irgendwie wurde er erst still, als sie seinen Reißverschluß langsam öffnete. Es wurde die verzweifeltste gierigste Nacht dieser großen Liebe, wohl weil ihr klar war, daß es die letzte sein würde. Schweigend öffnete Sophie die Kondompackung. Sie würde diesen Mann ewig lieben, aber ihr Leben wollte sie ihm nicht opfern. Nach wenigen Jahren wäre aus der klugen und hübschen Sophie Lackmann doch eine verbitterte Alt-Geliebte geworden. Nein, dann wollte sie lieber jetzt mit vierunddreißig als mit zweiundvierzig leiden.
Sophie verabschiedete Felix erst um zwei Uhr nachts mit einem langen Kuß, lag bis fünf Uhr wach und beschloß dann, eine sündhaft teure Creme auf die verquollenen Augen aufzutragen, um für den nächsten Tag das Schlimmste zu verhindern.
Im Büro stand die monatliche Konzeptionsbesprechung an, und das hieß am Donnerstag morgen: »Frau Lackmann, bitte berichten Sie über die Aktivitäten im letzten Monat und die anstehenden Projekte.«
Eine Stunde referierte sie im Alleingang. Die, die sie gut kannten, merkten vielleicht, daß nicht alles in Ordnung war, aber ihr Chef David Parker ließ sich leicht täuschen. Er besaß nicht für fünf Pfennige Gespür für Menschen. Seinen grauen Augen entging eigentlich immer alles, was wichtig war. Dafür paßten sie hervorragend zu seinen grauen Anzügen und den leicht blau getönten Hemden, die er immer trug. Ein Mensch, verwechselbar und unspezifisch wie eine graue Maus. Er war nicht gerade unansehnlich mit seinen einundvierzig Jahren – Tante Billie würde sagen, ›den schubst man nicht von der Bettkante‹ –, aber Leidenschaft war für Parker ein Fremdwort. In jeder Beziehung. Er verströmte ein Art Fürst-Pückler-Charme, immer halb gefroren.
Nur Bodo lud sie nach der Konzeptionsbesprechung auf einen Kaffee in die Firmen-Luxuskantine ein und fragte unvermittelt: »Irgendwas schiefgelaufen?«
»Schief ist gut, Bodo, meine ganze Lebensplanung wurde in den letzten zwei Tagen über den Haufen geschmissen. Ich sollte jetzt eigentlich schwanger sein und langsam anfangen, saure Gurken zu essen.«
»Hähh, was soll das denn? Etwa von Felix? Der ist doch immer noch verheiratet!«
»Ach, vergiß es«, seufzte Sophie.
»Ich wußte nicht, daß du ein Kind willst«, hakte Bodo erstaunt nach und nahm ihre Hand. Bodo war der hauseigene Patentanwalt bei Gene Dream, neunundreißig, gepflegt, höflich und ein enger Vertrauter von Sophie. Mit ihm konnte sie über fast alles reden.
»Doch, von Felix, nur von Felix«, schluchzte Sophie.
Bodo war so ziemlich der einzige, bis auf ihre Freundinnen Annette und Sabine natürlich und Tante Billie, der etwas von ihrem Verhältnis wußte. Aber auch er konnte jetzt wahrscheinlich nur ahnen, was Felix ihr bedeutete.
»Sophie, ich habe dich vor ewigen Zeiten beschworen, es zu genießen und sonst nichts, keine Hoffnungen, keine Perspektive«, redete ihr Freund Bodo zuckersüß auf sie ein.
»Ich kann nicht anders«, war die einsilbige Antwort. Und da sie ansonsten wohl selten solch ein entwaffnendes Argument ins Feld führte, schwieg Bodo. Aber natürlich machte er sich so seine Gedanken. Er hatte die Affäre zwischen Northeim und Sophie immer für einen Fehler gehalten. Erstens redete die ganze Firma darüber, was Sophie Gott sei Dank nicht mitbekam, und zweitens war das seiner Meinung nach ein ungleiches Spiel. Der stadtbekannte Professor, eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet, allem Anschein nach halbwegs glücklich verheiratet, mit gesellschaftlichen Verpflichtungen, hielt sich in der Stadt eine Geliebte.
Bodo mochte Sophie wirklich, und wenn er nicht schwul wäre, hätte er sich für die nette Pressesprecherin durchaus näher interessieren können, aber Sophie war einfach naiv. Sie hatte so gar keinen Hang zu Intrigen und Ränkespielen, und manchmal schätzte sie Menschen nicht richtig ein, sah immer nur das Gute. Es wurde wahrscheinlich Zeit, daß sie die rauhe Wirklichkeit akzeptierte. Sicher, Felix Northeim war ein toller Typ, aber eben eine Klasse zu groß für eine Sophie Lackmann, die trotz Studium und Auslandsaufenthalt doch immer das nette Mädchen aus Duisburg geblieben war. Der Kelch mit negativen Erfahrungen und Enttäuschungen war bisher an ihr vorübergegangen. Damit war jetzt wohl Schluß. Jetzt hatte es Sophie erwischt.
Nach drei langen Minuten meinte Bodo: »Dann mußt du dein Leben eben ohne ihn leben. Aber lebe dein Leben. Wenn du ein Kind willst, dann laß dir halt eins machen.«
»So kompromißlos können nur Schwule daherreden, die jahrelang ihre homosexuelle Veranlagung vor den Eltern, Schulkameraden, und Arbeitskollegen geheimgehalten haben«, giftete Sophie los. »Dann laß dir halt eins machen«, äffte sie ihn nach, »Mensch Bodo, bist du so naiv oder tust du nur so?« Sophie verdrehte die Augen. Bodo war für sie so ziemlich der angenehmste und vertrauenwürdigste Mann, den sie sich vorstellen konnte, was Tante Billie, nachdem sie Bodo zum erstenmal gesehen hatte, zu der Bemerkung verleitete, ›nur schwule Männer sind gute Männer‹. Aber manchmal verstand er Frauen eben doch nicht.
»Ja, sicher will ich ein Kind, aber nicht irgendein Kind, sondern ein Kind von Felix! Geht das in deinen schwulen Schädel rein?!«
Bodo drehte sich erschrocken um. Wenn Sophie weiterhin so laut schrie, hätte sie auch eine Anzeige im ›Kurier‹ aufgeben können. Sophie verlor anscheinend völlig die Nerven.
»Überleg doch mal, ob du ihn damit nicht zwingen willst, seine Frau zu verlassen und zu dir zu ziehen«, zischte Bodo, »oder willst du dir nur deine einsamen Wochenenden erträglicher machen?«
»Spinnst du, ich liebe Felix.«
»Traumprinzessin«, war Bodos einziger Kommentar, »wenn du ein Kind willst, dann mach es dir doch selbst. Kein Mann ist es wert, an ihm zu verzweifeln.«
Schweigen. Beide sagten nichts und nippten stumm an dem kalten Kaffee.
»Die Uhr tickt, Bodo. Was soll ich nur tun? Wie viele Jahre bleiben mir denn noch? Wie lange soll ich jetzt warten, ehe ich wieder einen Mann kennenlerne, mit dem ich mir ein Kind vorstellen kann und er sich eins mit mir?« Sophies Stimme klang immer verzweifelter und mutloser. Bodo hatte den wunden Punkt erwischt.
»Immer mit der Ruhe, Sophie, ich geb dir einen Rat. Überleg, was du wirklich willst, nur du!«
»Bodo, was soll ich denn wollen? Ich bin vierunddreißig, vielleicht habe ich Glück und ich lerne einen Traumvater mit fünfunddreißig kennen. Ein Jahr Zeit muß man sich ja gönnen, um den anderen kennenzulernen. Einmal alle Jahreszeiten miteinander erleben, einmal zusammen skifahren gehen, Silvester feiern, im depressiven Herbstwetter spazierengehen oder mit dem Rucksack durch Südamerika trampen.« Ihre Augen füllten sich schon wieder mit Tränen.
»Sind das deine entscheidenden Tests?« Bodo bemühte sich krampfhaft um einen sachlichen Ton. Auf solch eine Grundsatzdiskussion war er nicht vorbereitet.
»Ja, klar.« Sophie kramte verstohlen nach einem Taschentuch. Was konnte Bodo schon über die Eignungen für einen Mann fürs Leben wissen?
»Kann er meine schlechte Laune ertragen, wenn ich meine Periode bekomme? Bleibt der Sex auch nach einem Jahr noch aufregend? Das muß man doch wissen, wenn man ein Kind zusammen großziehen will. Ein Jahr ist das Minimum an Feuertaufe, um überhaupt an ein Kind zu denken, Bodo, verstehst du das nicht. Außerdem kann man wohl schlecht am ersten Abend mit der Tür ins Haus fallen. Dann wäre ich sechsunddreißig. Nehmen wir an, es dauert dann ein knappes Jahr, ehe es überhaupt klappt, dann wäre ich siebenunddreißig. Und mein süßes Baby würde ich dann erst mit bald achtunddreißig in den Armen halten. Das sind noch vier Jahre. Das ertrage ich nicht, niemals, Bodo, niemals.« Sophie stützte ihr Gesicht in die rechte Hand.
»Man erträgt viel, Sophie.«
Mit solchen Allgemeinplätzen konnte die Lackmann, wie man Sophie im Büro oft hinter ihrem Rücken nannte, normalerweise nichts anfangen, aber heute, tat es einfach nur gut, einem Menschen alles zu erzählen. Ihre Stimmung war auf dem Tiefpunkt angelangt.
»Wäre ich nur als Mann auf die Welt gekommen, Bodo. Glaub mir, du hast es gut. Mir wäre die Sehnsucht nach einem Kind erspart geblieben. Ich könnte, wenn ich sie denn doch hätte, täglich versuchen, eine andere zu schwängern. Ich würde ein paar hundert Mark im Monat zahlen und könnte sonntags mein Kind abholen und mit ihm in den Zoo gehen. Meinen Job müßte ich nicht aufgeben, schließlich lebt man als Vater munter so weiter wie bisher, nur mit der Bereicherung, daß sich irgendwo eine Frau tagein, tagaus um den Nachwuchs kümmert. Ich dagegen habe ein Scheißleben als Frau mit Mitte Dreißig.«
Bodo starrte Sophie einigermaßen verständnislos an. So hatte er die Sache noch nie gesehen.
Als Sophie an diesem Abend nach Hause kam, war ihr klar, daß wieder einmal ihr preisgünstiger Psychotherapeut würde herhalten müssen, um ein wenig Ordnung zu schaffen. Vielleicht hatte Bodo recht, sie mußte die Gedanken an Felix ausschalten und in sich, nur in sich selbst, hineinhorchen. In solchen Situationen schrieb Sophie immer in ihr Tagebuch. Leider überkam sie das Bedürfnis nur, wenn sie derangiert war, aus dem Gleichgewicht. Deshalb las sich das Tagebuch auch wie eine Ansammlung von Trauer, Wut, Zynismus und Weltschmerz, als sei ihr Leben das elendigste auf Erden.
In schwierigen Zeiten hörte Sophie immer gerne Tom Waits. Der war so wunderbar traurig und machte trotzdem nicht depressiv. Wie der das mit seiner völlig versoffenen Stimme hinbekam, war ihr zwar ein Rätsel, aber es wirkte immer. Zwar hatte sie bereits einige Trennungen hinter sich, wenn auch bislang immer selbst eingeleitete, aber das bedeutete ja nicht, daß sie diese leere Wohnung, diese plötzliche Einsamkeit nicht trotzdem beschissen fand. Es dauerte immer eine Weile, bis alle Freunde informiert waren, wieder spontan anriefen, einen ins Kino mitnahmen, oder nur ins Leo’s. Dabei ging Sophie eigentlich auch immer gerne allein aus. Es machte ihr nichts, solo am Margarita zu nippen, aber es war schlicht gewöhnungsbedürftig.
In diesen trüben Düsseldorfer Herbsttagen fing Sophie Lackmann an, ihre Post-Felix-Ära neu zu organisieren. Felix war auf der alljährlichen internationalen Jahrestagung der Biochemiker in Venezuela und ließ sich wahrscheinlich gerade die Äquatorsonne auf den Bauch scheinen. Sie war also völlig ungestört bei der Suche nach neuen Lebensperspektiven: kein Felix, kein Kind.
Zunächst unbemerkt wich die traurige Lethargie einer unendlichen Wut. ›Wieso‹ – dieser Gedanke ließ sich gar nicht mehr aus ihrem Gehirn verdrängen – ›wieso, in drei Teufels Namen, brauche ich einen Mann, um mein Leben zu leben?‹
Diverse Essays in Fachzeitschriften hatten die männerlose Gesellschaft bereits vorhergesagt. Männer zum Kinderzeugen waren eigentlich völlig unzeitgemäß. Die Spermienqualität wurde so und so immer schlechter, jedes zehnte Paar brauchte schon heute die Assistenz eines Reproduktionsmediziners, um an den ersehnten Nachwuchs zu kommen. Chemikalien, Pestizide und weibliche Hormone im Trinkwasser senkten die männliche Zeugungskraft. Wer sich als Frau heutzutage ein Kind wünschte, tat gut daran, fünfzig Mark für einen Spermien-Fitneß-Test zu opfern. Das Testset war in jeder Apotheke zu haben, und damit ließ sich zumindest ungefähr prognostizieren, ob der Geliebte, der zukünftige Ehemann, oder wer auch immer, potentiell zeugungsfähig war. Bei genügend bewegungsfähigen Samenzellen färbte sich die Lösung im Teströhrchen lila. Man benötigte dafür schlicht drei Milliliter frisches Sperma.
Und mit der Ehe als Dauer-Institution war es auch nicht mehr weit her. Nach vier Jahren, so die statistischen Berechnungen, stand unweigerlich die Trennung ins Haus. Knapp zwei Millionen Mütter erzogen ihre Kinder bereits jetzt alleine, und Sophie konnte leicht hochrechnen, wie viele es inoffiziell waren, wenn sie sich nur in ihrem Freundeskreis umschaute.
»Warum fang ich dann nicht gleich alleine an?« redete sie auf ihren Bruder Peter ein, eigentlich einen denkbar ungeeigneten Ratgeber in Liebesdingen und besonders in puncto Schwangerschaften. Er hatte immerhin schon einige Herzdamen zu einem Abbruch in Holland überreden müssen. Sie saßen nach zwei Whiskey sour im Swimmingpool, der neuen Disco am Düsseldorfer Hafen, und philosophierten angestrengt über den Sinn des Lebens. Peter hatte Sophie eingeladen – auf eine Anti-Depri-Tour, wie er es nannte. Neun Tage nach dem ersten Eklat mit Felix schien Sophie immer noch in Selbstmitleid zu versinken. Peter hatte an diesem Abend alle Termine mit seinen joggenden Millionärsgattinnen abgesagt.
»Mein Gott, datt du immer alles gleich so kategorisch sehen mußt, Schwesterherz!«
»Was schlägste denn vor? Du wirst sicher als Sechzigjähriger mit deinem Sohnemann Bauklötze stapeln!« war ihre Retourkutsche. Peter war erst neunundzwanzig, also fünf Jahre jünger als Sophie, und dachte überhaupt nicht an Nachwuchs. Ein gutaussehender, sportlicher Typ mit langen, blonden Haaren, Personal-Fitneßtrainer einiger gestreßter Manager und noch einsamerer Ehefrauen dieser ewig abgehetzten Typen. Irgendwie umwaberte Peter ein leichter Loser-Hautgout: abgebrochenes Sportstudium, abgebrochenes Informatikstudium, eben ein Verlierertyp. Er ließ sich treiben und genoß sein Leben. Jede Woche eine andere Perle im Bett. Keine einzige Sorgenfalte zierte sein markantes James-Dean-Gesicht, nur daß Peter etwa fünfzehn Kilo mehr wog, als James Dean jemals auf die Waage brachte.
»Datt is so dermaßen ungerecht«, fauchte Sophie bereits mit schwerer Zunge, »Anthony Quirin hat mit dreiundachzig nochn Kind gezeugt. Dem kannste es ja nachmachen, irgend’ne kleine Masseuse findeste sicher auch mal, mußt nur’n bißchen berühmt werden, oder etwas Kleingeld auf die hohe Kante legen!«
»Jetz mach aber mal ’en Punkt, übertreib doch nich so schamlos. Im Leben gibt ett eben nich immer nur ’ne Punktlandung. Watt glaubse denn?«
»Logisch, keene Punktlandung, du Trottel, aber, daß so’n Type wie Felix mir echt diktiert, wann ich en Kind kriege, datt is doch der Oberhammer.« Peter wußte nicht allzuviel über ihre Affäre mit Felix Northeim, nur, daß er verheiratet war und ein ziemlich angesehener Arzt. Das war auch gut so.
Die Thematik entglitt Sophie eindeutig, was schon leicht daran zu erkennen war, daß sie – ebenso wie Peter – in einen Mischmasch aus Ruhrpott-Slang und Kölsch verfiel. Logisch, Sophie und Peter waren ja auch in Duisburg großgeworden.
»Dann such dir doch nen coolen Typen, der dir en Kind macht, hock dich mit dem inne Dreizimmerbude, häng den Job an nen Nagel, züchte en paar Tauben im Hof und bring dem Alten abends sein Bier! So einen findste immer!«
Diese bemerkenswert unqualifizierte Aussage ihres Bruderherzchens machte Sophie einmal mehr klar, daß sie in zwei verschiedenen Welten lebten. Sonst hätte er wissen müssen, daß so ein Typ sie nicht mal mit der Kneifzange angefaßt hätte.
»Die suchen sich ne willige Kosmetikerin, und nicht so ein Karriereweib wie mich. Da käm es wahrscheinlich noch nicht mal im Vollrausch zur Zeugung, weil die bei mir gar keinen hochkriegen.«
»Für eine Nacht reicht’s immer«, feixte Peter.
»Du kapierst einfach nie was. Dein IQ kann nicht mal über 100 liegen!«
Sophie ging die Diskussion mit Peter gehörig auf die Nerven. Sie war kultiviertere Unterhaltungen gewohnt, und genau das schrie sie ihm auch mitten ins Gesicht. Sophies Hals war sowieso schon rauh, weil die Dezibel, die sie brauchte, um den Funk-Jazz zu übertönen, ihre Stimmbänder völlig verkrampft hatten. Sie ging also allein auf die Tanzfläche. Intellektuell war mit Peter heute sowieso nichts mehr anzufangen.
Peter gönnte sich einen weiteren Whiskey sour. Seine Schwester war ihm ein Rätsel. Sie hatte alles erreicht, Studium, einen tollen Job, einen Klasse-Lover mit Stil und Kohle, und jetzt wollte sie zu allem Überfluß auch noch ein Kind. Sophie konnte das Leben einfach nie so nehmen wie es kam, dachte er sich. Hätte er doch einen Schuß mehr Ehrgeiz von ihr und sie einen Schuß mehr Leichtigkeit des Seins von ihm. Dann hätten sie wohl beide weniger Probleme. Er machte sich ernsthaft Sorgen. Sophie hatte echt eine Krise, und dann zog sie ihr Ding meist ohne Rücksicht auf Verluste durch. Das kannte Peter schon. Sophie konnte rücksichtslos gegen sich und andere sein, wenn man sie tief verletzte und sie das Gefühl hatte, ungerecht behandelt worden zu sein. »Das muß ich verhindern, irgendwie«, schwor sich Peter an der Bar des Swimmingpool. Nur wie? Das wußte er auch nicht. Vielleicht würde Tante Billie seine wildgewordene Schwester zur Vernunft bringen können.
Sophie tanzte gerne alleine. Da konnte sie nachdenken, sich voll ihrem Körper hingeben, losgelöst vom Alltag. Wunderbar, genau das brauchte sie jetzt.
Plötzlich sah sie Achim, einen guten Freund von Peter, am Rand der Tanzfläche. Die beiden hatten drei Jahre zusammen in einer Zweizimmerwohnung gehaust, anders konnte man es wohl nicht nennen. Damals hatte Peter in Köln Sport und Achim Medizin studiert. Achim steuerte auf die Tanzfläche zu und schenkte Sophie sein süßestes Lächeln.
»Hi, Sophie, wie geht’s? Schön, dich zu sehen. Ist Peter da?«
»Steht da hinten an der Bar.«
»Kommst du mit, dann lasse ich uns einen schönen Margarita mixen?« fragte Achim und blitzte mit seinen tiefsinnigen Augen. Er war eher ein dunkler Typ, braune glatte Haare, sonnengebräunte Haut, immer ein Hauch von Latino-Bart im Gesicht, aber eben mit hellen Augen. Äußerlich der Typ, auf den Frauen total stehen, auch Sophie.
»Nein, ich kann keinen Margarita mehr sehen. Ich nehm einen Whiskey sour«, antwortete sie kühl. Spätestens da mußte Achim bemerkt haben, daß etwas nicht stimmte. Er zog sie an die Bar, nahm sie einmal fest in den Arm, und streichelte kurz ihre Wange.
Die Nummer nun wieder! Achim war latent, aber konstant in Sophie verliebt und ließ aber auch gar keine Gelegenheit aus, ihr das zu zeigen. Sie waren nie ein richtiges Paar gewesen, aber ein paarmal zumindest kurz davor. Achim war im Prinzip kein schlechter Liebhaber, beileibe nicht, eigentlich sogar ein guter ›Techniker‹, wie Tante Billie die Sorte Männer zu umschreiben pflegte, denen ein Schuß versaute Erotik fehlte. Nur irgendwie hatte es bei Sophie einfach nie richtig gefunkt. Sie mochte Achim, keine Frage, aber wenn sie ihn ein halbes Jahr nicht sah, dann krampfte sich ihr Herz nicht gerade vor Schmerz zusammen, dann steigerte sich die Sehnsucht keineswegs ins Unermeßliche. Wenn er da war, war es gut, wenn nicht, auch.
Er vergaß nie ihren Geburtstag, rief immer mal an, und wenn sie sich trafen, konnte es schon mal im Bett enden. So war das mit Achim und Sophie.
Lässig schmiß Achim seine Lederjacke über den Barhokker. Heute sah er in seiner schwarzen Jeans besonders niedlich aus. Einen süßen Knackarsch hatte der Gute, das mußte man ihm lassen. Jetzt ärgerte sich Sophie doch, daß sie nur die blaue Stretch-Hose und ein blaues T-Shirt übergeschmissen hatte, als Peter sie abends abholte. Wahrscheinlich sah sie ziemlich verschwitzt aus. Das Gröbste versuchte Sophie zwar auf der Toilette zu renovieren, aber nur mit mäßigem Erfolg. Sie hatte zuviel geheult und zu wenig geschlafen in den letzten Tagen. Kein Wunder, daß sie nicht wie das blühende Leben aussah, aber bei Achim war das eigentlich auch ziemlich egal.
»Is was mit Sophie?« fragte Achim sofort, als er sich neben Peter setzte.
»Die spinnt mal wieder!«
»Aha«, Achim orderte zwei Whiskey sour, »wieso«?
»Achim, laß mich bloß mit Sophie in Ruhe! Frag se selbs, die kindische Pute.« Peter war nicht gerade gesprächig.
»Ist es aus mit Felix?«
»Ja, wenn de datt genau wissen wills. Die willn Kind, er nich. Ende, Pustekuchen, so einfach.«
»Sie will ein Kind?« Achim starrte Peter wie ein Männchen vom Mond an. Sophie hatte mit ihm noch nie über ein Kind gesprochen, aber in den letzten zwei Jahren hatten sie ja auch nicht mehr soviel miteinander zu tun gehabt. Den Namen Felix konnte er schon nicht mehr hören. Felix hin, Felix her. Und jetzt auch noch ein Kind. Der war doch nun echt zu alt!
Peter und Achim unterhielten sich einsilbig, als Sophie – etwas aufgefrischt – wieder an die Bar zurückstolzierte. Peter drehte ihr demonstrativ den Rücken zu. Er war sauer wegen der heftigen Diskussion von vorhin, und irgendwie hatte er Sophie ihre gelegentlichen One-night stands mit seinem Freund Achim nie gegönnt. Achim war ihm eigentlich zu schade für diese Spielereien von Sophie. Aber Achim war alt genug! Peter war längst klar, daß er heute nicht mit Achim in irgendeiner Bar versumpfen würde. Achim war als Sophies Tröster schon immer ganz gut gewesen, und genau das brauchte Sophie heute sicher. So gut kannte Peter seine Schwester – auch auf die Gefahr hin, daß der Katzenjammer hinterher noch größer sein würde.
Seit sie mit Felix zusammen war, war zwischen ihr und Achim nichts mehr gelaufen. Natürlich war sie Felix immer treu gewesen. Aber unter den neuen Bedingungen würde sie sich nichts verkneifen. Das war für Peter so klar wie Kloßbrühe!
Peter verabschiedete sich mit einem Achselzucken, während Achim und Sophie wieder auf die Tanzfläche hüpften. Achim kam gerade aus den USA zurück. Während der letzten drei Monate hatte er dort sein letztes Praktikum am Massachusetts General Hospital in Boston in der Chirurgie absolviert. Da gab es viel zu erzählen. Achim war ein mindestens ebenso begeisterter Amerika-Fan wie Sophie. Komisch, daß Mediziner immer schon eine merkwürdige Anziehungskraft auf sie ausgeübt hatten. Wohl, weil sie selber gern Medizin studiert hätte und nur vor dem vielen Leid, das sie sicher nicht hätte ertragen können, zurückgeschreckt war. Ihre Jugendliebe Bernd lebte inzwischen als Unfallchirurg in Berlin, hoffentlich einigermaßen glücklich verheiratet und Vater von drei Kindern. Und Martin, mit dem sie mal ein Jahr zusammengewesen war, bohrte als Zahnarzt den Münchnern im Mund herum.
Gegen vier Uhr wankte Achim, von Sophie untergehakt, immer noch im Tanzschritt, aus dem Swimmingpool, und sie suchten ein Taxi. Ein Blick genügte, und Achim sagte, als sie sich beide auf die Rückbank quetschten, mit fester Stimme: »Agnesstraße 27.«
Zehn Minuten später stolperten beide in Achims Hinterhofwohnung, und dann ging alles ziemlich schnell, kurz und bündig wie immer mit Achim.
Als Sophie um sechs das erstemal unter der Bettdecke hervorlinste, entdeckte sie das reinste Chaos. Das kleine Apartment von Achim hatte längere Zeit keinen Putzlappen gesehen, und von einer Einrichtung konnte man sowieso kaum reden. Die Matratze lag am Boden. Der schmuddelige beige Teppichboden war kaum mehr auszumachen, weil auf den wenigen freien Flächen zwischen Schrank, Bett und Schreibtisch ihre Klamotten verstreut lagen, mittendrin ein welkes Kondom. Komisch, ein Kondom war zwischen ihr und Achim immer eine ausgemachte Sache gewesen. Achim kannte ihre Angst vor AIDS. Da war sie seit vielen Jahren extrem vorsichtig. Warum hatte er sich diesmal bloß so geziert? Vielleicht hatte er eine Latex-Allergie, dachte sich Sophie, soweit ihr Gehirn zum Denken überhaupt zu benutzen war. Das sollte bei Ärzten immer häufiger vorkommen.
Sophie suchte schnell Slip und Hose zusammen, trank einen Schluck Wasser aus der Leitung, drückte Achim noch einen Kuß auf den Dreitagebart und flüchtete, so wie sie es immer nach einer Nacht mit ihm getan hatte.
Zu Hause gönnte sie sich eine Tasse Nescafé und das Marzipanhörnchen, das sie an der Ecke beim Bäcker gekauft hatte. Der Anrufbeantworter blinkte: »Ich verzehre mich nach dir. Sehen wir uns Freitag, wenn ich lande? Ich könnte auch über Nacht bleiben. Meine Frau erwartet mich erst am Samstag. Wir können ja noch mal über ein Kind reden, vielleicht es einfach probieren«, hörte sie Felix aus dem Lautsprecher säuseln, unterbrochen von mehreren Knackslauten. Er mußte aus Venezuela angerufen haben.
Jetzt war es mit ihrer Beherrschung endgültig vorbei. »O Felix, ich liebe dich und hasse dich zugleich«, schluchzte sie in die Kissen. »Nein, ich will nicht, ich will einfach nicht mehr.«
Mit Schwung warf sie sich aufs Bett, zündete mit zittrigen Fingern eine Zigarette an und genehmigte sich einen Schluck Whisky, einen sensationell guten Glenfiddich. Wenn es so weiterginge, würde sie sich in zehn Jahren in solchen Situationen noch ein Valium einwerfen müssen. Das war klar.
Guter Trick, Herr Professor, dachte sie insgeheim, aber Sophie Lackmann kann ja rechnen. Am Freitag war der 23. Zyklustag. Da brauchte man weder über ein Kind reden, noch es machen, weil es nach Adam Riese gar nicht klappen konnte. Welche Frau hatte schon am 23. Tag ihren Eisprung? Bei einem regelmäßigen Zyklus von 28 oder mal 29 Tagen kam nur der 13. bis 16. Tag in Frage. Das wußte Felix als Gynäkologieprofessor besser als jeder andere. Also wieder einen Monat hingehalten, belogen und für dumm verkauft. Mit diesen Gedanken und dem Geruch von Achim an ihrem Körper schlief Sophie ein.
Nein, so konnte es nicht weitergehen. Das war unter ihrem Niveau, pure Verzweiflung, Chaos in Hirn und Bauch. Nein, so nicht. Sie würde Felix erst mal nicht wiedersehen!
Ihr ganzes Leben und ihren Beruf hatte sie bislang minutiös geplant, nur das Wichtigste in ihrem Leben, ein Kind, sollte sie einem schnöden Zufall überlassen? Nicht Sophie Lackmann!





























