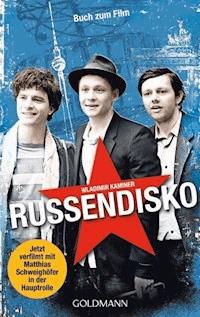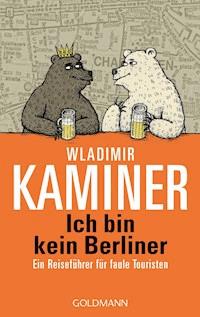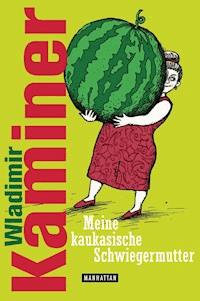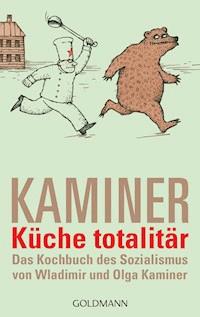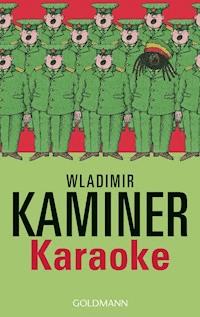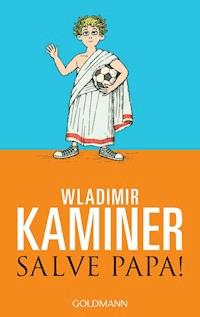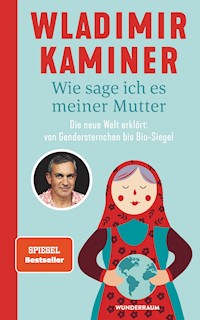9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Typisch deutsch und trotzdem lustig
Deutschland hat viel Liebenswertes zu bieten: Sparkassenberater, die von jeder Geldanlage abraten, Zeitungsenten aus Plüsch, ein findiges Finanzamt oder Vegetarier, die gerne Fleisch essen – nur nicht das von Tieren. Außerdem gibt es bei uns die perfekte Form der Schriftgutverwaltung. Schließlich ist ein Land ein schwieriges Unternehmen, und um es in den Griff zu bekommen, braucht man Erfindungsgeist. So erfanden die Amerikaner den Colt, die Russen das Destilliergerät und die Deutschen den Leitz-Ordner. Wladimir Kaminer sieht seine Wahlheimat mit viel Verständnis für deren Schrullen und Besonderheiten. Und so sind wir am Ende von uns selbst ganz bezaubert. Denn wer hätte gedacht, was für ein lustiges Volk wir im Grunde sind!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Ähnliche
Buch
Häufig öffnet einem erst ein Blick von außen die Augen für die liebenswerten Seiten des eigenen Landes. Und so sehen wir nun dank Wladimir Kaminer, wie wunderbar Deutschland ist. Man nehme nur den Begriff der »Einverständniserklärung« – wie kommen andere Völker ohne ihn aus? Bei uns gäbe es ohne ihn keinen Besuch auf dem Abenteuerspielplatz, keinen Zugang zur Schulbibliothek und keinen Schwimmunterricht. Es wäre ja denkbar, dass beim direkten Zusammenstoß mit dem Leben jemand zu Schaden kommt. Und so träumt Deutschland davon, das Dasein von allen Restrisiken zu befreien. Autos dürfen keine gefährlichen Abgase mehr ausstoßen – zumindest nicht ohne Einverständniserklärung – und dem ökologisch ernährten Vegetarier gehört die Zukunft. Zumindest wenn er sich von seinem Navi sicher leiten lässt, ausreichend Versicherungen abschließt und in seiner Steuererklärung das Katzenfutter nicht als »Geschäftsessen« deklariert. Keine Frage: Deutschland hat allerlei Eigentümliches und viel Wunderbares zu bieten ...
Autor
Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren, wo er eine Ausbildung zum Toningenieur für Theater und Rundfunk absolvierte. Seit 1990 lebt er in Berlin. Er selbst sieht sich als Weltbürger und sagt, er sei privat Russe, beruflich deutscher Schriftsteller. Mit seiner Erzählsammlung »Russendisko« sowie zahlreichen weiteren Bestsellern avancierte er zu einem der beliebtesten und gefragtesten Autoren Deutschlands. Er ist auch journalistisch tätig, verfasst Artikel für Zeitungen und Zeitschriften und geht mit Kaminer Inside für 3sat auf immer neue Entdeckungstouren, um Menschen im In- und Ausland kennenzulernen oder einen Blick hinter die Kulissen bekannter Gebäude zu werfen. Alle Bücher von Wladimir Kaminer gibt es auch als Hörbuch, von ihm selbst gelesen. Mehr Informationen zum Autor unter www.wladimir-kaminer.de.
Von Wladimir Kaminer lieferbar: Russendisko. Erzählungen · Militärmusik. Roman · Schönhauser Allee. Erzählungen · Die Reise nach Trulala. Erzählungen · Mein deutsches Dschungelbuch. Erzählungen · Ich mache mir Sorgen, Mama. Erzählungen · Karaoke. Erzählungen · Küche totalitär. Das Kochbuch des Sozialismus · Ich bin kein Berliner. Ein Reiseführer für faule Touristen · Mein Leben im Schrebergarten · Salve Papa. Erzählungen · Es gab keinen Sex im Sozialismus. Erzählungen · Meine russischen Nachbarn. Erzählungen · Meine kaukasische Schwiegermutter. Erzählungen · Liebesgrüße aus Deutschland. Erzählungen · Onkel Wanja kommt. Eine Reise durch die Nacht. Erzählungen. · Diesseits von Eden. Neues aus dem Garten. Erzählungen. · Coole Eltern leben länger. Geschichten vom Erwachsenwerden. · Das Leben ist keine Kunst. Geschichten von Künstlerpech und Lebenskünstlern. · Meine Mutter, ihre Katze und der Staubsauger. Ein Unruhestand in 33 Geschichten.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Manhattan Bücher erscheinen im Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Copyright © der Originalausgabe 2011 by Wladimir Kaminer
Copyright © dieser Ausgabe 2011 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Covergestaltung: UNO Werbeagentur Covermotiv: Jan Kopetzky
Die Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Hans-im-Glück-Verlags, München Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-06989-6 V006
www.goldmann-verlag.de
Neue Heimat
Wenn man von einem Land in ein anderes zieht, nicht nur, um sich die dortigen Sehenswürdigkeiten anzugucken, sondern mit dem Wunsch, dort ein neues Leben auf unbekanntem Territorium zu beginnen, so ist die tödlichste aller Gefahren der Vergleich. Dessen Verführungskraft ist allerdings sehr stark und hängt mit der Verführung durch den Zweifel zusammen. Kaum einer kann ihr widerstehen, und natürlich muss die neue Heimat den wildesten Erwartungen standhalten. Alles Neue und Ungewohnte wird genauestens bewertet, die Vorzüge und Nachteile abgewogen – die Sitten, die Waren, die Fernsehprogramme, die Architektur … Und immer fällt die neue Heimat beim Vergleich durch. Nie hält sie, was man sich von ihr versprochen hat.
Ich glaube, dieses Phänomen ist überall auf der Erde gleich, egal ob ein Chinese nach Australien zieht oder ein Kroate nach Finnland. Nur kenne ich viel zu wenig Chinesen und Kroaten, dafür aber sehr viele Russen und Ukrainer in Deutschland. Wenn ein Russe von den Deutschen spricht, dann sagt er, ihnen fehle das Herz. Sie gehen zwar auch gerne saufen, sie sitzen nächtelang in Biergärten oder ziehen mit einem Leiterwagen und Aquavit durch Kohlfelder. Sie sind als Extremtouristen überall auf der Welt bekannt, fahren mit dem Motorrad steile Berge hinauf und hinunter, laufen Marathon durch die Wüste, jagen bei großen Open-Air-Partys Mädels hinterher, doch das alles tun sie ohne Herz, aus bloßem Interesse. Und wenn das Interesse gesättigt ist, hören sie mit ihren Exzessen auf und gehen von neun bis fünf und einer Mittagspause zwischendurch wieder einer abhängigen Beschäftigung nach.
Dieses Doppelleben ist unter den Einheimischen in Deutschland stark verbreitet. Ihre Leidenschaften bleiben immer Hobbys. Während andere sich an ihren Abenteuern verbrennen, wollen sich die Deutschen eigentlich nur bilden. Deswegen werden hier in den Reisebüros statt erholsamer Sauftouren gerne »Bildungsreisen« angeboten. Die Menschen finden es toll, wenn man im Urlaub nebenbei noch irgendeinen Motorboot-Führerschein bekommen oder Spanisch lernen kann.
Die größte Schwäche seiner neuen Heimat ist aus Sicht des Neuankömmlings natürlich ihre Gastronomie. Hier entdeckt er riesige Defizite. Man kann unendlich lange darüber sinnieren, wie gesund, ökologisch bewusst und vitaminreich sich das Essen in Deutschland präsentiert, Tatsache ist: Nichts schmeckt hier so, wie es schmecken soll. Das fängt mit dem Brot an und endet bei Wassermelonen und Gurken. Diese Produkte sind keine Delikatessen, in Russland weiß jedes Kind, wie eine Gurke oder eine Beere oder eine Wassermelone zu schmecken hat. Ganz sicher nicht nach Zeitungspapier.
Den hiesigen Produkten fehlt es einfach an Geschmack, an Fett und Zucker und anderen Stoffen, die das Essen schmackhaft und die Menschen etwas mollig machen. Abgesehen davon fehlt hierzulande die Kultur der leicht gebeizten Gurke, des Pilzes und des Krauts. Die Deutschen können kein Gemüse richtig einlegen, sie bringen ihre Gurken mit Essig und Chemikalien um, sie trinken den Wodka warm und im Stehen und halten das polnische nastrovje für einen russischen Trinkspruch. Sie werden viel zu schnell betrunken und fallen immer dann um, wenn es am interessantesten wird, wodurch ihnen der unterhaltsame Weg in die Vielfalt der osteuropäischen Gastronomie verwehrt ist.
Ein weiterer großer Mangel und ein nicht weniger großes Problem hierzulande ist die sogenannte Aufklärung, ein Bildungsprozess aus der Vergangenheit, der mit den Deutschen von heute nichts mehr zu tun hat, sie aber im Glauben lässt, sie wären so etwas wie die Kulturavantgarde der Menschheit. Dabei haben sie eine Schwäche für dumme Kabarettistenwitze, schweinische Zeitungsüberschriften, hässliche Einfamilienhäuser und Hunde, die aus großen Büchsen mit vielen Konservierungsstoffen ernährt und dadurch praktisch unsterblich werden.
Ein anderes Thema ist die deutsche »Vergangenheit«. Mit »Vergangenheit« werden hier in der Regel die zwölf Jahre der nationalsozialistischen Diktatur bezeichnet, die in ihrer Mordlust und Monstrosität alle anderen Epochen und Diktaturen Europas locker übertreffen. Diese deutsche Vergangenheit sorgt bei den Russen oft für Unbehagen, besonders wenn sie auf sehr alte Menschen oder alt aussehende Hunde stoßen, die eigentlich fast immer sympathisch und nett wirken. Viele müssen aber schon als Kleinkind Mitglied der NSDAP gewesen sein. Obwohl der Krieg inzwischen seit mehr als sechzig Jahren vorüber ist, entbrennen in den deutschen Medien noch immer regelmäßig Skandale, weil neue Fakten auftauchen – dass der Schauspieler X oder der Sozialdemokrat Y als Kleinkind bereits bei den Nationalsozialisten mitmachte. Wahrscheinlich hat diese Diktatur in ihrer Agonie oder aus Verzweiflung sogar Föten in die Partei eintreten lassen, um sich auf diese Weise den Zugang zu den deutschen Medien des XXI. Jahrhunderts zu sichern.
Ich habe nur einmal eine Begegnung mit dieser deutschen »Vergangenheit« erlebt. Das war im Juli 1990 in Ostberlin. Damals war die Wiedervereinigung de facto bereits abgehakt, obwohl die DDR de jure noch existierte. Es fühlte sich an, als hätte der Lauf der Geschichte für einen Moment haltgemacht, um Luft zu holen. Die Ostberliner hatten in jenem Sommer die einmalige Gelegenheit, etwas zu erleben, das es so nirgends auf der Welt mehr gab: Sie lebten gleichzeitig im Sozialismus und im Kapitalismus. Sie genossen die Vorzüge beider Systeme, ohne ihre Nachteile zu spüren. Als Wohnungsmiete zahlten sie noch immer 16,50 DM, in den Kaufhallen lagen aber schon Berge von Bananen, und man konnte laut auf Honecker und die Kommunisten schimpfen. Die Polizei hatte Angst, die Punks von der Straße zu verjagen, und die Verkäuferinnen hatten keine Lust, die neuen Produktnamen auswendig zu lernen, jeden Tag kamen neue dazu. Sie antworteten zur Sicherheit: »Ham wa nich«, wenn man Unbekanntes verlangte. Dabei stand schon alles in den Regalen.
In dieser wunderbaren Zeit gingen mein Freund Boris und ich oft und gerne in der nagelneuen Kaisers-Filiale in Prenzlauer Berg einkaufen, die sich in einer leer stehenden DDR-Konsumkaufhalle eingerichtet hatte. Wir waren beide frisch aus der Sowjetunion geflüchtet, unsere alte Heimat befand sich gerade in Auflösung, und beinahe jede Woche ging ihr ein Stück ihrer Identität verloren. Unsere neue Heimat war dagegen gerade im Aufbau – täglich wurden riesige Laster mit Westwaren vor den Hintertüren der Ostkaufhalle ausgeladen.
An einem sonnigen Tag traf uns die deutsche Vergangenheit wie ein schwarzer Schatten, und zwar dort, wo wir sie am wenigsten erwartet hatten – vor der Kaufhalle. Auf dem Bordstein vor der Tür saß ein alter deutscher Schäferhund. Er sonnte sich mit geschlossenen Augen und wirkte überhaupt nicht böse, sondern verschlafen und müde. Boris stellte sich neben den Hund, um sich eine Zigarette zu drehen. Damals war Zigarettendrehen groß in Mode, alle drehten schwarzen Tabak wie verrückt, und manche konnten es sogar mit einer Hand in der Hosentasche. Mein Freund hatte noch keine solche Geschicklichkeit entwickelt, er brauchte ein spezielles Gerät, um Zigaretten zu drehen. Trotzdem fiel sein Tabak immer wieder auf den Asphalt, und Boris schimpfte laut auf Russisch. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch keiner von uns Deutsch, unsere Sprachkenntnisse waren auf das Minimum reduziert, das wir aus sowjetischen Kriegsfilmen kannten. In diesen Filmen sprachen russische Schauspieler, die Deutsche spielten, einander gelegentlich auf Deutsch an, um ihrer Rolle mehr Glaubwürdigkeit und Ausdruck zu verleihen. Es waren schlichte Sätze, die man sich leicht merken konnte wie zum Beispiel »Heil Hitler« oder »Feuerzeug kaputt« oder »Sie können gehen, Barbara«. Das war nicht viel, und wir konnten deswegen auf Deutsch keine Unterhaltung führen, wir konnten auch nicht auf Deutsch schimpfen, aber zum Einkaufen reichte es.
Mein Freund stand also in der Sonne, drehte seine Zigarette und schimpfte laut auf Russisch. Plötzlich erwachte der alte Hund. Er drehte seinen Kopf zu Boris, und ohne die Augen zu öffnen, nahm er Boris’ Hand ins Maul. Es sah schrecklich aus. Der Hund biss meinen Freund nicht, er hielt seine Hand zwischen seinen scharfen gelben Zähnen, zärtlich, aber fest. Dabei öffnete der Hund die Augen und schaute meinem Freund direkt ins Gesicht. Boris wirkte ziemlich durcheinander. Ihm fiel in dieser Situation nichts Besseres ein, als »Heil Hitler« zu sagen. Sofort machte das Tier sein Maul auf und ließ Boris los. Danach schloss der Hund die Augen wieder und tat so, als würde er im Sitzen schlafen.
Wir gingen sofort weg von der Kaufhalle, ohne ein Wort zu wechseln, aber mein Freund stand noch eine ganze Weile unter Schock. Wir wussten natürlich nicht, wie dieser schreckliche Hund reagiert hätte, wenn wir zu ihm »Feuerzeug kaputt« gesagt hätten oder »Sie können gehen, Barbara«. Doch wir beide waren überzeugt, dass dieser Hund ein Nazi war. Das Ganze ist nun schon zwanzig Jahre her, der Hund ist hoffentlich längst tot (sie sind zäh wie Leder), und mein Freund Boris ist vor zwölf Jahren nach Amerika emigriert. Er studierte dort Grafikdesign und schleppt als staatlich geprüfter Fremdenführer in New York russische Touristengruppen durch die Gegend.
Goldfieber
»Lassen Sie uns über das Leben philosophieren, Herr Kaminer !«, sagte mein Sparkassenberater und bestellte uns erst einmal zwei Bier. Dafür schätze ich den Mann: Wenn wir uns treffen, dann nicht in der Sparkasse zu Keksen und Kaffee, sondern in einer Kneipe mit Raucherecke. Wenn er über seine Finanzprodukte spricht, sagt er jedes Mal: »Allerdings würde ich Ihnen aus persönlicher Erfahrung von dieser Anlagemöglichkeit abraten.«
Das klingt vertrauenswürdig. Mein Sparkassenberater ist eigentlich gar kein Berater, sondern ein Abrater. Er sieht auch anders aus als die meisten seiner Kollegen. Im Normalfall müssen Sparkassenberater doch glatt rasiert und akkurat gekämmt sein, einen weichen Händedruck haben und eine Väterlichkeit gleichzeitig mit einer Prise Mütterlichkeit ausstrahlen, um an das Geld ihrer Kunden zu kommen, es irgendwo in Teufelsaktien anzulegen und dann mal zu sehen, was passiert. Mein Sparkassenberater ist da anders. Er hat einen sehr festen Händedruck und sieht aus wie ein normaler Mensch, also wenig vertrauensvoll. Und er philosophiert gerne.
»Nicht wir stellen die Regeln auf, wir regen uns nur darüber auf«, sagte er das letzte Mal tiefsinnig und zündete sich eine Zigarette an, als ich ihn nach den Auswirkungen der Finanzkrise auf seine Sparkassenfiliale fragte. »Geld war schon immer ein schnell verderbliches Gut, das man am liebsten sofort verbrauchen soll. Geld ist wie Bier. Wenn wir unsere Biere hier stehen lassen«, er zeigte auf unsere Biergläser, die fast leer waren, »wenn wir also diese Biere hier stehen lassen, weggehen und in zwei Wochen wieder zurückkommen würden, was meinen Sie, Herr Kaminer, wird das Bier noch immer auf uns warten?«
»Nein ?«, antwortete ich vorsichtig.
»Es wird ganz sicher nicht mehr da sein!«, unterstützte mich mein Sparkassenberater. »Genauso ist es mit dem Geld«, philosophierte er weiter. »Kaum lässt man es irgendwo anlegen, geht kurz weg und kommt zurück, ist es weg. Natürlich haben wir auch in dieser schwierigen Zeit etliche Angebote parat, aber ich würde Ihnen aus persönlicher Erfahrung nicht zu diesen Angeboten raten. Für die meisten Kunden bleibt nach wie vor das Schließfach die sicherste Form der Geldanlage. Bei uns in der Filiale sind alle belegt, und die meisten werden auf Jahrzehnte vermietet und beinahe täglich betreut.«
Mich erinnerte seine Geschichte sofort an einen Bekannten aus alten Zeiten. Anfang der Neunzigerjahre lernte ich in Berlin einen Mann kennen, der sein gesamtes Vermögen in Goldbarren in einem Schließfach am Bahnhof Lichtenberg deponiert hatte und sehr darunter litt. Er war ein Punk-Musiker, der gegen das Schweinesystem sang. Nach der Wende schloss er im wiedervereinigten Deutschland einen günstigen Plattenvertrag ab und bekam viel Geld. Einerseits war er dank dieses Vertrags mit der Plattenfirma in dem von ihm gehassten Schweinesystem angekommen, andererseits aber nicht ganz. Er konnte trotzdem kein Vertrauen in das kapitalistische Bankwesen entwickeln. Eine bürgerliche Investition kam für ihn nicht in Frage. Nachdem er einen Teil seines Gewinns in Drogen und einen weiteren in ein Wohnmobil – seinen Kindheitstraum – investiert hatte, kaufte er für den Rest des Geldes Goldbarren und deponierte sie am Bahnhof Lichtenberg in einem Schließfach.
Diese kurzsichtige Geldanlage veränderte sein Leben. Ursprünglich hatte er vor, mit seinem Wohnmobil auf Weltreise zu gehen, nun konnte er aber Berlin nicht mehr verlassen: Er musste alle vierundzwanzig Stunden zum Bahnhof Lichtenberg, um neue Münzen in das Schließfach zu werfen. Sein Wohnmobil parkte er neben der Bahnhofshalle, er fuhr damit nirgendwohin. Fünf Jahre später starb er in seinem Wohnmobil unter ungeklärten Umständen. Sein Gold bekam wahrscheinlich zuletzt die Deutsche Bahn und hat dafür später einen tollen neuen Bahnhof gebaut. Eine traurige Geschichte.
Mein Sparkassenberater hörte mir aufmerksam zu, zündete eine neue Zigarette an und sagte, er kenne eine ähnliche Geschichte, die noch trauriger sei. Ich bat ihn, sie mir zu erzählen.
»Oft sind es sehr alte Menschen, die Schließfächer in der Sparkassenfiliale besitzen, sie haben keine Kraft mehr, ihre Fächer auf- bzw. zuzuschließen. Ein sehr alter Mann kam trotzdem jeden Tag sein Schließfach besuchen«, erzählte mein Berater. »Einmal bat er mich, ihm zu helfen, seine Wertschatulle herauszunehmen, er konnte sie selbst nicht mehr herausheben, so schwer war sie. Ich ging mit ihm in den Tresorraum, holte seine Schatulle unter großer Anstrengung heraus – sie war tatsächlich verdammt schwer –, stellte sie auf den Tisch und wollte den Tresorraum wieder verlassen, wie es sich in einer Bank gehört. Doch der Kunde hielt mich am Ärmel zurück.
›Bitte bleiben Sie‹, flüsterte er. ›Machen Sie mir die Freude – ich möchte, dass Sie in meine Schatulle reinschauen. ‹
Er öffnete die Kiste. Sie war mit südafrikanischen Goldmünzen gefüllt, Sie wissen schon, diese Krügerrandmünzen. Ein toller Anblick, so viel Gold. Ich gratulierte ihm zu seinem Gold und wollte erneut gehen. Der Alte ließ mich aber immer noch nicht los.
›Nehmen Sie eine‹, forderte er mich auf, ›bitte, bitte!‹
Was sollte ich machen? Ich nahm eine seiner Münzen in die Hand: Es war eine Schokoladenmünze. Der Kunde hatte sein Schließfach mit Schokolade von Aldi gefüllt, unter die Schokolade eine Stahlplatte gelegt, um das Ganze schwerer zu machen, und freute sich nun fürchterlich über meinen Gesichtsausdruck. Ich war fassungslos und sagte nichts. Seine beiden Söhne kämen ihn nicht einmal besuchen, erzählte er mir. Der eine Sohn unterrichte irgendetwas in England, der andere sei vor langer Zeit mit seiner Freundin nach Stuttgart gezogen. Sie schrieben ihm nicht einmal Postkarten zu Weihnachten, beschwerte er sich. Er wisse überhaupt nicht, ob er Enkelkinder habe. Dafür stelle er sich jede Nacht vor dem Einschlafen vor, wie seine beiden Söhne nach seinem Tod hierherkämen, um ihre Erbschaft anzutreten, die dicke Schatulle aus dem Tresor holten, sie nach oben schleppten und die Aldi-Schokolade darin entdeckten. Allein dieser Gedanke gäbe ihm den Mut weiterzuleben und lasse ihn glücklich einschlafen. Jede Nacht träume er davon, und bestimmt werden seine Söhne noch dämlicher aus der Wäsche gucken, als ich es gerade getan habe.
Ungefähr ein Jahr danach starb der Kunde. Seine Söhne kamen nicht. Der Erbschaftsverwalter untersuchte das Schließfach, entsorgte die Stahlplatte und ließ die Schokolade in der Filiale in einer Ecke liegen. Sie wurde schnell aufgegessen. Niemand hat sich groß über die Schokolade gewundert, am wenigsten der Erbschaftsverwalter, als hätte er genau das erwartet.
Ich kann nicht ausschließen, dass die meisten Schließfächer in Deutschland mit Aldi-Schokolade gefüllt sind«, beendete der Sparkassenberater seine Erzählung. »Allerdings kann ich Ihnen aus persönlicher Erfahrung von dieser Anlagemöglichkeit nur abraten«, fügte er nach einer Pause hinzu.
Der deutsche Kletterwald
Jedes Alter hat seine Tücken, aber nichts ist anstrengender als die Pubertät. Es gäbe drei Mädchen-Cliquen in ihrer Klasse 6a, berichtete mir meine Tochter Nicole. Die obercoolen Mädchen aus der Mainstream-Clique tragen schon alle einen BH, benutzen Nagellack und schminken sich – nicht immer dezent. Die BH-Trägerinnen stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und werden von den Lehrern und anderen Schülern mit Respekt behandelt. Zu der zweiten Clique gehören Mädchen, die geistig schon längst reif für den BH sind, aber aus technischen Gründen noch keinen tragen. Ganz abseits vom Mainstream sind die sogenannten Babymädchen, die statt Rihanna-Clips den Kinderkanal im Fernsehen gucken.
Meine Tochter ist klein und kann daher nicht bei den Obercoolen angeben. Sie beneidet die Großen sehr und leidet unter dieser krassen Ungerechtigkeit der Natur, die irgendwelche blöden Kühe zu Obercoolen wachsen lässt und sie nicht. Ich als Vater leide mit meiner Tochter selbstverständlich mit, bloß: Wie kann ich ihr helfen? Und muss man das Erwachsenwerden beschleunigen? Bei solchen Fragen sind selbst die besten Väter hilflos.
»Würdest du bitte an unserem Wandertag teilnehmen?«, fragte mich Nicole eines Tages. Sie fuhr mit der Klasse in den sogenannten Kletterwald nach Strausberg-Nord, und es wäre cool, wenn ich mitkommen würde. Der Vater ihrer Freundin Mari, ein Polizist, habe auch vor mitzukommen, erklärte sie mir. Er nähme die Erziehung seiner Tochter sehr ernst. »Wenn du mitkommen könntest und ihn mit einem tiefschürfenden Gespräch von der Erziehung seiner Tochter ablenken würdest, dann könnten wir in der S-Bahn in Ruhe Musik hören«, meinte Nicole.
Ich sagte leichtsinnigerweise zu. Spätestens beim Wort »Kletterwald« hätte es natürlich bei jedem vernünftigen Vater geklingelt, und er hätte mindestens im Internet nachgeschaut, worauf er sich da einlässt. Aber ich konzentrierte mich auf den Vater von Mari, den Polizisten, und dachte über das Endziel des Ausflugs nicht weiter nach. Die Attraktion »Kletterwald« stellte ich mir entspannend vor: kleine Tannen mit aufgespannten Schaukelnetzen dazwischen und glückliche Kinder, die in den Büschen herumkrabbeln. Für alle Fälle zog ich mir Turnschuhe an.
Die Fahrt nach Strausberg-Nord dauerte eine Stunde und einunddreißig Minuten. Die Klasse 6a wurde von drei Erwachsenen begleitet: von Frau Walzer, der Sportlehrerin und gleichzeitig Klassenlehrerin der Klasse 6a, von dem Polizistenvater und von mir. Ich habe viel Interessantes über Polizeiarbeit erfahren: Wie verschiedene Fußballfans nach dem Grad ihrer Aggressivität eingestuft werden, und woher all die übergewichtigen Polizisten kommen, obwohl sie doch so einen sportlichen Beruf haben.
Der Vater von Mari war allerdings nicht irgendein gewöhnlicher Streifenpolizist, sondern ein Ordnungshüter auf Weltniveau. Er hatte bereits bei wichtigen Gipfeltreffen und Fußballspielen die Sicherheit gewährleistet und in Afghanistan Polizisten ausgebildet, damit sie besser gegen ihre Feinde, die Taliban, vorgehen konnten. Wobei er sich jedoch nicht sicher gewesen war, ob er nicht gleichzeitig auch die Taliban selbst ausbildete. Männer in archaischen Gesellschaften wechseln gerne ihre sozialen Rollen. Tagsüber sind sie Polizisten und bekämpfen die Taliban, nachts sind sie möglicherweise selber Taliban und bekämpfen die Polizisten. Auf jeden Fall wächst die Widerstandskraft der Taliban in gleichem Maße wie die Schlagkraft der Polizei. Je besser die einen ausgebildet werden, umso sicherer agieren die anderen. Ein Paradox, meinte der Polizistenvater. Außer in Afghanistan hatte er auch im Kosovo ausgebildet, und wahrscheinlich hat er auch zu Hause seine Frau und seine Tochter ausgebildet, aber danach habe ich ihn nicht gefragt.
Ich fühlte mich völlig in Sicherheit, in der S-Bahn neben dem Mann zu sitzen. Die Mädchen hörten entspannt die ganze Zeit Musik. An der Endstation stiegen wir aus und gingen den Rest des Weges zu Fuß. Ich war noch nie in Strausberg-Nord gewesen, und ich glaube, man fährt auch ohne Not nicht dorthin, es sei denn, um zu klettern. Die Gegend sah ländlich aus, kleine weiß gestrichene Häuschen, viel Grün. Die Bewohner von Strausberg-Nord hatten noch die inzwischen in den Städten selten gewordene Angewohnheit, ihre Unterwäsche auf dem Hof zum Trocknen aufzuhängen. Überall wehten Büstenhalter in unglaublichen Größen. Auch ein paar kleine Höschen waren zu sehen.
Im Kletterwald angekommen dachte ich zuerst, es müsse sich um einen Scherz handeln. Es war schließlich gerade der erste April, der Tag der Scherze. In zwanzig Metern Höhe hingen dort Metallkonstruktionen, so weit von einander entfernt, dass man fliegen können musste, um weiterzukommen. Die wackelnden Treppen, die einfach so in der Luft hingen, die schrecklichen Seile – die ganze Anlage sah aus wie eine kompliziert gebaute Folterstrecke mit abschließendem Erhängen. Nicht einmal der dümmste Makake würde sich auf ein solches Abenteuer einlassen, dachte ich, sagte aber nichts. Ich wartete, bis die anderen es selbst einsahen. Die hatten aber anscheinend keine Berührungsängste mit dem Kletterwald. Die Mitarbeiter gaben uns schließlich eine kleine Einweisung. Demnach gab es acht verschiedene Routen, eine schlimmer als die andere. Und für alle Kletterfans ab einem Meter sechzig wäre da noch die sogenannte Extremroute im Angebot, ein ganz besonderer Spaß für auf den Kopf Gefallene.
»Die Erwachsenen wollen auch mitmachen?«, fragte die Kletterwaldmitarbeiterin.
»Natürlich«, sagte Frau Walzer, die Sportlehrerin.
»Klar doch«, sagte der Afghanen-Ausbilder.
Und ich, ein Schreibtischarbeiter, sagte ebenfalls Ja, um nicht als Versager dazustehen.
Sekundenschnell wurden wir drei von Mitarbeitern des Kletterwaldes in spezielle Gürtel mit Rollen, Sicherheitsseil, Karabinern und andere Bergsteigerausrüstung gehüllt, dazu bekamen wir Schutzhelme und Handschuhe, und eine Minute später hing ich schon an einem Baum fest.
»Ich muss auf die Kinder aufpassen«, sagte Frau Walzer. »Jemand muss aber am Boden bleiben!«, rief sie uns zu und kletterte den nächsten Baum hoch.
Der Polizistenvater überlegte kurz und sagte, er werde am Boden bleiben, für alle Fälle, und um die Sicherheit von unten zu gewährleisten.
»Ich halte Ihnen den Rücken frei«, zwinkerte er mir zu und zog seinen Klettergürtel wieder aus.
Für mich führte nun kein Weg zurück. Meine Tochter und ihre ganze Klasse hatten sicher aufgepasst – was würden sie denken? Der Vater von Nicole kann nicht klettern? Nachdenklich und mit Vorsicht stieg ich immer weiter nach oben, und schon zweieinhalb Stunden später fand ich mich in einer mörderischen Höhe auf der Extremroute für auf den Kopf Gefallene zwischen zwei Seilen an einem Karabiner hängend. Bis zum nächsten Baum waren es noch drei Meter, meine Kraft reichte aber nicht einmal mehr für drei Zentimeter. Das verhängnisvolle Ende meiner Kletterkarriere war erreicht. Niemand machte Anstalten, mich aus dieser Lage zu befreien. Direkt unter meinen Füßen, weit unten auf der Erde, stand die Klasse 6a, die längst mit ihren Kletterrouten fertig war. Die unglaublich sportliche Frau Walzer bat gerade den Polizistenvater, der die Bodensicherheit vorzüglich gewährleistet hatte, ein paar Gruppenfotos zu machen, zur Erinnerung an diesen unvergesslichen Ausflug zu Beginn des Frühlings. Die Tatsache, dass ein großer Schriftsteller, weit über einen Meter sechzig groß, ganz oben an einem Seil festhing und nicht vorwärts kam, schien niemanden zu stören.
Dabei habe ich mich immer für supersportlich gehalten. Ich hatte mich geirrt. Meine Vorstellung von Sportlichkeit wurde im Kletterwald bei Strausberg-Nord völlig neu definiert. Eine solch sportliche Sportlehrerin wie Frau Walzer hat es in sowjetischen Schulen nie gegeben. Bei uns waren immer Männer für den Sportunterricht zuständig gewesen, ausrangierte Sportler, die keine Lust mehr hatten auf Sport. Der Unterricht hieß auch nicht »Sport«, sondern »physische Kultur«. In meiner Schule war ein ehemaliger Fußballspieler mit Namen Eduard und einer morgendlichen Alkoholfahne für »physische Kultur« zuständig, der allerdings auch auf Klettern stand. Seine Lieblingsübung war es, den Mädchen aus unserer Klasse auf das Seil zu helfen. Er sicherte sie von unten am Hintern ab, und die Mädels kletterten, so schnell sie konnten, von Eduard weg zwei oder drei Meter nach oben. Dort blieben sie in der Regel hängen. Der Fußballspieler Eduard beobachtete sie nachdenklich von unten und verteilte dann die Noten, völlig willkürlich, wie es uns damals schien.
Die Jungs mussten nicht klettern, stattdessen spielten sie Fußball.
Die Sportlehrerin meiner Tochter, Frau Walzer, kletterte schnell wie Mogli von Baum zu Baum, kontrollierte gleichzeitig die Klasse, und manchmal nahm sie auch noch ein paar Kinder mit, die auf der Strecke geblieben waren. Überhaupt habe ich in diesen zweieinhalb Stunden sehr viele Kletterdeutsche beobachtet, die sich mit einer solchen Gelassenheit auf diesen halsbrecherischen Strecken bewegten, als wären sie in einer Baumhöhle auf die Welt gekommen.
»Komm runter, Papa, wir gehen!«, rief mir meine Tochter zu. Ich sammelte meine letzten Kräfte, zog mich gewissermaßen am eigenen Schopf hoch und schaffte gerade noch die letzten Meter der Extremroute.
»Und? War es gut ?«, fragte mich der Polizistenvater.
»Nicht der Rede wert«, antwortete ich und wollte mit der Hand eine abwinkende Geste machen, bekam sie jedoch nicht mehr hoch.
»Ich komme mit meiner Einheit in einem Monat noch mal hierher und hole alles nach«, sagte der Vater.
Noch Wochen danach hatte ich Muskelkater und konnte mich kaum bewegen. Dafür wissen nun, hoffe ich, alle in der Klasse meiner Tochter, was für einen coolen Klettervater sie hat.
Unsere neue Religion
Das Wunderbare ist immer das Ungefähre. Wenn man das Wunderbare genauer betrachtet, wird einem schnell klar, so wunderbar ist es gar nicht. Deswegen beneide ich Chirurgen und Astronomen nicht: Sie haben zu weit geschaut, sie wissen zu viel, woran sollen sie noch glauben? Dabei brauchen alle Menschen etwas, woran sie glauben können, am besten etwas Wunderbares, das sie nicht verstehen. Und sie dürfen niemals an der Sache zweifeln oder sie hinterfragen, denn der Zweifel ist das Ende des Glaubens.
Es gibt Kinder, die das ihnen geschenkte Spielzeug erst einmal auseinandernehmen, um zu sehen, warum die Kuh so laut lacht und wieso der Hase laufen kann. Sie schauen in den Hasen, sie schauen in die Kuh, so lange, bis der Hase nicht mehr läuft und die Kuh für immer aufhört zu lachen. Russen vermeiden es, den Dingen auf den Grund zu gehen, denn die große Lehre des letzten Jahrhunderts war: je besser das Äußere, desto schlimmer der Inhalt. Egal ob Spielzeug, technische Geräte, Lebensmittel oder Ideen zur Verbesserung der Welt, sie wissen: je prachtvoller die Verpackung, desto trauriger der Inhalt. Ihre historische Erfahrung sagt ihnen, man darf nicht zu tief bohren, man sollte nicht alles ganz genau wissen wollen.
In Deutschland will man jedoch alles genau wissen. Mein Sohn Sebastian sollte im Biologieunterricht eigenhändig zehn Würmer präparieren. Das überstieg seine Kräfte. Zum einen taten ihm die Würmer leid, zum anderen wollte er so genau gar nicht wissen, welche Schätze sie in ihrem Inneren verbargen. Seine Biologielehrerin hatte aber die Aufgabe präzise gestellt. Sebastian sollte sich zuerst in einem Zooladen am Weddinger U-Bahnhof Gesundbrunnen zehn Würmer der bei Lehrern besonders beliebten Art Zophoba morio besorgen. Diese sollten dann in die Schule gebracht werden, wo man sie nicht gleich töten würde, wie mir Sebastian erklärte, sondern zuerst langsam foltern, um sie am Ende eines qualvollen Todes sterben zu lassen. Die Schüler sollten daraufhin die Würmer auseinandernehmen und ihre Innereien untersuchen.
»Könntest du mir nicht eine Entschuldigung schreiben, dass ich aus religiöser Überzeugung, die unserer Familie zu eigen ist, keine Würmer foltern darf?«, fragte mich Sebastian hoffnungsvoll.
Ich nahm ein Blatt Papier und schrieb: »Sehr geehrte Frau Biologielehrerin, es tut mir leid, mich in Ihren Unterricht einzumischen, aber nach der religiösen Überzeugung unserer Familie ist jedes Leben heilig und unantastbar. Deswegen darf mein Sohn Sebastian leider keine Würmer foltern. Ich bitte Sie um Verständnis.«
Natürlich war das eine glatte Lüge. Meine Kindheit und Jugend habe ich in einem atheistischen Land verbracht. Wir studierten Marxismus-Leninismus statt Gottesworte und gingen am Sonntag in die Disko, nicht in die Kirche. Allerdings sezierten wir auch keine Würmer in der Schule, stattdessen gab es einen Frosch, den wir auseinandernehmen mussten. Der Frosch war unheimlich alt und wahrscheinlich noch im Bürgerkrieg 1920 umgekommen. Mehrere Generationen Schüler hatten sich bereits an dieser Leiche vergangen, um die Froschinnereien zu studieren. Wahrscheinlich nähte unsere Lehrerin den Frosch jedes Jahr wieder zusammen, wobei er der ursprünglichen Froschform jedes Mal unähnlicher wurde. Jeder musste den Frosch, wenn nicht aufschlitzen, dann mindestens einmal anfassen, um in diese biologische Bruderschaft aufgenommen zu werden. Damals konnten mir meine Eltern nicht mit einer Entschuldigung helfen, denn religiöse Gefühle waren keine gültige Ausrede, außerdem durfte ohnehin niemand von der Hauptlinie abweichende Überzeugungen besitzen.
Meine Heimat war eine Diktatur, die Diktatur der Froschfolterer. In einer Demokratie jedoch müsste ein solcher Brief funktionieren, dachte ich. Und tatsächlich kam Sebastian am nächsten Tag sogar zwei Stunden früher von der Schule nach Hause. Die Lehrerin hatte meinen Brief gelesen, die Entschuldigung akzeptiert und Sebastian vom Unterricht befreit, denn er durfte auch nicht mit ansehen, wie die anderen Schüler ihre Würmer foltern. Anschließend wollte die Lehrerin von ihm wissen, zu welcher Konfession seine Familie gehört. Sebastian überlegte kurz und sagte, ohne rot zu werden: »Buddhismus.« Die Lehrerin wunderte sich, wie weit der Buddhismus inzwischen fortgeschritten war, woraufhin Sebastian präzisierte, es handle sich in unserem speziellen Fall um den sogenannten russischen Buddhismus, auch als Samowar-Buddhismus bekannt. Seine oberste Regel laute: Du darfst keine Würmer foltern.
Nächste Woche ist Elternversammlung. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll.
Im Land der Ideen
Die Bewohner der mittelfränkischen Stadt Lauf bereiten ihren Karpfen wie die Wiener ihr Wiener Schnitzel zu – konsequent. Sie machen den Karpfen platt, indem der Fisch in zwei Hälften längs zerschnitten wird. Danach wird jede Hälfte paniert und in den Zustand einer radikalen Knusprigkeit versetzt. Diese Karpfen, die im Gasthof Zur Post auf keinem Teller fehlten, als gäbe es in dem ganzen Lokal kein anderes Gericht, beeindruckten mich durch ihr ungewöhnliches Aussehen. Als jemand, der seit vielen Jahren jede Woche in einer anderen deutschen Stadt speist, glaubte ich, längst alle regionalen Spezialitäten dieses Landes mehrmals gekostet zu haben: Würste unterschiedlicher Größe und Farbe, Kraut, mal mehr, mal weniger sauer und manchmal zu Brei verkocht, Eisbeine, die von neugierigen japanischen Mädchen in Münchner Touristenlokalen zu dritt umschlungen werden, wie Pythonschlangen ihre Kaninchen umschlingen. Und Aufläufe, ja vor allem unzählige Aufläufe, diese kulinarische Erinnerung Deutschlands an die Zeit des Hungers und der Not. Vor diesem Hintergrund wirkte der mittelfränkische Karpfen gehoben, beinahe dekadent.
Meinen Besuch in Lauf an der Pegnitz verdankte ich Bundespräsident Köhler, der seine Aufgabe darin sah, Deutschlands Selbstwertgefühl zu modernisieren, d. h. zu heben. Gleich nach der Fußballweltmeisterschaft, die bekanntlich unter dem etwas verwirrenden Slogan »Die Welt zu Gast bei Freunden« stattfand, entwarf er, auf der Welle der allgemeinen Selbstbegeisterung surfend, ein neues Motto: »Deutschland – Land der Ideen«.
Schon beim ersten Slogan schauten sich die Deutschen ungläubig um, auf der Suche nach irgendwelchen »Freunden«, bei denen sie zu Gast waren. Jeder wollte sich zur Welt zählen, nicht Gastgeber sein. Nach der beinahe siegreichen Fußballweltmeisterschaft hatte sich jedoch das Selbstwertgefühl dermaßen gesteigert, dass nichts mehr unmöglich schien in diesem Land der Ideen. Aus dem Vorstoß des Bundespräsidenten entwickelte sich eine landesweite Initiative: »365 Orte im Land der Ideen«, unterstützt von der Deutschen Bank, die wahrscheinlich in jedem Ort Deutschlands eine Filiale hat und damit den Fluss der Ideen gut vor Ort kontrollieren kann.
Es war ein ehrgeiziges Projekt: Jeden Tag musste eine deutsche Stadt eine kreative Idee entwickeln oder auch zwei. Dafür wurde der Stadtverwaltung ein handgeblasener Pokal der Kreativität des Bundespräsidenten von den örtlichen Vertretern der Deutschen Bank überreicht. Der Präsident konnte unmöglich persönlich mit dem Pokal der Kreativität von Idee zu Idee torkeln, dafür hätte er 365 Tage im Jahr unterwegs sein müssen. Aber zum Glück hatte er überall seine Leute.
Die Städte und Gemeinden bewarben sich eifrig um den Pokal der Kreativität und statt 365 Ideen kamen über 1500 zusammen, d. h. fast jede zweite deutsche Stadt hatte eine ausgebrütet! Manche Ideen waren allerdings so bescheuert, dass sie schon im Sekretariat des Bundespräsidenten aussortiert wurden. Das Aussortieren tat dem Projekt nur gut, es waren sowieso viel zu viele Ideen für das relativ kleine Land. Nur die besten schafften es in den »Katalog der Ideen«.
Die Städte überboten sich an Kreativität und Einfallsreichtum, insbesondere in den Bereichen Kunst, Wirtschaft und Soziales. Es kam viel Erstaunliches zum Vorschein. Die Leipziger warfen zum Beispiel einen Elefanten in einen Brunnen mit Wänden aus Glas, damit man dem großen Tier beim Schwimmen von unten zuschauen konnte. Ein seltener Spaß. In Osterode luxussanierte man einen alten Schafstall. Die Bewohner von Pritzwalk machten, um den Abwanderungstrend zu stoppen, etwas aus dem öden Autobahndreieck Wittstock/Dosse: Man dreht sich dort nun nur noch im Kreis und kommt so gar nicht mehr weg – in den Westen. Die Stadt Kirchheim hat die Aktion »Buddeln mit Oma und Opa« ins Leben gerufen, damit Kinder unter Anleitung von engagierten Senioren Rüben sammeln und ihnen dadurch der reiche Erfahrungsschatz der älteren Generation nähergebracht wird. In Hamburg ließ die Leitung einer Justizvollzugsanstalt ihre Knastinsassen T-Shirts mit Aufdrucken wie »Noch unschuldig« und »Auf Bewährung« produzieren.
Die Idee von Lauf war, eigene Literaturtage auszurufen