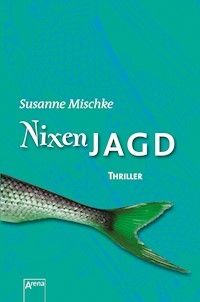8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Eigentlich entscheidet Mathilde nie aus dem Bauch heraus. Aber diesmal ist sie rettungslos verliebt – in einen zu lebenslanger Haft verurteilten Mörder. Allzu rasch gibt sie ihm ihr Jawort, weil sie glaubt, dass er der Richtige ist. Bis er plötzlich vor ihrer Tür steht … Susanne Mischkes neuer Kriminalroman ist originell und psychologisch packend zugleich. Sie schickt den Leser mit Mathilde auf eine Gefühlsachterbahn, wo Liebe sich in tiefen Hass verwandelt und hinter der Leidenschaft eiskaltes Kalkül zum Vorschein kommt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
4. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95569-0
© Piper Verlag GmbH, München, 2006
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagabbildung: Joachim Lapotre / plainpicture / Readymade-Images
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Immer muß es anfangen zu regnen, wenn man gerade aus der Tür tritt. Anfangs kann sie die Tropfen noch zählen, sieht einen nach dem anderen auf dem Pflaster zerplatzen, dann geht der Aufprall des einzelnen in einem Rauschen unter. Sie fängt an zu laufen. Der Körper wehrt sich gegen die Strapaze, die Muskeln machen sich schwer, es dauert, bis sie den Rhythmus gefunden hat. Eins, zwei, drei, vier, einatmen – eins, zwei, drei, vier, ausatmen. Allmählich verflüssigt sich die Schwere des Körpers, sie spürt die Kraft, die sie voranträgt, das Herz pumpt, sie funktioniert. Eine gut geölte Maschine. Selbstbewußt, die Arme angewinkelt, setzt sie einen Fuß vor den anderen, bereit für die tägliche Dosis Endorphin, die der Körper zur Belohnung für die Schinderei ausschüttet. Nicht immer, nur manchmal, wie ein launischer Liebhaber.
Dunkle Wolken hängen tief über der Stadt. Fast ohne zu dämmern, ist es Nacht geworden. Es riecht nach Herbst, die Pflanzenwelt verströmt den Duft des nahenden Verfalls. Schwarz hocken die Krähen in den Bäumen. Die letzten Hundebesitzer fliehen mit eingezogenen Köpfen. Kein Mensch sitzt mehr auf den vom Regen beträufelten Bänken. Regen klatscht ihr ins Gesicht. Sie vernimmt Schritte hinter sich und fährt im Laufen herum. Niemand zu sehen. Es muß das Echo ihrer eigenen Schritte gewesen sein. Runter mit der Kapuze! Lieber naß werden, als nicht richtig zu hören. Jetzt wird aus dem Prasseln des Regens und dem Rauschen der Blätter eine Kakophonie des Schreckens, unzählige Härchen richten sich auf, werden zu kleinen Antennen.
Sie hört das Aufklatschen von Sohlen, ganz deutlich. Da sind fremde Schritte. Nicht so panisch umdrehen! Die Angst nicht zeigen, sonst ist man ein potentielles Opfer. Also Kopf hoch, Schultern zurück. Angst ist nur eine Einbildung, ein chemischer Vorgang im Gehirn, reduzierbar auf einen Urinstinkt.
Na also. Es ist ein Jogger, ein Mitglied der Körperkult-Community, kein Vergewaltiger, kein Menschenfresser. Entwarnung. Sein Gesicht ist naß, er sieht gut aus, hebt lässig die Hand zum Gruß. Dann ist er im Dunkeln verschwunden. Nur sein Schweiß hängt noch in der Luft.
Wieder den Rhythmus finden. Eins, zwei, drei, vier, einatmen – eins, zwei, drei, vier, ausatmen. Ist das hier duster, die Landeshauptstadt könnte ruhig ein paar Laternen mehr aufstellen. Ein Zweig knackt. Etwas raschelt. Ihr Herzschlag gerät ins Stolpern. Ein Vogel flattert aus dem Gebüsch auf.
Bist du heute hysterisch. Adrenalin statt Endorphin. Das ist nur Quälerei, nichts wie nach Hause. Nur noch ein paar hundert Meter bis zur Brücke. In den Schatten der Haustür schlüpfen, den Schalter drücken und eintauchen in das sichere Licht. Happy-End.
Eins, zwei, drei vier, einatmen – eins …
Ein stummer Schrei reißt das Gesicht auseinander. Eine kalte Stahlschlinge schneidet in ihr Fleisch und schnürt ihr die Luft ab. Heißer Atem streift ihr Genick, während sie vergeblich nach Luft ringt. Gerade als die Todesangst zur Gewißheit wird, läßt der Druck nach, und für einen köstlichen Moment spürt sie, wie der Sauerstoff durch ihre Zellen strömt. Dann sieht sie in diese Augen und weiß, daß das erst der Anfang war.
Erster Teil
I
Mathilde zog die Karte stets bei geschlossenen Jalousien, als beginge sie ein Verbrechen. Dabei war es nur eine alte Gewohnheit. Aber Mathilde änderte ihre Gewohnheiten nicht gerne, auch nicht die schlechten.
An diesem Morgen war es der Tod.
Nicht gerade das, was einen vor einem Arztbesuch aufmuntern konnte, dachte Mathilde und schlug im Tarothandbuch nach. Dort stand etwas von Transformation und Veränderungen. Sie klappte das Buch zu. Unfug.
Mathilde wollte nichts verändern. Sie mochte ihr Leben, so wie es war. Sie lebte allein. Die Männer waren ihr immer wieder aus den Händen geglitten, nie hatte es ganz gepaßt.
Sie ging zum Fenster und öffnete die Jalousie. Klares Sonnenlicht strömte in die saubere, aufgeräumte Küche, in der jeglicher Okkultismus ab sofort nichts mehr verloren hatte.
Zehn nach sieben. Noch Zeit, ein Buch auszusuchen. Ärzte waren grundsätzlich unorganisiert, man mußte sich auf Wartezeiten einstellen. Klatschblätter rührte sie nicht an, schon gar nicht die abgegriffenen Hefte in Arztpraxen. Sie entschied sich für einen Kriminalroman, auf dessen Umschlag Spannung versprochen wurde. Was denn sonst, fragte sich Mathilde und packte das Buch in ihre Tasche.
Ehe sie ging, warf sie einen Blick auf ihre Wetterstation. Vierundzwanzig Grad, dreißig Prozent Luftfeuchtigkeit, Druck steigend. Also keine Jacke und den Florentiner.
Pünktlich um 7.58 Uhr traf Mathilde in der Praxis ihres Kardiologen ein. Sie wurde von einer Angestellten in ein Zimmer geleitet, das es im vergangenen Jahr so noch nicht gegeben hatte: sechs kognakbraune Ledersessel, ein Wasserspender, ein Kaffeeautomat. Auf einem niedrigen Tisch in der Mitte des Raumes lagen Geo, National Geographic und Cicero, die knochenfarbenen Glasfaserwände kleideten psychedelisch anmutende Bilder. Vorzeigeobjekte aus der Maltherapie in einer psychiatrischen Klinik, vermutete Mathilde. Sie war die einzige Patientin im Raum und hatte gerade ihr Buch aus der Tasche geholt, als die Tür geöffnet wurde. Drei Männer kamen herein. Zwei von ihnen trugen dunkelblauen Jacken, deren Ärmel das Niedersachsenpferd zierte.
Mathilde schaute diskret in ihr Buch. Die Männer setzten sich in die drei Sessel ihr gegenüber.
»Guten Morgen.« Es war eine tiefe, leise Stimme.
Sie sah auf. Seine Augen hatten die Farbe von angelaufenem Silber.
»Guten Morgen«, gab sie zurück und richtete ihren Blick wieder auf die Zeilen ihres Buchs. Aber an Lesen war gar nicht zu denken. Sie konnte spüren, wie er sie ansah.
Mathilde straffte ihre Schultern, als könnte sie damit seine Blicke abstreifen, und musterte nun ihrerseits den Mann: Er saß aufrecht da, zwei scharfe Falten zogen sich von den Flügeln einer griechischen Nase zu den spöttischen Mundwinkeln. Ein aristokratisches, intelligentes Gesicht, dessen Mund auf jeden herabzulächeln schien. Er war gründlich rasiert. Das braune Haar war kurz und an den Schläfen ergraut. Das Leder seiner Schuhe glänzte. Er trug eine schwarze Hose, ein sandfarbenes Hemd, unter dem sich kräftige Schultern abzeichneten, und Handschellen.
»Sind Sie herzkrank?« fragte er.
»Wohl kaum.«
»Was macht Sie da so sicher?«
»Steine werden nicht krank. – Und Sie?«
»Ich auch nicht. Ich habe kein Herz. Ich bin ein Mörder.«
»Ah, ja. – Ich bin Lehrerin.«
Ein kurzes Schweigen trat ein.
»Ich bin zu einer Kontrolluntersuchung hier«, erklärte Mathilde. »Einmal im Jahr, am Ende der Ferien.«
»Ein letzter Check vor der Feindberührung.«
»Das haben Sie präzise auf den Punkt gebracht«, sagte Mathilde.
»Das war einmal mein Beruf. Motivationstraining und Kommunikation. Mein Name ist Lukas Feller. Vielleicht haben Sie seinerzeit von mir und meinen Seminaren gehört.«
»Nein, bedaure.«
»Ist auch schon einige Jahre her. Sie brauchen mir Ihren Namen nicht zu nennen, wenn Sie nicht mögen.«
Tatsächlich überlegte Mathilde. War es klug, einem Mörder seine Identität preiszugeben? Lieber nicht. – Aber wenn er einem gefiel, der Mann, nicht der Mörder? Konnte man das überhaupt trennen?
»Welche Fächer unterrichten Sie?« fragte er. »Halt, lassen Sie mich raten, einverstanden?«
Mathilde nickte.
Er betrachtete sie erneut, nun, mit ihrer Erlaubnis, geradezu unverschämt. Die Augen eines Alligators, dachte Mathilde. Kaum ein Wimpernschlag, ein kühles Taxieren. Dann setzte er seine Worte, langsam und überlegt. Er schien gewohnt, daß man ihm zuhörte und ihn nicht unterbrach.
»Ihre Kleidung ist von lässiger Eleganz mit einem Hauch Extravaganz. Sie haben eine drahtige, muskulöse Figur und kräftige Hände. Deutsch und Französisch. Vielleicht auch Sport.«
»Mathematik, Physik und Spanisch.«
Er nickte bedächtig. »Verzeihen Sie. Das habe ich übersehen.«
»Was?«
»Ihren Hang zur Grandezza.«
»Vielleicht sind Sie ein wenig aus der Übung«, vermutete Mathilde.
»Welche fünf Worte würden Sie in Ihren Grabstein meißeln lassen?« fragte er.
»Wie bitte?«
»Fünf Worte. Die üblichen Konventionen außer acht gelassen.«
Mathilde lehnte sich zurück, überlegte kurz und sagte dann: »Sie war eine verdammt gute Lehrerin.«
»Das sind sechs.«
»Es ist mein Grabstein.«
Er lächelte.
Der König der Schwerter. Dieser Mann hier war definitiv der König der Schwerter: die Verkörperung vom Geist beherrschter Leidenschaft. Einer, der Haltung bewahrte, obwohl er offensichtlich verloren hatte. Eine Aura der Souveränität und Dominanz umgab ihn, und natürlich, wie jeden Herrscher, etwas Einsames.
Mathilde gehörte nicht zu den Frauen, die ihr Leben damit zubrachten, auf den Richtigen zu warten. Bis jetzt war sie sich nicht einmal eines Mangels bewußt gewesen. Daß sie einen Mann wie diesen schon lange gesucht hatte, wurde ihr erst klar, als sie ihn jetzt vor sich sah.
Die Dame vom Empfang kam herein, lächelte dem Patienten mit den Handschellen zu und ignorierte den Rest der Anwesenden. Mit bedächtigen Bewegungen füllte sie Milch in den Behälter des Kaffeeautomaten, überprüfte den Vorrat an Bohnen, kontrollierte die Sauberkeit der Tassen. Ihr Stringtanga zeichnete sich deutlich unter ihrer weißen Hose ab. Den beiden uniformierten Herren gefror der Blick. Der Mörder registrierte den Anblick mit amüsierter Gelassenheit.
Mathilde hatte die Gegenwart der beiden Bewacher zwischenzeitlich kaum mehr wahrgenommen. Sie waren Statisten, ein äußerer Rahmen, einzig dazu da, die Präsenz des Mannes in Handschellen hervorzuheben. Der Stringtanga dagegen war ein Störfaktor erster Güte. Doch schließlich gab es an der Kaffeemaschine beim besten Willen nichts mehr zu tun, und die Angestellte mußte wieder gehen.
»Dieses Zimmer erinnert ein wenig an die Business-Lounge einer Fluggesellschaft, finden Sie nicht?« bemerkte Feller, offenbar in der Absicht, den Abgrund zu überbrücken, den die Empfangsdame hinterlassen hatte.
»Der Sekt und die Erdnüsse fehlen«, entgegnete Mathilde.
»Es ist nur für Privatpatienten.«
»Tatsächlich?« staunte sie. »Wie sich die Zeiten ändern. Früher wurde man heimlich durchgewinkt.«
Sie sollten ein Schild an der Tür anbringen, dachte sie: Private und Mörder. Sie schielte auf die Uhr: acht Uhr zwölf. Schon lange hegte sie den Verdacht, daß Ärzte ihre Patienten absichtlich warten ließen, um sie gefügig zu machen.
»Darf ich fragen, was Sie da lesen?« Sie hätte das Buch längst verschwinden lassen sollen. Zu spät! Nun hob sie es hoch, damit er den Titel lesen konnte.
»Patricia Highsmith, Die gläserne Zelle«, las er vor.
»Ich habe es geerbt.«
Es hörte sich an wie eine tölpelhafte Lüge, dabei war es die Wahrheit. Unter den zweitausend Romanen ihrer Großmutter hatten sich – neben den üblichen Klassikern und der Buchklublektüre – überraschend viele Kriminalromane befunden. Aber geradezu sensationell war eine andere Entdeckung gewesen: drei Kisten süßlicher Liebesromane. Dabei war an Merle Degen weiß Gott nichts Süßliches gewesen.
»Darf ich es mir ansehen?« drängte sich seine Stimme in ihre Gedanken.
Sie wollte aufstehen und ihm das Buch reichen.
»Augenblick.« Der linke Bewacher streckte die Hand nach dem Buch aus. Fellers Mimik bat um Vergebung für den Mann, der den Roman durchblätterte und schüttelte, bevor er ihn dem Häftling aushändigte. Feller studierte den Text auf der Rückseite und schien die ersten Sätze zu lesen. Mathilde betrachtete seine Hände. Sie waren sehnig, mit langen Fingern und hervorstehenden Knöcheln.
»Gefällt es Ihnen?« fragte er dann.
Mathilde merkte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg. »Ich habe gerade erst angefangen, darin zu lesen.«
Er gab dem Beamten das Buch zurück, der es Mathilde weiterreichte. Rasch steckte sie es weg.
»Wie lange sind Sie schon im Gefängnis?«
»Acht Jahre.«
»Und wie lange noch?«
»Schwer zu sagen. Ich habe eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen.«
Es klang nüchtern und ermutigte Mathilde zu der Frage: »Wen haben Sie ermordet?«
Er lächelte. Selbstzufrieden wie Mephisto, fand Mathilde.
Die Tür des Wartezimmers wurde erneut geöffnet.
»Frau Degen, bitte.«
Mathilde griff nach Strohhut und Tasche und heftete sich einem Mädchen im weißen Kittel an die Fersen.
»Auf Wiedersehen«, sagte sie im Hinausgehen.
»Wohl kaum, Frau Degen«, antwortete er.
Die Siedlung döste in der Mittagshitze. Das kleine Haus mit dem steilen Dach, vor dem Mathilde ihren Golf parkte, hatte als einziges noch die alten Fensterläden, von denen nun die grüne Farbe abblätterte. Die Dachrinne hing an einer Seite rostig herunter. Der Garten besaß, wie alle anderen hier, die Form eines langen Korridors. Doch während in den meisten Gärten in dieser Straße eine gewisse Akuratesse herrschte, waren die Sträucher hinter dem maroden Jägerzaun ins Kraut geschossen, und die vier Obstbäume hatten wilde Triebe gebildet. Im hüfthohen Gras verteilt standen bunte Skulpturen, die ein wenig an die Nanas vom Leineufer erinnerten. Ganz hinten, am Ende des Gartens, befand sich ihr Entstehungsort, ein hellblauer Holzschuppen mit einem großen Fenster. Das Atelier. Mathilde argwöhnte allerdings schon längere Zeit, daß es inzwischen hauptsächlich der Aufbewahrung von Gerümpel sowie der Aufzucht von Hanfpflanzen diente.
Das Gartentor quietschte. Ein Trampelpfad führte zur Haustür, die in griechischem Kneipenblau angemalt war.
Mathilde betätigte den Türklopfer dreimal, ehe sie den Schlüssel herausnahm und die Tür aufsperrte. Im Flur war es dunkel. Seit ihre Mutter das Haus bewohnte, roch es dort wie in einem alten Schrank. Etwas Schwarzes flitzte an ihr vorbei nach draußen.
»Ich bin im Wohnzimmer.«
Mathilde folgte der Stimme, die einer süßen Rauchwolke entstieg. Sie brauchte kein Licht. Sie kannte dieses Haus, wie man nur Räume kennt, in denen man seine Kindheit verbracht hat. Meine blitzschnelle Kindheit, dachte Mathilde gerade, als ihr ein muffiges Gemisch aus Katzenurin, Rauch und etwas Orientalischem den Atem raubte. Sie eilte ans Fenster, zog die Vorhänge beiseite und stieß die Flügel auf.
»Mach zu, die Sonne knallt rein.«
Mathilde zog den schweren roten Vorhang wieder zu. Den Marillenlikör auf dem Tisch sah sie trotzdem. Das Zimmer war vollgestopft mit Möbeln und Krimskrams. Zeitschriften stapelten sich in den Ecken. Nichts erinnerte mehr an die Ordnung und Sauberkeit, die unter Merles Regiment hier geherrscht hatten. Auf der Anrichte, wo früher die Familienfotos gestanden hatten, befanden sich nun Eso-Kitsch und eine Vase mit welken Sonnenblumen. Ihr gelber Blütenstaub bedeckte das Holz.
Mathildes Mutter saß auf einem Sofa, über das eine Decke mit indischem Muster gebreitet war, und rauchte einen Zigarillo. Neben ihr hatte sich eine schmutzfarbene Katze zusammengerollt.
»Guten Tag, Franziska.«
»Warum bist du schon hier? Es ist zwölf. Du kommst doch mittwochs immer erst um zwei. Man kann die Uhr nach dir stellen.«
»Ich war beim Arzt.«
»Bist du etwa krank?« Franziska sah ihre Tochter prüfend an. Ihre Augen waren von einem luziden Blau, wie wenn man einen Tropfen Tinte in ein Glas Wasser fallen ließ.
»Nein, alles bestens.« Der Kardiologe hatte eine »leichte Plaquebildung im Bereich der Karotis« diagnostiziert. Nichts Gefährliches. »Nur eine kleine Alterserscheinung«, hatte er bemerkt, charmant wie er war. Mathilde wurde in diesem Monat zweiundvierzig.
»Wann wird endlich die Dachrinne repariert?« Das Geld dafür hatte Mathilde ihrer Mutter schon vor Wochen gegeben. Was offenbar ein Fehler gewesen war.
Franziska rang theatralisch die Hände, ihre Armreifen klirrten. Sie trug eines ihrer indischen Kleider, grasgrün mit einem bestickten Ausschnitt, der recht gewagt war, nicht nur für eine Sechzigjährige. Aber Franziska besaß eine robuste Schönheit, die ihrem wüsten Leben widerstanden hatte.
»Dieser Handwerker! Er läßt mich wieder und wieder sitzen.«
Das war eine Lüge, und das wußten beide. Das Geräusch schlurfender Schritte lenkte Mathilde vom Thema ab. Im Türrahmen erschien ein fleckiger, rotgrün gestreifter Kaftan, der sich über einen Buddhabauch spannte.
»Ah, die Frau Oberlehrer! Welch Glanz in unserer Hütte«, sagte eine Stimme, die knarzig war wie altes Brot.
»Das ist meine Hütte, nicht eure«, stellte Mathilde richtig. »Und von Glanz kann keine Rede sein, wenn ich mich so umsehe.« Konsterniert schaute der Zeck von Mathilde zu Franziska. Die saß schweigend da, die Augen halb geschlossen, geschützt hinter ihrer Rauchwolke. Dann hatte er sich wieder gefangen und grinste. »Du kommst zu früh zur Generalinspektion. Ich war gerade dabei, den Mülleimer auszulecken.«
»Ach, daher der Mundgeruch.«
»Bitte, Mathilde! Wo bleibt deine Kinderstube?« mahnte ihre Mutter in einer gestelzten Art, die nicht zu ihr paßte.
Kinderstube. Erinnerungen schlichen sich heran: polierte Möbel, Suppenlöffel, die so groß waren, daß sie kaum in den Mund paßten, Sonntagskleider, die nach Hoffmanns Reisstärke dufteten, Lackschuhe und Hüte. Viele Hüte.
Der Zeck hustete. Es klang, als ob man Holz spaltete. Mathilde riß die Vorhänge wieder auf. Das Licht und der hereinströmende Sauerstoff schlugen ihn in die Flucht, er schob seinen Bauch noch weiter heraus und plazierte seine Schrittchen so achtsam, als ob Glatteis auf dem Parkett herrschte.
Die Tür fiel ins Schloß. Mathilde nahm den Florentiner ab und fächelte sich damit Luft zu. Die Staubpartikel in den Sonnenstrahlen gerieten in einen wilden Tanz.
»Wohnt der Zeck jetzt etwa hier?«
»Nur vorübergehend. Sie haben ihm die Miete erhöht, und …«
»Erspar mir den Rest«, wehrte Mathilde ab.
»Stimmt, was rede ich, du hast ja kein Herz.«
Normalerweise setzten Bemerkungen dieser Art das übliche Scharmützel in Gang. Heute jedoch mußte Mathilde bei dem Wort Herz an den Mann mit den Handschellen denken. Lukas Feller. Sein Name hatte sich in ihr Hirn gebrannt. Sie lächelte.
»Warst du eigentlich jemals in jemanden verliebt, Mathilde? So richtig romantisch, mit Herzrasen und all dem?«
Mathildes Lächeln zerrann. Moritz. Das war tausend Jahre her. Und doch zitterte der Schmerz manchmal noch leise nach.
»Wie soll ich ohne Herz Herzrasen haben?« fragte sie, während sie das Bild über dem Sofa betrachtete. Ein Gebilde in Violett und Magenta, das an kopulierende Schnecken erinnerte. Es hieß »Yin und Yang« und war mit »Mara« signiert. Mara sei ihr Seelenname, den sie in einer Vollmondnacht geträumt habe. Der Nachname ihrer Mutter war Degen, denn sie hatte keinen ihrer zahlreichen Männer geheiratet.
Sie hörten, wie die Haustür zufiel. Mathilde ging in die Küche, ignorierte den hygienischen Zustand – sie war sich sicher, daß dort Kriechtiere und gefährliche Bakterienstämme lebten –, holte ein Geschirrtuch aus dem Schrank und breitete es auf der Sitzfläche des Wohnzimmersessels aus. Trotz dieser Maßnahme würden wieder unzählige Katzenhaare an ihr klebenbleiben. Die Perserkatze ihrer Mutter war die häßlichste Katze, die Mathilde kannte. Den schwarzen Kater mochte sie lieber, aber der nahm stets Reißaus vor ihr.
»Du wolltest mir irgendwas erzählen«, erinnerte Franziska.
Die Likörflasche und das Glas hatten zwischenzeitlich ihre Positionen verändert.
»Heute morgen habe ich meine Tarotkarte des Tages gezogen, und es war der Tod.«
»Das ist ja wunderbar!« Franziska warf die Arme in die Luft. Ihre Armreifen rasselten. »Der Tod bedeutet immer etwas Neues. Sofern man bereit ist, das Alte loszulassen.«
»Schön. Morgen bekomme ich eine neue Klasse. Das bedeutet wieder ein Stück Arbeit, bis ich denen Mores beigebracht habe.«
Lukas Feller lag auf dem Bett und las die Zeitung vom Vortag. Sie kam mit der Post, weshalb es mindestens einen Tag dauerte, bis sie bei ihm eintraf. Meistens zwei. Der einstündige Hofgang und das Abendessen waren vorüber, sie hatten noch eine knappe Stunde zur freien Verfügung, ehe der Einschluß erfolgte. Die Tür seiner Zelle stand offen. Obwohl er las, registrierte er jeden, der vorbeiging. Von den beiden Schließerinnen der Spätschicht war nichts zu sehen. Während ihrer letzten Dienststunde blieben sie fast immer in ihrem Büro neben dem Eingang zur Station.
Lukas hörte ein Geräusch an seiner Zellentür und blickte auf. Es war Karim, sein Zellengenosse – vier Jahre für Raubüberfall. Der Mangel an Haftplätzen im niedersächsischen Strafvollzug machte eine Doppelbelegung der Hafträume notwendig. Zu zweit war man allerdings noch gut dran, es gab auch Viererzellen. Karim hatte einen Putzeimer und einen Lappen in der Hand.
»Vergiß die Kaffeemaschine nicht«, sagte Lukas.
»Soll ich welchen machen?« Die Frage beinhaltete auch die Bitte, eine Tasse mittrinken zu dürfen. Kaffee mußte von den Häftlingen selbst gekauft werden und war somit eine wichtige Knastwährung, neben Zigaretten und Drogen.
»Von mir aus.«
Karim wischte sich die Hände an seinem T-Shirt trocken, das ein Eminem-Schriftzug zierte. Nur wenige Häftlinge trugen die dunkelblauen Jogginganzüge der Anstalt. Markenkleidung war gefragt, besonders bei den Jüngeren.
»Die Klosa sagt, du sollst ins Stationszimmer kommen, du hast Post.«
Lukas faltete die Zeitung zusammen, nahm den Katalog von Elektro-Conrad, den er sich von einem anderen Gefangenen ausgeliehen hatte, und ging damit den Flur entlang. Ein Häftling kam ihm entgegen und fixierte ihn. Er hatte einen breiten, kahlrasierten Schädel und Nackenmuskeln wie ein Opferstier. Lukas parierte den Blick. Der andere war Anfang Vierzig und erst seit einem Monat hier. Von seiner Gesinnung zeugten mehrere NPD-Aufkleber an der Innenseite seiner Zellentür, sichtbar für jedermann, wenn die Tür offenstand. Obwohl die Gänge vor den Zellen nicht breit waren, kam man dennoch ungehindert aneinander vorbei – wenn man wollte. Aber Kusak legte es drauf an. Er rempelte Lukas an. Der Katalog fiel auf den Boden, rutschte unter dem Geländer durch und schwebte nun über dem zweiten Stock in einem der Netze, die zwischen den Geländern eines jeden der vier Stockwerke gespannt waren.
»Hoppla«, sagte Kusak.
»Der Katalog ist runtergefallen«, sagte Lukas ruhig.
»Dein Problem, Feller.«
Offensichtlich erhob Kusak Anspruch auf die Stelle des Alphatiers in diesem Rudel von Raubtieren. Die Rußlanddeutschen hatte er schon auf seiner Seite, denn plötzlich lungerten drei von ihnen auf dem Gang herum und schirmten scheinbar zufällig die Wand ab, an der der Draht entlanglief, mit dem man den Alarm auslösen konnte. Was Lukas selbstverständlich nicht einfallen würde. Aber es waren hier nicht der Ort und nicht die Zeit für einen Übergriff. Soeben kam die Bedienstete mit der Aufschrift M. Klosa auf ihrem Namensschild aus dem Stationsbüro und witterte sofort, daß Stunk in der Luft lag.
»Was gibt es denn da?« fragte sie.
»Mir ist der Katalog runtergefallen«, antwortete Lukas.
»Ich werde mich darum kümmern. Sie haben Post, Herr Feller, kommen Sie bitte mit.«
Lukas ließ Kusak und seine Trabanten stehen und folgte Klosa. Seit die Station überwiegend von Frauen betreut wurde, hatten sich Umgangston und Sauberkeit gebessert.
Lukas setzte sich auf einen der vier Stühle vor dem Doppelschreibtisch. Klosas Kollegin schaute konzentriert auf den Bildschirm und nickte ihm nur kurz zu, ohne den Blick zu heben. M. Klosa nahm ihm gegenüber Platz. Das M stand für Marion, und das war so ziemlich alles, was man über die junge Beamtin wußte. Ob sie mit dem gleichnamigen Polizeipräsidenten verwandt war? Das Vollzugspersonal war angewiesen, den Inhaftierten nichts Persönliches zu erzählen, und besonders die Frauen achteten sehr auf die notwendige Distanz. Tief drinnen saß die Angst, das wußte Lukas, auch wenn sie alle sehr selbstbewußt auftraten. Klosa war nur einssechzig groß, und neulich hatte Lukas zu ihr gesagt: »Ihre Schlüsselkette ist zu lang. Jemand könnte sie Ihnen um den Hals wickeln.« Seitdem trug sie eine kürzere Kette.
Klosa schlitzte den Brief vor seinen Augen auf und schüttelte den Inhalt aus dem Umschlag: eine Seite hellblaues Briefpapier, beschrieben mit einer naiven, runden Frauenschrift, dazu ein Foto. Klosas Blick streifte es kurz, aber sie sagte nichts, sondern prüfte, ob sich in dem Umschlag noch etwas Verbotenes befand.
»In Ordnung«, sagte sie und reichte ihm seine Post. Aber dann konnte sie sich nicht verkneifen zu fragen: »Was finden diese Frauen nur an euch?«
Lukas zuckte die Achseln und drehte die Handflächen nach oben. »Sagen Sie es mir.«
»Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Mörder-Groupie.«
»Sicher?«
Sie warf ihm einen warnenden Blick zu und stand auf, Lukas ebenfalls. Der Gang draußen war leer, von Kusak war nichts zu sehen. Der Katalog lag nicht mehr im Netz.
Er brachte den Brief in seine Zelle. Die acht Quadratmeter Boden glänzten feucht, die Kaffeemaschine blubberte. Karim streckte den Kopf hinter dem Vorhang der Toilette hervor.
»Was schaust du so?«
Es war ein ungeschriebenes Gesetz, niemals ohne Erlaubnis einen fremden Haftraum zu betreten, und nur ein Dummkopf würde sich ausgerechnet den von Lukas Feller für so einen Fehltritt aussuchen.
»Man ist vorsichtig«, sagte Karim.
Lukas legte den Brief auf den winzigen Schreibtisch. Karim würde ihn nicht anrühren. Er nahm sich Kaffee, ging auf den Flur und unterhielt sich mit seinem Zellennachbarn Snick.
»Werden sie dich verlegen, wenn in Sehnde der neue Knast aufmacht?«
»Weiß nicht. Warum sollten sie?« fragte Lukas.
»Alle Lebenslangen kommen in den neuen Knast. Sicherheitsstufe eins, überall Kameras und Panzertüren.«
»Und welche Sicherheitsstufe haben wir hier?«
»Drei. Von vier.«
»Klingt, als ob hier jeder rein- und rausspazieren könnte.« Lukas grinste Snick zu. Snick war der Älteste der Station. Er saß wegen Betrugs und Urkundenfälschung und sollte in einem halben Jahr entlassen werden. Deshalb hatte er inzwischen regelmäßig Ausgang. Er tat Lukas hin und wieder einen Gefallen. Ohne Verbündete kam man hier nur schwer zurecht, das hatte der Einzelgänger Lukas rasch begriffen.
»Is ja irgendwie ungerecht«, befand Snick. »Die übelsten Kerle – dich natürlich ausgenommen – kommen in den schönen neuen Knast. Einzelzellen mit separatem Klo. Und wir können nach wie vor zu viert auf sechzehn Quadratmetern hausen und hinterm Vorhang scheißen.«
Kurz nach halb sechs trat die Schließerin der Nachtschicht schlüsselklappernd durch die Gittertür.
»Einschluß, meine Herren.« C. Meyer war Ende Vierzig und mollig. Etwas Mütterliches ging von ihr aus, die Häftlinge nannten sie Nachtschwester Conny. Sie nahm es mit dem Einschluß oft nicht so genau.
»Schönes Wetter hatten wir heute«, sagte Lukas. »Was sagt der Wetterbericht?«
»Soll so bleiben. Nur am Wochenende könnte es Hunde und Katzen regnen.«
Lukas nickte ihr zu. Er haßte sie für ihre Gutmütigkeit hinter der er deutlich den Gestank der Gönnerhaftigkeit roch. Doch sie war zuweilen nützlich.
»Gute Nacht, Herr Feller.«
»Nacht, Conny. Passen Sie gut auf uns auf.«
Sie kicherte. Dann fiel die Eisentür zu, und der Schlüssel schabte im Schloß.
Mathilde sah den Umschlag schon durch das Fenster des Briefkastens. Sie öffnete den Brief auf dem Weg nach oben. Er enthielt eine Konzertkarte für den übernächsten Freitag. Flamenco.
Sie lächelte, als sie beim Betrachten der Karte die Erinnerung einholte an jenen Herbstabend vor knapp zwei Jahren. Damals spielte die Abschlußklasse der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater, die sich nicht weit von Mathildes Wohnung befand, im Kammermusiksaal Beethoven-Sonaten. Mathilde hatte einen guten Platz, doch der Kunstgenuß litt durch das permanente leise Schniefen ihres Sitznachbarn. Sie hatte nur ein weißes, besticktes Tuch aus zarter Baumwolle dabei. Einen Moment zögerte sie. Doch jemand mußte diesem nervtötenden Geschniefe ein Ende bereiten, also reichte sie es dem Fremden.
»Das kann ich nicht annehmen«, flüsterte er. »Das ist sicher ein Erbstück.«
»Nehmen Sie es trotzdem.«
Pschschscht!
Nach dem Konzert bestand er darauf, sie nach Hause zu begleiten. Stumm gingen sie nebeneinander her durch die feuchte, tropfende Nacht. Ihre Schatten huschten über das glänzende Kopfsteinpflaster. Galant hielt er seinen Schirm, der immer wieder gegen die Krempe ihres Manhattans stieß, über sie. Mathilde war es nicht gewohnt, begleitet und beschirmt zu werden. Auch war es unnötig. Die Straßen, die sie passierten, gehörten zu den am besten bewachten der Republik. Eher war mit einer Personenkontrolle zu rechnen als mit Ganoven.
»Danke«, sagte sie erleichtert, als sie endlich vor ihrer Haustür angekommen waren. Sie suchte in ihrer Handtasche nach dem Schlüssel. Er klappte den Schirm zusammen und stand nun sehr dicht vor ihr unter dem kleinen Vordach. Das schwache Licht der Außenbeleuchtung wurde vom Nieselregen geschluckt, seine Augen lagen im Dunkeln. Er knetete seine Hände wie jemand, der vor einer schweren Aufgabe steht. Schöne Hände mit einem schmalen, goldenen Ehering.
Mathilde hatte endlich ihre Schlüssel gefunden und öffnete die Haustür.
»Ich beobachte sie schon seit einigen Wochen. Bei den Konzerten«, brach es aus ihm heraus.
»Und weiter?« fragte Mathilde.
Er zuckte mit den Schultern.
Ohne ein weiteres Wort an ihn zu richten, betrat Mathilde den Hausflur und ging die Stufen hinauf. Sie lauschte auf das Zufallen der schweren Tür, aber es blieb aus. Mit einem Klacken schaltete sich die Beleuchtung aus. Stufen knarrten. Im dritten Stock schloß sie die Tür auf. Sie ließ sie offen, machte kein Licht, nahm den Hut ab und schlüpfte aus dem Mantel.
Dann blieb sie stehen, horchte, fühlte ihren Herzschlag. Durch das hohe Fenster des Treppenhauses fiel silbriges Licht auf die Holzdielen des Flurs. Regentropfen glitzerten kalt an der Scheibe. Sie hörte langsame Schritte auf den alten Dielen. Sie kamen näher. Ein Schatten schob sich vor das Fenster. Dann Stille. Er war in ihrer Wohnung, ihre Nase witterte sofort den fremden Männergeruch. Die Tür glitt ins Schloß, eine Hand strich federleicht über ihren Rücken, Wirbel für Wirbel.
Als Studentin hatte Mathilde eine Zeitlang selbstgedrehte Zigaretten geraucht, und stets war die allererste Zigarette einer frisch geöffneten Packung die köstlichste gewesen. In diesem Bewußtsein machte sie nun die Augen zu und legte den Kopf in den Nacken, denn sie wußte, daß es mit diesem Mann nie wieder so sein würde wie jetzt. Noch war er eine unbekannte Größe, eine leere Leinwand für ihre Phantasien. Später würde er ihr seinen Namen nennen, würde über seinen Beruf, seine Familie, sein Leben reden, doch in diesem Moment war er nichts als ein heißer Atem an ihrem Hals, eine Hand, die ihre Brust umschloß und ein anschwellendes Stück Fleisch, das sich zwischen ihre Pobacken drängte. Sie wandte den Kopf und preßte ihre Lippen auf seinen Mund. Er verstand. Es fiel kein Wort, auch nicht, als sie ihn längst in ihr Schlafzimmer geschleust hatte.
Etwa zweimal im Monat fand Mathilde seither eine Konzert- oder Theaterkarte in ihrem Briefkasten. Nach den Veranstaltungen tranken sie stets eine Flasche Wein und verbrachten den Abend miteinander. Immer verschwand er im Lauf der Nacht. Es gab weder Forderungen noch Zukunftspläne. Er war ihr Ritter der Kelche, ein Träumer, der ab und zu in ihren Armen strandete – wie Treibgut.
Lukas, mein Liebster,
ich lese gerade Deinen letzten Brief. Vielleicht denkst Du ja auch gerade an mich. Ich hoffe es so sehr. Ich stelle mir vor, wie ich in Deinen starken Armen liege und Du mich streichelst. Ich weiß, daß dieser Tag kommen wird, ich werde auf Dich warten. Ich kann warten, Du bist jede Sekunde wert, auch wenn es wahnsinnig schwer ist. Ich weiß, daß Du mir nichts antun könntest, und selbst wenn, es wäre besser, durch Dich den Tod zu finden, als ohne Dich zu leben. Dann würde ich für immer Dir gehören. Du bist der Mittelpunkt meines Lebens. Jetzt ist schon ein ganzer Monat vergangen, seit wir uns gesehen haben. Ich flehe Dich an, beantrage bitte einen Besuchstermin für mich, egal wann, ich werde kommen. Und wenn es nur ein paar Minuten sind. Ich muß Dich sehen. Ich muß wissen, was los ist. Habe ich etwas falsch gemacht oder etwas Falsches gesagt, geschrieben? Wenn ja, dann tut es mir unsäglich leid. Liebster. Bitte. Ruf mich an. Ich möchte so gerne Deine sexy Stimme hören. Oder schreib mir wenigstens. Wenn ich etwas für Dich tun kann, dann laß es mich wissen. Ich warte.
In Liebe und Sehnsucht, Deine Claudine.
(P.S. Anbei ein Foto, wie Du es gerne hast.)
Lukas verzog den Mund angesichts der trostlosen Dummheit, die aus diesen Zeilen troff. Eine verachtenswerte Spezies. Frauen. Je schlechter man sie behandelte, desto anhänglicher wurden sie. Früher oder später verwandelten sie sich alle in winselnde Bittstellerinnen. Was sie Liebe nannten, war ihr Kampf um ein kleines bißchen Sicherheit. Dafür erniedrigten sie sich. Keine hatte je begriffen, daß sein Begehren durch nichts mit dem begehrten Objekt verbunden war.
Dennoch waren Besuche von Frauen eine Abwechslung. Besonders in den ersten Jahren, als er manchmal nicht mehr gewußt hatte, wie er den Gedanken ertragen sollte, daß da draußen das Leben tobte, während seines hier drinnen verrann. Sie hatten ihn für kurze Zeit vom Grübeln abgelenkt und ihn auch materiell versorgt: Geld, Tabak, Kaffee. Sie waren ahnungslose Zielscheiben für den Haß, der ihn hier drin am Leben hielt. Er hatte seine Spielchen mit ihnen getrieben, sie angelockt, warten lassen, ihre Glut neu entflammt, wenn sie schon fast resigniert hatten, nur um sie von neuem an seiner Kälte verzweifeln zu sehen. In letzter Zeit jedoch langweilten ihn die Frauen und erst recht ihre Lebensgeschichten, die er sich notgedrungen anhören mußte, und die sich auf fatale Weise ähnelten: Gewalt und Mißbrauch in der Kindheit und später prügelnde, saufende Ehemänner. Als ob er das nicht kennen würde. Und schließlich konnte er die zwei Stunden Besuchszeit, die man ihm pro Monat gewährte, nicht unbegrenzt aufteilen. Zumindest einen Vorteil hatte der Knast: Niemand von draußen konnte einem auf die Pelle rücken, wenn man es nicht wollte. Er würde ihr in zwei, drei Wochen schreiben. Das Warten machte sie mürbe. Alle. Deshalb verschwieg er ihnen auch, daß man zu bestimmten Zeiten auf der Station angerufen werden konnte.
Lukas betrachtete das Foto. Claudine. Magere Schenkel im Minirock. Blondes Haar, weich, fließend. Kaum noch vorstellbar, der Geruch von Frauenhaar, hier, im erdrückenden Mief der Anstalt. Die Perspektive des Fotos war frontal, das Fleisch lag bereitwillig da, gut ausgeleuchtet, kein Beiwerk, keine Posen. Wenigstens das hatte sie hinbekommen. Lukas nahm den Kugelschreiber, und langsam, Millimeter für Millimeter, durchlöcherte er mit der Mine das Papier. Als er fertig war, zog sich ein ausgefranster Riß vom Unterleib über den Bauchnabel bis hoch zum Brustbein. Lukas legte den Kugelschreiber hin, besah sich kurz sein Werk, knüllte dann Brief und Foto zusammen und warf beides vom Bett aus in den Abfalleimer.
Plötzlich kam ihm ein Gedanke. Er setzte er sich mit seinem Briefblock an den Schreibtisch.
»Stört es dich, wenn ich weiter fernsehe?« fragte Karim.
»Nein, nein«, antwortete Lukas großzügig.
In dem großen Raum neben dem Schlafzimmer machte Mathilde jeden Morgen um sechs Uhr ihre Yogaübungen, und jeden Donnerstag erteilte darin Herr Suong eine private Unterrichtstunde in Karate und Jiu-Jitsu. Das war nicht ganz billig, aber Mathilde hielt nichts von schlecht geputzten Turnhallen und Matten, über die schwitzende Wildfremde mit nackten Füssen liefen. Von Sammelumkleiden und Gemeinschaftsduschen erst gar nicht zu reden. Nur Leona Kittelmann, Kunst und Sport, nahm manchmal an der privaten Unterrichtsstunde teil. Sie war amüsant, gepflegt und roch nach Pudding.
Auf die morgendlichen Yogaübungen folgte die immer gleiche Routine; Mathilde funktionierte wie ein Uhrwerk: duschen, Haare fönen, Auswahl der Kleidung in Abstimmung mit den Wetterdaten, Tee aufbrühen, Zeitung holen, Tarotkarte ziehen, frühstücken.
Die Tarotkarte des ersten Schultages war die Neun der Schwerter: Grausamkeit.
»Na also«, murmelte Mathilde. Sie nahm das Teesieb aus der Kanne und ging nach unten, die Zeitung holen. Ihre Schritte klackerten durch die Totenstille des Treppenhauses. Man wohnte ruhig hier, im Zooviertel.
Zum japanischen Grüntee las sie die Zeitung. Nach dem Frühstück, das sie stets um sieben Uhr fünf beendete, ging Mathilde noch einmal ins Bad. Es war ganz in Weiß gehalten. In Mathildes Wohnung gab es viel Weiß, dagegen war das Gros ihrer Kleidung schwarz. Sie putzte sich die Zähne und schminkte ihre Lippen in einem strengen Burgunderrot. Ohne dieses Rot fühlte sie sich nackt im Gesicht.
»Ein Gesicht, als hätte Picasso die Callas gemalt«, hatte ihr irgendein Mann einmal gesagt. Eigenwillig, wollte dieser Euphemismus wohl sagen. Irgendwie schroff und unregelmäßig, fand Mathilde. Sie trug einen Hauch Make-up auf und blieb vor dem Spiegel stehen. Warnend zog sie die Brauen hinauf, dann erbost zusammen, glättete ihre Stirn und deutete ein ironisches Lächeln an. Es folgten das Raubtierlächeln, der vernichtende Seitenblick, das Fletschen des linken Eckzahns. Am Ende ihrer Exerzitien zwinkerte sie sich zufrieden zu. Sie erprobte ihr Mienenspiel jeden Morgen. Ihr Beruf erforderte perfekte Schauspielerei.
Ehe sie ging, widmete sie sich der Hutauswahl. An der längsten Wand des Schlafzimmers bewahrte sie fünfundneunzig Hüte auf. Die meisten stammten aus Merle Degens eigener Manufaktur, die sie nach dem Krieg gegründet hatte, nur die Strohhüte waren aus Italien. Die Hüte ruhten in runden Schachteln aus massiver Pappe oder sogar aus Leder. Es gab gestreifte Schachteln, einfarbige und solche mit floralen Mustern. Borsalino, Auseer, Barett, Florentiner, Kanotier, Casseur, Melone … Mathilde wußte genau, in welcher Schachtel welcher Hut lag. Einige kannte sie schon ihr Leben lang, denn die Lindener Hutfabrik hatte ihr den Kindergarten ersetzt. Seit Merle gestorben war und die Hüte bei ihr Einzug gehalten hatten, trug Mathilde täglich einen von ihnen. Sogar den Lodenhut mit der geringelten Auerhahnfeder hatte sie schon ausgeführt, aber nur einmal, zum Schützenfest.
Um halb sieben erfolgte die »Lebendkontrolle«. Der Haftraum wurde aufgesperrt. Lukas erwachte stets kurz vorher vom Rasseln der Schlüssel und Schlüsselketten, vom Knallen der Türen, die ins Schloß fielen. Der Ausdruck hinter Schloß und Riegel hatte auch im Zeitalter der Videoüberwachung nichts von seiner ursprünglichen Bedeutung eingebüßt.
Das Bett bestand aus einer dünnen Matratze aus schwer entflammbarem Material, die auf einem Holzbrett lag. Die gestreifte Bettwäsche und das Laken waren gebügelt und imprägniert, wodurch sie sich kalt und gummiartig anfühlten. Lukas hatte schon härter geschlafen. Dennoch träumte er manchmal von einem weichen Bett mit weicher, duftender Bettwäsche, und einer weichen, duftenden Frau darin. Oder einer Nacht unter freiem Himmel. Und von einem ausgedehnten Schaumbad in einer Badewanne. Ob man den Gefängnisgeruch je wieder loswürde?
Karim hatte Kaffee aufgesetzt und ging nun sein Frühstück holen, damit Lukas seine Morgentoilette in Ruhe verrichten konnte. Lukas machte das Fenster weit auf. Es wies nach Westen. Noch wehte morgenkühle Luft durch die Betongitter herein. Aber es würde ein warmer Tag werden, und nach der Arbeit würde die Zelle stickig und aufgeheizt sein. Manchmal verglich Lukas das Gefängnis mit einer Bienenwabe. Wo sonst lebten so viele Wesen zusammen auf so engem Raum? Selbst ein Hundezwinger hatte dem Gesetz nach größer zu sein als diese Zelle für zwei Mann.
Er machte ein paar Liegestütze und Situps, dann schaute er hinaus auf die ebenfalls vergitterten Fenster des U-Haft-Blocks gegenüber, auf den verdorrten Rasen des Freigeländes und hinauf in einen hellgrauen Sommerhimmel über Stacheldrahtrollen.
Karim kam mit einem Tablett herein, und Lukas ging ebenfalls sein Frühstück holen.
Vor der Tür des Haftraums lag der Katalog von Elektro-Conrad. Na also. Lukas hob ihn auf und nickte zufrieden.
Mathilde schritt zum Pult, stellte ihre Aktentasche darauf, nahm den Panamahut ab und legte ihn daneben. Dann wandte sie sich ihrer neuen Klasse zu. Die Jugendlichen fläzten auf ihren Stühlen und unterhielten sich. Zwölf Mädchen, zehn Jungen. Alle vierzehn oder fünfzehn Jahre alt. Doch nach und nach verstummten die Gespräche unter Mathildes kaltem Blick und der gemeißelten Strenge ihrer Mundwinkel.
»Guten Morgen. Ihr werdet künftig aufstehen und eure Gespräche einstellen, wenn ich das Klassenzimmer betrete. Ein Guten Morgen wäre zudem wünschenswert. Das üben wir gleich einmal.«
Mit viel Stühlerücken und Gestöhn begaben sich die Jugendlichen in eine annähernd aufreche Haltung. Dann ertönte ein Gebrumm, das sich wie kollektives Magenknurren anhörte.
»Soll’n das?« tönte es von einer der hinteren Bänke. »Wir sind Schüler, keine Marines.«
Kichern.
»Tobias Landwehr, nicht wahr?«
Nach dem Motto Erkenne deinen Feind hatte Mathilde jeden Schülerbogen studiert.
Der Schüler, ein kleiner Rothaariger mit Brille, nickte.
»Du tauschst bitte den Platz mit Uta Liesegang in der ersten Bank.« Ein dünnes Mädchen blickte erstaunt auf, entfaltete sich dann zu beachtlicher Länge und bewegte sich widerstrebend nach hinten. Tobias schlurfte nach vorn.
»Das Aufstehen dient euch als Zeichen, euch zu sammeln und auf meinen Unterricht zu konzentrieren«, erklärte Mathilde. »Setzt euch, bitte.«
Die Schüler plumpsten auf die Stühle, als hätten sie einen Marathon hinter sich, aber niemand redete mehr. Wieder musterte Mathilde einen nach dem anderen.
»Mein Name ist Degen. Einige von euch kennen mich. Ich mache keine Kuschelpädagogik. Lernen ist immer ein schmerzlicher Prozeß, egal was euch bisher darüber erzählt wurde. Wenn ihr Spaß haben wollt, dann seid ihr hier falsch. Hier geht es um Leistung.«
Sie ließ ihren Worten Zeit, in die Köpfe einzudringen, ehe sie fortfuhr: »Nun die Regeln: Ich dulde keinerlei Gespräche während des Unterrichts. Ich lege Wert auf Pünktlichkeit und Ordnung. Ich kontrolliere eure Mappen unangekündigt und unregelmäßig, Mappenführung wird benotet. Erfolg ist lediglich eine Frage der Disziplin. Was die Kleidung betrifft …«, sie sah in die Runde, registrierte ein paar nackte Bäuche und umgedrehte Baseballkappen, »… wir sind hier nicht im Dschungelcamp und ihr seid auch nicht die Loser aus den MTV-Clips, die vor brennenden Ölfässern herumzappeln. Ah, und eines noch: Ich bin der modernen Kommunikationstechnik sehr zugetan, wir werden daher im nächsten Schuljahr zusammen die Cebit besuchen. Dennoch möchte ich der Sicherheit halber erwähnen, daß MP3-Player, Discmen und Mobiltelefone im Unterricht nichts zu suchen haben.«
Jetzt grinste die Klasse. Jeder kannte die Geschichte, wie Mathilde letztes Jahr ein musizierendes Handy aus dem Fenster des zweiten Stockwerks geworfen hatte. Der Apparat war auf dem Kopfsteinpflaster des Schulhofs zerschellt. Er hatte dem Biologielehrer gehört, der es auf dem Fensterbrett vergessen hatte. Seine Frau war zu der Zeit hochschwanger gewesen.
Mathilde war fürs erste zufrieden. Sie waren wie junge, ungezogene Hunde. Begegnete man ihnen mit natürlicher Autorität, dann war es … Mathilde stutzte, als sich ihr Blick in einer weit aufgerissenen Mundhöhle verfing. Sie ging auf den Schüler zu.
»Lennart Schuster.«
»Äh, ja?«
»Du hast mich gerade angegähnt.«
»Ich habe nicht Sie angegähnt, Frau Degen, ich habe einfach so gegähnt. Für alle.«
Mathildes Augenbrauen schnellten nach oben. Die Sekunden dehnten sich, es war sehr still geworden. Dann sagte sie mit sanfter Stimme: »Ich weiß, es ist früh, und euer überbordender Hormonspiegel läßt euch Teenager nicht vor zwölf Uhr in der Nacht müde werden, weswegen ihr um acht Uhr morgens noch völlig unausgeschlafen seid. Ist es nicht so?« Sie sah den Gähner katzenfreundlich an.
»Ja, schon möglich.«
»Steh bitte mal auf, Lennart.«
Als mache ihm die Erdanziehung übermäßig zu schaffen, mühte sich der Schüler in die Senkrechte.
»Du weißt sicher, wo sich der Sanitätsraum befindet, nicht wahr? Da gehst du jetzt hin und hältst ein Nickerchen auf der Liege, sagen wir bis viertel vor neun. Für die Englischstunde bei meiner Kollegin solltest du ausgeschlafen sein.«
Schuster ging, nicht ohne seinen Kumpels zuzugrinsen. Aber es war kein Siegerlächeln, eher das Mundwinkelverziehen eines trotzigen Kleinkindes.
Mathilde wandte sich der Klasse zu. »Noch jemand, der seine Körperfunktionen nicht unter Kontrolle hat? – Gut. Dann wenden wir uns jetzt den Winkelfunktionen zu.«
Lukas stand vor dem Küchenwagen an. Zwei Häftlinge teilten labberige Brote, Marmelade und Diätmargarine aus. Das Fatale war: Weil es so wenig davon gab, mochte man das Zeug sogar irgendwann. Lukas war einer der letzten in der Schlange. Die vor ihm hatten es heute nicht besonders eilig, sie nervten den austeilenden Häftling mit Marmeladentauschwünschen und Beschwerden über angebliche Bevorzugung des Vordermannes. Lukas wartete geduldig, bis sie mit ihrem Palaver und den Kindereien fertig waren. Auf der anderen Seite des Treppenhauses lehnte Kusak in der Tür, trank aus einem Becher und grinste. Eine Vorahnung beschlich Lukas, als er mit dem Tablett in den Händen seine Zelle betrat.
Karim lag zusammengekrümmt neben der Kloschüssel und japste nach Luft.
»Was ist passiert?«
»Nichts«, keuchte Karim.
Lukas richtete ihn auf. Wie immer waren keine Verletzungen an Gesicht und Händen zu erkennen. Lukas zog Karims Sweatshirt hoch. Der ganze Oberkörper zeigte eindeutige Spuren von Schlägen und Tritten. Dazu kamen Schnitte wie von einer Rasierklinge.
»So kannst du nicht arbeiten. Sag, du hättest dir den Magen verdorben«, riet Lukas.
»Muß heute nicht arbeiten. Anwaltsbesuch.« Karims Stimme war ein heiseres Flüstern.
»Um so besser.«
Lukas half Karim auf das Bett und brachte ihm ein nasses Handtuch, um das Blut abzuwischen. Nicht, daß ihm allzuviel an Karim gelegen hätte, aber der junge Aserbeidschaner war ruhig, fügsam und sauber. Einen besseren Mitbewohner konnte man sich an diesem Ort nicht wünschen. Keiner von beiden kam auf die Idee, den Vorfall zu melden. Solche Dinge regelte man ohne die Obrigkeit. Doch selbstverständlich würde der Übergriff Konsequenzen haben, denn wenn er Kusak das durchgehen ließ, würde Lukas hier bald kein Bein mehr auf den Boden bekommen.
Mathilde hatte Die gläserne Zelle inzwischen gelesen. Es war mühsam gewesen, denn eigentlich las Mathilde lieber Sachbücher. Geschichten zu lesen, die sich jemand ausgedacht hatte, empfand sie als Zeitverschwendung. Dieses Buch war noch dazu deprimierend. Sicherlich ließen sich die Verhältnisse in amerikanischen Gefängnissen während der Sechziger nicht mit dem modernen deutschen Strafvollzug vergleichen. Und doch hatte sie, während sie Kapitel um Kapitel in sich hineinwürgte, ständig Lukas Feller vor Augen: seinen Cäsarenkopf mit den markanten Kerben, den klassisch-schönen Mund und seine Augen, diese wasserklaren Eisblöcke, deren unbewegter Blick dennoch jede Regung verfolgte.
Seit Tagen überlegte sie, ob sie es tun sollte. Am Sonntag hatte sie sich mit ihrer Großmutter darüber beraten.
– › Wo ist das Risiko?‹ hatte sie gefragt. ›Ich erfahre es nicht, wenn er das Buch einfach wegwirft. Aber vielleicht mache ich ihm damit ja eine Freude.‹
– ›Sieh an, Mathilde. Es geht also darum, einem bedauernswerten Häftling eine Freude zu machen? Das glaubst du doch selbst nicht, Mathilde Degen, die du bisher noch nie sonderlich sozial veranlagt warst!‹ - hörte Mathilde ihre Großmutter antworten, natürlich nur in Gedanken. Schließlich war Mathilde nicht verrückt, auch wenn sie sich mit einem Grabstein unterhielt. Merle Degen, geborene Steinberg, geboren am 14. 3. 1916 – verstorben am 28. 4. 2000 verkündete die goldfarbene Inschrift auf dem grauen Granit.
– ›Zeit, damit anzufangen‹, hielt Mathilde dagegen.
– ›Dir sind doch die Konsequenzen bewußt, die eine solche Geste nach sich ziehen kann? Bestimmt wird er dir einen Dankesbrief schreiben, dann mußt du antworten, und es wird kein Ende nehmen.‹
– ›Was ist dabei, wenn mir ein Häftling schreibt?‹
– ›Ein Mörder, Mathilde! Er hat getötet, er gehört nicht mehr zur zivilisierten Welt.‹
– ›Unsinn! Um das zu beurteilen, müßte ich Details über seine Tat erfahren. Außerdem kann ich den Kontakt jederzeit abbrechen. Schließlich ist er eingesperrt, und ich bin draußen‹, hatte sie konstatiert und danach eilig die Grabstätte verlassen, denn es näherte sich eine ältere Dame, die sie mißtrauisch ansah.
Entschlossen ging sie nun mit dem Buch ins Arbeitszimmer und suchte nach einem passenden Umschlag. Die Adresse der JVA Hannover fand sie im Telefonbuch.
Sollte sie etwas in das Buch hineinschreiben?
Auf keinen Fall. Worte, die man in ein Buch schrieb, bekamen einen feierlich-endgültigen Charakter, fast wie Worte auf einem Grabstein. Genau, das war es! Es wäre interessant zu erfahren, was sich ein Mörder auf den Grabstein schreiben würde. Sie würde ganz nonchalant an ihr Gespräch anknüpfen. Nur keine große Sache daraus machen.
Sie nahm eines ihrer Kärtchen mit dem Aufdruck Mathilde Degen in Stahlstich. Von ihren fünf Füllern wählte sie den ebenholzfarbenen Faber, der seidenweich schrieb. Ihre Hand war ruhig, als sie in ihrer klaren, steilen Handschrift schrieb:
Welche fünf Worte würden Sie auf Ihren Grabstein schreiben? Grüße, M. Degen
Aber ihr Herz klopfte wild.
Mathilde verbrachte die große Pause am liebsten draußen an der Luft. Da sich jedoch gerade ein Sommergewitter über der Stadt entlud, blieb nur das Lehrerzimmer. Jemand hatte die Tür nicht sorgfältig geschlossen, und als sich Mathilde näherte, war ihr, als hätte sie ihren Namen gehört. Sie blieb stehen.
»… wird langsam ein wenig eigenbrötlerisch.«
Die Stimme von Johann Isenklee, Englisch und Sozialkunde.
»So ist das eben, wenn man keine Familie hat. Keine Ahnung vom Leben.«
Hatte der Familienmensch Isenklee nicht letztes Jahr seine Frau wegen einer achtundzwanzigjährigen Referendarin verlassen?
»Und dann diese Hüte, wie eine alte Jungfer«, bestätigte die Stimme von Corinna Roth, Latein und Geschichte. Ausgerechnet diese schlampige Fregatte mußte ihr Schandmaul an Mathilde wetzen! Corinna Roths Sohn war ein stadtbekannter Junkie und sie selbst schien nur auf ihre Frühpensionierung zu warten, um sich vollends dem Suff zu ergeben.
»Hat sie schon eine Katze?« lachte eine junge Männerstimme.
Auch du, mein Brutus, erkannte Mathilde betrübt die Stimme von Rolf Böhnert, dem Musiklehrer.
»Von einem Mann ist jedenfalls nichts bekannt«, sagte die Roth. »Würde mich auch wundern bei dem Besen.«
»Vielleicht ist sie eine von diesen Kampflesben«, lästerte Isenklee nicht eben taktvoll, wo doch eigentlich jeder wußte, daß Rolf Böhnert homosexuell war. Der lenkte prompt ab, indem er fragte: »Wie vielen Handys hat sie wohl in dieser Woche schon das Fliegen beigebracht?«
Über Mathildes Nase grub sich eine steile, tiefe Falte ein. Im Grunde war sie unantastbar. Seit Jahren erzielten ihre Schüler mit Abstand die besten Noten. Ihre letzte Abiturklasse hatte als beste der Schule abgeschlossen und war die drittbeste Abiturklasse von Niedersachsen gewesen. Die Elternschaft schätzte Mathilde und legte Wert darauf, daß man ihren Kindern etwas abverlangte. Natürlich kam es hin und wieder vor, daß eine allzuzart besaitete Berufsmutter Mathildes Methoden rügte. Zu einer hatte Mathilde vor den Ferien gesagt: »Wenn Sie etwas gegen Leistung haben, sollten Sie Ihren Sohn in die Waldorfschule schicken. Dann kann er am Ende der Zehnten vielleicht schon seinen Namen tanzen.«
Direktor Ingolf Keusemann hatte sie danach unter vier Augen um etwas Mäßigung im Umgang mit den Eltern gebeten. »Wir sind eine Privatschule, Mathilde. Wir leben vom Geld dieser Leute!«
Mathilde war egal, ob man sie im Kollegium mochte oder nicht. Sie selbst konnte die meisten ihrer Kollegen ebenfalls nicht leiden. An der Spitze war man nun einmal einsam. Aber offensichtlich hatte Mathilde es mit der Diskretion übertrieben. Einem Ruf als verschrobene alte Jungfer oder gar als Lesbe galt es entgegenzuwirken. Allzurasch konnte sich daraus ein Autoritätsproblem ergeben.
»Ihr seid wirklich armselig! Als ob es über euch nichts zu sagen gäbe«, mischte sich da eine zornige Stimme in die Unterhaltung ein.
Die tapfere Leona Kittelmann. Immerhin.
Ein Geräusch ließ Lukas aufhorchen. Zuerst hatte er nur das gewohnte Kettenrasseln, Schlüsselklirren, Türenknallen vernommen. Dazu die tranigen Stimmen der Männer, ihre schlurfenden Schritte, das Quietschen des Küchenwagens, Geschirrklappern, das Piepsen der Metallsonde vor der Station, das alles bildete einen Geräuschteppich mit vertrautem Muster. Es waren die Klänge, die einen den ganzen Tag über verfolgten. Dann aber: schwere Schritte, Winseln, das Geräusch von wetzenden Krallen. Er lächelte zufrieden. Auf Connys Wetterbericht war doch stets Verlaß.
Türen wurden aufgerissen.
»Raustreten, sofort raustreten! Haftraumkontrolle.«
Lukas verließ seine Zelle und stellte sich zusammen mit den anderen Häftlingen im Flur auf. Der Hundeführer war mit dem Diensthund der Anstalt und einem ganzen Trupp Wachpersonal aufmarschiert. Der Hund passierte die Reihe der Männer anscheinend ohne Interesse, doch er würde es sofort merken, wenn jemand etwas am Körper versteckte. Drogen schienen für diese Tiere so intensiv zu riechen wie Thüringer Bratwurst. Lukas empfand jedesmal Bewunderung für die Arbeit des Hundes.
Jetzt war seine Zelle an der Reihe. Der schwarze Schäferhundrüde beschnüffelte sein Schuhputzzeug. Lukas war bekannt für seinen Schuhputztick. Der Schließer öffnete alle fünf Dosen. Wenig später kamen Herr und Hund heraus, gefolgt vom Schließer.
»Zu viele Bücher, Herr Feller. Sie wissen doch, daß nur fünf erlaubt sind. Sie haben acht.«
»Drei davon gehören Karim.«
»Der kann doch gar nicht lesen«, wandte der Schließer ein.
»Deswegen darf er doch Bücher haben, oder etwa nicht?«
»Treiben Sie es nicht zu weit, Herr Feller!«
Lukas schug sich mit einer theatralischen Geste gegen die Brust und versprach, die drei überzähligen Bücher am Montag in die Bücherei zurückzubringen.
Korinthenkacker! Mit den weiblichen Bediensteten kam Lukas Feller entschieden besser zurecht.
Sie zogen weiter. Lukas wartete mit der Geduld und der Gespanntheit einer Raubkatze. Kusaks Haftraum war nun an der Reihe. Gestern, beim Hofgang, hatte Kusak Lukas zugeflüstert: »Wie geht es deinem kleinen Schwanzlutscher? Ist sein Arsch schon wieder zu gebrauchen?«
»Er kommt seinen Pflichten nach«, hatte Lukas nur geantwortet.
Kusak hatte seit kurzem eine Zelle für sich allein. Vermutlich wollte niemand für die Sicherheit eines Mitbewohners garantieren. Es dauerte keine zwei Minuten, bis Hund und Herr aus der Zelle zurückkamen. Aus tiefer Kehle knurrend hatte sich das Tier in eine Rolle aus Bast verbissen, die sein Herr mit beiden Händen festhielt. Die umstehenden Häftlinge drückten sich eingeschüchtert an die Wand. Lukas blieb gelassen, er kannte die Prozedur. Das Zerrspiel war die Belohnung für den Hund. Durch die martialischen Laute der Bestie hörte man den lauten Befehl: »Kusak! Umdrehen! Beine auseinander, Hände an die Wand!« Der Vollzugsbeamte trat aus Kusaks Zelle. Er trug Latexhandschuhe und hielt ein kleines Tütchen in die Höhe.
»Im Fuß des Wasserkochers. Nicht gerade das originellste Versteck, Kusak.«
»Scheiße! Was ist das?«
»Umdrehen und Hände an die Wand, hab ich gesagt!« bellte sein Kollege.
»Das ist getürkt! Damit habe ich nichts zu tun! Ich bin unschuldig!« brüllte Kusak und begann sich zu wehren, als ihm der Schließer Handschellen anlegen wollte. Sofort stürzten sich drei kräftige Bedienstete auf ihn, der Hund raste, die Häftlinge johlten und pfiffen, für einen Samstagmorgen war reichlich viel los. Als man Kusak an ihm vorbeiführte, blieb Lukas’ Gesicht ausdruckslos. Hinter Kusak hörte er einen Bediensteten murmeln: »Immer dieselbe Leier, alle sind sie unschuldig wie die Lämmer.«
Schon immer war für Mathilde klar gewesen, daß sie niemals etwas mit einem Kollegen anfangen würde. Auch dann nicht, wenn er jung, blond und wie ein griechischer Gott gebaut war, sie das ganze Jahr über anlächelte und versuchte, sie in Diskussionen über Didaktik zu verwickeln.
»Nehmen Sie es mir nicht übel, Mathilde, aber Ihr Unterricht erinnert mich ein klein wenig an das vorvorige Jahrhundert.«
»Es gab schon schlechtere Jahrhunderte.«
»Zugegeben.«
»Ich halte es mit den preußischen Tugenden. Wo wir gerade dabei sind: Können Sie die aufzählen, Herr Kollege?«
»Pflichtbewußtsein, Unbestechlichkeit, Sparsamkeit, Ehrlichkeit … ähm …«
»Haltung, Ehre, Ordnungssinn, Bildung, religiöse Toleranz, gerechte Justiz.«
»Und was geschah zu guter Letzt mit dem preußischen Staat, Frau Kollegin?«
»Er ging unter.«
»–«
Ende der Leseprobe