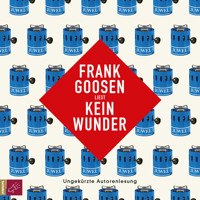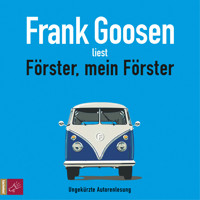9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Frank Goosens Bestseller jetzt im KiWi-Taschenbuch Eine Stadt im Ruhrgebiet. Anfang der Achtziger. Helmut besucht die Oberstufe eines Gymnasiums und hat eine Mutter, die immer nur wissen möchte, was er eigentlich will. Vom Leben, zum Beispiel. Helmut hört Platten und verliebt sich in die Schulsprecherin Britta. Zur ersten Liebe aber gehört auch die erste Enttäuschung. Und so beginnt ein Roman von der einen, großen Liebe, von Glück, Freundschaft und vom Leben eben. »Zum Schreien witzig, zum Weinen schön« Focus
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Ähnliche
Frank Goosen
Liegen lernen
Roman
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Frank Goosen
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Für Maria
»Von einer Katze lernen
heißt siegen lernen.
Wobei siegen ›locker durchkommen‹ meint,
also praktisch: liegen lernen.«
Robert Gernhardt
Teil eins
1
Im September 1998 stürzte ein Mann frühmorgens vornüber aus einer im Souterrain gelegenen Kreuzberger Kneipe in eine Pfütze brackigen Regenwassers und fühlte sich nun bereit für einen abschließenden Döner. Sein Leben als verantwortungsloses, bindungsunfähiges, triebhaftes Arschloch war definitiv an einem Tiefpunkt angekommen. Gegenüber war eine Plakatwand, auf der stand: »Wir werden nicht alles anders, aber vieles besser machen!« Der Mann war knapp über dreißig, ungewaschen und unrasiert und hatte seit einigen Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Fast schien es, als wolle er liegen bleiben, da in der Pfütze. Einfach liegen bleiben, ging ihm durch den Kopf. Aber der große breite Wirt mit der hohen Stimme und die fünf stummen Biker würden sicher etwas dagegen haben. Und ob das hässliche, magere Mädchen, das seit Stunden im Schneidersitz in ein Mineralwasser hineinmeditiert hatte, sich für ihn verwenden würde, war mehr als fraglich. Aus der Kneipe kam chinesische Musik.
Der Mann schmeckte Regenwasser. Er fror. Aber das alles dauerte nur ein paar Sekunden, dann stand der Mann auf und ging in die nächste Telefonzelle. Man sah ihn telefonieren, den Kopf gegen den Apparat gelehnt. Nach ein paar Minuten kam er wieder heraus. Er ging ein paar Schritte und blieb vor einem türkischen Imbiss stehen. Aus dem Döner würde nichts werden. Der Mann hatte kein Geld mehr. Er konnte jetzt nur noch warten.
Dieser Mann, der mit leerem Magen, Kopfschmerzen und einem tauben Gefühl in den Knochen vor diesem Imbiss stand, war ich. Die ganze Geschichte hatte an dem Tag angefangen, als meine Eltern sich einen Farbfernseher kauften.
Es hatte bis zum Spätsommer 1982 gedauert, bis mein Vater den uralten Schwarz-Weiß-Fernseher auf den Müll warf und ein neues Gerät anschaffte. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte es nicht unbedingt ein Farbfernseher sein müssen, wahrscheinlich war ihm ohnehin schon lange alles zu bunt, aber der Händler hatte einfach keine Schwarz-Weiß-Geräte da, und das war unser Glück. Der Apparat wurde geliefert, als die großen Ferien vorbei waren, aber das war Zufall.
Mein Vater tat immer so, als interessiere Fernsehen ihn nicht, aber seine allabendliche »Tagesschau« ließ er sich nicht nehmen. Filme, Serien und Reportagen schien er immer nur widerwillig zu sehen, nach dem Motto: Na, wenn der Fernseher schon mal an ist … Das hat er nie gesagt, aber man sollte das von ihm denken.
Meine Mutter hat immer sehr gern ferngesehen. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätten wir schon längst einen »Buntfernseher« gehabt. Aber mein Vater meinte, dafür sei kein Geld da. Meine Mutter schüttelte dann nur den Kopf und seufzte. Sie mochte »Was bin ich?«, und wenn Robert Lembke den Gong schlug, machte sie die Augen zu, denn dann wurden die Berufe der Leute eingeblendet, und sie machte die Augen erst wieder auf, wenn der Gong zum zweiten Mal ertönte, und dann versuchte sie mitzuraten. Ich glaube, meinem Vater ging das ziemlich auf die Nerven. Aber er sagte nichts, sondern atmete nur ein paarmal hörbar aus oder kratzte sich etwas zu oft am Fuß.
Meine Eltern hatten eine graue Sitzgarnitur. Meine Mutter saß auf dem Zweisitzer und mein Vater in einem der beiden Sessel. Seine Füße legte er auf den anderen Sessel, und der Dreisitzer blieb meistens leer. Meistens zog sich mein Vater die Socken aus, und dann sah man, dass er sich nicht so gern die Fußnägel schnitt.
Ich war begeistert, dass wir endlich einen Farbfernseher hatten. Ich konnte mir ein Leben ohne Fernsehen schon gar nicht mehr vorstellen, und vor allem konnte ich mich an ein Leben ohne Fernseher gar nicht mehr erinnern. Der Fernseher war immer dagewesen.
Meine frühesten Fernseherinnerungen haben alle mit amerikanischen Serien zu tun. Da war ein Mann, der im Vorspann durch eine Menge Türen ging und schließlich in einer Telefonzelle stand, die aber in Wirklichkeit ein Fahrstuhl war, der abwärts fuhr. Dann gab es eine Serie, die hieß »Renn, Buddy, renn!«. Auch da kann ich mich nur noch an den Vorspann erinnern, wo ein Mann, natürlich, die ganze Zeit rennt, durch Straßen und über Brücken, wahrscheinlich in New York. Das Größte aber war »Bezaubernde Jeannie«. Ich weiß nicht warum. Das einladende Dekolleté von Barbara Eden hat mir erst Jahre später etwas gesagt. Aber ich fand es toll, wenn sie vor eben diesem Dekolleté ihre linke Hand auf ihre rechte legte, die Ellenbogen abspreizte und dann einmal kurz nickte. Dann war sie weg oder etwas anderes war da oder verändert oder was weiß ich. Ihren Mann, Colonel Nelson, der bei der NASA arbeitete, hat sie »Meister« genannt, aber man hatte nie den Eindruck, dass er auch einer war. Der »Meister« war Larry Hagman, der dann später J.R. wurde, aber das hat man ihm damals noch nicht angesehen. Ich war so begeistert von der bezaubernden Jeannie, dass meine Mutter sie als Mittel zur Disziplinierung anwendete. Hatte ich irgendetwas angestellt, war Jeannie gestrichen. Ich habe ein paarmal geheult deswegen, aber das hat nichts gebracht.
Wenn meine Eltern fernsahen, dann sahen sie fern und nichts anderes. Da wurde nicht geredet. Aber meine Eltern redeten ohnehin nicht viel, jedenfalls nicht miteinander. Wir waren die absolut letzten, die einen Farbfernseher bekamen. Ich traute mich gar nicht zu sagen, dass wir noch ein Schwarz-Weiß-Gerät hatten, damit wäre ich unten durch gewesen. Nur Mücke wusste davon, denn Mücke wusste ohnehin alles, aber er hielt dicht, denn auch bei seiner Familie hatte es lange gedauert, bis ein Farbfernseher im Wohnzimmer stand, allerdings hatte Mückes Familie wirklich kein Geld.
Als es am Morgen hieß, gegen Mittag würde der neue Fernseher geliefert, wusste ich, dass ein neuer Abschnitt in meinem Leben begann. An diesem Tag hörte ich zum ersten Mal von Britta.
Aber vorher hörte ich von einer Brust.
Mein Freund Mücke hatte in den Ferien angeblich zum ersten Mal eine Brust angefasst. Als ich morgens zur Schule kam, passte er mich schon hundert Meter vorher ab, zündete sich eine Zigarette an, stieß den Rauch aus, nahm die Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger und unterbreitete mir die Neuigkeit, als hätte er zufällig eine Methode zur Kernfusion entdeckt.
Er war mit seinen Eltern in der Eifel gewesen, zwei Wochen. Die Brust sei die Brust einer Frau von immerhin neunzehn Jahren gewesen. Eine tolle Brust, aber das müsse er ja eigentlich nicht hinzufügen, schließlich hätte er sie sonst nicht angefasst. Eine richtige Titte sei das gewesen, groß und rund und geil, die Titte einer gefickten Frau, gefickt von seinem Bruder. Sein Bruder habe die Frau von immerhin neunzehn Jahren mitgebracht, als er Mücke und seine Eltern in der Eifel besucht habe. Mücke hatte die ganze Nacht kein Auge zugetan, weil er dachte, dass sein Bruder vielleicht jetzt nebenan was mit der Frau von immerhin neunzehn Jahren machte, und selbstverständlich habe ihn, Mücke, das so scharf gemacht, dass er wiederum die ganze Nacht was mit sich selber gemacht habe. Und als er am nächsten Morgen, völlig übernächtigt und mit Augenlidern schwer wie Hanteln, mit zum Platzen voller Blase ins Bad getaumelt sei, habe da die Frau von immerhin neunzehn Jahren gestanden, nackt wie nichts, und habe sich mit einem Handtuch zwischen den Beinen herumgerieben. Wahrscheinlich habe sie sich nur abgetrocknet, aber beschwören wollte Mücke das nicht, denn sein Bruder versorgte ihn nach wie vor mit harten Fakten über die Geilheit der Frauen im Allgemeinen und der Versautheit dieser Frau von immerhin neunzehn Jahren im Besonderen, und vielleicht, so Mücke, habe sie es nicht ausgehalten und schnell mal mit dem Badetuch nachgeholfen, aber wie gesagt, das könne er nur vermuten. Die Frau von immerhin neunzehn Jahren habe, fuhr Mücke fort, offensichtlich nicht einmal daran gedacht, ihre Brüste mit dem Handtuch zu bedecken – was natürlich zu den Schilderungen passte, die Mücke von seinem Bruder kannte, nein, im Gegenteil, sie habe ihn unverschämt angegrinst, das Handtuch zu Boden fallen lassen, ihre Brüste mit den Händen hochgehoben und gefragt, ob sie Mücke gefielen. Klar, habe Mücke gesagt, nicht schlecht die Dinger, und daraufhin habe die Frau von immerhin neunzehn Jahren gefragt, ob er sie mal anfassen wolle. Wenn’s sein muss, habe Mücke gesagt und die Dinger angefasst und außerdem beschlossen, im neuen Schuljahr Klassensprecher zu werden. Er sei jetzt in dem Alter, wo man beginne, sich über andere Sachen den Kopf zu zerbrechen als darüber, wie man an immer bessere Wichsvorlagen komme. Die Frau von immerhin neunzehn Jahren habe darauf bestanden, dass er ihre Brüste nicht einfach nur mal so antippe, mit dem Zeigefinger oder so, sondern, dass er sie richtig in die Hand nehme – wobei er übrigens festgestellt habe, dass zwei richtige Titten ganz schön schwer sein können.
»Na ja«, sagte Mücke, »das mit dem Klassensprecher, das habe ich schon wieder verworfen. Ich reiß mir doch nicht für diese jämmerlichen Idioten den Arsch auf.«
Mücke erzählte viel. Immer wieder von seinem großen Bruder, der sich oft prügelte und viel Sex hatte.
Ich behielt meine Ferienerlebnisse für mich. Ich war in Holland gewesen. Es war der letzte Urlaub gemeinsam mit meinen Eltern, aber das wusste ich damals noch nicht. Ich war in eine blonde Holländerin verliebt. Im vierten Schuljahr war ich in Anke verliebt gewesen. Ich hatte den ganzen Tag an sie denken müssen. Und jetzt hatte ich drei Wochen lang an diese Holländerin denken müssen.
Die Holländerin war vielleicht knapp über zwanzig und arbeitete in einer Bäckerei, in der ich jeden Morgen frische Brötchen holen musste. Für meinen Vater hätte es auch drei Tage altes Brot getan, aber meine Mutter bestand auf frischen Brötchen, schließlich sei Urlaub. Die Holländerin war ganz hellblond. Und unter der weißen Bäckerschürze trug sie immer einen sehr kurzen Rock. Sie sprach deutsch mit einem holländischen Akzent, sie hörte sich an wie die Tochter von Rudi Carrell. Sie war sehr freundlich und lächelte oft, und dann sah man weiße Zähne, die genau zu ihrem Haar passten. Einmal ging ich nach dem Frühstück noch einmal hin und wartete, bis der Laden Mittagspause machte. Als sie herauskam trug sie keine Schürze mehr. Sie hatte sehr schöne, braune Beine. Sie war die schönste Frau der Welt.
Es war ein sehr stiller Urlaub, denn meine Eltern redeten nicht viel miteinander, aber wie schon gesagt, das war bei uns nicht unbedingt Mode. Wir kamen seit Jahren hierher. Immer nach Holland, immer in das gleiche Nest am Meer. Nur die Pensionen wechselten, sahen aber alle gleich aus. Morgens, nach dem Frühstück, gingen wir spazieren und dann in ein Lokal, um zu Mittag zu essen. Nachmittags gingen wir wieder spazieren oder spielten Minigolf. Dann gingen wir in ein Café und tranken Kaffee und aßen ein Stück Kuchen. Dann gingen wir zurück in die Pension. Wenn das Wetter schlecht war, saßen wir in der Pension und blätterten Illustrierte durch. Um sechs Uhr gab es Abendessen, egal bei welchem Wetter. Leberwurstbrote und Hagebuttentee, jeden Abend. Danach ging mein Vater allein am Strand spazieren. Ich konnte ihn vom Fenster meines Zimmers aus sehen, wie er direkt am Wasser entlangging, als müsse er den Strand vermessen, den Kopf gesenkt, die Augen auf den Sand geheftet. Vielleicht suchte er etwas. Gefunden hat er nie was. Meine Mutter räumte in der Zwischenzeit die Gemeinschaftsküche der Pension auf und widmete sich dann ihren Kreuzworträtselheften, die sie im Urlaub stapelweise durcharbeitete, als bekäme sie Geld dafür. Später saßen wir vor dem Fernseher, und meine Mutter häkelte Topflappen. Spätestens um elf gingen wir ins Bett.
Von alledem erzählte ich Mücke nichts. Er hätte sich nur darüber lustig gemacht, wo er doch jetzt eine Brust angefasst hatte. Vor der Schule schnippte Mücke seine Zigarette weg und atmete ein letztes Mal Rauch aus.
Wir hörten von Britta, bevor wir sie sahen. Sie war »die Neue«. Einige Jungs hatten sie schon gesehen. »Sie ist geil, absolut fickbar!«, sagte der lange Schäfer, den keiner leiden konnte. Er wollte Mückes Freund sein, deshalb redete er wie Mücke.
In der ersten großen Pause sahen wir sie. Sie war wunderschön. Sie hatte ganz dunkle Haut, als habe sie sehr lange in der Sonne gelegen. Ihre Augen waren schmal, und ihre Brauen sahen aus wie aufgemalt. Sie war anders als die anderen Mädchen. Sie sah aus, als würden wir sie nicht interessieren.
Wir umkreisten sie unauffällig, die ganze Pause lang. Wir konnten nicht genug von ihr kriegen und wussten nicht, was wir sagen sollten.
Als ich am Mittag nach Hause kam, war mein Vater schon da. Ein Mann in einem weißen Kittel stand neben ihm. Der neue Fernseher war da, ein großer Kasten aus schwarzem Kunststoff. Es lief das Testbild. Der Mann versuchte, meinem Vater noch einen Videorekorder aufzuschwatzen, aber damit wollte mein Vater nichts zu tun haben. Ich ging in mein Zimmer und wartete, dass meine Mutter mich zum Essen rief.
Die erste Sendung, die ich in unserem neuen Farbfernseher sah, war natürlich die »Tagesschau«. Mein Vater hatte es sich vorbehalten, das neue Gerät selbst einzuweihen. Nach der »Tagesschau« kam Professor Grzimek. Nach einer halben Stunde Farb-TV ging ich in mein Zimmer. Ich setzte mir Kopfhörer auf und hörte »The Concert in Central Park«. Ende Mai 82 war ich auf dem Simon-and-Garfunkel-Konzert im Dortmunder Westfalen-Stadion gewesen. Ich trug Bluejeans und ein weißes Hemd mit Börtchen und eine schwarze Weste, so wie Art Garfunkel auf der Platte. Ich mochte am liebsten »America«, weil ich den Begriff »New Jersey Turnpike« so gut fand. Ich hatte eine Kompaktanlage von Schneider, Plattenspieler und Kassettenrekorder. Die hatte ich mir von dem Geld gekauft, das ich zur Konfirmation bekommen hatte.
Ich hatte schon einiges an Platten. Vor allem Beatles und Simon and Garfunkel und ein bisschen Bob Dylan. In der Schule waren wir uns weitgehend einig, dass heutige Musik nicht gut war. Außer vielleicht Bap, aber das hatte politische Gründe. Es war nicht so schwer, Platten zu kaufen. Irgendwie war immer etwas Geld übrig. Meistens musste ich nur eine oder zwei Wochen einigermaßen mein Geld zusammenhalten, dann konnte ich mir wieder was leisten. Zu Weihnachten und zum Geburtstag ließ ich mir dann noch welche schenken.
Die letzte Platte von Dylan hieß »Shot of Love«, und die hatte uns nicht begeistert. Alles hörte sich an wie selbst gemacht, wie in der Garage aufgenommen. Man war allgemein der Ansicht, die letzte gute Platte sei »Live at Budokan« gewesen. Die musste man haben. Aber das war ein Doppelalbum und entsprechend teuer. Vor dieser Investition hatte ich bisher zurückgeschreckt.
Als ich am nächsten Morgen aufstand, erwischte ich meine Mutter dabei, wie sie den Fernseher einschaltete. Sie starrte ein paar Sekunden auf das Testbild, dann bemerkte sie mich, schaltete den Apparat aus und legte die Fernbedienung weg.
Mein Vater war Stationsvorsteher bei der Deutschen Bundesbahn. Er war groß und still. Er hatte lange Arme, die manchmal nicht zu ihm zu gehören schienen, so sehr schlackerten sie neben seinem Körper her. Meine Mutter hatte mal im Einzelhandel gearbeitet, in einem Kaufhaus, in der Spielwarenabteilung. Dann hatte das Kaufhaus geschlossen, und ein paar Monate lang hatte sie Schuhe verkauft. Dann war ich gekommen. Seitdem war sie Hausfrau. Und mein Vater hatte Karriere machen dürfen. Als Stationsvorsteher. Manchmal fragte ich mich, ob meine Mutter vielleicht auch hätte Karriere machen wollen. Sie hätte schon längst Abteilungsleiterin sein können für Holzeisenbahnen und Brummkreisel.
Meine Mutter war etwas kleiner als mein Vater und unheimlich dick. Im Sommer trug sie ärmellose Blusen, aus denen ihre Arme hervorquollen wie Wurst, die nicht in den Darm passte. Am schlimmsten war ihr riesiger Busen. Als kleines Kind, als sie mich noch manchmal umarmte und an sich drückte, hatte ich oft Angst, er würde eines Tages abfallen und mich unter sich begraben.
Außerdem sang meine Mutter. Schlecht, aber gern. Als meine Ohren noch kaum über die Tischplatte reichten, sang meine Mutter mir gern die Schiwago-Melodie vor, in der Version von Karel Gott: »Weißt du, wohin …« Dazu trug sie ein rotes Kleid mit schwarzen, knubbeligen Knöpfen und erzählte sich selbst von den Weiten der russischen Taiga und der tiefen Liebe, die ein Mann wie Omar Sharif einer Frau schenken konnte.
Auch mein Vater hatte mit Musik zu tun. Und zwar im Keller.
Der Keller: Wände und Decken hatte mein Vater mit Holz verkleidet, einen Teppich hatte er gelegt und eine Heizung installiert, um dort seinen Schatz zu lagern, eine riesige Schallplattensammlung, Hunderte von kunstledernen Alben, die in durchsichtigen Plastikfolien je fünfzig kleine Vinylscheiben beherbergten. Vom Boden bis zur Decke reichten die prall gefüllten Regale, und mein Vater verbrachte ungezählte Wochenenden damit, immer wieder neue Ordnungskriterien auszuknobeln. Manchmal ging er auch einfach nur am Regal entlang und strich mit den Fingerkuppen über die Rücken der Alben oder nahm eine Platte heraus und überprüfte im fahlen Licht der Kellerfunzel ihren Zustand. Mitten im Keller stand auf einem halbhohen Tisch ein Plattenspieler aus den Fünfzigerjahren, der erste, den sich mein Vater von seinem eigenen Geld gekauft hatte, ein Koffergerät mit einem unförmigen Arm, mit einer dicken Nadel am Ende.
So viel ich weiß, ist meine Mutter nie in diesem Keller gewesen. Mich selbst hatte mein Vater eines Tages mit nach unten genommen, nur um mir klarzumachen, dass ich dort nichts anrühren durfte. Einmal jedoch bin ich meinem Vater heimlich gefolgt, habe an der Kellertreppe gewartet, bis er eine Platte aufgelegt hatte, und mich dann näher geschlichen. Durch schmale Schlitze in der aus Holzlatten zusammengefügten Tür sah ich meinen Vater vor dem Plattenspieler stehen. Er stand einfach da und sah der Platte beim Drehen zu, bis sie zu Ende gespielt hatte. Dann nahm er die Platte vorsichtig vom Teller und verstaute sie wieder in einem der Alben. Er ging an den Wänden entlang und fuhr mit den Fingerkuppen über die Rücken der Alben, griff schließlich eines heraus, blätterte darin herum, nahm eine neue Platte heraus, legte sie auf und stand wieder davor und sah ihr beim Drehen zu. Das tat er noch einige Male. Und dann, ich glaube, es war bei der sechsten oder siebten Platte, kam plötzlich Bewegung in meinen Vater. Zunächst war gar nichts zu bemerken, dann jedoch sah ich, wie sein Oberkörper sich bewegte, vor und zurück und auch zu den Seiten. Mein Vater tanzte. Er tat so, als halte er jemanden im Arm, und drehte sich. Nach etwa einer halben Stunde wurde mir langweilig, und ich ging wieder nach oben.
Meine Eltern fassten sich nie an. Manchmal, im Winter, hängte sich meine Mutter bei meinem Vater ein, aber das war kein echtes Berühren, da berührten sich nur die Mäntel.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass meine Eltern mich auf die übliche Art und Weise bekommen hatten. Die Vorstellung, meine Eltern hätten Sex gehabt, um mich zu bekommen, war absurd. Wo sollte mein Vater in den Mutterberg eindringen? Wie konnte er sicher sein, dass es die richtige Stelle war, wenn sein Ding irgendwo stecken blieb, wo es warm und feucht war? Das konnte genauso gut die Achselhöhle meiner Mutter sein oder eine Bauchfalte. Und wenn doch, wie hatten sie sich in Stimmung gebracht? Hatte meine Mutter die Schiwago-Melodie gepfiffen? Hatte mein Vater gesungen: »Heißer Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr«? Hatte er sich ein dünnes Bärtchen auf die Oberlippe geklebt, um auszusehen wie Omar Sharif? Vielleicht war mein Vater gar nicht mein Vater. Vielleicht war meine Mutter gar nicht meine Mutter. Ich sah auch keinem von beiden ähnlich. Vielleicht hatten sie mich adoptiert. Oder gefunden.
Zwei Wochen nach dem Ende der Ferien sollte der neue Schülersprecher gewählt werden. Der alte hatte Abitur gemacht. Britta kandidierte. Eine Woche lang verteilte sie vor der Schule Flugblätter und zog sich damit den Zorn des alten Schmalendorf zu, der mindestens seit Kaiser Wilhelm Direktor unserer Schule war. Schmalendorf war noch im Krieg gewesen, und er mochte keine Flugblätter.
Am Wahltag regnete es. Wir wurden in die Aula getrieben, wo sich die Kandidaten vorstellen sollten. Genauer gesagt stellten sich zwei Gremien zur Wahl, bestehend aus je vier Leuten, an deren Spitze der eigentliche Kandidat beziehungsweise die Kandidatin stand. Die beiden Gruppen saßen auf der Bühne an je einem Schultisch, auf dem kleine grüne Appolinaris-Flaschen standen. Mücke und ich saßen in der letzten Reihe. Britta war noch nicht da. Die anderen versuchten, so zu tun, als seien sie nicht nervös. An dem einen Tisch saßen nur drei Leute, das musste Brittas Gremium sein. Zwei Jungs, ein Mädchen. Einen kannte ich aus der Oberstufe: groß, sehr dünn, dichtes, schwarzes Haar, das ihm auf dem Kopf hockte wie ein Helm. Niemand hatte ihn je in etwas anderem als seinem Jeansanzug gesehen. Auf der rechten Brusttasche der Jacke stand »Public Enemy No. 1« geschrieben, mit Filzstift.
Neben ihm saß ein höchstens elfjähriges Mädchen, das ich noch nie gesehen hatte; sie trug ein hellblaues, hochgeschlossenes Kleid und hatte ihre langen, blonden Zöpfe zu Affenschaukeln geflochten, die neben ihrem Kopf hin und her baumelten. Der Dritte war ein stadtbekanntes Tennis-Ass aus einer unserer Parallelklassen, ein hübscher Bengel, der Lacoste-Polohemden und teure Tennisschuhe trug. Die Schuhe waren ihm von einer Ausrüsterfirma gestellt worden, die in ihm die große deutsche Tennishoffnung witterte. Man munkelte, alle möglichen Mädchen seien hinter ihm her, sogar einige aus der Oberstufe.
Am anderen Tisch saßen vier Jungs aus der Oberstufe. Alle hatten kurze Haare. Einer von ihnen las die FAZ. Das war der eigentliche Kandidat. Er trug geflochtene italienische Schuhe, eine helle Stoffhose mit Bundfalte und Bügelkante sowie ein himmelblaues Hemd mit weißem Kragen.
»So stelle ich mir den Typen vor, der den Drachen erledigt hat«, sagte Mücke.
»Siegfried?«
»Genau den.«
Alle warteten auf Britta. Am Rande der Bühne stand Schmalendorf, der einleitende Worte sprechen wollte und über die Verspätung sichtlich verärgert war. Schließlich riss ihm der Geduldsfaden, er ließ das Saallicht herunter- und das Bühnenlicht hochfahren. Als er gerade anfangen wollte zu reden, kam Britta durch den Zuschauerraum, sprang auf die Bühne und setzte sich auf ihren Platz. Sie trug Jeans und Turnschuhe, ein rotes T-Shirt mit V-Ausschnitt und darüber ein offenes Cordhemd. Ihre Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.
Schmalendorf sagte etwas über das Privileg, wählen zu dürfen, und erklärte den Wahlvorgang: Wir sollten uns anhören, was die beiden Gremien zu sagen hatten, konnten dann Fragen stellen und sollten dann auf dem Zettel, den wir am Eingang erhalten hatten, entweder ein Kreuzchen bei Gremium A oder eben bei Gremium B machen. Britta war A. Deshalb durfte sie anfangen. Schmalendorf reichte ihr das Mikro.
Britta gab das Mikro weiter an Staatsfeind Nummer eins, der eine kurze Einführung gab, wieso und warum sich dieses Gremium in genau dieser Zusammensetzung zur Wahl stelle: gleichmäßige Besetzung mit Männern und Frauen, die aus der Unter-, Mittel- und Oberstufe kamen, um auch allen Interessen mit gleicher Gewichtung entsprechen zu können. Während er redete, zog Britta erst ihr Cordhemd aus, zog dann das Gummi aus ihrem Pferdeschwanz und schüttelte ihr Haar. Sie bog den Oberkörper zurück, und alle sahen, dass sie keinen BH trug. Das Mädchen mit den Affenschaukeln und das Tennis-Ass stellten sich vor und sagten etwas, das ich nicht hörte. Dann gaben sie das Mikro an Britta weiter. Im Gegensatz zu ihren Vorrednern erhob sie sich, kam nach vorn, ging am Bühnenrand auf und ab und schien jeden von uns einzeln anzusehen.
Sie sagte, dass gerade die Schule als neben der Familie primärer Ort der Sozialisation sich einklinken müsse in den gesellschaftlichen Diskurs und dass gerade in diesen Zeiten, da es um eminent wichtige Fragen des Überlebens der menschlichen Rasse auf diesem Planeten gehe, die Debatten nicht vor den Klassenzimmern haltmachen dürften. Die Menschheit sei heute in der Lage, sich hundertfach selbst zu zerstören, und der westlichen Welt falle nichts Besseres ein, als im Profitinteresse des militärisch-industriellen Komplexes unvermindert an der Rüstungsspirale zu drehen, das legitime Selbstbestimmungsrecht der Völker beispielsweise in Mittelamerika mit Füßen zu treten und über die Führbarkeit eines thermonuklearen Krieges zu spekulieren, wobei der Verlust Europas und die Verseuchung der Atmosphäre billigend in Kauf genommen würden, anstatt den ersten Schritt in eine atomwaffenfreie Welt zu tun und auf die Stationierung der Pershing II und Cruise-Missiles zu verzichten. In der ersten Reihe meldete sich ein Fünftklässler und fragte, was das bedeuten sollte.
»Krieg ist Scheiße«, sagte Britta, »und dicke Männer verdienen daran.«
Dann kam sie auf die Gefährdung unserer Umwelt zu sprechen, die Zerstörung der natürlichen Ressourcen durch eine seit Mitte des neunzehnten Jahrhunderts rücksichtslos durchgeführte Industrialisierung, den Rückgang der Artenvielfalt, das Abholzen des Regenwalds, den sauren Regen und die Gefahren der sogenannten friedlichen Nutzung der Kernenergie. Harrisburg sei erst der Anfang gewesen, vielleicht passiere das nächste dicke Ding gleich vor unserer Haustür, in Biblis oder Krümmel oder sonst wo. Und es sei in jedem Falle falsch, den Kopf in den ohnehin cadmiumhaltigen Sand zu stecken, jeder und jede müsse sich im Gegenteil darüber im Klaren sein, dass nur das Individuum in der Lage sei, den Lauf der Welt zu verändern, weshalb sie uns alle zu größtmöglicher Eigeninitiative auffordern wolle. Im Falle ihrer Wahl werde sie Arbeitsgruppen einrichten, die sich all dieser Themen annehmen würden, die prüfen sollten, was hier, an unserer Schule, in unserem ganz konkreten Lebensumfeld getan werden könnte, um einen Beitrag zu leisten. Ferner werde sie dafür sorgen, dass mindestens zweimal pro Halbjahr eine Rocknacht in der Pausenhalle stattfinde, bei denen Bands von der Schule Gelegenheit erhalten sollten, erste Auftritte zu absolvieren. Das bisher vernachlässigte Schülercafé solle zu einem auch außerhalb der Unterrichtszeiten geöffneten Treffpunkt werden, in dem Folkmusikabende veranstaltet werden sollten, wo sich aber auch eine Schülerliteraturgruppe, zu deren Gründung sie hier nachdrücklich aufrufe, formieren solle. Zur Realisierung ihrer Pläne habe sie bereits beim Hausmeister und den Vertrauenslehrern vorgefühlt, und sie alle seien bereit, sich mehr oder weniger direkt dort einzubringen. Natürlich müsse ein Raucherraum für die Oberstufe her, da es ein Unding sei, dass Rauchwillige bei Wind und Wetter sich vor dem Gebäude auf der Straße treffen müssten, was überdies ein versicherungsrechtliches Problem darstelle. Doch bei allem, was sie auf die Beine stellen wolle, sollten wir immer daran denken, dass sie nur unsere Vertreterin, die Erfüllungsgehilfin des Schülerinnen- und Schülerwillens, nicht aber unsere Vortänzerin sein könnte, die Initiativen müssten von uns selbst getragen werden, wir selbst hätten es in der Hand, Einfluss auf das zu nehmen, was Einfluss auf uns ausübe, nur so hätten wir die Möglichkeit, uns ein Stück Selbstbestimmung in einer fremdbestimmten Welt zu erkämpfen, ein Kampf, der uns jedoch keine Angst machen dürfe, sondern den wir als Chance begreifen müssten, als Chance, die Ausbildung unserer Persönlichkeit nicht anderen zu überlassen, sondern sie in die eigenen Hände zu nehmen.
Und dann legte sie das Mikrofon auf den Boden und setzte sich wieder.
Ein paar Sekunden lang war es sehr still. Dann aber fing irgendjemand an zu klatschen, und die anderen fielen mit ein, und schließlich wurde gejohlt und gepfiffen und geschrien. Siegfried trommelte mit den Fingern hektisch auf der Tischplatte herum, stand schließlich auf, ging nach vorn und bückte sich nach dem Mikro. Er betonte, im Gegensatz zu seiner Vorrednerin wolle er nicht zu so platter, billiger Polemik greifen. Erste Pfiffe. Das Hochpeitschen pubertärer Emotionen sei seine Sache nicht. Mehr Pfiffe. Aber dieses Vorgehen wolle er der Unerfahrenheit seiner um einige Jahre jüngeren Gegenkandidatin zugute halten. Erste Buhrufe. Ferner wolle er darauf hinweisen, dass ein Schülersprecher nicht über ein allgemeinpolitisches Mandat verfüge, ja dass die politische Betätigung eines gewählten Schülervertreters auch rechtlich schlichtweg verboten sei. Und er könne sich nicht vorstellen, dass die Mehrheit der Schülerschaft, besonders aber die reiferen Jahrgänge, sich außerhalb der Gesetze bewegen wolle. »Wieso nicht?«, rief Mücke, und ein paar Leute lachten.
Natürlich sei auch er, fuhr Siegfried fort, für Rock- und Folkabende, und auch für einen Raucherraum wolle er sich einsetzen, und zum Thema Schülercafé habe er vor allem zu sagen, dass eine solche, sicherlich sehr begrüßenswerte Einrichtung, wolle sie langfristig überleben, auch die Frage der Wirtschaftlichkeit bedenken müsse. Allgemeines Stöhnen.
Mittlerweile waren vor allem die Fünft- und Sechstklässler in den ersten Reihen unruhig geworden, Pärchen begannen herumzuknutschen, und ein paar Plätze neben mir packte jemand ein Leberwurstbrot aus. Siegfried hörte irgendwann auf, weil sowieso keiner mehr zuhörte. Er gab das Mikrofon an Schmalendorf zurück und setzte sich wieder. Sein Nebenmann klopfte ihm halbherzig auf die Schulter. Siegfried schüttelte den Kopf.
Jetzt durften Fragen gestellt werden. Es kamen keine. Wir machten unsere Kreuze, standen auf, drängelten uns zum Ausgang durch und warfen die Wahlzettel in eine der beiden hölzernen Urnen, die im Foyer auf einem Tisch standen.
Bis zum Beginn der nächsten Stunde war noch etwas Zeit. Mücke ging nach draußen und rauchte. Ich saß in der Pausenhalle und schrieb die Mathehausaufgaben vom langen Schäfer ab. Dann ging plötzlich die Tür zum Schulhof auf und Britta kam herein. Mir fiel das Heft von den Knien. Sie sah mich an. Sie lächelte. Sie sagte: »Hallo!« Ich sagte auch »Hallo!«, aber es hörte sich an wie »Urgh!« Sie ging an mir vorbei zu den Mädchentoiletten. Ich holte mein Portemonnaie hervor und zählte mein Geld. Dann ging ich in die Stadt und kaufte mir »Bob Dylan live at Budokan«.
2
Als Kind soll es ja eigentlich ganz leicht sein, zu wissen, was man will. Ich wollte vor allem: groß werden. Aber dummerweise reichte das nicht aus, denn groß wurde man ja sowieso. Man musste noch mehr wollen. Ständig musste was gewollt werden. Ich weiß nicht, wie oft meine Mutter zu mir sagte: Ich möchte wissen, was du eigentlich willst. Immer wieder kam es zu Situationen, in denen man sagen musste, was man wollte. An der Supermarktkasse gestattete mir meine Mutter, eine Süßigkeit mitzunehmen. Da waren aber so viele: Die drei Musketiere zum Beispiel, ein geflochtener Schokoladenstrang mit Karamel gefüllt. Das Ding sah aus wie ein Zopf, und wenn man reinbiss, dann konnte man das Karamel mindestens einen halben Meter lang ziehen, und wenn man es kaute, dann blieb mehr als die Hälfte in den Zähnen hängen. Lecker, aber aufwendig. Oder sollte es doch Hanuta sein, wo man meiner Ansicht nach zuerst eine der beiden Waffelschichten von der Schokoladenfüllung abnagen musste, um den vollen Genuss zu haben? Oder doch ein Raider, wo in dem goldenen Papier zwei Riegel steckten, die aussahen wie Zigarren? Und dann tauchten eines Tages diese Schokoladeneier mit den Bausätzen im Bauch an der Supermarktkasse auf und machten die Entscheidung noch schwerer. Es war zum Verzweifeln. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Meistens gelang es mir, alles auf zwei Alternativen einzugrenzen, aber das machte es nicht leichter. Im Gegenteil. Um nicht ganz mit leeren Händen dazustehen, entschied ich mich dann oft überhastet für eines, und wenn ich das dann hatte, wurde mir plötzlich klar, dass ich doch lieber das andere hätte haben wollen. Viel lieber. Es wurde eine existenzielle Frage. Aber das wollte meine Mutter nicht begreifen. Sie war nur genervt, weil ich solche Zicken machte. »Herrgott, manchmal möchte ich wirklich wissen, was du eigentlich willst.« Nicht nur du, Mama, nicht nur du.
Am Wochenende nach der Schülersprecherwahl hatte Onkel Bertram Geburtstag, und natürlich mussten wir hin. Das hatte ich nicht zu entscheiden, obwohl mir das wiederum sehr leichtgefallen wäre. Ich konnte den Onkel nicht ausstehen, aber das konnte niemand.
Onkel Bertram war eigentlich mein Großonkel, der Bruder meines Großvaters väterlicherseits. Er war ein Ekel, aber man munkelte, er habe Geld, also waren alle nett zu ihm und ließen sich seine Unverschämtheiten gefallen. Er war bekannt für seine Fürze. Er furzte in aller Öffentlichkeit, ohne sich zu schämen. Er rülpste auch gern. Wenn bei den Familienfeiern das Abendessen gereicht wurde, hing ihm immer irgendetwas aus dem Mundwinkel heraus. Mal ein Stück Fleisch, mal ein bisschen Salat. Dann wieder lief ihm Soße das Kinn hinunter. Seelenruhig ließ er es laufen und schickte noch einen Rülpser hinterher. Onkel Bertram rauchte Lord Extra. Und er trank Export, in rauen Mengen, ohne betrunken zu werden. Wenn er trank, konnte er noch mehr furzen.
Seine erste Frau, meine Großtante, war schon tot. Fast fünfzig Jahre lang hatte sie den Onkel ertragen, hatte ihm das Bier gebracht und die Zigaretten angezündet, wenn er es verlangte, und hatte sich beschimpfen lassen, wenn ihm irgendetwas nicht passte, oder einfach nur, weil es ihm Spaß machte. Die Ehe war kinderlos geblieben.
Als meine Großtante starb, war ich vielleicht sechs Jahre alt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie jemals etwas gesagt hätte, außer vielleicht »Guten Tag!« und »Auf Wiedersehen!« oder »Hat es geschmeckt?« oder »Lasst euch bald mal wieder sehen!«. Einmal gingen meine Eltern und ich zum Kaffeetrinken am Sonntagnachmittag hin, und als wir klingelten, machte Herr Figge, der alte Nazi von nebenan, die Tür auf und führte uns ins Wohnzimmer, und da kniete meine Großtante vor Onkel Bertram und wusch ihm in einer Plastikschüssel die Füße. Ich sah nur ihre zum Dutt geknüpften Haare und ihren geblümten Kittel. Sie hatte zwei Kittel. Einer war blau gemustert, der andere braun. Ich glaube, sie hatte nichts anderes anzuziehen, ich habe sie jedenfalls nie in etwas anderem gesehen. Sie wusch ihm die Füße mit Wasser und Seife, und Onkel Bertram grinste breit, als wir hereinkamen. Dann sah er Herrn Figge an und grinste noch breiter. Herr Figge war beeindruckt.
Nur ein halbes Jahr nach dem Tod meiner Großtante hatte Onkel Bertram wieder eine gefunden, die ihm die Unterhosen wusch und den Fernseher an- und ausschaltete. Sie hieß Frau Fuchs und war fast so dick wie meine Mutter. Sie war etwas gesprächiger, aber das ließ mit den Jahren nach. Ich fragte mich, wie er auch diese Frau dazu brachte, das alles für ihn zu tun. Wahrscheinlich war auch hier Geld im Spiel.
Onkel Bertram erklärte jedem die Welt. Als ich seiner Meinung nach alt genug war, die Wahrheit zu ertragen, nahm er mich bei einer Familienfeier beiseite, legte mir den Arm um die Schulter, nahm mich mit auf den Balkon und drückte mich in einen Stuhl, ließ sich selbst in den daneben fallen und kam ganz dicht an mich heran, so dicht, dass ich riechen konnte, was er gegessen hatte. Bevor er loslegte, kniff er noch die Augen zusammen, schnitt eine schmerzhafte Grimasse, hob eine Arschbacke und ließ einen seiner donnernden Fürze fahren. Und dann erklärte er mir, wie das wirklich war mit Adolf und den Autobahnen und dem »Kriech«, und überhaupt hätten die Engländer auch die KZs erfunden, siehst du, das hast du nicht gewusst, und das hätte auch alles hingehauen, wenn da nicht die verdammten Itaker gewesen wären, feige Hunde alle miteinander. Und Herbert Wehner (auch ein Italiener?, fragte ich mich) sei das größte Arschloch, das rumlaufe, der könne nämlich Russisch, weil der im »Kriech« in Moskau gewesen ist, der feige Hund, wie der Brandt, der Verbrecher, die sollte man sowieso »nach drüben« verfrachten, zu den Russen, wo sie hingehören, und überhaupt sind das auf jeden Fall Spione, und die Russen, da sollte ich mal drauf achten, die wollen »Kriech«, das sieht man denen an, achte mal auf den Breschnew, wie der guckt, oder der Gromyko, die wollen »Kriech«, so viel ist klar. Dann stand er auf, legte mir die Hand auf die Schulter, mahnte mich, darüber mal nachzudenken, zog eine Grimasse, knallte noch einen raus und ging wieder hinein.
Diese Familienfeiern liefen immer gleich ab: Man traf sich am Nachmittag und trank Kaffee und aß Kuchen. Abends gab es Bier und Buletten und Kartoffelsalat mit harten Gurkenstückchen und viel Mayonnaise. Dann gab es Schnaps. Die Aschenbecher quollen langsam über, was zuerst niemanden störte, dann jedoch einer der anwesenden Tanten so unangenehm auffiel, dass sie überhastet danach griff und die Hälfte auf dem Tisch verteilte. Meist wurde dann versucht, den Dreck mit der Hand in den übervollen Ascher zurückzuschieben, wobei die Asche sich in die weiße, mit selbst gemachten Stickereien aufgewertete Tischdecke rieb. Alte Männer saßen mit durchgedrückten Rücken auf Stühlen mit hohen Lehnen, die Bauchhosen bis unter die Brustwarzen gezogen, oder sie saßen in tiefen Sesseln, aus denen sie ohne Hilfe ihrer Frauen nicht mehr hochkamen. In der Hand hielten sie billige Zigarren, und ihre Nacken waren ausrasiert. Über ihren Köpfen hingen in schlechten Kopien die Motive niederländischer Meister, irgendeine häusliche Szene, der Boden in Schachbrettmuster. Ich erinnere mich an Speichelbläschen, die in Mundwinkeln platzten und an gelbe Zähne, die zu vorgerückter Stunde auch schon mal herausgenommen wurden, was die Münder zu schwarzen Löchern mitten im Zimmer machte. Manchmal war ein Akkordeon dabei, und um Mitternacht wurde vom Westerwald gesungen, über dessen Wipfeln der Wind so kalt pfiff. Oder auch vom treuen Husar, der sein Mädel ein ganzes Jahr geliebt habe und noch mehr. Die schwarzen Löcher gingen lachend auf und zu, und die Speichelbläschen platzten nicht mehr, sondern sammelten sich und liefen schließlich in dünnen Rinnsalen Richtung Kinn.
Die Frauen sangen auch, in den Händen ein altes Taschentuch, um sich die Tränen abwischen zu können, wenn es sie zu sehr rührte. Zwischendurch standen die Männer auf und gingen aufs Klo. Sie trafen die Schüssel nicht und pissten daneben und gingen zurück, ohne sich die Hände zu waschen. Und am Ende roch das ganze Haus nach kaltem Essen, kaltem Rauch und gerülpstem Schnaps.
Einmal war mein Vater nicht da, und ich ging nur mit meiner Mutter zum neunzigsten Geburtstag einer Großtante. Sie waren alle wieder da. Es wurde das volle Programm geboten, inklusive Akkordeon und einer Menge Singerei, und mir fiel auf, dass meine Mutter sehr fröhlich war. Wenn mein Vater dabei war, saß sie meist einfach da und unterhielt sich mit irgendeiner Tante. An diesem einen Abend aber wurde sie immer mehr zum Mittelpunkt des Festes, sang alle Strophen aus vollem Halse und tanzte sogar mit Onkel Bertram, der seine Hand auf den Hintern meiner Mutter legte und die Zigarette beim Tanzen nicht aus dem Mund nahm. Wenn meine Mutter mal ein paar Minuten nicht tanzte, dann trank sie. Einige Schnäpse und auch Bier aus der Flasche. Einige Tanten machten komische Gesichter. Auch Onkel Bertram machte ein komisches Gesicht, aber er feuerte meine Mutter an, nur ja nicht nachzulassen und fasste sie immer wieder an, meist am Hintern. Und irgendwann war der Akkordeonspieler müde und wollte gehen, aber meine Mutter forderte lautstark Zugaben, und der Mann spielte weiter und tanzte und sang, aber jetzt hatte sie Mühe, die Tonart und den Rhythmus zu halten. Nach und nach verabschiedete sich die Festgemeinde, bis nur noch meine Mutter, die Großtante, die Geburtstag hatte, und ein erschöpfter Akkordeonspieler, der sein Instrument schon nicht mehr halten konnte, zurückblieben. Der Mann sank in der Ecke zusammen, und das Akkordeon gab einen letzten klagenden Ton von sich und war dann endlich still.
Dann liefen wir quer durch die Stadt nach Hause, weil keine Busse mehr fuhren und ein Taxi zu teuer war. Meine Mutter nahm mich an der Hand und sagte, wie toll es sei, am Leben zu sein, und dass man das keinen Moment vergessen dürfe, egal, was man tue und wer man sei und wie weit man es gebracht habe, jeder Mann und jede Frau habe dankbar zu sein, einfach für die Tatsache, auf dieser Erde leben zu dürfen, und das dürfe ich nie vergessen, ich dürfe alles vergessen, ich dürfe sogar meine »arme, alte Mutter« vergessen, nicht aber, wie schön es sei, am Leben zu sein, und wie schön das Leben sein könne, wenn man nur wolle. Wir liefen mehr als eine Stunde, und meine Mutter hörte nicht auf zu reden.
Im Hausflur begann sie wieder zu singen, ganz leise zunächst, als sie die Wohnungstür aufschloss schon lauter, und als die Tür hinter uns ins Schloss fiel und meine Mutter den schweren Schlüsselbund einfach auf den Boden fallen ließ, sang sie fast so laut wie noch vorhin auf der Feier, und dann begann sie wieder zu tanzen, zog sich den Mantel aus und drehte Pirouetten und warf den Mantel von sich und kickte ihre Schuhe in eine Ecke und tanzte auf ihren Strümpfen weiter, mit geschlossenen Augen sich immer weiter um die eigene Achse drehend, im vagen Walzertakt. Sie zog ihre Bluse aus dem Bund ihres Rockes, und ich hängte meine Jacke an die Garderobe im Flur, und meine Mutter warf ihre Bluse auf den Boden. Ihre riesigen Brüste kämpften gegen das riesige Mieder an. Meine Mutter tanzte ins Schlafzimmer, und durch die Tür sah ich kurz darauf ihren Rock, diesen braunen Rock mit dem Umfang eines Heizkessels, auf die Diele fliegen. Dann geschah eine Zeit lang nichts. Ich ging in mein Zimmer und zog mich aus. Und dann ging plötzlich das Licht aus, und ich drehte mich um und sah die Umrisse meiner Mutter, die im Gegenlicht der Dielenlampe viel größer aussah als normal. Sie sagte, in ganz hoher Tonlage und fast noch singend, ich solle mal herkommen, also kam ich mal her, und sie packte mich unter den Armen und hob mich hoch und drückte mich an sich, und da merkte ich, dass sie nichts anhatte. Sie drückte meinen Kopf zwischen ihre Brüste, wo er fast völlig verschwand. Es war sehr feucht, da zwischen ihren Brüsten, und es roch und schmeckte irgendwie nach … altem Blumenkohl, jedenfalls war es das, woran ich denken musste, obwohl ich noch nie alten Blumenkohl gegessen hatte, schließlich kochte meine Mutter alles immer ganz frisch, aber trotzdem roch es nach Blumenkohl, da zwischen ihren Brüsten, diesen riesigen Dingern, aber eben nach Blumenkohl, der nicht mehr so ganz frisch war, eigentlich sogar schon verdorben, ja so riecht das hier, dachte ich. Ich konnte kaum atmen, da zwischen ihren Brüsten, und meine Mutter fragte, ob ich mich auch so sehr freue, am Leben zu sein, aber sie wollte wohl keine Antwort, denn sie setzte mich wieder ab und verschwand ins Badezimmer und ich verschwand in mein Bett und schlief gleich ein.
Also: Am Wochenende nach der Wahl hatte Onkel Bertram Geburtstag. Alles lief ab wie gehabt: nachmittags Kirsch- und Stachelbeertorte, abends Frikadellen und Kartoffelsalat mit beinharten Gurkenstückchen. In diesem Stadium begann Onkel Bertram meist, die Anwesenden in ernste Gespräche zu verwickeln. Es passte ihm nicht, wie die meisten ihr Leben angingen. Der eine hatte sich zu hoch verschuldet, die andere war dem falschen Mann auf den Leim gegangen, der Dritte erzog seine Kinder falsch, die Vierte hatte den falschen Beruf ergriffen. Onkel Bertram gab konkrete Anweisungen, wie dies oder das abzustellen sei. Niemand widersprach. Es musste wirklich eine Menge Geld im Spiel sein.
An diesem Sonntag wandte er sich mal wieder mir zu, zog mich in die Küche, wo Frau Fuchs saß und auf weitere Instruktionen wartete. Mit einer kurzen Kopfbewegung schickte der Onkel sie hinaus. Dann setzte er sich an den Küchentisch und wies mir den Platz gleich neben sich zu. Er nahm zwei Flaschen Bier aus dem Kühlschrank, stellte sie auf den Tisch und fragte, ob ich mich damit auskenne. Ein wenig, sagte ich. Gut, sagte der Onkel, ich sei jetzt in dem Alter, wo ich ab und an einen Schluck vertragen könne. Er öffnete die Flaschen und stieß mit mir an. Er nahm einen tiefen Schluck. Ein kleines bisschen Bier sammelte sich in seinem Mundwinkel. Er setzte die Flasche wieder ab und fuhr sich mit dem Handrücken durchs Gesicht. Dann rülpste er und sagte, er mache sich Sorgen um die deutsche Jugend. Da er auf eine Entgegnung zu warten schien, fragte ich: »Wieso?« Darauf sagte er, das sei natürlich nichts Neues, er mache sich schon lange Sorgen um die deutsche Jugend und um das ganze Land. »Komm, nimm noch ’n Schluck!«, sagte er.
»Also, Junge«, fing der Onkel an, und seinem Ton nach zu urteilen, wurde es jetzt ernst, »ich mache mir auch Sorgen um dich.«
»Um mich?«
»Es steht nicht gut um die deutsche Jugend.«
»Nicht?«
»Nein. Nicht gut. Um die deutsche Jugend.«
»Aha«, sagte ich und wartete.
»Helmut, mein Junge, zunächst einmal: Nimmst du Drogen?«
Ich verneinte ehrlich. Damit gab sich der Onkel jedoch nicht gleich zufrieden, sondern beteuerte, es ginge ihm nicht darum, mich den Behörden oder meinen Eltern auszuliefern, sondern einfach darum, solche Probleme früh genug zu erkennen, um mir helfen zu können, damit ich nicht auf die schiefe Bahn gerate. Ich sagte, mit Drogen hätte ich nichts am Hut.
»Gut«, sagte der Onkel, nachdem er mir lange tief in die Augen geschaut hatte. »Wenn du mal meinst, du brauchst etwas, dann halte dich hier dran!« Onkel Bertram hob die Bierflasche und trank. Dann sagte er: »Und jetzt zu etwas, das vielleicht noch viel wichtiger ist.«
»Was denn, Onkel Bertram?«
»Helmut, machst du mit bei diesen Demonstrationen?«
»Demonstrationen?«
»Helmut, du weißt, der Russe steht vor der Tür, der hockt in Thüringen, nimm noch ’n Schluck, Junge, der hockt in Sachsen, der Russe, also direkt vor unserer Nase, und da hat er uns an den Eiern, wenn wir nicht aufpassen, Helmut, mein Junge, und einige von deinen Altersgenossen meinen, den sollte man mal machen lassen, den Russen, also ich kann nur sagen, die sollen doch rübergehen, wenn sie meinen, dass es da besser ist, aber Helmut, mein Junge, nimm noch ’n Schluck, ich hoffe, du bist nicht so dumm und gehst denen auf den Leim. Also: Warst du schon einmal auf so einer Demonstration?«
»Nein.«
»Gut, mein Junge, das soll auch so bleiben, nimm noch ’n Schluck!« Und vor lauter Erleichterung entwich dem Onkel ein ganzes Bündel von Fürzen. Und dann ging es zum gemütlichen Teil über: Der Onkel wollte wissen, wie es mit »Mädels« aussah.
»Wie meinst du das, Onkel Bertram?«
»Na ja, mein Junge, du hast es doch mit Mädchen, oder? Also, du willst mir doch keine Schwuchtel werden. So ein langhaariger Schwuler mit Handtäschchen und Ohrring und allem? Du hast es doch mit Mädels, oder?«
»Na ja, jedenfalls nicht mit Jungs.«
»Gut, Junge, das hört sich alles sehr gut an. Liegt gerade was an?«
»Was meinst du damit, Onkel Bertram?«
»Hast du ’ne Schickse?« Erst viel später ist mir aufgefallen, dass ausgerechnet der rechtsradikale Onkel ausgerechnet ein jüdisches Wort in diesem Zusammenhang gebrauchte. Vielleicht war Onkel Bertram ja ein viel größerer Dialektiker, als wir alle dachten.
»Nicht direkt«, sagte ich. »Aber ich arbeite daran.«
»Gut. Aber lass dir nicht auf der Nase herumtanzen. Denk immer daran, dass du der Chef im Ring sein musst. Lass dich nicht unterbuttern. Ich weiß, dass das jetzt in Mode gekommen ist, aber lass dir kein X für ein U vormachen. Und wenn du Fragen hast, dann komm zu mir, deine Eltern müssen davon nichts erfahren. Komm, Junge, nimm noch ’n Schluck.« Und dann stieß er noch mal mit mir an, verlagerte sein Gewicht auf die mir zugewandte Seite, ließ zur anderen Seite einen Furz heraus, stand auf, ging zum Kühlschrank, nahm eine Flasche Korn heraus, stellte sie auf den Tisch, nahm aus dem Küchenschrank zwei Pinnchen, goss sie randvoll, stellte eines vor mich hin und hob das andere vor sein Gesicht. Ich prostete ihm zu. Ich stürzte den Korn genau wie der Onkel in einem Zug herunter. Dann musste ich husten, und der Onkel lachte. Er sagte, ich solle so bleiben, wie ich bin, und ging zurück zu der zu seinen Ehren angetretenen Festgesellschaft, um sich wieder den verpfuschten Leben seiner missratenen Verwandten zu widmen. Ich atmete auf. Ich war der drogenabstinente, heterosexuelle Nichtdemonstrierer, die große weiße Hoffnung der Familie, des ganzen Landes.
So völlig unerfahren, wie es aussah, war ich damals aber schon nicht mehr. Ich hatte mal auf einer Party mit einem Mädchen Händchen gehalten. Es war beim langen Schäfer, vielmehr bei seinen Eltern, in der Kellerbar. Die Wände waren holzgetäfelt, und auf dem Holz klebten Autogrammkarten von Schlagerstars: Freddy Breck, Peter Rubin, Mouth and McNeal, Bernd Clüver, Peggy March und anderen. Es floss noch kein Alkohol, und wenn, dann nicht besonders viel, ich habe jedenfalls nichts davon mitbekommen. Die Tische und Stühle hatte Schäfer rausgeräumt, und in den Ecken lagen jetzt Matratzen ohne Laken, und Mücke machte Bemerkungen über die Flecken auf den Dingern.
Ich kannte das Mädchen nicht, das plötzlich neben mir saß, aber sie war mir beim Tanzen aufgefallen. Sie tanzte ziemlich viel. Sie hatte blonde Haare, zu vielen kleinen Locken verdreht. Sie trug eine weiße Bluse und schwitzte. Sie hatte ziemlich große Brüste, und es schien ihr nichts auszumachen, dass man das sehen konnte. Sie trank Cola aus einer fast leeren Literflasche. Etwas lief ihr am Kinn herunter, und dann bot sie mir die Flasche an, aber ich wollte nicht, weil meine Mutter mir erzählt hatte, dass immer etwas Speichel in die Flasche hineinläuft, wenn man daraus trinkt.
Die Musik war sehr laut, und das Mädchen schrie mir etwas zu, das ich nicht verstand, und sie lachte, also nickte ich. Sie rutschte etwas näher und schrie mir ins Ohr, ob ich die Party auch toll fände und dass sie Jasmin heiße. Ich dachte, das hört sich ja an wie ein Parfüm, und ich schrie ihr meinen Namen ins Ohr und dass ich die Party auch toll fände. Bis hierhin war alles einfach. Dann saßen wir nur so da und sagten beide nichts. Ich hatte das Gefühl, sie lehne ihre Schulter an meine, aber das konnte auch Einbildung sein. Was war jetzt zu tun? Ich kam mir wieder vor wie an der Supermarktkasse. Sollte ich einen halben Meter Karamel aus geflochtener Schokolade ziehen? Oder lieber erst eine Waffelplatte von der Füllung nagen? Sollte ich mir eine Zigarre aus Goldpapier gönnen? Oder hatte ich es mit einer Bausatzüberraschung in einem Ei zu tun? Es gelang mir nicht einmal, das alles auf zwei Alternativen einzugrenzen.
Dann plötzlich lag ihre Hand auf meiner.
Ach du Scheiße!
Was jetzt?
Meine Hand schwitzte, auch auf dem Rücken. Musste ich jetzt mit ihren Fingern spielen? Fest stand, dass ich irgendetwas tun musste. Aber was? Schweiß lief mir die Wirbelsäule hinunter. Ich hatte die Chance, hier etwas zu erleben. Diese Chance durfte ich nicht versauen. Sollte ich erst ihre Hand streicheln und dann ihren Oberschenkel? Und dann? Musste ich sie dann küssen? Aber dann hätte ich ja gleich aus der Flasche trinken können, wegen der Spucke. Musste ich meinen Arm um sie legen? Musste ich ihr an die Brust gehen? Musste ich sie nach Hause bringen? Wo sie wohl wohnte? Vielleicht am anderen Ende der Stadt, und zurück fährt vielleicht kein Bus mehr, und ich muss stundenlang laufen und kriege Ärger mit meinen Eltern, weil ich viel zu spät komme. War das Mädchen mit dem Parfümnamen das wert? O Gott, sie hatte gerade mal ihre Hand auf meine gelegt, und schon hing da ein Rattenschwanz an existenziellen Entscheidungen dran!
Unter meinen Achseln entstand ein Bodensee aus Schweiß.
Und dann dachte ich daran, dass Mücke mich vielleicht beobachtete, obwohl ich ihn nicht sehen konnte, also musste jetzt dringend etwas geschehen, denn sonst konnte ich mir tagelang das Gequengel anhören, dass ich zu blöd sei, mich an Weiber ranzumachen und was weiß ich nicht noch alles, also packte ich ihre Hand und wollte sie streicheln, aber irgendwas stimmte nicht, denn sie schrie auf, und das hörte man im ganzen Raum, denn in genau diesem Moment war ein Song zu Ende und der nächste hatte noch nicht angefangen, es war wie in der Doornkaat-Werbung, und alle sahen zu mir hin, und das Parfümmädchen sprang auf und sagte noch etwas zu mir, aber da lief schon wieder Musik, und ich konnte es nicht verstehen, und dann war sie weg.
Glücklicherweise hatte Mücke nichts mitbekommen, denn er war gerade auf dem Klo.
Die Achtzigerjahre waren keine gute Zeit, um erwachsen zu werden, jedenfalls keine Zeit, auf die man voller Sentiment zurückblicken kann. Schlaghosen, Clogs, Abba, llja Richter – die Siebzigerjahre hatten Charme, da kam noch was aus den Sechzigern rüber, vielleicht sogar die Ahnung der Idee, die Welt könne besser werden. Die Achtziger hatten so etwas nicht. Auf den Illustrierten waren entweder nackte Frauen oder Atompilze, manchmal beides, und man wusste oft nicht, was schlimmer war.