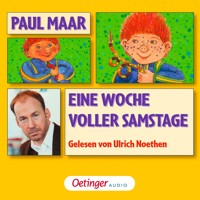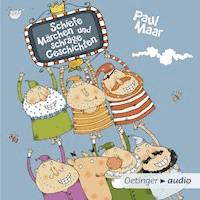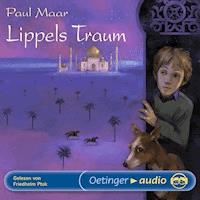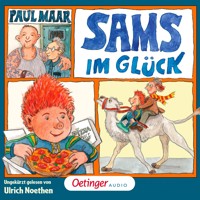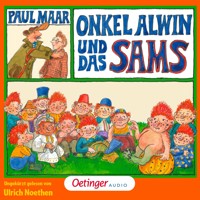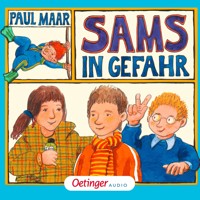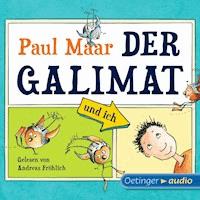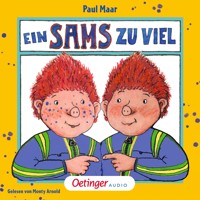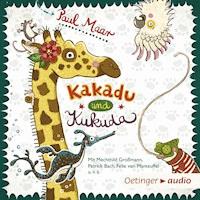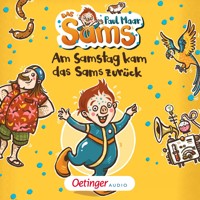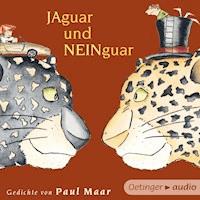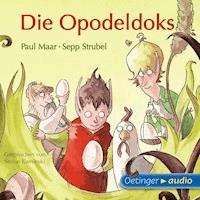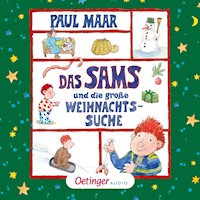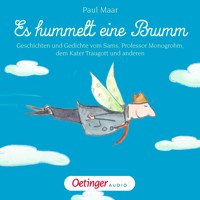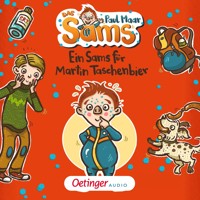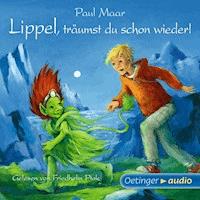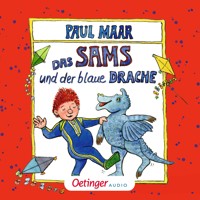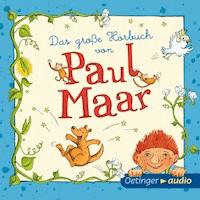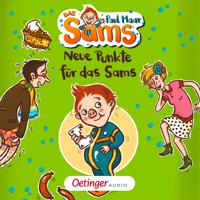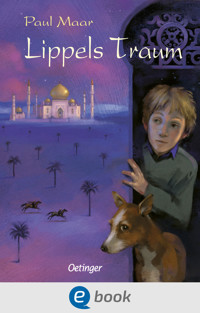
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oetinger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Lippel
- Sprache: Deutsch
Wer ist Muck? Der kleine herrenlose Köter, der Lippel immer auf dem Schulweg nachläuft, oder der Hund aus dem Königspalast? Und wer sind Asslam und Hamide, mit denen Lippel im Sandsturm durch die Wüste irrt? Die beiden türkischen Kinder aus seiner Klasse oder der Prinz und die Prinzessin aus dem Morgenland? Es ist ein aufregendes Abenteuer, das Lippel da träumt, und er selbst steckt mittendrin. Oder ist es gar kein Traum?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
»Wenn wir jede Nacht das Gleiche träumten, würde es uns genau so beschäftigen wie alles, was wir täglich sehen.
Wenn ein Handwerker sicher sein könnte, jede Nacht zwölf Stunden lang zu träumen, er sei König, so wäre er ebenso glücklich wie ein König, der jede Nacht zwölf Stunden lang träumte, er sei ein Handwerker.«
Diese Sätze hat Blaise Pascal geschrieben.
Das war ein Philosoph und Mathematiker, der im 17. Jahrhundert in Frankreich lebte. (Er hat sich zum Beispiel die erste Rechenmaschine ausgedacht.)
Pascal hatte die Gewohnheit, seine Ideen, Gedanken, Einfälle auf kleine Zettel zu schreiben, um sie nicht zu vergessen.
Nach seinem Tod fand man in seiner Wohnung einen ganzen Stapel solcher kreuz und quer beschriebener Papiere. Es war sehr schwierig sie überhaupt zu entziffern.
Aber seine Notizen waren so lesenswert, dass man sie in einem Buch veröffentlichte, das man »Gedanken« nannte. (Auf Französisch heißt das »Pensées«.)
Als ich die Notiz oben las, stellte ich mir vor, wie es wäre, wenn jemand wirklich jede Nacht vom Gleichen träumte. Könnte der überhaupt noch zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden?
So ist dieses Buch entstanden.
Lippel
Was war das nur für ein Wetter!
Im Kalender stand Juni, aber das Wetter benahm sich so hinterhältig, als wäre erst April.
Wenn Lippel zum Beispiel aus dem Haus ging, um für sich und seine Eltern Jogurts zu kaufen, schien die Sonne. Aber kaum war er dreihundert Schritte weit weg, fing es heftig an zu regnen.
Es regnete vier Minuten lang. (Das ist ungefähr die Zeit, die Lippel brauchte, um zurückzurennen, zu klingeln, ins Haus zu stürmen, seinen Regenmantel anzuziehen und wieder hinauszugehen.)
War Lippel dann wieder dreihundert Schritte vom Haus entfernt, kam die Sonne heraus. Und weil er keine Lust hatte noch einmal zurückzugehen, musste er bei strahlendem Sonnenschein im Regenmantel einkaufen.
Wenn er sich beim ersten Regenschauer aber einmal nicht sofort umdrehte und zum Haus rannte, weil er sich sagte:
»Es hört ja doch gleich wieder auf!«, dann regnete es bestimmt den ganzen Nachmittag und Lippel kam nass wie ein Tafellappen vom Einkaufen zurück.
Lippels Vater sagte oft: »Ich weiß gar nicht, was du gegen das Wetter hast! Es ist doch schön abwechslungsreich.«
Aber Vater hatte gut reden. Er blieb den ganzen Tag im Haus und schrieb an seinen Artikeln für die Zeitung.
Da hatte es Lippel schon schwerer. Schließlich musste er vormittags in die Schule und nachmittags ging er entweder einkaufen oder in die Stadtbücherei, um sich Bücher auszuleihen.
(Es waren übrigens fast nur Bücher, die vom Morgenland handelten.)
Aber vielleicht muss die Sache mit Lippels Namen erst einmal erklärt werden:
Lippels Vater hieß mit Nachnamen »Mattenheim«, genau wie Lippels Mutter. Deshalb ist es unschwer zu erraten, dass auch Lippel mit Nachnamen Mattenheim hieß.
Mit seinem Vornamen ist es schwieriger.
Eigentlich hatten ihm seine Eltern den Namen Philipp gegeben. »Philipp« ist kein schlechter Name, und da es ja seine Eltern gewesen waren, die diesen Namen ausgesucht hatten, war es eigentlich nicht recht einzusehen, warum sie nie Philipp zu ihm sagten. Aber genauso verhielt es sich.
Sie nannten ihn nämlich immer Lippel und hielten das wohl für eine ganz normale Abkürzung von Philipp.
So glaubte der Junge, sein Name sei Lippel, bis er sechs Jahre alt wurde. Mit sechs kam er in die Schule und dort erfuhr er zu seiner Überraschung, dass er nun der Schüler Philipp Mattenheim sein sollte.
Später, als er dann schreiben konnte und die anderen aus seiner Klasse lesen gelernt hatten, kam eine neue Schwierigkeit hinzu: Wenn er seinen Namen schrieb, lasen die anderen immer »Pilipp«, weil sie noch nicht wussten, dass man »Ph« wie »F« ausspricht.
Wenn zum Beispiel bei Herrn Göltenpott, dem Kunstlehrer, zu Beginn der Stunde die Zeichenblöcke ausgeteilt wurden, lief das so ab:
Herr Göltenpott stürmte ins Klassenzimmer, ging sofort zum Schrank, holte den Stapel Zeichenblöcke heraus, legte ihn auf der ersten Bank ab (dort saß Elvira, seine Lieblingsschülerin), sagte: »Elvira, bitte austeilen!«, setzte sich an das Lehrerpult und las Zeitung.
Elvira entzifferte mühsam den Namen, der auf dem obersten Block stand, rief: »Sabine!«, und Sabine kam nach vorne und holte ihren Block ab.
»Robert!« Und Robert kam nach vorne und holte seinen Block ab.
Dann vielleicht: »Andreas!« Und Andreas kam auch nach vorne und holte seinen Block ab.
Das ging immer so weiter, bis sie zu Lippels Block kam. Dann rief sie nämlich »Pilipp!«, und nun entstand erst mal eine Pause.
Elvira rief noch einmal: »Pilipp!« Aber niemand kam nach vorne, um den Block abzuholen.
Herr Göltenpott merkte, dass etwas Ungewöhnliches in der Klasse vorging, faltete seine Zeitung zusammen, nahm seinen Kaugummi aus dem Mund, wickelte ihn in Silberpapier und steckte ihn in seine Jackentasche.
Herr Göltenpott war nämlich nicht nur begeisterter Zeitungsleser, er war auch leidenschaftlicher Kaugummikauer.
Er kam immer nur kauend in die Klasse. Zu Beginn der Stunde nahm er den Kaugummi aus dem Mund und rollte ihn sorgfältig in Silberpapier ein, am Schluss der Stunde wickelte er ihn wieder aus und steckte ihn in den Mund zurück. Die älteren Schüler behaupteten, er kaue schon seit fünf Jahren an ein und demselben Kaugummi. Aber das stimmte nicht. Elvira hatte ihn gesehen, als er Kaugummis aus einem Automaten holte, und das war noch nicht einmal drei Wochen her. Jedenfalls hatte sie es so in der Klasse erzählt.
Für Herrn Göltenpott fing eine Schulstunde nicht mit dem Klingeln an, sondern dann, wenn der letzte Zeichenblock ausgeteilt war. Deshalb musste er jetzt erst Zeitung und Kaugummi verstauen, bevor er sich der Frage widmen konnte, weshalb das Austeilen der Blöcke so plötzlich stockte.
Lippel bekam von alledem nichts mit. Er kam gar nicht auf die Idee, dass er der Grund dieser plötzlichen Stockung sein könnte. Er wunderte sich nur, dass offensichtlich jemand das gleiche Bild hinten auf den Zeichenblock geklebt hatte wie er: einen Tiger, der gerade ein Feuerwehrauto anfällt.
Erst als Herr Göltenpott mit vorwurfsvoller Stimme sagte: »Philipp Mattenheim, träumst du schon wieder? Willst du deinen Block nicht in Empfang nehmen? Wartest du, dass man ihn dir bringt?!«, schreckte Lippel hoch, rannte nach vorne und holte auch seinen Zeichenblock ab.
So hörte Lippel schließlich auf drei Vornamen:
Für seine Eltern, seine wenigen Freunde und seinen Onkel Achim hieß er Lippel.
Die meisten aus seiner Klasse riefen ihn Philipp.
Und für einige wenige, die selbst in der vierten Klasse noch nicht begriffen hatten, dass man »Ph« wie »F« ausspricht, war er immer noch der Pilipp.
Da er für sich selbst aber stets der Lippel blieb, soll er hier auch so genannt werden.
Das Leseversteck
Es gab drei Dinge, die Lippel ganz besonders gern mochte: Er liebte Sammelbilder, eingemachtes Obst und Bücher.
Eigentlich mochte er noch vieles andere ganz besonders gern. Aber das hing alles mit diesen drei Dingen zusammen, deshalb kann man die Sammelbilder, das eingemachte Obst und die Bücher schon besonders hervorheben.
Weil er Sammelbilder liebte, liebte er zum Beispiel Milch, Jogurt, süße und saure Sahne und Einkaufengehen.
Das muss man vielleicht etwas genauer erklären.
Es fing damit an, dass Lippel oben auf dem Dachboden drei alte Bücher fand, die »Wunder der Tiefsee«, »Bei den Trappern« und »Im Morgenlande« hießen.
In die Bücher waren große, farbige Bilder eingeklebt und unter jedem stand eine kurze Erklärung. Manchmal fehlte ein Bild. Dann war da nur ein weißes Rechteck zu sehen, unter dem etwa stand: »Scheich Achmed nimmt fürchterliche Rache an den Assassinen.« Und Lippel musste sich selbst ausmalen, worin die Rache wohl bestand. Er kam zu dem Entschluss, dass der Scheich die Assassinen gezwungen hatte Tomatensuppe zu essen. Das war die schrecklichste Strafe, die sich Lippel vorstellen konnte.
Sein Vater erklärte ihm, dies seien Sammelbilder in einem Sammelalbum. Man hätte die Bilder früher bekommen, wenn man eine bestimmte Schokoladensorte gekauft habe.
Und kurz darauf entdeckte Lippel, dass es solche Sammelbilder immer noch geben musste: Auf den Milchpackungen waren Sammelpunkte aufgedruckt, sie hießen »Penny«. Und daneben stand: »Für 100 Penny gibt‘s spannende Farbbilder.«
Das Wort »spannende« verhieß allerhand. Seitdem sammelte Lippel eifrig Penny-Punkte. Er hatte schon fast achtzig. (Dreiundsiebzig, genau gesagt.)
Die Sammelpunkte gab es nicht nur auf Milchpackungen, sondern auch auf Jogurtbechern und bei süßer und saurer Sahne. Seitdem ging Lippel ausgesprochen gern einkaufen. Selbst bei dem hinterhältigen Wetter, das gerade herrschte. So konnte er am besten darauf achten, dass beim Einkauf nie die Milch oder die saure Sahne vergessen wurde.
Die zweite Vorliebe von Lippel war eingemachtes Obst. Dies brachte mit sich, dass er Frau Jeschke mochte.
Frau Jeschke war eine ältere, dicke Frau mit dicken Brillengläsern. Sie war Witwe und wohnte zwei Häuser weiter, auf der anderen Straßenseite.
Lippel lernte sie kennen, als der Briefträger einmal aus Versehen einen Brief in Mattenheims Briefkasten gesteckt hatte, der eigentlich an Frau Annemarie Jeschke gerichtet war. Lippel brachte ihr den Brief.
Da die Tür offen stand, ging er einfach ins Haus. Frau Jeschke saß beim Mittagessen, soeben war sie beim Nachtisch angelangt: eingemachte Sauerkirschen mit einem Klecks Sahne.
Sie kamen miteinander ins Gespräch, weil Lippel fragte, ob er vielleicht den Sammelpunkt von der Sahnepackung ausschneiden dürfte.
Frau Jeschke lud ihn zu einem Schüsselchen Nachtisch ein und er lobte die Kirschen so begeistert, dass sie ganz erstaunt fragte: »Schmecken meine Kirschen denn so viel besser als eure?«
»Wir haben gar keine«, sagte Lippel.
»So was! Kocht denn deine Mutter keine Kirschen ein?«, fragte Frau Jeschke weiter.
»Nein, nie«, sagte Lippel und spuckte einen Kern aus.
»Sie weiß wahrscheinlich gar nicht, wie man das macht.«
Und weil er merkte, dass Frau Jeschke jetzt vielleicht ein schlechtes Bild von seiner Mutter haben könnte, setzte er schnell hinzu: »Dafür kann sie aber unsere Zentralheizung entlüften!«
»Nun, das ist auch was wert«, meinte Frau Jeschke und sie nahmen sich beide noch einmal Nachtisch.
Von da an besuchte Lippel Frau Jeschke öfters. Sie freute sich jedes Mal, wenn er kam. Manchmal gab es eingemachtes Obst für ihn, manchmal Sammelpunkte. Frau Jeschke sammelte nämlich jetzt für ihn mit.
Man muss allerdings betonen, dass Lippel nicht nur wegen des Obstes und der Sammelpunkte zu ihr kam. Er mochte sie gern und unterhielt sich genauso gerne mit ihr wie sie sich mit ihm.
Mit seiner dritten Vorliebe, mit den Büchern, war das so: Weil er Bücher liebte, las er gerne. Am liebsten las er ein Buch in einem Zug durch, ohne abzusetzen.
Weil er das Lesen liebte, blieb er am Abend gern lange auf. Denn je länger man aufbleibt, desto länger kann man lesen.
Und weil er es liebte, lange aufzubleiben, liebte er den Verschlag unter der Treppe im ersten Stock. Das war Lippels Versteck.
Familie Mattenheim wohnte in einem Einfamilienhaus, in dem schon Lippels Großeltern gewohnt hatten, bevor sie nach Australien ausgewandert waren.
Lippels Zimmer lag im ersten Stock, gleich gegenüber der Treppe. Dummerweise hatte die Tür zu seinem Zimmer oben eine schmale Milchglasscheibe. So konnten seine Eltern immer sehen, ob bei ihm Licht brannte oder nicht. Sie mussten dazu nicht einmal die Treppe hochsteigen. Man sah es schon, wenn man unten im Flur stand.
Und wenn Lippel gerade beschlossen hatte, nach dem Zubettgehen noch ein Stündchen oder zwei zu lesen, kam bestimmt keine Viertelstunde später seine Mutter ins Zimmer und sagte: »Lippel, Lippel, Lippel! Hast du wieder das Licht an! Jetzt wird aber endlich geschlafen, schließlich hast du morgen Schule!«
Dann fuhr sie ihm noch einmal durchs Haar, wartete, bis er das Buch unters Bett geschoben hatte, knipste das Licht aus und ging wieder nach unten.
Eine Zeit lang hatte Lippel versucht mit der Taschenlampe unter der Bettdecke zu lesen. Aber das war unbequem und umständlich: Man musste in der einen Hand das Buch und in der anderen die Taschenlampe halten, und wenn man die Seite zu Ende gelesen hatte, hatte man keine Hand frei, um umzublättern.
Deshalb war Lippel schließlich auf den Verschlag gekommen. Das war so eine Art Wandschrank mit schräger Decke, den Lippels Vater unter der Treppe zum Dachboden eingebaut hatte. Dort wurde alles aufbewahrt, was sonst nur im Weg stehen würde: Dosen mit Ölfarbe oder mit Salzgurken, leere Kartons und volle Limonadenkästen.
Es gab im Verschlag auch Licht. Und irgendwann, als Lippel nach dem Zubettgehen noch einmal aufgestanden war, um aufs Klo zu gehen (natürlich mit einem Buch unter dem Arm), war er auf dem Rückweg nicht nach rechts in sein Zimmer gegangen, sondern nach links geschlichen, hatte leise die Tür zum Verschlag geöffnet und das Licht angeknipst. Dann hatte er sich auf sein altes, zusammengerolltes Schlauchboot gesetzt, das hier auf den Sommer wartete, hatte die Tür von innen zugezogen und angefangen zu lesen.
Später am Abend hörte er, wie Vater unten aus dem Wohnzimmer kam, halblaut zu Mutter sagte: »Alles dunkel bei Lippel. Er schläft!«, und wieder ins Wohnzimmer zurückging.
Von da an verbrachte Lippel viele gemütliche Abende in seinem Versteck, las und trank zwischendurch manche Flasche Limonade leer. (Der Limonadenkasten stand gleich neben dem Schlauchboot. Lippel musste nicht einmal aufstehn, wenn er sich bedienen wollte.)
Er schaffte es auch jedes Mal, wieder im Bett zu liegen, bevor seine Eltern schlafen gingen. Denn dann schauten sie meistens noch einmal leise in sein Zimmer.
So war sein Versteck bis jetzt noch unentdeckt geblieben.
Nur Lippels Vater wunderte sich manchmal, weil er alle fünf Tage einen neuen Kasten Limonade kaufen musste, und sagte: »Irgendetwas geht da nicht mit rechten Dingen zu!«
Reisepläne
Genau zu der Zeit, von der bis jetzt die Rede war – als das Wetter verrückt spielte, Lippel schon fast achtzig Punkte gesammelt hatte (dreiundsiebzig, genau gesagt) und er das Versteck unter der Treppe entdeckte –, genau zu dieser Zeit also stellten Lippels Eltern fest, dass es ihnen großen Spaß machen würde, Lippel eine Woche lang mutterseelenallein zu lassen. Und deshalb beschlossen sie schnell, ohne ihn nach Wien zu fahren.
So jedenfalls stellte es Lippel immer hin, wenn er mit seinen Eltern darüber sprach.
Seine Eltern dagegen schworen hoch und heilig, dass sie so nie denken würden. Und dass sie es wirklich sehr, sehr schade fanden, dass er nicht mitkommen konnte.
Aber Lippel tat so, als glaubte er ihnen kein Wort. Wenn sie ihn schon nicht dabeihaben wollten, sollten sie wenigstens ein schlechtes Gewissen haben!
Doch der Reihe nach:
An einem Nachmittag, als Lippel gerade triefend nass vom Einkaufen zurückgekommen war und nun im Kühlschrank drei alte Milchpackungen etwas nach hinten schob, damit die vier neuen, die drei Jogurts und die saure Sahne Platz fanden, kam Vater zu ihm in die Küche und sagte mit ernstem Gesicht: »Lippel, ich habe etwas mit dir zu besprechen.«
»Meinst du das mit der Milch?«, fragte Lippel. »Sie ist nicht direkt sauer, nur ein bisschen dick. Und wenn wir die beiden Schüsseln einfach …«
»Was für eine Milch?«, fragte Vater verwirrt.
»Na ja, die auf dem Wohnzimmerschrank«, sagte Lippel.
»Nein, ich will nicht mit dir über Milch reden!«, sagte Vater, zog ihm den nassen Regenmantel aus und hängte ihn über die Stuhllehne.
»Limonade?«, fragte Lippel argwöhnisch.
»Auch nicht über Limonade. Über Wien. Ich will mit dir über Wien reden.«
»Lieber über Bagdad«, sagte Lippel erleichtert. »Ich weiß eine ganze Menge über Bagdad. Steht alles im Morgenland-Buch. Scheich Achmed …«
»Lippel! Jetzt hör doch mal endlich zu: Demnächst ist ein Kongress in Wien. Da muss Mama hinreisen.«
»Was ist denn ein Kongress?«, fragte Lippel.
»Da reden viele Leute über wichtige Dinge. Jedenfalls über Dinge, die für Mama wichtig sind.«
»Alte Kirchen und Gemälde und so was?«
»Genau!«
»Redet Mama da auch?«
»Ja, das wird sie.«
»Und wie lange dauert der Kongress?«
»Eine Woche.«
»Hm. Dann sind wir beide also eine Woche allein«, sagte Lippel. »Da werden wir natürlich weniger Milch brauchen als zu dritt.«
»Nein, Lippel – weißt du …«
»Ja?«
»Ich habe vor, mit Mama nach Wien zu fahren!« Nun war es heraus und Vater atmete erleichtert auf.
»Und ich?«, fragte Lippel fassungslos. »Komme ich nicht mit?«
»Das geht leider nicht. Du musst doch in die Schule.«
»Ihr könnt mich doch nicht eine ganze Woche lang allein lassen«, sagte Lippel empört. »Machst du einen Witz?«
»Es wird solange jemand hier wohnen und für dich sorgen.«
»Wer denn?«
»Das wissen wir auch noch nicht. Ich verspreche dir: Wir fahren nur, wenn wir jemanden finden. Jemand, der nett ist.«
»Ihr könnt mich doch nicht eine Woche lang bei einem Fremden lassen«, protestierte Lippel.
Vater seufzte.
»Kannst du das nicht verstehn, Lippel?«, fragte er. »Ich möchte eben gerne dabei sein, wenn Mama ihren Vortrag hält.«
»Ich auch!«, sagte Lippel.
»Weißt du, ich war noch nie in Wien …«
»Ich auch nicht!«, sagte Lippel.
»Ja, aber du bist zehn und ich bin achtunddreißig!«, sagte Vater. »Denk darüber nach! Vielleicht kannst du dich doch an den Gedanken gewöhnen.«
»Nie!«, sagte Lippel und ging aus der Küche.
Ein paar Tage später versuchte es seine Mutter.
»Lippel«, sagte sie. »Du bist doch mein großer Sohn. Ein richtig großer Junge. Stimmt’s?«
»Das sagst du nur, weil du mit mir über Wien reden willst«, antwortete Lippel.
Und so war es auch.
»Ich habe uns beide jetzt angemeldet«, sagte sie.
»Uns beide?«, fragte Lippel. »Wo?«
»Nein, uns beide. Papa und mich«, sagte Mutter. »Für den Kongress in Wien. Papa hat ja schon mit dir darüber geredet.«
»Und was wird mit mir?«, fragte Lippel entrüstet. »Ihr lasst mich also hier verhungern!«
»Es kommt jemand, der für dich kocht und für dich sorgt, während wir weg sind«, sagte Mutter. »Außerdem müsstest du auch so nicht verhungern. Im Kühlschrank stehen so viele Jogurts, dass du jeden Tag vier davon essen könntest. Das würde zum Überleben reichen.«
»Und wer kommt?«, fragte Lippel.
»Bei Papas Zeitung gibt es eine Sekretärin. Die hat eine Schwester. Und deren Freundin ist gerade arbeitslos. Die würde für eine Woche kommen und hier wohnen.«
»Einfach so?«
»Nein, wir bezahlen sie natürlich dafür«, sagte Mutter. »Wir haben sie für nächsten Sonntag zum Kaffee eingeladen. Damit ihr euch kennen lernt.«
»Wie heißt sie denn?«
»Frau Jakob«, sagte Mutter. »Bist du damit einverstanden, dass sie am Sonntag mal vorbeikommt?«
»Ich weiß nicht«, sagte Lippel unentschlossen.
»Du müsstest dann allerdings am Samstag eine Sahne mehr kaufen als gewöhnlich«, sagte Mutter und lächelte ein bisschen dabei. »Eine Sahne reicht immer gerade für uns drei. Aber wenn wir zu viert wären …«
»Na ja, meinetwegen soll sie kommen«, sagte Lippel. »Ich kann sie mir ja mal anschauen.«
Lippel hätte gar zu gerne gewusst, was Frau Jeschke von der ganzen Sache hielt.
Aber er hatte Hemmungen, sie direkt zu fragen, und überlegte die ganze Zeit, wie er es anstellen könnte. Schließlich fand er doch eine Lösung und rannte gleich hinüber zum Haus, in dem Frau Jeschke wohnte.
»Frau Jeschke«, sagte er noch in der Haustür. »Frau Jeschke, kann ich Sie was fragen?«
»Mich fragen?«, fragte Frau Jeschke erstaunt. »Natürlich kannst du das. Zieh deinen nassen Regenmantel aus und setz dich erst mal in aller Ruhe hin! Worum geht es denn?«