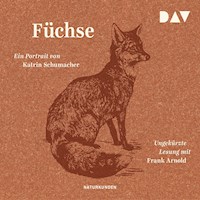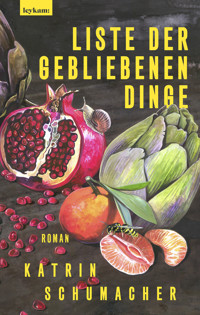
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Leykam
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein sinnliches und poetisches Romangemälde, das von unsicheren Zeiten und vom Licht der Liebe erzählt, ein Roman im Stillleben Mirren und Kato, Kato und Mirren. Sie lieben sich. Während Kato üppige Stillleben aus der Kunst für ihr Publikum nachkocht, malt Mirren. Aus einer großen Stadt am Fluss ziehen sie in eine kleine Stadt am Kanal, schließlich in ein grünes Provisorium, eine Bude, die sie zu ihrem Ort ausbauen. Doch hinter der Tapete dieser Bude spielt sich Befremdliches ab, es rieselt aus der Wand, die Zeit wird unzuverlässig, die Wege in die Stadt verschwinden. Katrin Schumacher verwebt literarische Fantastik, Schauerroman und Naturbeobachtung zu einer poetischen Liebesgeschichte, die von der existenziellen Verunsicherung unserer Zeit erzählt. Weder in der Kultur noch in der Natur finden die Figuren Halt. Was geht und was bleibt? Vielleicht nur eine Liste, die Liste der gebliebenen Dinge. Mit Schutzumschlag, Strukturpapier und Lesebändchen Illustration von Annika Siems
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Ein sinnliches und poetisches Romangemälde, das von der Liebe in unsicheren Zeiten erzählt. Was geht und was bleibt?
Mirren und Kato, Kato und Mirren. Sie lieben sich. Während Kato üppige Stillleben aus der Kunst für ihr Publikum nachkocht, malt Mirren. Aus einer großen Stadt am Fluss ziehen sie in eine kleine Stadt am Kanal, schließlich in ein grünes Provisorium, eine Bude, die sie zu ihrem Ort ausbauen. Doch hinter der Tapete dieser Bude spielt sich Befremdliches ab, es rieselt aus der Wand, die Zeit wird unzuverlässig, die Wege in die Stadt verschwinden. Katrin Schumacher verwebt literarische Fantastik, Schauerroman und Naturbeobachtung zu einer poetischen Liebesgeschichte, die von der existenziellen Verunsicherung unserer Zeit erzählt. Weder in der Kultur noch in der Natur finden die Figuren Halt. Was geht und was bleibt? Vielleicht nur eine Liste, die Liste der gebliebenen Dinge.
Über Katrin Schumacher
Katrin Schumacher, 1974 in Lemgo geboren, promovierte Literaturwissenschaftlerin und studierte Kunsthistorikerin, Journalistin und Literaturredakteurin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, schreibt, seit sie schreiben kann. Katrin Schumacher hat in Bamberg, Antwerpen, Hamburg gelebt und lebt nun in Halle an der Saale. Von ihren biografischen Stationen hat sie das Faible für literarische Fantastik, niederländische Malerei, fließende Gewässer und Nature Writing mitgebracht. Nach wissenschaftlichen Texten, Katalogarbeiten, Essays und dem Band »Füchse« (Matthes & Seitz 2020) ist »Liste der gebliebenen Dinge« ihr literarisches Debüt.
Newsletter des Leykam Verlags
In unserem Newsletter informieren wir Sie über aktuelle Veranstaltungen unserer Autor*innen, neue Bücher und aktuelle Angebote. Hier geht es zur Anmeldung:
https://mailchi.mp/leykamverlag/newsletter
leykam:seit 1585
Katrin Schumacher
Liste der gebliebenen Dinge
ROMAN
leykam:
Belletristik
– Wo bist du?
– Hier.
Inhalt
Fuchsaugen
Spinnenatem
Schwieriges Obst
Zeuxis und Parrhasios
Petrichor
Das goldene M
Waldmeistergeist
Kalypso
Kopfmusik
Babinskis Lächeln
Nackt
Prinzessinnen
Königin
Zöpfe
Grund
Lichteinfall
Provisorium
Piraten
Splitter
Stillleben
Literatur bei leykam
Fuchsaugen
Den Telegraphenpfad rein, dreihundert Meter geradeaus, dann rechts zweihundert Meter in den Wald hinein. Holzpfosten heben zwei schwarze Drähte in die Höhe, am Feld entlang, hinein ins Laub. Vor dem Tor tauchen die Drähte aus dem Grün wieder auf. Hier ist die Lichtung, hinter dem Tor ist die Wiese. Ein schmal getrampeltes Band zieht sich vom Tor am Boden entlang.
Kato zieht die Schlüssel aus der Tasche, ein Bund von Welten. Der Schlüssel, der zu der Wohnung in der Stadt amFluss gehört, den sie nie abgegeben hat, obwohl sie dort längst nicht mehr wohnt. Der für die Tür zu unseren Zimmern oben im großen Haus in der kleinen Stadt und die beiden bis auf zwei Zacken im Bart gleichen Schlüssel, die zum Haus ihrer Eltern gehören, auch die noch da. Hier nun der fünfte Schlüssel, der neuste am Bund, der, der glänzt, der zum Tor, zum Garten, zum Berg, zum Haus, zum Fluss, zur Bude.
Der grüne Lack auf der Klinke blättert in zackigen Partikeln. Das Verwittern macht den Lack den Wiesenzacken gleich, durch die Kato nun auf den Pfad schreitet, vorbei an schief gewordenen Terrassenplatten vor dem verfallenen Haus, in kürzer werdenden Schritten den Hang abwärts, während sich von links und rechts das Gebüsch zu schließen versucht über dem Weg, als wolle es in letzter Minute vereiteln, dass sie die Bude erreicht.
Kato rutscht und bleibt immer wieder an den Dornen der Schlehen hängen, deren Äste oder Arme oder Ausläufer an den bloßen Beinen, der Jacke, der Haut reißen.
– Wo bist du?
Anscheinend war ich fast bis zum Fluss hinuntergegangen, während Kato den Weg zur Bude zurücklegte. Kato, ich seh es genau, guckt ins Licht und überlegt, sich selbst ein kleines Märchen zu erzählen, um die Zeit zu überbrücken, bis ich wiederkomme. Um mir dann zu erzählen, was erzählt werden muss. Das mit dem See.
Ein kleines Märchen geht so: Ein Fischer lebte in einer Hütte nahe dem Fluss Goma. Vor und neben dem Haus hingen seine Netze im Sonnenschein. In dem Haus hing ein Bild seiner Frau, ihr Portrait war das Einzige, was dem Fischer geblieben war von ihr. Und das gemeinsame Kind, ein Sohn, kräftig wie sein Vater, bernsteinäugig wie seine Mutter. Als der Fischer eines Abends im letzten Licht des Tages saß und seine Netze zählte, kam ein Fuchs aus der Hecke und setzte sich zu seinen Füßen. Fischer, sprach der Fuchs, kennst du mich noch? Der Fischer blickte dem Fuchs in die Augen und musste verneinen. Fischer, sagte der Fuchs, schau genau hin, erkennst du mich nicht? Ich bin deine Frau.
Da das Märchen so klein ist und Kato wohl meine Schritte hinter der gelb leuchtenden Forsythie neben der Bude hört, ist es hier zu Ende.
– Kato.
– Mirren?
– Na?
Das mit dem Luftholen ist nicht einfach nach dem Aufstieg, und so kann mich Kato noch ein paar Augenblicke betrachten, mit Lächeln, noch länger, die Augen im Gespräch, bevor wir zu sprechen beginnen. Und uns erzählen. Dass der Rotwein dieser Gegend schon immer zu sehr nach Weißwein geschmeckt hat und dass der See nicht mehr da ist.
Katos Blick auf den Boden, als ob auf den geriffelten Holzplanken geschrieben stünde, was eigentlich passiert ist, ob sich die Noten fürs Seeverklingen auf die Linien dort setzen könnten.
– Er ist einfach weg, Mirren. Trocken, es ist einfach nur noch eine trockene Senke dort.
Als wir in der kleinen Stadt ankamen, hatten wir begonnen, den See zu beschwimmen, zu betauchen, unsere Hängematten in den Weiden am Ufer aufzuspannen und uns mit ihm zu beschäftigen. Ich hatte angefangen, Pflanzen zu sammeln und in einem Aquarium in der Küche den Wasserlebensraum nachzubilden. Laichkraut, Tausendblatt, Wasserpest, dazu die Erbsenmuscheln, Posthornschnecken, Teichmuscheln, Spitzschlammschnecken, alles, was an diesen langen Wassernachmittagen auf uns zukam, trug ich nach Hause, um den Seealtar in der Küche zu bestücken. Am liebsten mochte ich die im Nassen goldglänzenden Malermuscheln. Die flache Teichmuschel mit den braungelben Runzeln bekam sogar Kinder. Oder Junge. Oder wie man das nennt, bei Muscheln.
– Muschellarven, weißt du doch.
Sie wuchs nach. Das meiste aber hielt nicht lang durch. Ich weiß nicht mehr, was aus dem Aquarium wurde. Kato weiß es auch nicht. Wir hatten uns eine lange Zeit nicht gesehen. Nun ist Kato wieder hier, in unserer Bude, und meint, dass es zu reden gäbe, der See, er sei nicht mehr, unser See, er sei weg.
Wir sitzen auf dem Rand der Terrasse, die Füße im Bodenlosen über dem Hang, und die vom Tag noch sonnenwarmen grauen Holzplanken schneiden in die Unterseite unserer Oberschenkel. Es ist kein Zufall, dass die Terrasse einem Steg ähnelt, aus genau dem Holz gebaut, das in den Marinas der Welt den Weg vom Festland aufs Wasser bereitet, kannelierte Bretter, auf denen sicher Stehen ist. Mit Blick auf die Ebene, den Fluss, die Weinberge erinnern wir uns in langsamen Sätzen. Erst an den einen See. Dann an die anderen. Dann an uns.
Zwei Körper, die sich oft und auf bestimmte Weise nahe sind, nähern sich einander an in ihrer Dichte. Wie Lösungen verschiedener Konzentration, die ineinander geschüttet werden. Der eine Körper geht in die Erfahrung des anderen über, der wiederum passt sich an. Weiches Umfassen macht weich. Muskeln können im Umarmen wachsen.
Kato glaubte immer fest an diese Theorie, mit uns war es so geschehen, als wir unsere Zeit hatten. Ich war schwer, wurde ein wenig leichter an ihr. Und sie bekam etwas von meiner Kraft. Kato glaubte daran, dass diese Erfahrung uns beide betraf, und ich glaubte daran, dass diese Erfahrung nicht nur menschliche Körper betrifft.
Buch und Bach. Alles, was sie ist, sagte sie einmal, könne sie auf eines dieser beiden Bs zurückführen. Hier verstanden wir uns und sahen uns an, an den Abenden meist erzählten wir uns unsere Flüsse, sagten uns mit unseren Bachläufen Gutnacht, lasen uns aus den Flüssigkeiten vor und spiegelten uns in unseren Pfützen. Wenn das Katokind nicht las, erzählte sie mir, stand es barfuß oder in Kindergummistiefeln im Lauf des Wassers, das die Grenze zwischen dem Grundstück ihrer Eltern und ihrer Großeltern war. Eine fließende Grenze im Grün, zwischen Hühnerstall, Kohlenkeller, Kurzrasen, Apfelbäumen, dem Nutzgarten ihrer Großeltern und dem aufwendig präparierten Blumengarten ihrer Eltern. Auf der einen Seite der Misthaufen. Auf der anderen Farbgestaltung, Kräuter und Gemüse nur, wenn es schön aussah. Es gab eine kleine Holzbrücke mit wackeligem Handlauf über den Bach, neben der auch drei Stufen ins Wasser führten, wobei dort das Bachbett so ausgewaschen und tief war, dass es unweigerlich in Katos Kindergummistiefel schwappte.
Sie wusste alles über den Bach. Wo die Wasserlinie gerade noch so niedrig war, dass sie trockenen Fußes durchkam. Wo die Sedimentablagerungen so weich waren, dass sie einsank. Der weiche Schlamm, die Ufergräser, die Weidenzweige, die als raschelnd fedrige Verbindungshaare von einem Ufer zum nächsten wuchsen. Die Betonröhren, die einen begehbaren Tunnel unter der Straße bildeten, ihr Echo, voll unheimlich. Wo die Forellen standen (unter der Brücke, am Rand, im alten Autoreifen), und wo am Tennisplatz die Bälle im Wasser landeten und einzustecken waren. Wo die Winterlinge standen und die Schlüsselblumen. Wie süß die Enden der Taubnesselblüten am Bachrand schmeckten. Und wo der knorrige Holunder so stand, dass man durch eine harte Zweighöhle kriechen musste.
Das Bachreich hatte natürliche Grenzen. Dort, wo er aus der Erde kam, aus einer kleinen unbegehbaren Röhre gegenüber der Ziegelei. Und dort, wo er sich am Freibad und am Ententeich entlang in einer anderen großen Betonröhre im Dorf verlor, wo er zwar immer wieder auftauchte (hinter der Kirche, neben dem Gemeindehaus, beim Kuhbauern), aber nicht mehr in Katos Revier floss.
Ihr Bach war ein Kilometer der Welt. Sie hatte ihn verstanden. Sie wusste ihn und hatte mir alles erzählt. Und hier beginnt mein Märchen von Kato.
Vor der Bude sinkt langsam die Sonne. Vor unseren Füßen, links an der Böschung, liegt ein alter Weihnachtsbaum, der seine Farbe verloren hat. Von der Zeit bestaubt liegt er dort, an seine Spitze hat jemand, vielleicht ich, ein angesplittertes Weinbergschneckenhaus gesteckt.
Einmal, sagt Kato, bin ich an einem Sommertag durch den Garten meiner Eltern gegangen und habe eine große Weinbergschnecke gesehen. Diese langsamen Wohnmobile sind immer zuhauf im Garten unterwegs gewesen, unterm Rhabarber, auf den Trockenmauern, in den Hangbeeten unter dem Walnussbaum. Diese Schnecke hatte sich auf ihrer glitzernden Spur einen Weg ins Zimbelkraut gebahnt. Und sie war nummeriert. Auf ihrem Kalkhaus trug sie eine mit Filzstift gemalte Sechzehn. Ich bin ins Haus, hab meine Mutter gesucht, Mama, in unserem Garten ist eine nummerierte Schnecke. Da hat sie stolz eine Liste aus ihren Papieren auf dem Küchentisch gekramt und sagte: Ja, die sind alle nummeriert, hier, so kann ich zählen, wie viele Weinbergschnecken im Garten sind.
Meine Mutter, sagt Kato, hatte für alles Listen. In welcher Ecke des Gartens sie an welchem Tag in der Woche was machen muss.
Ich möchte sie nicht daran erinnern, aber Kato hatte auch Listen, zwar nicht für die Dinge, die zu tun waren, sondern für die Dinge, die getan waren. Ich hatte es ihr irgendwann gesagt: Schreib doch mal all die Bücher auf, die du gelesen hat. Schreib auf, welche Ausstellungen du gesehen hast. An welchen Orten du warst, in welchen Wassern du geschwommen bist.
– Weißt du, Mirren, die einzigen Listen, die ich je geschrieben habe in dieser Hinsicht, waren Listen von Dingen, die ich gegessen habe.
Ich hatte diese Listen sogar mal gefunden, sie hatte sie Sissi-Listen genannt, nach der dünnen Elisabeth von Österreich.
Aber Kato fing tatsächlich an. Romantitel zu notieren. Eine kleine Landkarte mit Punkten zu versehen. Dinge, die getan waren, gelesen, gespürt. Sie führte eine Liste der lautesten Insekten und eine der bittersten Kräuter. Eine Liste des schönsten Lichts. Ich nahm mir immer wieder vor, eine Liste ihrer Listen zu schreiben. Doch welche sah ich? Welche nicht?
Kato suchte, sobald sie die Bude erreichte, immer den Blick in die Muschel. Sie hatte sie in der Tasche ihres Mantels gefunden, als sie zum ersten Mal an der halb verfallenen Hütte ankam, sie hatte immer kleine Dinge in der Tasche, an denen sie sich festhielt und die sie befühlte, während sie sich unterhielt, während sie ging, während sie in der Bahn saß. Deshalb steckte sie auch ständig Funde ein. Irgendjemand, der sich sehr für andere Menschen interessierte und einen Beruf daraus gemacht hatte, erzählte Kato einmal, wie sie es machen müsse: für jeden guten Moment am Tag einen Gegenstand von der rechten in die linke Tasche wandern lassen und am Abend das Glück zählen. Ach was, hatte sie pariert, das Glück, das sind doch schon die kleinen Dinge in der Tasche.
Diese Muschel der Bude jedenfalls war halb und klein, eine der Teichmuscheln aus dem See. Eine halbe Malermuschel, Unio pictorum, die ihren Namen daher hatte, dass in ihren Schalen früher Wasserfarben gemischt und aufbewahrt wurden. Schon im Mittelalter hatte man das wohl getan. Kato fand den Gedanken seltsam, dass in dem Inneren des Tieres, das aus dem Wasser kam, das eigentlich Lebendige, das verschwunden war, ersetzt wurde durch buntes Wasser.
Sie hatte mich einmal dazu gebracht, meine Farben in den Schalen anzurühren. Zwölf hatte sie gesammelt und aufgereiht, von Hellgelb bis Tiefschwarz wurde die Palette, am schönsten auf dem Perlmutt des Muschelinneren sahen das Rosa und das Nachtblau aus. Grün war auch hübsch. Der braune Rand. Der weiße Grund. Wie farbige Augen, die von Kindern gemalt waren, lagen die Muscheln im Atelier. Ich ließ das Wasser verdunsten und legte die trockenen Schalen mit dem Farbfilm in eine Ecke. Aus der Räumrotation meines Ateliers heraus müssen sie wohl im Müll gelandet sein.
Katos halbe Manteltaschenmuschel aber war nicht verschwunden. Sie hatte sie am ersten Tag mit der Bude in einen Holzspalt zwischen die Terrassenbalken geklemmt, wo sie seitdem bei jedem Besuch von ihr begrüßt wurde.
Das Licht verschwindet, die Kühle kommt, unsere Weinbergschnecken, auch hier, unterwegs in ihren Kalkhäuschen, unzählbar.
Spinnenatem
In der ersten Woche war die Bude noch keine Bude, sondern eine Hütte. Man musste einen großen Teil des Hangs hinunterstolpern, die Bretter und Handläufe, die einmal den Weg sichern sollten, waren mit der Zeit Hindernisse geworden, die Zweige der Büsche verhakten sich oben in den Haaren, während unten die Wurzeln und Strauchableger ihre Fallen auslegten, sagten: Komm mir ja nicht nahe. Die Wegwidrigkeit sprach zu Händen und Füßen und glücklicherweise hatten wir Sonnenbrillen auf, die zurückschlagenden Zweige machten nur ein paar Striemen im Gesicht. Kato hatte einen Ratscher am Hals, als wir am ersten Gebäude ankamen.
– Das nennst du Gebäude?
Ein Schuppen lag dort linkerhand, der drei versperrte Türen hatte, von denen wir kurze Zeit später wussten, sie führten zum Holzverschlag, zum Gerätekabuff und zu einer kleinen rosa Toilette, durch die mindestens ein Jahrzehnt kein Wasser geflossen war. Spinnweben, dichte schmutzige Tücher bewegten sich in den Räumen, verdickte weiße Stellen immer dort, wo ein Stück Beute eingesponnen worden war. So alt war das alles, dass wir keine lebendige Spinne sahen. Nur trockene Spinnenleichen und Insektenhülsen bewegte der Luftzug der geöffneten Türen. Selbst das marmorierte Wespennest war lang schon leeres Papiergewölle, grau und schön hing es am Deckenrand des Holzverschlags. Bereit, von der Natur übernommen zu werden. Die Büsche und Brombeerranken hatten schon angefangen, den Schuppen zu verdauen, hatten die Holzpaneele auseinandergeschoben, hatten sich nach innen getastet voller Vertrauen in die sonnige Zukunft, wenn das Schuppendach eines windigen Tages über seine Seitenwände stürzen würde.
An dieser saumseligen Sprengung rechts vorbei tat sich ein kleines Plateau auf, hier war wilde Wiese, und hier würde im Sommer alles hochstehen, was jetzt als vertrocknete Stecken vom letzten Jahr übrig geblieben war. Disteln konnte ich erkennen, Zittergras und Trespen, dazwischen schlugen Sträucher aus, und aus dem Ilex kamen schon die gelben Blütenballen, blaue Perlhyazinthen schoben sich mit ihren unanständigen Stängeln überall aus dem Boden, und am Rand stand ein riesiger Rosmarin, der größte, den ich je gesehen hatte.
– Da hat es sich jemand schön gemacht.
Kato ging voran und das Erste, was uns auffiel, war die robuste Terrasse. Ein Steg ins Hangmeer lag vor uns, die Holzhütte dahinter. Hütte 1876, die Nummer war auf Messingplättchen an die Wand genagelt und das Einzige, was hier glänzte. Zwischen den braun getünchten Holzpaneelen hatte sich Staub abgelegt, Spinnweben an den Fenstern, die zumindest heil waren, ein Fliegengitter baumelte von einer Ecke des Rahmens. Zwei große Fenster wiesen auf die Terrasse hinaus, daneben war die Tür. Der Schlüssel mit der gelben Markierung „Bungalow“ passte, und sie öffnete sich nach außen. Der Budengeruch war sofort da. Nicht muffig, eher wie mit Luft versetzter Staub. Atmeten Insekten eigentlich?
– Das weißt du doch. Ohne Lunge, die haben diese Schlitze und diese Kanäle, Tracheen heißen die …
Kato betonte die beiden Es mit einem schönen Stolperer in der Mitte, das konnte ich mir merken.
– Und da strömt Sauerstoff rein und Kohlendioxid raus, also nicht reines, aber klar, das ist Atmen.
Ein Jahrzehnt Spinnenatem also schlug uns entgegen, und das roch nach, ja, es war sofort da für Kato: nach schwedischem Sommer, dänischem Kiefernholzferienhaus, polnischer Datsche, holländischer Strandhütte, ostisländischem Kircheneingang, duftete nach allen Orten auf einmal, an denen sie Ferien gemacht und als Kind nachts wach gelegen hatte, um den Spinnen beim Atmen zuzuhören.
Meine Erinnerung war eine andere. Ich hatte nie Ferien gemacht als Kind in Dänemark oder Schweden, ach was, Island. Wir sind manchmal an die Ostsee gefahren, glaube ich, ich hatte alles vergessen und wollte das so. Das Wir gab es nicht mehr. Meine Erinnerung sollte eine Zukunft sein. Oder zumindest eine Erinnerung, die ich mir selbst geben konnte, die ich in Büchern gelesen, die ich auf Bildern gesehen hatte. In meiner Erinnerung sollte sich für immer ein weißes Leinentuch als Sonnensegel unter dem durchsichtigen Wellplastik der Terrasse spannen, es sollte heiß und luftig zugleich sein, darunter ein Tisch, ein rotes Sofa, Stühle mit weiß lackierten Eisengestellen, und aus dem sommergewärmten Haus sollte ein Geruch nach uraltem Dasein und Wissen kommen und tausend Stimmen aus aufgeschlagenen Büchern.
– Kato. Erzähl mir eines deiner Märchen, bitte, schnell.
Und das kleine tröstende Märchen ging so.
Es war einmal eine Füchsin, die wohnte unter einer großen Eiche. Sie teilte den Bau mit einem Dachs und einer Wildgans. Eines Tages kam ein Soldat an der Eiche vorbei und wunderte sich, als er die Tiere einträchtig vor ihren Eingängen sitzen sah. Sag Füchsin, hast du keinen Hunger auf die Gans? Oh doch, sagte die Füchsin, jeden Tag. Und du, Gans, hast du keine Angst vor der Füchsin? Oh doch, sagte die Gans, jeden Tag. Und Dachs, was machst du in diesem Bau? Ich bin der, der da sein muss. Ich sammle den Hunger und sammle die Angst, jeden Tag, und ich vergrabe sie.
Und da dies nur ein kleines Märchen war und ich nur ein bisschen Trost brauchte, war es hier schon zu Ende.
Die Tür der Hütte ging nach außen auf, und als der erste Schock des Geruchs uns ein klein wenig verändert hatte, gingen wir neugierig hinein. Erst Kato, dann ich, während der Hunger und die Angst draußen blieben. Die Spinnweben waren auch hier atemberaubende Segel, die ins Wehen kamen und die Räume zum Leben erweckten. Drei Räume, ein großer links, in dem ein Sofa, ein Regal und ein Schrank standen, eine kleine Küche gleich gegenüber der Eingangstür, und ein Zimmer rechts, in dem ein Doppelbettkasten mit zwei Schaumstoffmatratzen voller Fliegenleichen stand. Alles schien zweimal vorhanden, die Matratzenkerne, die weißen Plastikstühle, die spirreligen Küchenstühle, selbst das Sofa ein Zweisitzer. Zwei Tische gab es, zwei Schränkchen. Wer hat von meinem Tellerchen gegessen.
Es ist seltsam, in ein fremdes Haus einzudringen, auch wenn es wie dieses lange nicht bewohnt wurde. Die Dinge darin sind laut. Die Abziehbildchen knacken sich ins Gedächtnis, die Prilblumen der anderen, Fix und Foxi mit abgeblätterten Ohren. Das Schränkchen auf dem Küchenboden war mit Wachstuch benagelt, auf dem tummelten sich Entchen in blauweißem Karoambiente. Was sie wohl bewachten?
– Mirren, schau mal.
Kato hatte das Schränkchen geöffnet und wir blickten auf Porzellan mit dunkelblauem Vergissmeinnichtdekor.
– Das behalten wir.
Wir würden später als Erstes dunklen süßen Port aus den kleinen Tassen nippen. Was wir noch daraus tranken: schwarzen Tee mit Milch, Milch, Weißwein, Rotwein, aufgegossene Kräuter, Wasser. In dieser Reihenfolge.
Was wir noch fanden, waren zwei billige Blechtöpfe mit dünnen Wänden und wackeligen Kunststoffgriffen. Außerdem ein paar Sektgläser, klebrig, und fünf Schnapsstamperl, schmutzig. Der ehemalige Herr der Hütte hatte eine Kochplatte installiert und ein undurchschaubares Wassersystem gebaut. Strom hatte der Ort, Wasser nicht, nur das, was sich in den Zisternen sammelte oder in den Regenwassertonnen unter den Dachrinnen. Ich ging rund um das Haus und versuchte zu verstehen, wie der Mann sich mit Wasser versorgt hatte. Aber ich kam nie zu einem sinnvollen Ende. Ich würde mir etwas ausdenken müssen, doch zunächst blieb, das Vorhandene zu nutzen, irgendetwas zusammenzustecken und zu überlegen, wie viel Wasser wo zu fangen sein könnte. Das Dach war glücklicherweise heil, zumindest von oben – von unten hatten sich vermutlich Waschbären durch die Verschalung geboxt, um ein Quartier zu suchen, und dabei einigen Schaden angerichtet. Verspleißte Holzbretter lagen in Stücken unter dem First, aber es würde kein Problem sein, ein paar Bretter, die ich im Holzverschlag gefunden hatte, gegen die Löcher zu nageln.
Die Hütte war verkommen, sie lag seit über zehn Jahren im Schlaf. Trotzdem oder gerade deshalb war sie genau unsere Bude. Wir wussten es sofort. Sie war ein Boot, ein Schiff, ein schlafender Ort, im wilden Wuchs, ein Teil davon, ein Raum für uns. In dem wir lebendig sein würden.
Jetzt sitzen wir hier auf der Terrasse, die Sonne geht unter und es ist Zeit, vom See zu erzählen.
– Weißt du, Mirren, ich bin wirklich lange nicht dort gewesen. Vor sechs Wochen aber war mir so nach Wasser, und da dachte ich: Ich geh zum See.
Kato erzählt, wie sie das Fahrrad rausgeholt, sich durch die Stadt geschlängelt, den Weg am Fluss entlang genommen hat und an der Stelle nach der Brücke in das Naturschutzgebiet abgebogen war. Nur wenige Leute waren unterwegs, ein paar Jogger, ein paar Leute, die von ihren Hunden ausgeführt wurden. Nach einem kurzen Weg durch eine Gartenkolonie musste sie rechts über eine zweite Brücke, dann immer geradeaus durch die Gräser, und dann hätten links die Schwemmwiesen beginnen müssen und rechts der See. Die Wiesen waren da. Der See nicht.
– Nur eine verdammte tote Senke. Ich hab gedacht, ich seh nicht richtig oder ich hab mich verfahren, ich hab wirklich gesucht.
Die Stelle, an der die Angler gern standen, war ein kleiner trockener Hang geworden. Der Kies und die Erde hatten etwas Gras angesetzt, und je weiter Kato in die Mitte schaute, desto weniger See war da. Ehemalige Wasserpflanzen, die jetzt borstiges Unkraut waren. Der elegante Tannenwedel war zu Spülbürsten getrocknet. Ein Haufen Heu, nur am Rand stand ausgeblichen tot und trotzig das Schilf und raschelte sein eigenes Echo.
– Bist du reingegangen? In die Senke, meine ich?
– Ich hab mich nicht getraut. Meine Füße haben sich nicht getraut. Mein Gefühl hat sich nicht getraut.
Kato war fortgeradelt und am anderen Tag wieder hin. Und wieder. Eine Woche lang war sie jeden Tag zum Nichtmehr-See gefahren und hatte am Nichtmehr-Ufer gesessen und an die Schnecken und Muscheln und die kleinen Rotfedern und Putzerfische gedacht, die immer neugierig anschwammen, sobald man im Sommer länger als zehn Minuten im Wasser saß, frech und kitzelnd.
– Und dann bin ich zu dir gefahren, Mirren. Sag mir bitte, wohin all das ist.
Wieso bleiben von den Millionen Sätzen, die wir im Leben hören, nur wenige ein Leben lang wortwörtlich im Gedächtnis? Wieso erinnert man sich aus der ganzen Flut von Empfangenem immer nur an wenige Sätze, jahrelang, jahrzehntelang, meist sogar mit der Stimmlage der Sprechenden?
– Du bist so schön.
Das erste Mal, dass jemand mir den Satz schenkte, ist ungefähr zwanzig Jahre her, und ich weiß noch immer, von wem und mit welcher Begeisterung er mir gesagt wurde. Oft, wenn ich Kato ansah, musste ich diesen Satz denken und sagen, und ich hoffte, dass er ihr ebenso ins Gedächtnis geschrieben war wie mir. Jetzt gerade denke ich den Satz und sage ihn nicht, weil er noch nicht wieder dran ist, ich muss ihr erst etwas zu dem See sagen und kann es nicht. Kato schaut in das Abendlicht, das vorm Hang steht, und ich erinnere mich, wie ich früher so oft wahrgenommen hatte, was ein Sommertag mit ihr gemacht hatte. Leichte Vanille und etwas, das ganz weich, salzig und rot wie Soljanka roch. Woher die Salznote kam, hatte ich oft versucht zu verfolgen. Woher die ständige Vanille kam, war klar, sie ist eine Bäckerin. Und was für eine. Allein, als sie mir einmal erklärte, wie ein Mürbeteig am besten zuzubereiten ist, wurde ich satt und ruhig.
Von der Kälte oder Wärme, Mirren, von der Temperatur der Hände hängt es ab. Die Butter in kalten Würfeln, der Zucker, das Ei, das Mehl, eine Prise Salz und eine kleine Handvoll gemahlener Mandeln. Samtig weich fühlt sich das Mehl unter den Fingern an, weicher werdend die Butter. Und je wärmer die Finger, desto schneller die Verbindung zwischen den Zutaten. Der Teig braucht Schnelligkeit und eine gewisse Kühle, sonst kippt die Konsistenz ins Klebrige, nicht in die weiche Kugel, die am Ende steht.
Am liebsten, sagte Kato, mag ich es, Eier mit den bloßen Händen zu trennen. Die Schale an einem scharfen Rand aufbrechen, dann mit dem Daumen vorsichtig in die Bruchstelle,