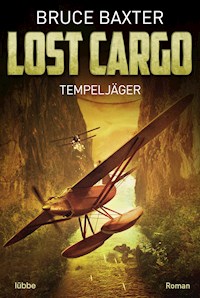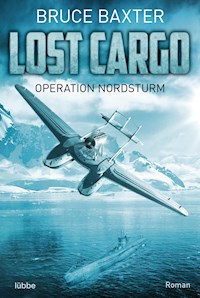
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sardinien, 1937: Ein Sonderauftrag führt Jack Kelley und Otto Keller von der Lost Cargo Company nach Monte Carlo, wo sie eine Kiste unbekannten Inhalts an Bord nehmen sollen. Doch sie sind nicht die Einzigen, die hinter der Fracht her sind. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt, das Jack und Otto von Spanien über England bis nach Norwegen führt, auf der Spur einer sagenumwobenen Kraftquelle und verfolgt von der deutschen Legion Condor, dem britischen Geheimdienst - und einer atemberaubend schönen Frau, die ein uraltes Geheimnis hütet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumPROLOG12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849EPILOGSavoia-Marchetti S 55Über dieses Buch
Sardinien, 1937: Ein Sonderauftrag führt Jack Kelley und Otto Keller von der Lost Cargo Company nach Monte Carlo, wo sie eine Kiste unbekannten Inhalts an Bord nehmen sollen. Doch sie sind nicht die Einzigen, die hinter der Fracht her sind. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt, das Jack und Otto von Spanien über England bis nach Norwegen führt, auf der Spur einer sagenumwobenen Kraftquelle und verfolgt von der deutschen Legion Condor, dem britischen Geheimdienst – und einer atemberaubend schönen Frau, die ein uraltes Geheimnis hütet.
Über den Autor
Bruce Baxter hat sich schon immer für Fliegergeschichten begeistert. Er liebt das Streamline-Design der 1930er Jahre, und die TV-Wiederholungen der alten Abenteuerserials hat er in seiner Kindheit mit den Augen verschlungen. Aus all diesen Einflüssen sind seine Romane um die Lost-Cargo-Company entstanden. »Ich liebe die alten Cliffhanger«, sagt er. »Action und historische Rätsel mit einer guten Prise INDIANA JONES – genau wie in meinen Büchern.«
BRUCE BAXTER
LOST CARGO
OPERATION NORDSTURM
Roman
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Vollständige Taschenbuchausgabe
Copyright © 2021 by Bruce Baxter
Originalausgabe 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Stefan Bauer
Risszeichnung: Daniel Ernle, dec3 GmbH & Co., Berkheim
Titelillustration: © Arndt Drechsler, Leipzig
Umschlaggestaltung: Thomas Krämer
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0347-5
luebbe.de
lesejury.de
PROLOG
NordmeerAnno Domini 1387
Die Planken der Kogge ächzten, und ihr breiter Rumpf schien zu erbeben, als sie über den Wellenkamm kippte und in die nächste dunkle Kluft stürzte, die sich unter dem Kiel auftat.
Detward von Hoya harrte vorn am Bug aus, die kräftigen Arme um den senkrecht aufragenden Spriet geschlungen und Wind und Wetter trotzend. Die weiße Gischt, die immer dann emporspritzte, wenn das Schiff den Grund des Wellentals erreichte, hatte seinen vollen, silbergrauen Bart durchnässt und seine wollenen Kleider bis auf die Haut durchdrungen.
Doch Detward spürte weder Nässe noch Kälte, noch empfand er Furcht. So hoch die Wellen sich auch auftürmen mochten, sein Blick blieb fest auf den Horizont gerichtet, so als könnte er in der Dämmerung zwischen Nacht und Tag etwas sehen, das kein anderer vor ihm erblickt hatte …
»Herr!«, versuchte eine Stimme gegen das Tosen der See und das Heulen des Windes anzukämpfen. Sie gehörte einem dürren Mann mit tief liegenden Augen, dessen Kleider nicht weniger durchnässt waren als die des Kaufmannes. Doch in seinen ausgemergelten Zügen stand blanke Furcht zu lesen. »So nehmt doch Vernunft an, ich bitte Euch …«
»Ich bin vernünftig, Kapitän«, versicherte Detward. Anders als der schmächtige Befehlshaber des Schiffes war er ein vierschrötiger Mann, dessen breiter Wanst von Annehmlichkeit und Wohlstand zeugte – Wohlstand, den er auf dieser Reise noch unendlich zu mehren gedachte. »So vernünftig, wie ich es nur sein kann«, versicherte er.
»Aber die Weisung der Hanse lautet …«
»Die Hanse hat hier nichts zu befehlen«, fiel Detward dem Kapitän barsch ins Wort. »Dieses Schiff mag unter dem Bremer Banner segeln, aber ich habe dafür bezahlt – und ich allein bestimme, wohin die Reise geht.«
»Aber das ist Wahnsinn!« Der Kapitän deutete am Mastbaum empor. Das Rahsegel war eingeholt worden, wie ein stummes Mahnmal ragte der Mast jetzt auf, den Winden schutzlos ausgeliefert. »Lange hält das Schiff das nicht mehr aus! Die Mannschaft ist kurz davor zu meutern!«
»Dann bringt die Männer dazu, ihre Pflicht zu tun, Kapitän«, beschied Detward ihm kaltschnäuzig. »Der Kurs wird beibehalten!«
»Aber …«
»Kurs beibehalten!«, schrie der Kaufmann gegen den Wind, dass seine Stimme sich überschlug. Damit verließ er seinen Platz am Bug und hangelte sich am Sicherungstau entlang nach Achtern, wo sich das hölzerne Kastell erhob und eine Luke unter Deck und in sein Quartier führte. Es war wenig mehr als ein fensterloser Verschlag, doch es war die geräumigste Kammer an Bord und gewöhnlich dem Kapitän vorbehalten. Es sei denn, der Eigner selbst war auf Reisen.
Detward bückte sich unter dem niederen Sturz hindurch und verriegelte die Tür hinter sich. »Meuterei«, maulte er dabei in seinen nassen, salzstarrenden Bart. »Das könnte diesen faulen Hunden so passen.«
»Die Männer fürchten sich?«
Detward wandte sich um. Im Schein der Laterne, die unterhalb der Decke hing und ob des Seegangs hin und her schaukelte, saß eine junge Frau auf einem der grob gezimmerten Stühle. Sie war eine Schönheit, allerdings nicht auf die aufreizende, marktschreierische Weise wie die Dirnen im Bremer Hafen. Eher auf eine ruhige, überlegene Art, die Detward stets in Unruhe versetzte. Ihr Haar war so schwarz wie die nächtliche See und umrahmte ihre wie immer ein wenig entrückt wirkenden Züge. Ihr weites Gewand aus grauem Stoff hatte infolge der Reise gelitten.
Als Detward sie an Bord gebracht hatte, war sie gefesselt gewesen, doch er hatte schon bald auf diese Maßnahme verzichtet – wohin sollte sie auch fliehen?
»Diese Feiglinge würden am liebsten umkehren«, knurrte er. »Sie wissen ja nicht, was ich weiß.«
»Ihr wisst nichts, Herr«, sagte die junge Frau leise.
»Ich weiß genug«, widersprach er. Über die schwankenden Planken trat er an die Seemannskiste, die an der Rückseite der Kammer stand. Er nahm den Schlüssel, den er an einer Lederschnur um den Hals hängen hatte, öffnete die Truhe und holte eine kleine hölzerne Schatulle hervor, der er einen filigranen Gegenstand entnahm.
Es war ein Pfeil aus einem schimmernden Metall, der an einer kurzen Kette aus Silber befestigt war. Detward hielt sie mit Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand und ließ den Pfeil frei daran hängen. Schon nach kurzer Zeit hatte er sich eingependelt und deutete bugwärts.
»Welchen Weg zeigst du mir?«, murmelte der Kaufmann dabei und leckte sich die salzigen Lippen in kaum verhohlener Gier. »Er führt nicht nach Norden …«
»Nein«, sagte die Frau. »Der Pfeil hat seinen eigenen Willen. Seine eigene Bestimmung.«
»Und er wird mich ans Ziel bringen«, flüsterte Detward. Seine Augen glänzten im unsteten Licht der Laterne. »Das ist meine Bestimmung.«
»Nein«, sagte sie nur.
Detward wandte seinen Blick von dem Kleinod und sah sie an. »Was soll das heißen?«
Die Frau sah ihn gleichmütig an. »Wie jeder Kompass kann auch dieser nur die Richtung zeigen, nicht mehr und nicht weniger – Eure Bestimmung jedoch müsst Ihr selbst finden, Herr. Wollt Ihr wissen, was Eure Bestimmung ist? Was die Zukunft Euch bringen wird?«
»Reichtum und Ruhm wird sie mir bringen«, meinte Detward überzeugt. »Die Stadtherren werden sich mir beugen müssen – und am Ende gar die mächtige Hanse!«
»Nein, Herr«, sagte sie nur und schüttelte ruhig das Haupt. »Eure Männer haben recht, wenn sie sich fürchten, denn dieses Schiff wird seinen Bestimmungsort niemals erreichen.«
Sie sagte es mit derartiger Endgültigkeit, dass Detward schauderte. »Schweig, Weib!«, zischte er dennoch. »Ich will nichts davon hören!«
»Nein? Warum habt Ihr mich dann hierhergebracht, wenn Ihr meine Worte nicht hören wollt?«
»Schweig«, verlangte er noch einmal. »Ich bin nicht hier, um mir dein Gewäsch anzuhören!«
»Das ist wahr«, bestätigte sie. Der Blick ihrer dunklen, beinahe schwarzen Augen intensivierte sich und wurde stechend. »Ihr seid hier, um zu sterben.«
In diesem Moment wurde das Schiff von etwas getroffen.
Detward vermochte nicht zu sagen, was es gewesen war, aber die Erschütterung war deutlich zu spüren. Gleichzeitig erklang aufgeregtes, beinahe panisches Geschrei an Deck.
»Diese elenden Feiglinge«, stieß Detward zwischen gefletschten Zähnen hervor. Rasch legte er den Kompass in das Kästchen zurück und verstaute beides in der Truhe. Dann verließ er die Kapitänskajüte wieder und stieg über die schwankende Leiter zurück auf Deck.
Das Erste, was ihm dort begegnete, war die furchtverzerrte Miene des Kapitäns. Todesangst sprach aus seinen weit aufgerissenen Augen. »Ich habe es Euch gesagt!«, brüllte er gegen Wind und Wellen an, dass seine dünne Stimme sich überschlug. »Wir sind zu weit gefahren! Zu weit nach Norden, dem Rand der Welt entgegen!«
»Unfug!« Detward stieß ihn zur Seite und wankte nach Backbord, wo sich die Matrosen entlang der Reling reihten und in die See starrten, vor Entsetzen wie versteinert.
Der Kaufmann packte zwei von ihnen und riss sie zurück, um für sich selbst Platz zu schaffen, dann starrte er hinaus in die noch fast schwarze See, die sich unablässig zu schäumenden Bergen türmte, um schon im nächsten Moment wieder in ungeahnte Tiefen zu stürzen.
Und aus dieser Tiefe brach im nächsten Moment das blanke Grauen hervor.
1
Argentiera, Sardinien23. August 1937
Als Jack erwachte, brummte sein Schädel, als würde ein schwerer Pratt & Whitney darin auf niederen Touren laufen.
Verdammter Tequila!
Er blinzelte, Sonnenlicht blendete ihn. Es musste bereits Tag sein, vermutlich schon spät. Im gleißenden Gegenlicht sah er eine schlanke Gestalt am Fenster stehen, mit nichts als ihrer Schönheit bekleidet.
»Casey?«, stieß er halbwach hervor.
»No«, kam es mit italienischem Akzent zurück. Die Schöne drehte sich zu ihm um und strich ihre schwarze Mähne zurück. »Wir hatten uns auf Allegra geeinigt – aber wenn du willst, bin ich auch gerne Casey für dich, mio caro.«
Jack schüttelte den dröhnenden Kopf.
Ein anderes Mädchen.
Eine andere Zeit …
Er zwang sich dazu, vollends zu erwachen. Ächzend richtete er sich im Bett halb auf und tastete nach der Zigarettenpackung auf dem Nachtkästchen. Er schüttelte eine heraus, schob sie sich in den Mund und steckte sie an. Er rauchte in ruhigen Zügen, während er zusah, wie Allegra sich ankleidete.
An besonders viel konnte er sich nicht mehr erinnern, was die vergangene Nacht betraf, aber an ihre perfekten Rundungen ganz bestimmt. Sie gehörten zu den wenigen erfreulichen Seiten, die Argentiera zu bieten hatte.
Die Ortschaft existierte eigentlich nur wegen des Silbers, das an der Westküste Sardiniens abgebaut wurde. Den Kern der Siedlung, die sich in einer hufeisenförmigen Bucht erstreckte, bildete dementsprechend die Förderanlage, die sich an eine zerklüftete Felswand schmiegte. Rings herum waren weitere Gebäude wie Pilze aus dem Boden geschossen – Verwaltungsbaracken und Unterkünfte, aber auch eine Reihe von Läden, Lokalen und Bordellen, in denen die Minenarbeiter ihr sauer verdientes Geld verjubeln konnten. Und natürlich das schäbige Hotel, in dem Jack und Otto wohnten, seit sie wieder in Europa weilten.
Eine Zeitlang hatten sie sich nach ihrem Abenteuer in Amazonien* noch in den Staaten herumgetrieben, auf den Florida Keys und in der Gegend um Atlantic City, wo sie aus den guten alten Tagen der Prohibition noch einige Verbindungen hatten. Als die Vergangenheit sie jedoch in Gestalt eines etwas übereifrigen FBI-Beamten wieder einzuholen drohte, waren sie mit ihrer S 55 über die Nordroute zurückgekehrt, auch wenn das bedeutet hatte, dass sie sich mit ihrem alten Freund Emile Rochas auseinandersetzen mussten, dem sie noch immer Geld schuldeten. Und so waren sie hier gelandet, in diesem Kaff am Arsch der Welt, um im Auftrag eines französischen Gangsters Waffen für den spanischen Bürgerkrieg zu schmuggeln. Und dabei wussten sie noch nicht einmal, ob das Zeug für die Republik oder für die Putschisten bestimmt war. Es hätte Rochas ähnlich gesehen, beide Parteien zu beliefern und so doppelt Geschäfte zu machen.
Allegra hatte ihr Werk vollendet. Ihre schwarze Mähne hatte sie mit einer Schleife gebändigt, ihr rotes Kleid setzte ihren aufregenden Körper perfekt in Szene. »Kann ich noch etwas für dich tun, amore mio?«, fragte sie lächelnd.
Jack grinste. »Ich bin versucht, sofort Ja zu sagen. Aber da unten am Kai steht ein Deutscher und wartet auf mich. Und du weißt ja, wie die sind.«
»Si.« Sie nickte. »Sempre puntale.«
Sie warf ihm noch einen Handkuss zu, dann huschte sie zur Tür des Hotelzimmers hinaus – nur um beinahe mit dem Mann zusammenzustoßen, der auf der Schwelle stand.
Er war hager, groß und kahlköpfig, und in seinem Gesicht wucherte unter einer riesigen Habichtsnase ein gewaltiger Schnurrbart mit kunstvoll gezwirbelten Enden. Zu seinen sandfarbenen Drillichhosen trug er ein gestreiftes Hemd, dessen Ärmel er aufgekrempelt hatte. In seinem Mundwinkel hing eine Pfeife. Allegra huschte an ihm vorbei und verschwand.
»Wenn man vom Deutschen spricht«, meinte Jack.
»Ich hab das gehört«, stellte Otto klar.
»Und?«
»Stimmt absolut.« Er grinste. »Und deshalb weiß ich, dass du zu spät dran bist. Wir werden bereits am Pier erwartet.«
»Verdammt.« Jack kniff die Augen zusammen und schüttelte den Kopf, doch der Kater ließ sich auch damit nicht vertreiben. Trotzdem schlug er die Decke zurück und schwang die Beine aus dem Bett. Das war schon mal ein Anfang.
»Schwere Nacht gehabt?« Otto paffte kleine Wölkchen.
»Ging so.«
»Was immer die Kleine mit dir angestellt hat, ich hoffe, du hast es genossen. Könnte nämlich für eine Weile das letzte Mal gewesen sein.«
Jack schaute auf. »Wieso? Was meinst du?«
Otto nahm die Pfeife heraus und deutete mit dem Mundstück zum Fenster. »Wirf mal einen Blick nach draußen, Skipper.«
Jack stöhnte und fuhr sich durch das schwarze Haar. Jedes einzelne davon konnte er auf seinem Schädel spüren. Schließlich tat er seinem Geschäftspartner den Gefallen und erhob sich endgültig aus den Federn. Nackt wie er war, die Zigarette im Mundwinkel, durchquerte er das spärlich möblierte Zimmer, trat ans Fenster und schaute hinaus.
Unterhalb des Hotels, das den schönen Namen Bella Ventura trug, erstreckten sich die Baracken der Arbeiter den Hang hinab bis zur Bucht. Das Meer glitzerte tiefblau im Licht der Vormittagssonne, aber Jack hatte keine Augen für die Schönheit der Natur. Denn unten am Kai, wo neben ein paar heruntergekommenen Fischkuttern auch die Savoia-Marchetti im Wasser dümpelte, hatte eine Jacht festgemacht: schneeweißer Rumpf, zwei Masten, das Deck aus Teak, die Aufbauten aus Mahagoni. Und auf den Planken standen ein paar Figuren, die Jack ganz und gar nicht gefielen.
Es waren wahre Kleiderschränke, die in ihren schwarzen Anzügen und mit den Borsalinos auf den Köpfen so aussahen, als wären sie einem Gangsterfilm entsprungen. Zwei von ihnen hatten Thompson-Maschinenpistolen mit Trommelmagazinen in der Armbeuge und schienen auch zu wissen, wie man damit umging. Jack war klar, dass das nur eins bedeuten konnte.
»Scheiße«, sagte er.
*siehe LOST CARGO – TEMPELJÄGER
2
Monte Carlo, Fürstentum MonacoZur selben Zeit
Peter Henderson hatte die Augen geschlossen und atmete tief ein und aus. Er konnte das Salz des Meeres riechen, hörte, wie die Wellen gegen die Klippen schlugen, und spürte die warme Sonne auf seiner blassen englischen Haut.
Es war schön, wunderschön … und doch wäre er gerne an einem anderen Ort gewesen, weit weg von hier.
Henderson zwang sich, die Augen wieder zu öffnen. Er stand auf einem der von schmiedeeisernen Geländern umgebenen Balkone im obersten Stockwerk des Hôtel Hermitage. Das Panorama, das sich vor ihm ausbreitete, war im wahrsten Wortsinn atemberaubend: Zur Linken lag das ehrwürdige Casino, in dem die Roulettes sich unaufhörlich drehten; von Palmen umgeben thronte es einem Palast gleich über den Klippen und der azurblauen See, der unbestreitbare Grund dafür, dass sich Adelige, Politiker, Geschäftsleute und Bonvivants aus der ganzen Welt an diesem Ort ein Stelldichein gaben. Das Gewirr der Straßen und Plätze, das sich unterhalb davon erstreckte, wurde von hohen Häusern beherrscht, deren verspielte, pastellfarbene Fassaden aus der Zeit gefallen wirkten, die letzten Überreste einer anderen, weniger komplizierten Ära; jenseits davon das Hafenbecken mit all den stolzen Jachten und Schonern, die dort festgemacht hatten. Auf der anderen Seite schließlich, geschützt vom Tête de Chien, der sich riesenhaft und schützend über der Bucht erhob, das Fort Antoine und der Palast der Fürsten, die es in all den Jahrhunderten geschafft hatten, die Eigenständigkeit ihres kleinen Reiches zu bewahren.
Es war ein seltsamer Ort, der Zeit und der Welt scheinbar entrückt. Wer sich hier aufhielt, konnte leicht vergessen, dass nur rund dreihundert Meilen entfernt ein blutiger Bürgerkrieg tobte; dass sich andernorts dunkle Wolken über Europa zusammenballten und die Welt auf einen weiteren verheerenden Konflikt zusteuerte, nachdem doch der letzte alle Kriege hatte beenden sollen.
Vielleicht, dachte Henderson, lag es an der Natur des Menschen, dass er gerade in solchen Zeiten nach Zerstreuung verlangte.
Nervös sog er an der Zigarette, die er zwischen den Fingern hielt, und genoss die Aussicht noch etwas länger. Es war eine Illusion, das wusste er, nichts als schöner Schein. Aber er wollte daran festhalten, solange es möglich war.
Zwei schwere Renault-Limousinen wälzten sich die Serpentinen der Uferstraße herauf – neue Gäste für das Casino. Bereits seit achtzig Jahren drehte sich das Roulette in dieser Stadt und hatte auch zu Kriegszeiten niemals stillgestanden. Fortuna hatte sich als wahrhaft neutral erwiesen, und den Betreibern des Casinos war es schon immer herzlich gleichgültig gewesen, wer sein Geld an ihre Spieltische trug.
So wie in diesen Tagen …
Henderson sah zum blauen Himmel. Eine Maschine flog von Nordwesten ein. An der Art, wie sich das Sonnenlicht auf ihrer Aluminiumhülle brach, hätte Henderson schwören können, dass es sich um eine deutsche Junkers handelte.
Ob es die Maschine war?
Henderson wusste es nicht mit Bestimmtheit, aber es spielte auch keine Rolle. Das Treffen würde stattfinden, der Termin war festgesetzt. Nur noch ein Wunder konnte sie vor dem bewahren, was nun folgen würde.
Oder eine verzweifelte Maßnahme …
Henderson tat noch einen Zug, den Rest der Zigarette schnippte er in die Tiefe. Mit einem letzten sehnsüchtigen Blick auf die Bucht und den trügerischen Frieden wandte er sich ab, schlug den Vorhang beiseite und ging ins Zimmer zurück. Blütenduft schlug ihm entgegen und der Geruch von poliertem Holz. Die Einrichtung war in Weiß gehalten, die Wände mit lackiertem Holz getäfelt, Stuck an der Decke. Ein Ventilator sorgte für angenehm frische Luft.
»Sie werden bald da sein«, sagte Henderson.
Die Frau, die an der Frisierkommode saß und ihr kurzes blondes Haar kämmte, hielt für einen Moment inne. Der Blick ihrer katzenhaft grünen Augen war heiter, beinahe amüsiert.
»Du machst dir immer noch Sorgen?«, fragte sie.
»Mehr denn je. Und du solltest ebenfalls besorgt sein.« Er trat zu ihr und legte die Hände auf ihre schmalen Schultern. Sie trug nur das Untergewand, ihre reifen Formen zeichneten sich durch den dünnen beigefarbenen Seidenstoff deutlich ab.
»Du hättest diesem Treffen niemals zustimmen dürfen, Larna. Nicht unter diesen Voraussetzungen.«
»Das klingt, als hätte ich die Wahl gehabt.« Sie legte die Bürste beiseite und wandte sich zu ihm um. Und wie immer, wenn sie ihn direkt ansah, konnte er nicht anders, als sich einzugestehen, wie wunderschön sie war. »Du weißt, dass es nicht so gewesen ist.«
»Trotzdem, London war ein Fehler. Nun sieh, wohin es uns gebracht hat.«
»Wie ich schon sagte, Peter – ich hatte keine andere Wahl. Wenn wir herausfinden wollen, was die andere Seite weiß, dann ist dies der einzige Weg.«
»Es ist ein Risiko«, beharrte er.
»Das habe ich nie bestritten.« Sie lächelte. Ein offenes, entwaffnendes Lächeln, dem er schon oft nachgegeben hatte. Aber nicht dieses Mal …
»Du darfst ihnen nichts verraten, hörst du?«
»Ein wenig werde ich preisgeben müssen«, widersprach sie. »Wie sollen wir sonst an die Informationen kommen, die wir brauchen? Und wir müssen nun einmal herausfinden, ob die Deutschen das Logbuch haben.«
»Du spielst mit dem Feuer, Larna.«
»Ich weiß.« Sie lächelte wieder. »Aber ist es nicht das gewesen, was dir stets an mir gefallen hat?«
Ihr auffordernder Blick und ihre halb geöffneten Lippen, durch die ihre schneeweißen Zähne blitzten, kamen einer Einladung gleich, und er beugte sich zu ihr hinab und küsste sie. Er spürte ihren warmen Atem, roch den Duft ihres Haars und sagte sich, dass das alles ihm gehörte, ganz gleich, was kommen mochte. Der Gedanke beruhigte ihn, wenn auch nicht sehr. Zu viel stand auf dem Spiel.
»Ich werde zum Flugplatz gehen und dort warten«, kündigte er an, nachdem sie sich wieder voneinander gelöst hatten. »Ich lasse dich benachrichtigen, sobald sie eingetroffen sind.«
»Das könntest du tun«, räumte Larna ein. Sie strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und ließ wie zufällig einen der Träger ihres Hemdes herabgleiten. Makellos weiße Haut kam darunter zum Vorschein, der Ansatz ihrer Brüste. »Du könntest aber auch noch ein wenig bleiben«, fügte sie hinzu.
Er konnte nicht widerstehen.
Abermals beugte er sich zu ihr hinab, und ihre Arme schlangen sich um seinen Hals und zogen ihn an sich, als wollten sie ihn niemals wieder loslassen.
Henderson war kein Idiot.
Er wusste nur zu gut, welchem Zweck dieses Manöver diente, und oft genug schon hatte sie ihn damit weichgekocht.
Aber nicht dieses Mal.
Sein Entschluss stand fest.
3
In aller Eile hatte sich Jack angezogen.
Nicht, dass er sich jetzt viel wohler fühlte – sein Schädel dröhnte immer noch, und sein leerer Magen rebellierte. Aber immerhin sah er jetzt in seinen beigen Fliegerhosen und mit der ledernen Schott A2 über dem zerknitterten Hemd halbwegs wie ein Mensch aus.
Zusammen mit Otto ging Jack den Pier hinab. Die Sonne war hell und stechend und nur durch die getönten Gläser der Sonnenbrille zu ertragen. Auch wenn es angesichts des unerwarteten Besuches vermutlich mehr als angemessen gewesen wäre – den Colt Army 1911 hatte Jack vorsorglich im Hotelzimmer gelassen. Er wollte nicht, dass die Sache außer Kontrolle geriet. Zumal die Kleiderschränke auf der Jacht die sehr viel überzeugendere Artillerie hatten.
Mit zu Schlitzen verengten Augen sahen die Kerle ihnen entgegen. Ehemalige französische Fremdenlegionäre, die nun im privaten Auftrag arbeiteten und denen es auf ein Menschenleben mehr oder weniger nicht ankam. In Bizerte hatten Jack und Otto bereits das Vergnügen mit den Gentlemen gehabt …
»Ahoi«, rief Jack ihnen zu, um gute Laune bemüht. »Ist es gestattet, an Bord zu kommen?«
Einer der Ballermänner, dem Akzent nach ein Belgier, rief sie zu sich herüber. Jack warf Otto einen vielsagenden Blick zu, dann passierten sie die schmale Planke und gingen an Bord. Sie hatten das Deck kaum betreten, als ein vierschrötiger Kerl daherkam, mit einem Kinn wie ein Kassenschrank, und sie nach Waffen durchsuchte.
»Jungs«, meinte Jack gedehnt, »wir hatten schon das Vergnügen mit eurem Boss. Glaubt ihr wirklich, wir wären so dämlich, eine Knarre mitzunehmen?«
Die Gorillas verrieten nicht, wie dämlich sie Jack und Otto fanden. Während die einen sie in Schach hielten, machte der andere seine Arbeit.
»Sie sind sauber«, erklärte er schließlich gleichmütig.
»Natürlich sind wir das.« Jack grinste breit. »Wir sind doch unter Freunden, oder etwa nicht?«
»Bien sûr«, sagte eine nur zu vertraute Stimme – und aus dem Niedergang, der unter Deck und in den Salon des Schiffes führte, wälzten sich ungeheure Körpermassen, die von einem dunkelgrünen Samtbademantel und dem dazugehörigen Gürtel nur mühsam in Zaum gehalten wurden.
Der Kopf, der ohne Hals darauf zu sitzen schien, war ebenso rund wie der Körper selbst; kleine schwarze Augen stachen daraus hervor, so heiter und verzeihend wie die eines Raubfisches. Auf seinem spärlich behaarten Haupt saß der unvermeidliche Fes, der sein Markenzeichen war.
Dies war Emile Rochas.
In Nordafrika und im südlichen Mittelmeerraum besser bekannt als l’araignée – die Spinne.
»Emile.« Jack setzte ein entwaffnendes Lächeln auf – auch wenn ihm eher nach Kotzen war. »Welch unerwartetes Vergnügen an diesem entlegenen Plätzchen!«
»Es ist ein Rattenloch«, meinte Rochas mit despektierlichem Blick zum Ufer, wo die aus Stein, Wellblech und morschem Holz errichteten Baracken den Hang hinaufwucherten. »Ist es schon immer gewesen. Anständige Leute kommen nicht hierher, das macht es zu einem idealen Versteck.«
»Schön, dass es Ihnen gefällt.« Jack nickte. »Ist es auch erlaubt zu fragen, welchem günstigen Wind wir diesen Besuch zu verdanken haben?«
»Jack, mein Junge.« Rochas hatte seine Massen vollständig auf Deck gezwängt. Mit einem Seufzen ließ er sich auf dem riesigen, orientalisch gemusterten Diwan nieder, der dort eigens für ihn errichtet worden war. »Was bringt dich auf den Gedanken, dass ich nicht rein zufällig hier gelandet bin?«, fragte er mit jenem starken französischen Akzent, den er sorgfältig kultivierte. »Ich verbringe die Sommermonate gerne auf dem Wasser, wie du weißt.«
»Klar«, knurrte Otto halblaut und vorsorglich auf Deutsch, »du bist ja auch ein skrupelloser Halsabschneider, der mit dem Elend anderer Leute ein Vermögen verdient.«
»Ruhig, Oz, sonst haben wir hier sehr schnell ausgezaubert«, raunte Jack ihm mit Blick auf die schussbereiten Thompsons zu. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein vielbeschäftigter Mann wie Sie etwas dem Zufall überlässt«, sagte er dann laut und an Rochas gewandt.
»Da hast du recht.« Rochas schnipste mit der goldberingten Rechten, worauf ein mit Pluderhosen bekleideter Diener auftrat und ihm Eiswasser brachte. Rochas trank einige Schlucke, Schweiß glänzte dabei auf seiner breiten Stirn. »Setzt euch, meine Freunde«, forderte er Jack und Otto dann auf.
Die beiden tauschten Blicke.
Ein Gangster vom Schlag eines Emile Rochas war schon übel genug, wenn er sein wahres Gesicht zeigte. Diese zur Schau gestellte Freundlichkeit jedoch war geradezu furchterregend. Irgendetwas führte er im Schilde, das stand fest.
Jack und Otto kamen der Aufforderung nach und setzten sich auf die beiden Decksstühle, die dem Diwan gegenüber aufgestellt waren. Rochas’ Schießmänner ließen sie dabei keinen Moment aus den Augen.
»Eine kleine Erfrischung?«, fragte Rochas.
»Nein, danke.« Jack schüttelte den Kopf.
»Warum so misstrauisch? Ihr müsst wissen«, eröffnete Rochas ihnen mit einer Miene, die so feierlich war wie falsch, »ich bin sehr zufrieden mit euch. Zugegeben, nach dieser Sache in Gibraltar** war ich ziemlich enttäuscht, und es hätte nicht viel gefehlt, und ich hätte euch Betonschuhe verpassen lassen und euch auf den Meeresgrund geschickt. Aber es hat sich wieder einmal gezeigt, dass Nachsicht und Milde reifere Früchte tragen als rohe Gewalt.«
»Hört, hört«, brummte Otto.
»Zugegeben, zuerst hatte ich den Verdacht, dass ihr abhauen und mich um die zehntausend Dollar prellen wolltet, die ihr mir noch schuldet. Aber als die Ehrenmänner, die ihr beide nun einmal seid, seid ihr zu mir zurückgekehrt und arbeitet nun schon … wie lange für mich?«
»Etwas über sechs Monate«, erwiderte Jack. Dass Otto und er tatsächlich vorgehabt hatten, sich abzusetzen und nur aus dem einen Grund nach Nordafrika zurückgekehrt waren, weil die Notwendigkeit sie dazu gezwungen hatte, überging er geflissentlich.
»Wie die Zeit vergeht.« Rochas grinste versonnen, Goldzähne blitzten. »Und anders als damals in Gibraltar habt ihr in all den Monaten gute Arbeit geliefert. Von den zehntausend Dollar Schulden sind gerade mal noch achttausend übrig.«
»Siebentausendzweihundert«, verbesserte Jack. »Wir wollen korrekt bleiben.«
»Natürlich.« Rochas nickte. »Wie würde es euch gefallen, eure Schulden auf einen Schlag zu halbieren?«
Wieder tauschten Jack und Otto Blicke. Wenn ein Schlitzohr vom Schlage eines Emile Rochas von sich aus ein solches Angebot machte, war Vorsicht geboten …
»Worum geht es?«, wollte Otto wissen.
»Oh, dieses deutsche Misstrauen!« Rochas rieb sich die dicken Hände. »Wie habe ich das vermisst!«
»Ist eine berechtigte Frage«, wandte Jack ein.
»Natürlich, und ihr sollt sie selbstverständlich beantwortet bekommen. Ich habe einen neuen Auftrag für euch, ein Flug von Monte Carlo nach Lissabon.«
»Welche Fracht?«
Rochas grinste. »Gehört es nicht zum Berufsethos der Lost Cargo Company, keine Fragen zu stellen?«
Jack schnitt eine Grimasse. Er mochte es nicht, wenn seine eigenen Worte gegen ihn verwendet wurden. Otto würde ihm das wieder ewig vorhalten …
»Es ist nur eine Kiste, die ihr fliegen sollt. Das ist alles.«
»Warum gerade wir?«
»Aus drei Gründen – erstens seid ihr in der Nähe und verfügbar, soweit ich das sagen kann. Zweitens habt ihr Erfahrung mit den Spaniern und kennt die Routen, die derzeit am sichersten sind. Und drittens …«
»… stehen wir bei Ihnen noch ordentlich in der Kreide«, vervollständigte Otto.
»Genauso ist es.« Rochas entblößte sein Gebiss noch weiter.
Jack überlegte fieberhaft.
Er versuchte gar nicht erst, dahinterzukommen, worum es sich bei der geheimnisvollen Fracht handeln mochte. Waffen, Gold, Diamanten – es gab kaum ein krummes Geschäft, bei dem Rochas seine kurzen Finger nicht irgendwie im Spiel hatte. Eines stand allerdings fest: Wenn er von sich aus bereit war, dafür dreitausendsechshundert Dollar springen zu lassen, musste für ihn noch sehr viel mehr bei dem Handel drin sein. Oder er stand aus irgendeinem anderen Grund unter Druck, das Geschäft möglichst zügig abzuschließen. Beide Fälle boten eine gute Grundlage, um noch ein wenig zu verhandeln …
»Wir wollen fünftausend«, erklärte Jack rundheraus.
Otto, der auf dem Mundstück seiner Pfeife herumgekaut hatte, verschluckte sich beinahe daran.
Rochas lachte nur.
»Jack, mon ami … du weißt, dass ich dich mag. Du bist ein guter Schmuggler, und ich bin bereit, dir dafür manches zu verzeihen. Aber du solltest es nicht übertreiben, hörst du?«
Aus dem Augenwinkel konnte Jack erkennen, wie die Gorillas ihre Thompsons hoben. Vermutlich hätte keiner dieser Kerle ein Problem damit gehabt, jemanden am hellen Vormittag auf offenem Deck zu erschießen und an die Haie zu verfüttern, von denen es in der Bucht nur so wimmelte. Der Abfälle wegen, die täglich von der Minenkolonie ins Meer gekippt wurden …
»Viertausendfünfhundert«, sagte Jack.
Rochas lachte nur noch lauter und klopfte sich auf die fetten Schenkel. Die Sache schien ihm tatsächlich Vergnügen zu bereiten – wie wenn eine Katze mit der Maus noch ein bisschen spielte, ehe sie sie fraß.
»Okay, okay.« In einer Verständnis heuchelnden Geste hob Jack die Hände. »Viertausend. Aber das ist mein letztes Wort.«
Rochas hörte jäh zu lachen auf.
Sein Mund blieb offen stehen. Seine Raubfischaugen musterten die beiden Männer, die ihm auf Deck gegenübersaßen. Die Zeit schien plötzlich stillzustehen.
»Oh, Scheiße«, knurrte Otto auf Deutsch.
»Na ja«, meinte Jack, »vielleicht ist es doch noch nicht …«
»D’accord«, erklärte Rochas unerwartet. »Ich bin einverstanden.«
»Wirklich?«
»Natürlich«, versicherte der Franzose und klatschte in die Hände. »Das wollen wir begießen, Champagner für alle«, befahl er dem Diener mit den Pluderhosen. »Oder bevorzugen die Gentlemen ein anderes Getränk?«
»Ein Bier wär mir lieber«, knurrte Otto und verzog das Gesicht. »Vielleicht ist es ja mein letztes auf dieser Welt.«
»Aber, wer wird denn so pessimistisch sein?«, fragte Rochas freudestrahlend. »Es ist nur ein Auftrag wie unzählige andere, die ihr beide schon erledigt habt – nur, dass ihr diesmal viertausend Dollar damit verdienen werdet. Auf euer Wohl, mes amis«, sagte er und stieß das mit prickelndem Schaumwein gefüllte Glas hoch in die Luft.
»Cheers«, erwiderte Jack und hob ebenfalls sein Glas.
Aber etwas in Emile Rochas’ tief liegenden, wie kleine Kohle glimmenden Augen sagte ihm, dass etwas an der Sache faul war. Und dass es nicht so einfach werden würde.
**siehe LOST CARGO – TEMPELJÄGER
4
Flugfeld nahe Les Salines, MonacoZwei Stunden später
Die Junkers hatte aufgesetzt.
Es war nicht die Maschine gewesen, die Henderson vom Hotelbalkon aus beobachtet hatte, aber ein Flugzeug desselben Typs. Die Drillingsmotoren der Ju 52 röhrten, als das Flugzeug langsam zum Auslauf kam. Die aus gewelltem Aluminium bestehende Hülle gleißte in der Mittagssonne, auf dem Leitwerk ließ das schwarz-weiß-rote Emblem mit dem Hakenkreuz keinen Zweifel daran, woher die Maschine kam.
Endlich kam sie zum Stillstand.
Das Luk an der Seite wurde geöffnet und eine Ausstiegshilfe herangefahren. Der Erste, der sich zeigte, war ein junger Fähnrich in der Uniform der deutschen Luftwaffe.
Dann stieg der Mann aus, dessentwegen Peter Henderson seit mehr als einer Stunde am Rand des Rollfelds wartete – und der der Grund für das satte Dutzend Zigarettenstummel war, das zu seinen Füßen verstreut auf dem Boden lag. Zuletzt hatten sie einander in London gesehen, vor etwas mehr als zwei Monaten, und auch nicht für lange. Doch dieses Gesicht hätte Henderson unter Tausenden wiedererkannt. Und nicht nur der Klappe aus schwarzem Stoff wegen, die über dem linken Auge lag.
Baron Eugen von Troneck war ein außergewöhnlicher Mann.
Außergewöhnlich in seiner Erscheinung, die eine hochgewachsene, sehnige Statur und ein entschlossen wirkendes Gesicht mit harten Zügen umfasste. Außergewöhnlich aber auch in seinem Auftreten, aus dem eine natürliche, beinahe angeborene Autorität sprach. Dieser Mann war von Kindesbeinen an daran gewohnt, Befehle zu erteilen. So wie er gewohnt war, dass sie ohne Widerspruch befolgt wurden.
Von Troneck kam die kleine Gangway herab.
Anders als in London, wo sie sich bei einer Veranstaltung im Adelphi Theatre begegnet waren, trug er jetzt seine Uniform: schwarze Reithosen, die in glänzenden hohen Stiefeln steckten, dazu ein hüftlanger schwarzer Rock. Insignien von Rang oder Waffengattung suchte Henderson vergeblich, das fremdartig aussehende Symbol auf den Kragenspiegeln sagte ihm nichts. Die Offiziersmütze saß korrekt auf dem Haupt, ihr Schirm beschattete die bleichen Züge, die trotz des kantigen Kinns nicht militärisch wirkten. Die milde Verständigkeit, die aus dem verbliebenen Auge sprach, ließ eher an einen Gelehrten denken. Wie Henderson inzwischen wusste, traf in von Tronecks Fall sowohl das eine als auch das andere zu.
Er trat die Zigarette aus, an der er bis zuletzt gesogen hatte, und hob die Hand, um auf sich aufmerksam zu machen. Von Troneck sah ihn und winkte zurück, und im nächsten Augenblick standen sie einander gegenüber. Der Baron überragte die schmächtige Gestalt des Engländers beinahe um einen ganzen Kopf, und angesichts der perfekt sitzenden Uniform des Deutschen kam sich Henderson in seinem weißen Sommeranzug schäbig und unpassend gekleidet vor, fühlte sich beinahe erniedrigt. Er rief sich ins Bewusstsein, dass dies vermutlich genau der Zweck war, den der Baron mit dem geschniegelten Aufzug verfolgte.
»Herr Henderson, welch eine Freude«, sagte von Troneck. Seine Stimme war angenehm, sein Akzent deutlich, aber nicht störend, der Inbegriff kühler Kultiviertheit. »Ich kann kaum glauben, dass zwei Monate vergangen sind, seit wir uns in London trafen. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen.«
»Mir ebenso«, erwiderte Henderson – und das war noch nicht einmal gelogen.
»Ist sie … ebenfalls hier?« Von Tronecks verbliebenes Auge sah sich begierig um. Henderson glaubte, eine gewisse Nervosität darin zu erkennen.
»Im Hotel«, entgegnete er ausweichend. »Sie bereitet sich auf ihren Auftritt vor.«
»Natürlich.« Der Baron grinste wie ein Pennäler, der sich in seine Lehrerin verschossen hatte. »Aber es ist mir doch gestattet, ihr vorher noch meine Aufwartung zu machen?«
»Selbstverständlich«, entgegnete Henderson mit einem Lächeln, für das er sich am liebsten selbst geohrfeigt hätte. »Sie wäre sehr enttäuscht, wenn Sie sie nicht besuchen würden, Baron.«
»Sehr gut. Ich bin ein großer Verehrer ihrer Kunst, wie Sie wissen. Und wie ich Ihnen in London schon sagte, verspreche ich mir viel von dieser Zusammenkunft.«
»Pandora hofft, dass sie Ihre hohen Erwartungen erfüllen kann«, entgegnete Henderson ausweichend. »Ihr Metier ist nicht gerade das, was man eine exakte Wissenschaft nennt …«
»Wissenschaftler haben wir in Deutschland genug, daran hat es noch nie gemangelt, Herr Henderson. Intuition ist das, wonach ich suche – das, was sich mit reiner Wissenschaft eben gerade nicht erklären lässt.«
»Nun«, meinte Henderson und straffte sich innerlich, »dann hoffe ich, wir werden Sie nicht enttäuschen.«
»Davon bin ich überzeugt«, entgegnete von Troneck – und Henderson konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass eine leise Drohung in diesen Worten mitschwang.
Es bestärkte ihn in der Entscheidung, die er für sich allein getroffen hatte. Es war notwendig, zu ihrem Schutz und zu seinem eigenen.
Und womöglich auch zu dem der gesamten menschlichen Zivilisation …
»Wenn Sie mir bitte folgen möchten, Baron von Troneck – eine Limousine steht bereit, die uns zum Hotel bringen wird.«
»Sehr gerne.« Der Deutsche nickte. »Ich bin sicher, wir werden uns ausgezeichnet verstehen.«
Hendersons Zögern währte nur einen kaum merklichen Augenblick. »Davon bin ich überzeugt«, sagte er dann.
5
Es war ein ruhiger Flug.
Glatt wie ein Brett lag das Meer unter ihnen und glänzte und glitzerte, als hätte eine übermütige Fee Sternenstaub darübergeschüttet.
»Bestes Flugwetter«, meinte Jack, der im Pilotensitz der Savoia-Marchetti hockte. Dicht über seinem Kopf wölbte sich die flache Verglasung des Cockpits, darüber geißelten die beiden mächtigen Propeller die Luft mit ihren harten, wuchtigen Schlägen.
Die S 55 war mit anderen Hydroplanen nicht zu vergleichen. Während gewöhnliche Wasserflugzeuge meist nur zwei Schwimmer anstelle eines Fahrgestells hatten und so die Landung und das Starten auf dem Wasser ermöglichten, hatten die italienischen Konstrukteure einen anderen Ansatz gewählt: Die beiden länglichen Rümpfe der Maschine beherbergten nicht nur Raum für Fracht und Passagiere, sondern bildeten zugleich die Schwimmer, auf denen sie startete und landete; nach achtern gingen sie in eine Konstruktion aus Leichtmetall über, die das Höhen- und die drei Seitenleitwerke trug und zur besseren Stabilität mit den Tragflächen verspannt war. In deren Mitte, in der Verbindung der beiden Rümpfe, befand sich das entsprechend hoch gelegene Cockpit, das über Leitern von beiden Frachträumen aus erreicht werden konnte.
Den nötigen Antrieb erhielt die S 55 von einer über dem Cockpit angebrachten Triebwerksgondel, an der zwei schwere Isotta-Fraschini-Motoren vom Typ Asso 750 ihren Dienst versahen; mit ihren zusammengenommen rund 1800 PS beförderten die beiden in Tandemmanier angebrachten Propeller die Maschine durch die Luft. Es war eine ungewöhnliche, um nicht zu sagen abenteuerliche Konstruktion, die jedoch schon kurz nach ihrer Indienststellung mehrere Rekorde in Sachen Geschwindigkeit, Höhe und Reichweite gebrochen hatte. Es war ein Triumph moderner Ingenieurskunst, der zur Ausnahme einmal nicht aus England, Frankreich, Deutschland oder den USA gekommen war – entsprechend hatten die italienischen Faschisten alles unternommen, um die S 55 zu Propagandazwecken einzusetzen. Die Transatlantik-Überquerung von gleich vierundzwanzig dieser Maschinen unter dem Kommando des italienischen Luftmarschalls Italo Balbo vor vier Jahren war nicht die einzige, aber die spektakulärste Aktion in dieser Hinsicht gewesen, entsprechend groß war der Bahnhof, den man den Italienern bei ihrer Ankunft in Chicago bereitet hatte. Und entsprechend berühmt war die S 55 dadurch über Nacht geworden.
Trotzdem hatten Jack und Otto die Savoia-Marchetti nicht ganz freiwillig gegen ihre alte Maschine getauscht – eine französische Latécoère 28-3, der sie den Namen Liberty III gegeben hatten***. Inzwischen jedoch hatten sie sich an die S 55 gewöhnt und ihre Vorzüge im Hinblick auf Ladekapazität und Reichweite schätzen gelernt. Und obwohl Otto stets eine gewisse Skepsis gegenüber allem hegte, was nicht von deutschen Konstrukteuren gebaut worden war, war es schließlich sein Vorschlag gewesen, der Savoia-Marchetti den schönen Namen Liberty IV zu geben …
»Ja, bestes Flugwetter«, bestätigte er vom Sitz des Co-Piloten aus. Die besondere Konstruktionsweise des Flugzeuges und die flache Überdachung des Cockpits bedingten es, dass man auf den Pilotensitzen mehr lag als wirklich saß; wegen seiner hageren, baumlangen Statur musste der Deutsche jedoch noch zusätzlich den Kopf einziehen, was ihn in unregelmäßigen Abständen dazu veranlasste, über Südeuropäer zu lamentieren, die in seinen Augen alle kleinwüchsig veranlagt waren.
»Komm schon, Oz, lass mich ein Lächeln sehen«, verlangte Jack und sah ihn durch die grün getönten Gläser seiner Sonnenbrille herausfordernd an. Otto revanchierte sich mit etwas, das mehr wie ein Zähnefletschen aussah. »Immerhin habe ich’s geschafft, Rochas viertausend Piepen abzuluchsen.«
»Abwarten, noch haben wir den Zaster nicht«, brummte Otto. Um sein kahles Haupt vor der Sonneneinstrahlung im Cockpit zu schützen, trug er wie immer seine lederne Fliegerhaube. »Aber ich muss zugeben, das war ganz schön ausgebufft, Skipper.«
»Auch ein Schwergewicht wie Rochas kann mal unter Zugzwang geraten, das muss man ausnutzen – und es kommt noch besser«, versicherte Jack. Mit einem Blick auf den Kompass korrigierte er den Kurs. Die Maschine neigte sich ein wenig, und es sah aus, als würde die spiegelglatte Fläche des Meeres nach unten kippen.
»Noch besser?« Von der Seite sandte ihm Otto einen zweifelnden Blick. »Inwiefern?«
Jack grinste breit. »Hast du vergessen, was das Ziel dieses Fluges ist? Wenn wir es in Monte Carlo nicht schaffen, echtes Geld zu machen, weiß ich auch nicht!«
»Was?« Otto fuhr vom Sitz hoch und vergaß dabei ganz, den Kopf einzuziehen. Mit Wucht stieß er ihn sich an der metallenen Verstrebung der Kanzel.
»Sachte, Oz.«
»Verdammter Mist!« Otto zog sich die Fliegerhaube vom Kopf und rieb sich die schmerzende Stelle. Dann erst schien er sich zu erinnern, was zuletzt gesprochen worden war. »Sag mal, hast du wirklich gerade gesagt, dass du unser sauer verdientes Geld ins Spielcasino tragen willst?«
»Vor allem will ich es vermehren, großer Zauberer«, entgegnete Jack. »Stell dir das blöde Gesicht von Rochas vor, wenn wir ihm nach unserer Rückkehr das Geld unter die Nase halten und den Rest unserer Schulden damit abbezahlen.«
»Das würde ich gerne sehen.« Otto schnaubte so verächtlich, dass das Kanzelglas über ihm beschlug. »Du vergisst dabei nur, dass wir unser Geld noch gar nicht haben. Nur zweihundert Dollar Anzahlung. Und davon müssen wir auch noch das Benzin für den Weiterflug kaufen.«
»Aye, keine Sorge«, bestätigte Jack. »Wenn wir die Roulettekugel eine Weile für uns rollen lassen, werden wir sehr viel mehr haben als das. Bis wir um drei Uhr nachts die Ladung übernehmen, sind wir bereits zwei gemachte Männer, Oz – und als solche werden wir zu Rochas zurückkehren und ihm sagen, dass er und seine Schießmänner uns in Zukunft mal kreuzweise können. Ist das nichts?«
»Der Gedanke hat was«, gab Otto zu. »Aber wie willst du das anstellen? Soviel Glück, wie dazu nötig wäre, hast du nicht, Skipper – und Texas-Poker wird da drin nicht gespielt. Ganz abgesehen davon, dass sie zwei arme Schlucker wie uns gar nicht erst reinlassen werden.«
»Das überlass getrost mir«, entgegnete Jack, der unverdrossen weitergrinste. »Ich habe schon einen Plan.«
»Bitte nicht«, stöhnte Otto. »Das letzte Mal, als ich das hörte, saßen wir anschließend in Atlantic City im Knast.«
»Nun vergiss doch mal diese dumme Geschichte. Und wenn du schon dabei bist, vergiss auch gleich noch deine deutsche Sparsamkeit, die bringt uns hier nicht weiter.«
Otto erwiderte etwas in seiner Muttersprache, das Jack nicht verstand – und er fragte auch nicht weiter nach.
»Das ist eine Chance, Oz, eine echte Chance! Oder willst du noch ein ganzes weiteres Jahr in Rochas’ Auftrag Waffen nach Spanien schmuggeln? Ich möchte gar nicht wissen, wie viele arme Schweine wegen dem verdammten Zeug schon draufgegangen sind, das wir geliefert haben!«
Otto biss sich auf die Lippen, die trocken und rissig waren von der Sonne. Genau wie Jack wusste auch er nur zu gut, wie es sich anfühlte, Soldat zu sein und Befehle zu empfangen, von jedem Tag aufs Neue um sein Leben zu fürchten. Beide hatten sie im Großen Krieg gekämpft, und auch wenn sie auf verschiedenen Seiten gestanden hatten, hatte es sich für beide gleich beschissen angefühlt.
»Nein«, stellte er deshalb klar, »das will ich nicht.«
»Rochas wird uns niemals aus seinem Dienst entlassen, Oz, das muss dir klar sein«, fuhr Jack fort. »Solange sie sich in Spanien gegenseitig die Schädel einschlagen, wird er von uns verlangen, dass wir für ihn Waffen fliegen, dafür läuft dieses Drecksgeschäft nämlich viel zu gut. Es sei denn, wir schaffen es, uns endgültig von ihm loszukaufen. Und das geht nur mit einem Haufen Geld, oder?«
Otto presste weiter die Lippen zusammen, während er stur geradeaus durch das Cockpitfenster starrte. Dass sein Partner recht hatte, ließ sich nicht von der Hand weisen.
Rochas war ein gerissener Mistkerl. Solange sie keinen Weg fanden, ihre Schulden endgültig abzubezahlen, würde er immer wieder eine Möglichkeit finden, sie an sich zu binden. Er würde sie für sich arbeiten lassen, bis ihr Flugzeug irgendwann abgeschossen würde oder sie in irgendeinem Dreckloch von Gefängnis landeten. Und das war es sicher nicht gewesen, was ihnen vorgeschwebt hatte, als sie die Lost Cargo Company gründeten, zwei ehemalige Feinde, die sich geschworen hatten, niemands Diener mehr zu sein und die Freiheit über den Wolken in vollen Zügen auszukosten …
»Also gut«, erklärte er sich bereit, »du hast gewonnen. Hoffentlich bist du am Spieltisch genauso überzeugend.«
»Noch viel überzeugender«, feixte Jack.
»Was noch nicht erklärt, wie du in den Laden reinkommen willst. Hast du überhaupt eine Ahnung, was für ein nobler Schuppen das ist?«
»Vertrau mir, es wird alles wunderbar«, versicherte Jack. »Kleider machen ja bekanntlich Leute – und ich weiß schon, wie wir an die passenden Klamotten kommen.«
»Will ich das auch wissen?«
»Wahrscheinlich nicht«, gab Jack grinsend zu, während er abermals den Kurs korrigierte und die Maschine nach Norden steuerte. Die französische Küste zeichnete sich dort bereits ab, während sich fern im Westen der Himmel orangerot färbte und das Heraufziehen jener Nacht ankündigte, die nach Jacks Auffassung alles ändern würde.
Er sollte recht behalten.
Aber anders, als er gehofft hatte.
***nachzulesen in LOST CARGO – TEMPELJÄGER
6
Hôtel Hermitage, Monte CarloZur selben Zeit
Der Salon war mondän eingerichtet.
Mit grünem Leder bezogene Sessel bildeten kleine Gruppen, und die bunten Schirme von Tiffany-Lampen spendeten diffuses Licht, das sich in der dunklen Holztäfelung der Wände spiegelte. Die Fenster und die Läden davor waren geschlossen, um die Hitze des Nachmittags nicht einzulassen.
In den blauen Dunstschwaden, die sich hier niemals zu legen schienen, saß eine einzelne Gestalt. Sie trug ein leichtes Sommerkleid aus blauer Seide mit einem dazu passenden Tuch, das sie sich turbangleich um den Kopf gebunden hatte. Ihre Gesichtszüge waren anmutig, von einer stolzen, geradezu klassischen Schönheit, mit einer spitzen Nase und hohen Wangenknochen. In unregelmäßigen Abständen sog sie an der Zigarette, die sie an einer langen Spitze in ihrer Linken hielt. Es war nur eine beiläufige Geste, und auch wenn Henderson ihr schon unzählige Male dabei zugesehen hatte, konnte er nicht anders, als davon fasziniert zu sein.
»Larna?«
Sie sah auf. Wenn sie überrascht war, dass er zurückgekehrt war, ließ sie es sich nicht anmerken.
»Ist er hier?«, fragte sie nur.
»Draußen.« Henderson nickte.
Larna griff nach dem Highball-Glas, das vor ihr auf dem kleinen Tischchen stand. Die Eiswürfel darin klirrten leise, als sie einen Schluck von ihrem Ginfizz nahm.
»Ich lasse bitten«, sagte sie.
Henderson blieb stehen. Der Blick, mit dem er sie bedachte, wurde eindringlich, beinahe warnend.
»Ich lasse bitten«, wiederholte sie.
Henderson nickte wiederwillig und ging nach draußen – um schon im nächsten Moment wieder zurückzukehren, Eugen von Troneck im Schlepp.
»Larna – Baron Eugen von Troneck. Baron von Troneck – Miss Larna King, besser bekannt als …«
»… die einzigartige Madame Pandora«, vervollständigte der Deutsche. Begeisterung sprühte aus seinem einen Auge. In preußischer Höflichkeit nahm er die Mütze ab, schlug die Hacken zusammen und deutete eine Verbeugung an. »Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich mich über diese Begegnung freue, Madame.«
»Die Freude ist ganz meinerseits, werter Baron«, versicherte Larna. Sie streckte ihm eine Hand entgegen, auf die von Troneck einen galanten Kuss hauchte.
»Sie gestatten, dass ich mich zu Ihnen setze?«
»Aber natürlich. Wenn du uns bitte entschuldigen würdest, Peter.« Sie sandte Henderson einen auffordernden Blick.
»Ich …« Er zögerte, während von Troneck Platz nahm. »Sollte ich nicht lieber bleiben? Womöglich gibt es rechtliche Dinge zu klären, bei denen ich …«
»Mein Manager ist um mein Wohl besorgt, Baron von Troneck«, sagte Larna lächelnd und an ihren Gast gewandt. »Hat er denn Grund dazu?«
»Selbstverständlich nicht«, beteuerte der Deutsche. »Ich bin lediglich ein aufrechter Bewunderer Ihrer Kunst, nicht mehr und nicht weniger.«
Larna nickte. »Du siehst, du kannst beruhigt sein, Peter«, beschied sie Henderson mit einem Blick ihrer grünen Augen.
Henderson rang sich ein Lächeln ab. »Wenn du mich brauchst, ich bin draußen«, erklärte er dann und verließ den Salon.
Larna und von Troneck waren allein.
»Er ist eifrig«, stellte der Baron fest.
»Bisweilen ein wenig zu eifrig.« Sie nahm erneut einen Schluck aus ihrem Glas. »Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Der Ginfizz hier ist ausgezeichnet.«
»Nein, danke.« Von Troneck schüttelte den Kopf, während er sie mit dem verbliebenen Auge taxierte.
»Sie wirken überrascht«, stellte sie fest.
»Ein wenig«, gab er zu. »Ich gestehe, dass …«
»… ich nicht die bin, die Sie erwartet haben?«
»So würde ich es niemals ausdrücken, schließlich sind Sie eine Frau von berückender Schönheit.«
»Ich danke Ihnen, Herr Baron. Dennoch sehe ich Ihnen ein gewisses Befremden an, und das ist nicht verwunderlich. In London haben Sie nur das von mir gesehen, was Sie sehen sollten. Was alle sehen sollen, die Fassade. Ein wenig Pomp und Gloria gehören bei meinem Berufsstand gewissermaßen dazu.«
»Natürlich, aber … was ist mit Ihrem Haar?«, fragte er, auf die kurze blonde Strähne deutend, die keck unter dem Kopftuch hervorlugte.
»Eine Perücke«, erklärte sie.
»Ich verstehe.«
Sie sog an ihrer Zigarette. »Ich hoffe, ich habe Sie nicht enttäuscht.«
»Durchaus nicht«, sagte er schnell. »Ich habe die weite Reise nicht wegen Ihrer Haare gemacht, Madame Pandora – sondern weil ich davon überzeugt bin, dass Sie eine sehr außergewöhnliche Frau sind. Und dass es etwas gibt, das uns beide verbindet.«
Sie sah ihn unverwandt an. »Und das wäre?«
»Unsere Leidenschaft für die Vergangenheit«, entgegnete von Troneck ohne Zögern. »Was ich mit dem Verstand und den Mitteln der Wissenschaft zu durchdringen suche, das tragen Sie in Ihrer Seele. Wir sind zwei Seiten derselben Medaille.«
»So habe ich es nie betrachtet«, gab sie zu. »Gewöhnlich werden Leute wie ich von seriösen Wissenschaftlern ausgelacht.«
»Weil es Idioten sind«, entgegnete der Baron. »Ohne Visionen für die Zukunft und ohne Vertrauen in das Schicksal.«
Larna nahm wieder einen Zug. »Sie glauben an Schicksal?«
»Ich glaube an Chancen, die die Geschichte uns sterblichen Menschen von Zeit zu Zeit gewährt – und ich habe nicht vor, diese Chancen ungenutzt verstreichen zu lassen. Deshalb war ich sehr dankbar, als Sie über Ihren Manager dieser Zusammenkunft zugestimmt haben.«
Larna lehnte sich in ihrem Sessel zurück. Durch die Dunstschwaden des Rauches taxierte sie ihr Gegenüber. »Ich genieße einen gewissen Ruf, Baron von Troneck, und die Liste derer, die meine Dienste gerne in Anspruch nehmen möchten, ist lang. Das bedeutet, dass ich es mir leisten kann auszusuchen, wen ich zu meinen privaten Séancen zulasse und wen nicht.«
»Dessen bin ich mir bewusst«, versicherte er.
»Und ich kann Ihnen auch keine Versprechungen machen, was Ihr spezielles Ansinnen betrifft.«
»Auch das ist mir klar. Aber wenn es überhaupt jemanden gibt, der mir bei meinen Forschungen helfen kann, dann sind Sie es. Das ist mir in dem Augenblick klar geworden, als ich Sie in London gesehen habe. Nicht nur mit meinem Auge«, versicherte er, auf sein verbliebenes Sehorgan deutend, »sondern auch mit dem Herzen.«
Sie taxierte ihn, ohne dass zu erkennen war, was sie dachte. »Verstehen Sie mich nicht falsch, Baron von Troneck, aber ich würde gerne sichergehen, dass Sie mich nicht für eine Närrin halten. Mir ist bewusst, dass Sie nicht aufgrund einer Schwärmerei hier sind. Für wen arbeiten Sie genau? Was ist das für eine Uniform, die Sie da tragen?
»Ich dachte, ich hätte es Ihrem Manager gegenüber erwähnt – ich stehe im Dienst der in meinem Land neu gegründeten Forschungsgesellschaft für Ahnenerbe.«
»Was darf ich mir darunter vorstellen?«
Von Troneck lächelte. »Jedes Volk hat Wurzeln, nicht wahr? Ursprünge in der Vergangenheit, die es näher zu erforschen gilt – mit dem deutschen Volk verhält es sich nicht anders.«
»Und dazu brauchen Sie mich?« Larna hob die Brauen. »Eine Engländerin mit einer russischen Mutter?«
Von Troneck lächelte nur. »Ich halte Sie nicht zum Narren, Pandora. Wie Sie schon richtig vermutet haben, bin ich nicht aufgrund einer romantischen Schwärmerei hier, obschon ich Sie für eine außergewöhnlich attraktive Frau halte …«
»Ich danke Ihnen.«
»… sondern weil ich Sie bereits seit einer ganzen Weile beobachten lasse.«
»Mich«, echote sie und nippte an ihrem Ginfizz.
»Die Person, die Sie auf der Bühne darstellen«, wich er aus. »Ihre Arbeit. Ihre Methoden.«
»Und? Zu welchem Schluss sind Sie durch Ihre Beobachtungen gekommen, Herr Baron?«
»Dass Sie anders sind als all die übrigen selbst ernannten Wahrsager und Medien da draußen«, eröffnete er ohne Zögern. »Ich denke, dass Sie tatsächlich eine Verbindung in die Vergangenheit unterhalten – und dass diese Vergangenheit und jene, nach der ich suche, einander womöglich berühren.«
»Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht«, entgegnete Larna und stellte ihr Glas zurück auf den Tisch. »Was hat Sie zu diesem Gedanken bewogen?«
Von Troneck sah sie durchdringend an. »Im Jahr 1387«, begann er dann, »ist vor der nordnorwegischen Küste ein Schiff gesunken – ein Bremer Kauffahrer aus dem Besitz eines gewissen Detward von Hoya. An Bord der Kogge befand sich eine Frau. Eine Seherin, wie es heißt. Ein Medium.«
»Woher wissen Sie das?«
»Weil ich durch – nennen wir es einen glücklichen Zufall – in den Besitz des Logbuches des Schiffes gelangt bin. Sie müssen wissen, der Kapitän überlebte als Einziger das Unglück. An eine Schiffsplanke gebunden, erreichte er die Küste der Lofoten. Unglücklicherweise hatten ihn die Strapazen wohl den Verstand gekostet – er faselte immerzu etwas von einem Ungeheuer, einer Kreatur aus der Tiefe, die das Schiff zerstört hätte. Er muss bereits wenig später gestorben sein, vermutlich infolge der Entbehrungen und der Unterkühlung, die er erlitten hatte. Seine Aufzeichnungen jedoch blieben auf geradezu wundersame Weise bis zum heutigen Tag erhalten und fanden ihren Weg zu mir.«
»Von ganz allein«, sagte sie.
»Nun, ein wenig mehr Aufwand war schon dafür vonnöten«, gab von Troneck zu, ohne erkennen zu lassen, worin dieser Aufwand bestanden hatte. »Aber aufgrund dieser Aufzeichnungen weiß ich, dass Detward von Hoya damals auf der Suche gewesen ist. Auf der Suche nach etwas, das …«
»… ich für Sie finden soll«, unterbrach Larna ihn.