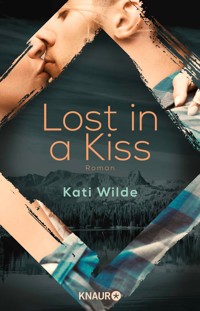
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Versprechen. Zwei Herzen. Drei Regeln. Vier Wochen, um sie alle zu brechen. Im Liebesroman "Lost in a Kiss" nimmt uns die US-amerikanische Autorin Kati Wilde mit auf einen vierwöchigen Roadtrip durch Oregon und Kalifornien, auf dem die Funken fliegen. Frech, romantisch und leidenschaftlich. Als Aspens beste Freundin Bethany sie auf einen vierwöchigen Roadtrip zur Feier ihres College-Abschlusses einlädt, hegt Aspen gemischte Gefühle. Hauptsächlich, weil Bethanys überfürsorglicher Bruder Bram dabei sein wird, mit dem sie immer wieder aneinandergerät und der scheinbar keine allzu hohe Meinung von ihr hat. Aber Aspen ist entschlossen, das Beste aus der Reise zu machen und irgendwie mit Bram zurechtzukommen. Doch dann springt Bethany in letzter Sekunde ab. Aspen, die als Einzige den Grund dafür kennt, tritt den Roadtrip mit Bram allein an. Als sich Aspens Gefühle für Bram mit der Zeit verändern und alles bisher Unausgesprochene zwischen ihnen ans Licht kommt, riskiert sie nicht nur, ihr Herz zu verlieren … "'Lost in a Kiss' ist eine moderne, heiße und gleichzeitig zutiefst emotionale Stolz und Vorurteil-Story, die ihr nicht verpassen solltet!" Kristen Callihan, New York Times-Bestsellerautorin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Kati Wilde
Lost in a Kiss
Roman
Aus dem Amerikanischen von Karla Lowen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Aspen findet Bram, den Bruder ihrer besten Freundin, zu reich, zu arrogant und absolut unausstehlich – wenn auch zugegebenermaßen verdammt gut aussehend. Bram lässt Aspen seit ihrer ersten Begegnung immer wieder spüren, dass er ebenfalls keine hohe Meinung von ihr hat. Nur ihrer besten Freundin zuliebe willigt Aspen ein, sie und Bram auf einen Roadtrip zur Feier des College-Abschlusses zu begleiten. Doch dann springt Bethany ab! Und Aspen findet sich plötzlich allein mit Bram in der rauen Schönheit Oregons und Kaliforniens wieder …
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Epilog
Leseprobe
Prolog
Kapitel 3
Leseempfehlungen
1
Brauchst du Geld für eine Kaution?
Die Nachricht meiner Mutter erreicht mich, als der Bus an der Haltestelle vor Walmart einfährt. Nur ein Satz, und das flaue Gefühl im Magen, das mich seit Wochen begleitet, wird stärker.
Die Zeit reicht noch für eine Antwort, bevor ich einsteige. Warum? Steckt Nash mal wieder in Schwierigkeiten?
Wenn ja, werde ich mich darum kümmern müssen. Mom kommt erst morgen zurück – aus ihrem ersten Urlaub, seit mein Dad vor sieben Jahren gestorben ist.
Ich werde es meinem Bruder nie verzeihen, wenn er ihr die Reise vermiest.
Gelegentlich beschließt Nash, sein Leben in den Griff zu bekommen, und kehrt nach Hause zurück, wo er auf eine solide Basis aufbauen kann. In den meisten Fällen sucht er aber nur ein paar Wochen Unterschlupf bei Mom, weil ihm mal wieder alle anderen Möglichkeiten ausgegangen sind. Seine letzte Rückkehr gehörte in die Kategorie »Leben in den Griff bekommen«. Er arbeitet jetzt an einer Tanke in der Nachbarschaft und hält sich laut Mom ganz gut. Doch wenn sie nur ein paar Tage aus dem Haus sein muss, damit er in alte Gewohnheiten zurückfällt, weiß ich nicht, wie er sein Leben jemals in den Griff bekommen will.
Und Mom wird einfach immer wieder dafür zahlen.
Der Bus ist voll, aber ich entdecke einen Platz ganz hinten – oder besser gesagt einen halben, denn der Typ auf dem Fensterplatz übt sich im Manspread. Sein linkes Knie ragt weit in meinen Fußraum und zwingt mich zu einer verkrampften Sitzhaltung, die Knie schräg im Gang, den neuen Schlafsack an die Brust gedrückt. Natürlich merkt er nichts davon, denn er hat die Augen geschlossen und Stöpsel in den Ohren.
Idiot, denke ich und überlege, ihm »versehentlich« den Ellbogen in die Flanke zu rammen, doch mein Handy summt und rettet ihn.
Die Kaution ist für dich. Ein grinsender Smiley begleitet Moms Antwort. Wenn du Bethanys Bruder ermordet hast.
Ich ersticke mein Schnauben im zusammengeknautschten Nylongewebe. In einer guten Stunde starte auch ich in den Urlaub – zu einer vierwöchigen Reise mit meiner besten Freundin und ihrem Bruder Bramwell Gage. Und obwohl ich nicht vorhabe, ihn umzubringen, werde ich vermutlich stündlich mit dem Gedanken spielen.
Für wie dumm hältst du mich, schreibe ich zurück. Wenn ich ihn ermorde, dann doch nicht heute. Ich warte, bis wir durch eine einsame Landschaft wandern. Wenn sie mich nicht erwischen, brauche ich auch keine Kaution, oder?
Wie clever von dir. Man sieht, dass du deinen schicken neuen Bachelor nicht umsonst gemacht hast. Ihre Stimme ist mir so vertraut, dass ich den trockenen Ton im Ohr habe, während ich die Nachricht lese.
Ja, so clever, dass mir gerade noch was viel Besseres eingefallen ist: Knack doch den Jackpot, wo du schon in Vegas bist. Dann kannst du meinen Anwalt bezahlen, wenn sie mich doch erwischen.
Meine teuerste Aspen, ich liebe dich über alles, aber wenn ich den Jackpot knacke, stehen deine Anwaltskosten ganz unten auf der Liste der Schulden, die ich begleichen werde.
Der Kommentar verpasst mir einen Dämpfer. Ihr Ton bleibt scherzhaft, aber ich möchte niemals zu ihrem Schuldenberg beitragen.
Dann muss ich wohl einfach nett zu Bram sein und über unseren unguten Start hinwegsehen.
Genau, nachdem du ja so leicht verzeihst. Der angefügte Smiley verdreht die Augen.
Ich habe guten Grund, sauer auf ihn zu sein. Ich werde ihn mit Küssen überschütten und in die Arme schließen. Wenn ich fest genug zudrücke, plumpst ihm vermutlich ein Diamant aus dem Hintern, so verklemmt, wie er ist. Dann bin ich reich, und wir können uns den Anwalt doch noch leisten.
Deine Tante Clara meint, sie weiß nicht, was sie schlimmer findet: die Vorstellung von Plumps-Diamanten oder davon, sie aufzusammeln, wenn man weiß, woher sie stammen.
Sag ihr, BRAM ist schlimmer.
Nur zur Information: Solltest du mir je einen Diamantring schenken, werde ich ihn nicht tragen.
Sollte ich dir je einen Plumps-Diamanten schenken, hoffe ich, dass du ihn verkaufst. Und alle Geldsorgen los bist. Kannst du Tante Clara fragen, wie kalt es nachts am Newberry-Campingplatz wird?
Ziemlich kalt. Zwischen drei und sechs Grad.
Mist. Aber eigentlich logisch. Auf einem Berg in der Hochwüste von Oregon ist es nachts nun mal kalt. Mein Blick fällt auf den Nylon-Schlafsack in meinem Schoß. Er war nicht das billigste Modell aus dem Walmart-Sortiment, aber fast – und das Beste, was ich mir leisten kann. Leider werde ich damit erfrieren.
Nicht, dass ich Mom davon erzählen und sie in Sorge versetzen würde. Okay, danke.
Clara meint, du sollst dich bei Aaron und Anna melden, wenn ihr nach Bend kommt. Vielleicht könnt ihr euch treffen.
Mein Cousin und meine Cousine, beide älter als ich – Anfang dreißig. Die wenigen Male, wenn wir uns im Urlaub gesehen haben, sind wir zwar gut miteinander ausgekommen, aber vermutlich haben sie Besseres zu tun, als sich mit mir abzugeben. Ich glaube, Mom denkt sie sich immer noch als Teenager – und Aarons und Annas Bild von mir ist vermutlich immer noch das einer Zehnjährigen, die mal einen Sommerurlaub mit ihnen im Pine Valley verbracht hat, was nicht weit von der zweiten Station auf unserer Reise entfernt ist.
Ich habe ihre Nummern nicht im Handy. Kannst du meine weitergeben und ihnen sagen, dass ich nächste Woche da bin? Ich erwarte keinen Anruf, aber Mom wird sich freuen, dass ich mich bemühe. Ich bin voraussichtlich ein paar Tage in der Gegend.
Wird gemacht. Gib mir Bescheid, wenn ihr in der Timberline Lodge ankommt. Schick mir Fotos.
Mach ich, verspreche ich, und plötzlich brennt meine Kehle, weil ich weiß, was sie nicht schreibt. Eigentlich wollten sie und Dad ihren zwanzigsten Jahrestag im Ferienresort Mount Hood verbringen. Doch dann wurde bei Dad Knochenkrebs diagnostiziert. Er hat es bis zum Jahrestag geschafft, war aber zu schwach für irgendwelche Reisen. Es wäre ohnehin nichts geworden. Zu dem Zeitpunkt hatten die Behandlungskosten bereits ihre Ersparnisse aufgefressen und sämtliche Kreditrahmen gesprengt. Auch sieben Jahre später müht sie sich noch ab, die Schuldenberge abzubezahlen, aber sie wachsen immer weiter.
Aber niemanden ermorden, ermahnt sie mich noch mal.
Ich garantiere für nichts.
Im Grunde mache ich mir keine großen Sorgen um Bram. Er hat mich bei jeder Begegnung davon überzeugt, dass er ein geschniegelter verklemmter Kontrollfreak mit beeindruckendem Überlegenheitskomplex ist, aber ich bin wild entschlossen, mich mit ihm zu arrangieren.
Ich sorge mich um seine Schwester. Und um mich, wenn ich ehrlich bin – denn ginge es nicht um Bethany, würde ich absagen und zu Hause bleiben.
Dabei hatte ich mich auf die Reise gefreut. Ein paar Tage auf dem Mount Hood, danach in Central Oregon. Anschließend runter nach Kalifornien, an den Mount Shasta, und die letzte Woche am Lake Tahoe. Bethany hat sich diese Reise von Bram zum Abschluss gewünscht. Anscheinend hat ihre Familie diese Tour jeden Sommer gemacht, bevor ihre Eltern vor acht Jahren bei einem Autounfall ums Leben kamen. Damals war Bram neunzehn und Bethany vierzehn.
Ich wurde erst nachträglich mit eingeplant. Bethany hatte sich die Reise irgendwann um Weihnachten herum von ihrem Bruder gewünscht, mich hat sie erst vor einem Monat gefragt. Schätzungsweise musste sie Bram erst dazu überreden.
Obwohl ich auch nicht sonderlich scharf auf seine Gesellschaft bin, habe ich sofort zugesagt. Zum einen, weil ich mir eine solche Gelegenheit nicht entgehen lassen sollte – unwahrscheinlich, dass ich so bald wieder über einen vollbezahlten Urlaub stolpere –, und zum anderen, weil Bethany mich dabeihaben möchte. Wir haben uns jetzt vier Jahre lang ein Zimmer geteilt, doch ab Herbst studieren wir an verschiedenen Unis in verschiedenen Städten: Sie am MIT in Cambridge, ich an der Seattle University. Sie meint also, wir könnten die unvermeidliche Trennung hinauszögern.
Bis vor ein paar Wochen war ich auch sehr dafür, unsere gemeinsame Zeit zu verlängern. Ich wollte diese Reise. Für mich. Denn immer, wenn ich an die Zukunft denke, befällt mich schreckliche Atemnot.
Ich weiß, dass ich nur ein wenig ausgebrannt bin. Das letzte Jahr war heftig. Die Bewerbung am Graduiertenkolleg, die Abschlussarbeit schreiben, ein Paper nach dem anderen abgeben, die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen.
Also dachte ich, ein paar Wochen Abwechslung, in denen ich mal nicht an meine Zukunft denke, könnten mir wieder einen klaren Kopf verschaffen.
Leider ist es nie so einfach. Vor ein paar Wochen habe ich herausgefunden, dass mir zur Finanzierung des Studiengangs nichts anderes übrig bleibt, als den fetten Bildungskredit aufzunehmen, den ich bisher vermeiden konnte. Ich weiß, dass Tausende Studenten einen Kredit aufnehmen und wundervoll damit klarkommen, aber ich habe gesehen, wie meine Mutter in den letzten sieben Jahren gekämpft hat, und diese Erfahrung verstärkt mein ohnehin schon ungutes Gefühl.
Ich will keinen Urlaub. Ich will mir einen Job suchen und herausfinden, wie ich zwei weitere Jahre studieren kann, ohne in einem Berg aus Schulden zu versinken.
Und es ist wirklich krank, aber einen Moment lang habe ich mir allen Ernstes gewünscht, mein Bruder Nash hätte tatsächlich etwas angestellt. Dann hätte ich einen Grund gehabt, zu Hause zu bleiben.
Ginge es allein um Urlaub, hätte ich längst abgesagt. Ich glaube aber, Bethany möchte mich nicht nur als Reisebegleitung dabeihaben. Das letzte Jahr mag heftig für mich gewesen sein, doch für sie war es die Hölle, und sie ist noch immer wackelig auf den Beinen. Deshalb glaube ich, sie möchte jemanden als Puffer zwischen sich und ihrem übertrieben fürsorglichen Bruder haben, obwohl sie es nicht ausdrücklich gesagt hat. Und dieser Puffer bin ich. Also werde ich mich mit Bram verstehen.
Und wenn es mich umbringt.
2
Der ungute Anfang zwischen Bramwell Gage und mir war wirklich nicht meine Schuld, sondern ganz allein seine, denn er hat seiner Schwester im ersten Semester nach zwei Wochen einen Überraschungsbesuch abgestattet.
So was tut man doch einfach nicht. Das ist Regel Nummer eins für einen rücksichtsvollen Umgang zwischen Erwachsenen: Man fällt seinen Mitmenschen nicht unangemeldet ins Haus – und auch nicht ins Studentenwohnheim. Man ruft vorher an. Die einzige Ausnahme gilt für Eltern, aber nur, solange die Kinder unter ihrem Dach wohnen.
Diese Ausnahmeregel ist vermutlich der Grund, warum sich Bram eingebildet hat, er könnte einfach auf dem Campus erscheinen. Schließlich war er für eine Weile Bruder und Vater zugleich für Bethany gewesen. Das verstehe ich. Er war es gewohnt, nach ihr zu sehen und sich zu vergewissern, dass es ihr an nichts fehlt.
Trotzdem hätte er vorher anrufen können. Dann hätte Bethany nämlich nicht geglaubt, sie hätte an diesem Freitagabend frei. Und ich hätte ein anderes Wochenende abgewartet, um meine neue schüchterne Zimmergenossin aus ihrem Schneckenhaus zu locken, indem ich sie überrede, mit mir auf einen Rave zu gehen. Dabei waren wir gar nicht lange unterwegs gewesen. Wie sich herausstellte, vertrug sie keinen Alkohol. Ich war gerade mal leicht angeheitert, als ich merkte, dass sie stockbesoffen war und wir nach Hause mussten.
An der Eingangstür von unserem Gebäude liefen wir dann in ihren Bruder hinein. Nicht, dass ich ihn als Bethanys Bruder erkannt hätte, als ich ihn im gelben Lichtschein vor der Tür stehen sah. Er trug eine Anzugsweste über einem schneeweißen Hemd, das fast schon leuchtete, seine breiten Schultern warfen einen langen Schatten, die hohen Wangenknochen wurden von seinem Handy angestrahlt. Nein, war mein erster Gedanke, heilige Scheiße, entweder habe ich mir die Wirklichkeit schöngetrunken, oder Photoshop produziert jetzt schon perfekte männliche Exemplare für die Realität. Eine Sekunde später fiel Bethany diesem Exemplar um den Hals und lallte etwas davon, wie schön es sei, ihn zu sehen, und dass sie nicht geahnt habe, dass er geschäftlich in Portland war. Dann lehnte sie sich zur Seite und kotzte knapp an seinen schwarz glänzenden Schuhen vorbei auf die Betonstufen.
Die folgenden Minuten waren die einzigen, in denen ich Sympathie für Bram empfand. Er hielt Bethany das Haar nach hinten, während sie den zweiten Schwall in ein Gebüsch spuckte. Und so gern ich es auf das Reihern geschoben hätte, dass sich mein Magen zusammenzog, war es in Wirklichkeit die Reaktion darauf, wie sich seine schmalen Lippen zu einem Lächeln verzogen und er murmelte: »Sieht aus, als hättest du dich ein bisschen zu gut amüsiert.«
Was für eine Stimme. Tief und polternd und so voller Zuneigung, dass er Bethany vermutlich nie sagen musste, dass er sie liebte. Sie hörte es aus jedem Wort.
Bethany schüttelte langsam den Kopf und hob den Zeigefinger vor sein Gesicht. »Von wegen zu gut.«
Grinsend hielt er ihren Finger fest, bevor sie ihm das Auge ausstechen konnte. »Gerade gut genug?«
»Fast.« Sie kicherte und grinste wie er. »Aber Aspen meinte, ich wäre betrunken und wir sollten gehen. Bin ich betrunken?«
Er sah aus, als müsste er ein Lachen unterdrücken. »Ich glaube schon.«
»Ganz genau, ich bin betrunken! Das Bier hat eklig geschmeckt, aber die Musik war so laut, dass ich den Beat in der Brust gespürt habe. Bumm. Bumm. Und wir haben mit zwanzig heißen Typen getanzt, glaube ich.« Sie befreite ihre Hand aus seinem Griff, hob die Arme über den Kopf und schwenkte den Hintern, doch dabei stolperte sie auf den Stufen.
Wir fingen sie gleichzeitig auf. Bram erwischte ihre Handgelenke, ich fasste ihr von hinten um die Hüfte. Eine atemlose Sekunde lang stützten wir Bethany zwischen uns.
»Schalt einen Gang zurück, Beyoncé«, sagte ich. »Alles okay?«
»Mehr als okay.« Unbeholfen langte sie nach hinten, um meine Schulter zu tätscheln. »Du bist die Beste, Aspen. Ich bin so froh, dass wir zusammenwohnen.«
Anhänglich im Suff, wie schön. Man weiß nie, wie sich Leute verändern, wenn sie etwas getrunken haben.
»Darüber bin ich auch froh, Süße.«
Sie packte Bram beim Revers und zog ihn zu sich. »Hörst du ihre Stimme? Sie klingt heiser, aber das ist sie gar nicht. Ist das nicht sexy?«
Ich schnaubte. »Sexy« war besser als die üblichen Kommentare, die ich zu hören bekam. »Bist du krank?« war noch die nettere Variante. Weniger nette reichten von »Raucherstimme« bis hin zu »Hast wohl gerade einen Schwanz gelutscht«.
Und auch die Ursache für meine Reibeisenstimme war alles andere als schön. »Mom und Dad fanden meine Stimme vermutlich nicht so sexy, als ich mir als Baby wegen Dauerkoliken die Stimmbänder wundgeschrien habe.«
»Sie hat Knötchen«, erklärte Bethany und nickte ernst. »Wie Chloe.«
Eine Information, die ihrem Bruder vermutlich wenig sagte, es sei denn, er war Fan von Pitch Perfect. »Vielleicht sollten wir hochgehen«, meinte ich und sah ihm über ihren Kopf hinweg in die Augen. Sie waren dunkler als ihre, braun, nicht karamellfarben. Mit einem Blick bat ich ihn wortlos, mir zu helfen, sie auf unser Zimmer zu schaffen.
Er nickte, als hätte er genau das vor.
»Ins Bett? Aber Bram ist doch gerade erst angekommen!«
»Ich bin bis Sonntag in der Stadt«, tröstete er sie. »Wir haben morgen Zeit.«
»Gleich ganz früh«, sagte Bethany, als erwartete sie, am nächsten Morgen fit zu sein und nicht total verkatert.
Ich ging die Stufen hoch, um den Code an der Tür einzugeben, dann drehte ich mich um und sah, wie sie sich mit dem Absatz an der Kante des Gehwegs verfing und fast wieder stürzte.
Mit elegantem Schwung fing Bram sie auf, hob sie an die Brust und trug sie hinein. Nachdem wir nun auf gleicher Höhe waren, fiel mir auf, dass er fast einen Kopf größer ist als ich, vielleicht mehr. Und auch Bethany ist ein ganzes Stück größer als ich, dennoch trug er sie, als würde sie nichts wiegen.
Wow, das war sexy. Die Typen vom Rave waren nichts im Vergleich zu Bramwell Gage. Eigentlich stehe ich nicht auf schick, aber er machte eine gute Figur darin. Anscheinend hatte er vor seinem Erscheinen nur Sakko und Krawatte eines Dreiteilers abgelegt und noch nichts Bequemeres angezogen. Sein Hemd war zu, bis auf den obersten Knopf an der Halsgrube, unter dem gebräunte Haut zum Vorschein kam. Die graue Weste schmiegte sich an seinen flachen Bauch, unter den langen Ärmeln zeichnete sich die Spannung der Armmuskeln und die Kraft in den Handgelenken ab, während er Bethany trug, und der lockere Sitz seiner Anzughose betonte schmale Hüften und lange, muskulöse Schenkel.
Bethany hatte ihren Bruder ein paarmal erwähnt, seit wir uns ein Zimmer teilten. Jetzt bedauerte ich, dass ich mir keine Bilder hatte zeigen lassen. Viele Bilder.
Im Foyer hielt ich die Tür zum Treppenhaus auf und wartete, bis er Bethany hindurchgetragen hatte. »Dritter Stock.«
»Wo sonst«, sagte er trocken, und ich grinste, als er vorbeiging. Lieber Gott, auch sein Hintern war perfekt.
Und ich Glückspilz würde ihm drei Stockwerke nach oben folgen.
»Ich kann selber laufen«, protestierte Bethany, aber als er sie nicht absetzte, ließ sie den Kopf an seine Schulter sinken. »Du hättest mit auf den Rave kommen sollen.«
Diesmal wirkte sein Lächeln angespannt. Vielleicht war es doch nicht ganz so leicht, sie zu tragen. »Ich war nicht eingeladen.«
»Wir auch nicht. Aber nächstes Mal kannst du Aspen fragen. Sie weiß, wo man hinmuss.«
»Ach ja?«, fragte er und streifte mich mit einem Blick, bevor er sich an den Aufstieg machte.
Plötzlich beschlich mich ein ungutes Gefühl, und statt auf seinen Hintern blickte ich auf seinen Rücken, während ich ihm langsam folgte. Hatte ich seinen Blick falsch interpretiert? Sein »Ach ja« hatte nicht wütend geklungen, höchstens desinteressiert, aber als er mich angesehen hatte, war sein Kiefer angespannt, und seine Augen hatten sich verengt, als wäre er nicht nur voller Zuneigung und Wärme, sondern außerdem stinksauer.
Nicht auf Bethany. Auf mich.
Aber warum? Vielleicht irrte ich mich. Meine Mom wirft mir immer vor, dass ich zu schnell in die Defensive gehe und Kritik wittere, wo gar keine beabsichtigt ist. Manchmal hat sie vermutlich recht. Aber oft habe ich auch das Gefühl, dass sie Leute freundlicher einschätzt, als sie es verdienen.
Doch nachdem er Bethany so fürsorglich behandelte, wollte ich nicht vorschnell über Bram urteilen. Außerdem war ich mir keiner Schuld bewusst und hatte mich vermutlich getäuscht.
Wir wohnten in einem der älteren Gebäude auf dem Campus, wo die Holzstufen unter jedem Schritt knarzten. Im Treppenhaus war es wie immer kalt, aber im dritten Stock hing noch immer die Hitze vom Tag, trotz der Ventilatoren, die sich in den Fenstern an den Enden der Gänge drehten. In das ratternde Gebläse mischte sich »Demons« von Imagine Dragons, das aus einem der Zimmer drang. Jemand brannte Räucherstäbchen ab, aber das schwere Parfum vermengte sich nur mit dem süßlichen Duft von Marihuana, statt ihn zu verdecken. Das war vermutlich Rachel, die Bethany und mir ein paar Joints angeboten hatte, bevor wir losgegangen waren.
Himmel, dieser Geruch. Ganz wie zu Hause – zumindest an den Tagen, an denen mein Bruder da ist. Dafür war Rachel unterhaltsamer als Nash. Und natürlich klüger.
Ich führte Bram zu unserem Zimmer, das dritte von links, kam aber kaum darüber hinaus, die Tür aufzuschließen. Bethanys Füße berührten kaum den Boden, da stürzte sie schon in den Gemeinschaftswaschraum.
»He!« Ich lief ihr nach, doch dann sah ich, wie eine der Toilettentüren zuschwang und ihre Knie auf dem Linoleumboden landeten. Also machte ich kehrt und ging zurück in den Flur und zu unserem Zimmer. Dabei sagte ich zu Bram: »Ich bringe ihr eine Zahnbürste und …«
Eine große Hand klatschte vor mir an die Wand, und ein weißer Hemdsärmel versperrte mir den Weg, sodass ich schlitternd zum Stehen kam.
Bram blickte wütend auf mich herab. »Wo hast du sie hingeschleppt?«
Automatisch ballte ich meine Hände zu Fäusten, doch ich biss die Zähne zusammen und verkniff mir die Antwort, die mir auf der Zunge lag. Vorsicht, Arschloch. Leg dich nicht mit mir an.
Ich hielt mich zurück. Seine Schwester hing über der Kloschüssel, und er war besorgt. Leute reagieren gereizt, wenn sie sich um einen geliebten Menschen sorgen.
Ich war schließlich auch gereizt. »In die alte KittyCat-Lounge am MLK-Boulevard. Eine der Studentenverbindungen hat sie gemietet. Bethany hat zwei Gläser getrunken …« Er öffnete den Mund, aber ich kam ihm zuvor: »Und ich habe sie die ganze Zeit im Auge behalten. Ihr wurde nichts eingeflößt.«
An seiner Schläfe pulsierte eine Ader. »Du weißt, dass sie noch nicht volljährig ist?«
»Nein, sag bloß.« Meinte dieser Typ das ernst? »Ich auch nicht, aber ich wette eine Million Dollar, dass du auch minderjährig warst, als du dich das erste Mal betrunken hast. Wen interessiert das?«
»Mich.« Er presste die Kiefer so fest aufeinander, dass es hätte knacken müssen. Seine breite Brust hob und senkte sich in tiefen Atemzügen, als würde er um Beherrschung ringen. Damit war er nicht allein. »Diese Art von Leichtsinn kann ihr Leben zerstören.«
»Ach wirklich?« Ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen. »Dann lass dir was sagen: Deine Familie ist reich. Nichts wird zerstört, wenn sie sich auf einer Party betrinkt. Selbst wenn sie morgen die Uni abbricht, wird sie danach ein Leben führen, von dem die meisten nicht mal träumen können.«
Ich hätte jedenfalls nicht halb so viel anstellen können wie Bethany, wenn sie wollte. Die Uni war für mich der einzige Weg zu einem einzigen Ziel. Ich konnte mein Leben ganz leicht ruinieren. Sie hätte sich verdammt anstrengen müssen.
Frustriert stieß er den Atem zwischen den Zähnen aus. »Ich rede nicht davon, dass sie sich betrunken hat, ich rede von ihrer Sicherheit. Hast du nicht bemerkt, dass sie noch nie bei einem Rave war?«
»Natürlich.« Schließlich hatte Bethany es mir gesagt.
»Trotzdem hast du sie mitgeschleift.«
Mitgeschleift? Sie war begeistert gewesen. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich sie nicht in Schwierigkeiten brachte, wenn ich das sagte.
Also nickte ich und schürzte die Lippen. »Du hast recht. Sie ist diesen wilden Leichtsinn nicht gewohnt. Also erkläre ich es zu meinem neuen Lebensziel, sie waghalsigen Situationen auszusetzen, damit sie lernt, damit umzugehen, nachdem du bei dieser Aufgabe so kläglich versagt hast. Wenn du mich jetzt also entschuldigst …«, ich duckte mich unter seinem Arm hindurch, »… kümmere ich mich um deine Schwester, statt hier tatenlos auf dem Gang zu stehen.«
Ich schlüpfte in unser Zimmer und schlug die Tür zu, halb in Erwartung, dass Bram hinterherstürzte, um weiter zu streiten. Dann hätte er etwas erleben können, denn ich neige zu Revierverhalten. Bramwell Gage schien mir der Typ zu sein, der einfach hingeht, wo es ihm passt, doch einen Schritt durch diese Tür, und ich hätte ihm den Kopf zurechtgerückt.
Mist, warum war ich gleich noch mal hier? Einen Moment lang sah ich mich verdattert um, bevor es mir wieder einfiel.
Bethany.
Unser Zimmer war ein einziges Chaos, überall lagen Pappkartons und Klamotten herum. Die Kartons, weil Bethany vor Kurzem einen Mini-Kühlschrank, eine Espressomaschine und einen Breitbildfernseher erstanden hatte, die alle am Nachmittag geliefert worden waren. Die Kleidung, weil sie ihren Schrank durchwühlt hatte, bevor sie sich für ein ähnliches Outfit wie meins entschieden hatte: ein eng anliegendes Camisole-Top und schwarze Shorts. Bei mir herrschte nur deswegen weniger Unordnung, weil ich nicht so viele Klamotten besaß.
Ich schnappte mir Bethanys Necessaire und das »Feeling like Shit?«-Notköfferchen, das Mom für mich zusammengestellt und mit Marker beschriftet hat – vermutlich, weil sie wusste, dass es mir beim Anblick der Aufschrift immer gleich besser gehen würde.
Hoffentlich hatte es auf meine Zimmergenossin die gleiche magische Wirkung.
Sie war noch immer in der Toilettenkabine. Ihr Bruder stand in der Tür zum Waschraum, die er mit dem Rücken offen hielt, und erkundigte sich mit tiefer Stimme, ob sie etwas bräuchte. Ich spürte, wie er mich ansah, als ich an ihm vorbeiging, doch ich sparte mir die Mühe, seinen Blick zu erwidern oder nachzusehen, ob er sich mittlerweile beruhigt hatte.
Keine Zeit für den Idioten.
»Hey, Fliegengewicht«, sagte ich, ging vor ihrer Kabine in die Hocke und schob ein Handtuch unter dem Spalt durch. »Leg dir das hier unter die Knie.«
Ein Stöhnen hallte in der Toilettenschüssel. »Ich glaube, ich bin fertig.«
»Okay. Ich hab dir deine Zahnbürste und ein paar andere Sachen gebracht.«
»Stell es bitte ans Waschbecken und geh, solange ich noch einen letzten Rest Würde besitze.«
»Ich bin mir ziemlich sicher, deine Würde hat sich über die Schuhe deines Bruders ergossen.«
»Oh, Mist. Ist Bram noch da draußen?«
»Ja«, antwortete er von der offenen Tür aus. »Und deine Würde hat meine Schuhe verfehlt.«
»Applaus für mich.« Der leichte Sarkasmus war offensichtlich zu viel für sie, denn sie stöhnte erneut. »Aspen, ernsthaft, ich habe Kotze auf dem Top. Lass mich allein, bis ich es gewaschen habe.«
»Ich hab dir deinen Pyjama gebracht.«
»Ich liebe dich.«
»Klar tust du das, ich bin ja auch so liebenswert. Okay, ich lass dir alles am Waschbecken. Nimm eine Ibuprofen und trink möglichst viel Wasser, sonst fühlst du dich morgen noch viel mieser.« Damit ging ich zurück auf den Gang, schob Bram aus dem Waschraum und schloss die Tür. »Sie braucht ein paar Minuten für sich.«
»Habe ich gehört.« Er sah mich durchdringend an. »Du machst das nicht zum ersten Mal.«
Wie konnte man es einem zur Last legen, sich um jemanden zu kümmern? Doch genau das tat er.
Ich riss die Augen in gespielter Bewunderung auf. »Großer Gott. Du bist ein echter Sherlock Holmes. Du siehst die Indizien und leitest den Tathergang ab. Du könntest recht haben. Vielleicht hatte ich schon mal mit Alkohol zu tun. Oder vielleicht, ganz vielleicht, kann ich lesen und habe irgendwo zwischen all den Worten eine Passage darüber gefunden, wie man einen Kater behandelt. Ich überlasse es deinem Genie herauszufinden, welche der Möglichkeiten zutrifft.«
Er presste die Kiefer zusammen. Wenn er so weitermachte, würde er bald keine Zähne mehr haben. Aber er hielt den Mund, wie ich gehofft hatte.
Die richtige Antwort lag ohnehin in der Mitte. Ich hatte schon öfter gefeiert. Ich mochte Partys. Das Leben ist kurz, man muss die Gelegenheiten nutzen.
Aber ich war nicht dumm. Ich hatte Pläne für die Zukunft und würde mich daran halten. Also musste ich auf mich aufpassen, weil es sonst niemand tat, mal abgesehen von Mom – der ich auf keinen Fall zur Last fallen wollte. Sie hatte es schon schwer genug.
Doch sein Schweigen dauerte nicht an. Bramwell Gage war noch nicht mit mir fertig.
»Du kennst Bethany noch nicht lange«, sagte er gepresst. »Dir ist vermutlich nicht klar, wie schüchtern sie ist und wie viel Mut es sie gekostet hat, zu Hause auszuziehen und …«
»Doch, das habe ich schon bemerkt.«
Er redete ungerührt weiter: »Sie ist nicht wie du.«
Tja, auch das hatte ich schon bemerkt. Dennoch stellten sich mir die Nackenhaare auf. »Ach, und wie bin ich deiner Meinung nach?«
Sein Blick wanderte auf direktem Weg zu meinen Haaren, als würden sie alles erklären. Ich hatte mein kurzes blondes Haar gerade erst pechschwarz gefärbt. Jetzt stand es ab wie die Stacheln eines Igels, deren Spitzen man in Blau getaucht hatte.
»Wow«, sagte ich trocken. »Gute Arbeit, Sherlock. Sie haben mich überführt.«
Seine braunen Augen wurden schmal, und er kam auf mich zu. Verdammt, ich hasse es, wenn Leute versuchen, mich mit ihrer Körpergröße einzuschüchtern. Ich hob das Kinn und wich nicht von der Stelle. Sollte er nur wagen, mir das vorzuhalten.
Und genau das tat er. »Du meinst, ich würde dich nach deinem Haar beurteilen? Falsch, es geht mir um dein ›Wen interessiert das?‹ und den Schwachsinn von wegen ›Bethany ist reich, was soll ihr schon passieren?‹. Du bist genau die Sorte Freundin, die sie im Moment nicht brauchen kann. Du gehst völlig in deiner kleinen Rebellion auf und bringst ihr ganzes …«
Die Toilettentür quietschte, und er verstummte. Seine Wut war wie weggeblasen, sein Gesicht komplett verändert. Bethany kam in ihrem kurzen Captain-America-Schlafanzug heraus und blieb gleich hinter der Tür wieder stehen. Ihr Blick fiel auf mich.
Dann runzelte sie die Stirn und betrachtete Bram. Trotz seiner veränderten Miene wusste sie offensichtlich sofort Bescheid. »Was ist los? Ihr zwei seht wütend aus.«
»Nein«, widersprach ich. »So schaue ich immer, wenn ich dringend pieseln muss. Entschuldigt mich.«
Als ich wieder aus dem Bad kam, war ihr Bruder verschwunden. Genau wie meine Wut. Er war ein eingebildeter Idiot gewesen, aber soweit ich es beurteilen konnte, hatte er sich Sorgen um seine Schwester gemacht – und ich hatte mich auch nicht gerade bemüht, die Situation zu entschärfen. Sobald er hochgegangen war, hatte ich zurückgeschlagen. Er hatte es verdient. Bis auf den Kommentar über den Reichtum der Familie. Das war mies von mir gewesen. Trotzdem hatte ich gesehen, wie wichtig ihm seine Schwester war, und das rechnete ich ihm hoch an.
Ich hätte also über unseren Zusammenstoß hinweggesehen – hätte Bram es auch getan.
Stattdessen kam Bethany am Tag darauf in unser Zimmer, völlig außer sich vor Wut. Sie schäumte, weil er vorgeschlagen hatte, ihr entweder eine eigene Wohnung zu besorgen oder das Wohnheim zu bitten, eine andere, passendere Zimmergenossin für sie zu finden.
»Ist das zu fassen?« Sie stapfte zum Fenster, wirbelte herum und breitete die Arme aus. »Er sagt zu mir: ›Sie kommt offensichtlich nicht damit klar, dass du Geld hast, und sie wird dich entweder übers Ohr hauen oder benutzen.‹ Also habe ich ihm erzählt, dass du mich noch nie um etwas gebeten oder dir etwas geliehen hast, aber er meinte nur: ›Eine Freundin wie sie ist im Moment einfach nicht gut für dich.‹ Also habe ich ihm gesagt, dass er ein totales Arschloch ist und ich ihm eine reinhaue, wenn er noch ein Wort darüber verliert, dass ich eine andere Zimmergenossin brauche.«
»Ein Arschloch«, stimmte ich zu, aber es war ein hohles Echo ihrer Worte. Ich wusste, dass sie mich nicht verletzen wollte, indem sie mir das erzählte. Sie dachte, es würde mich genauso wütend machen wie sie. Doch so war es nicht, sosehr ich es mir auch wünschte. Stattdessen war mir einfach nur schlecht, wie nach einem Schlag in den Magen. Es gelang nicht vielen, meinen Schutzpanzer zu durchdringen und mir das Gefühl zu geben, der letzte Dreck zu sein. Doch Bram hatte es geschafft.
Der schlechte Einstieg lag also wirklich ganz und gar an ihm.
In den folgenden vier Jahren hat sich unser Verhältnis nicht gebessert, aber wenigstens auch nicht verschlechtert. In kürzester Zeit hatte sich Bethany wieder mit ihm versöhnt und skypte regelmäßig mit ihm, aber ich wusste immer, wann, und mied unser Zimmer so lange. Wenn ich ihm nicht aus dem Weg gehen konnte, ignorierte ich ihn einfach. Meistens. Denn er konnte mich offensichtlich nicht ansehen, ohne über mich zu urteilen, und sagte unausweichlich etwas, das mich wieder auf die Palme brachte.
Aber wenn mich Bethany auf dieser Reise braucht, werde ich mir auf die Zunge beißen, bis sie blutet – und hoffen, dass es Bram genauso hält.
3
Als mein Handy das nächste Mal summt, gehe ich davon aus, dass mir Bethany schreibt. Vermutlich will sie mich informieren, dass ihr Bruder schon da ist, oder sie fragt, wann ich meinen Hintern zurück auf den Campus schwinge.
Irrtum. Es ist schon wieder meine Mutter.
Wir gehen jetzt zu einer Show. Viel Spaß, falls wir uns vor deiner Abreise nicht mehr sprechen. Pass auf dich auf, und grüß Bethany von mir.
Mach ich. Ich liebe dich.
Ich liebe dich auch.
Als hätte ich je daran gezweifelt.
Was für eine Fehleinschätzung von Bram. Vor vier Jahren hat er meine gefärbte Igelfrisur als Zeichen der Rebellion gedeutet, doch das war falsch. Meine Mom unterstützt mich in allem, es gibt also nichts, wogegen ich rebellieren müsste. Sie hat immer hinter mir gestanden, auch als ihre Karriere den Bach runterging, wir unser Haus verloren haben und Nash immer schwieriger wurde. Und selbst wenn sie mich einschränken würde, würde ich mich nicht auflehnen. All meine Bemühungen sind auch für sie, damit sie sich nicht um mich sorgen muss – zusätzlich zu all ihren anderen Sorgen.
Bram hat also keine Ahnung. Soll er mich ruhig für eine Rebellin halten. Ich erzähle ihm bestimmt nicht, dass ich mir während der letzten Chemo-Behandlung meines Vaters die Haare abrasiert habe und fast fünf Jahre brauchte, bis ich sie wieder wachsen lassen konnte, ohne mir wie eine Verräterin vorzukommen. Als bedeuteten ein paar Zentimeter Haare mehr, dass ich sein Leid vergesse und ihn hinter mir lasse.
Aber vermutlich würde Bram auch dazu etwas Herablassendes sagen. Er hat beide Eltern verloren, und laut Bethany hat er seine Schwester einfach aufgesammelt und ist kontinuierlich voranmarschiert.
Wie so ein pedantischer, neunmalkluger Roboter. Kann ich mir gut vorstellen.
Wenn er sich weiterhin von Vorurteilen leiten lässt, frage ich mich, was er aus meinem jetzigen Aussehen schließt. Mein Haar ist mittlerweile schulterlang, aber dunkel gefällt es mir einfach besser. Tönungen sind günstig, deshalb ist es kastanienbraun statt aschblond. Nach der Abschlussfeier habe ich Mom den größten Teil meiner Kleidung mit nach Hause gegeben, und jetzt trage ich das einzig halbwegs hübsche Stück, das auf diese Reise mitkommt – ein Sommerkleid mit Gänseblümchen-Print, das ich vor zwei Jahren im Schlussverkauf im Einkaufszentrum erstanden habe.
Vermutlich denkt er billiges Flittchen mit schlecht gefärbtem Haar.
Flittchen. Wie ich dieses Wort liebe. Ich sollte mich selbst so bezeichnen.
Ich stehe auf und halte mich an der Stange fest, als der Bus schlingernd zum Stehen kommt. Die Nummer zehn hält an der Nordseite des Campus’, ich muss also ein kurzes Stück bis zur Bibliothek laufen, wo Bethany auf unsere Taschen aufpasst.
Mein letzter Gang über den Campus. Schon wieder zieht sich mir die Kehle zusammen, aber diesmal nicht so schlimm. Reed wird mir fehlen. An einem privaten College mit lauter reichen Studenten zu studieren, war nicht immer leicht. Bram ist ein Arsch, aber keiner seiner Kommentare kommt an die Sprüche ran, die ich mir hier in Reed anhören musste. Trotzdem ist es alles in allem eine schöne Zeit gewesen. Ich habe mehr nette als ätzende Leute getroffen und fühle mich zwar nicht viel klüger als vorher, aber das liegt vermutlich nur daran, dass ich jetzt weiß, was ich alles nicht weiß.
Und das Unigelände ist einfach Wahnsinn. Sanfte grüne Hügel, riesige Bäume und ein glitzernder Bach, der mitten hindurchfließt. Im Winter ist es nicht so spektakulär, wenn es grau ist und regnet. Wohl aber im Herbst, wenn sich das Laub färbt. Oder im Frühling, wenn Blütenblätter wie Schneeflocken durch die Luft schweben. Und heute spürt man schon den Sommer. Ein lauer Wind gleicht die warme Sonne aus und streift mit perfekter Temperatur über die Haut.
Die Brücke über den Bach mündet auf den Weg, der an der Nordflanke der Eliot Hall entlangführt, einem großen Backsteingebäude wie aus einem Jane-Austen-Roman. Die Bibliothek, in der Bethany wartet, liegt östlich davon, gleich hinter einer Wendeschleife – doch als ich um die Ecke komme, fällt mein Blick auf einen grauen Range Rover, der mit offener Heckklappe in der Schleife parkt. Daneben steht eine bekannte Gestalt, den Blick aufs Handy gerichtet, und mir wird klar, dass ich gar nicht so weit laufen muss.
Bram ist schon da. Juhu.
Bethany ist nicht bei ihm, er muss also frisch angekommen sein – und gibt ihr vermutlich gerade Bescheid. Er sieht nicht glücklich aus, aber das überrascht mich nicht, denn er sieht nie glücklich aus. Okay, normalerweise sieht er auch nicht so frustriert aus wie jetzt, die Stirn herabgezogen, der Mund eine Linie. Meistens läuft er auf Robotermodus, und ich kann sein Gesicht kaum deuten.
Doch jetzt steht sein kurzes braunes Haar ab, als hätte er es zerrauft. Wie immer hat er das Sakko abgelegt, und Hose und Weste sitzen wie angegossen, während ihm der rote Schlips locker und etwas schief vom Hals hängt.
Verdammt, er ist praktisch aufgelöst.
Und so traurig es ist, bei seinem Anblick zieht sich bei mir alles zusammen, und es kribbelt auf der Haut. Ich weiß, dass er ein Idiot ist, aber es gibt kleine, dumme Bereiche in meinem Hirn, bei denen diese Erkenntnis noch nicht angekommen ist – oder denen es einfach egal ist. Und zufällig sind es jene Hirnregionen, die mit meinen weiblichen Zonen verbunden sind.
Ich weiß auch nicht, was er an sich hat. Es ist, als wäre sein Kopf von einer Wolke aus Leuchtpfeilen umgeben, auf denen Hier hinschauen steht. Selbst inmitten dieses Idylls aus weitläufigen Rasenflächen und kathedralenartigen Eichen ist es sein Gesicht, das meine Blicke auf sich zieht und nicht mehr loslässt. Und vermutlich würde ich auch in einem Raum voller Leute als Erstes Bramwell Gage erblicken.
Nicht, weil er heiß ist. Er sieht fantastisch aus, klar. Aber auf dem Campus wimmelt es von gut aussehenden Typen, und keiner hat diese Wirkung auf mich. Bei ihnen kann ich den Blick abwenden.
Aber vermutlich löst er in Wirklichkeit etwas ganz anderes in meinem Gehirn aus, nämlich die Kampf-oder-Flucht-Reaktion. Mein Blick wird von ihm angezogen, weil ich mich vor ihm in Acht nehmen muss. Es ist ihm schon mal gelungen, meinen Schutzwall zu durchbrechen und mich zu demoralisieren. Wenn ich ihm also begegne, meldet mein Gehirn: Gefahr!
Daher ist es nur logisch, dass sich mein Puls beschleunigt, sobald ich ihn sehe. Das ist keine Schwärmerei. Es ist Wissenschaft.
Außerdem macht mich Gefahr ein bisschen an, ich gebe es zu. Aber nicht so sehr, dass ich den Kopf verliere. Denn wirklich gefährlich wäre es zu vergessen, dass mich Bram für eine schäbige Schnorrerin hält.
Doch als er aufblickt und mich auf sich zukommen sieht, reagiert er anders als gewohnt. Normalerweise verhärtet sich sein Gesicht, als würde er noch einen Gang im Robotermodus hochschalten. Diesmal dagegen glätten sich seine Sorgenfalten, und sein Gesicht hellt sich auf, als ob er sich freuen würde, mich zu sehen.
Merkwürdig. Mein Kampf-oder-Flucht-Impuls wird stärker.
Ich bin noch zu weit von ihm entfernt, um ihn zu begrüßen, ohne zu schreien. Eine lange Sekunde blickt er mir also einfach nur entgegen, und noch nie war mir die Intensität seiner dunklen Augen so bewusst wie jetzt, während sie an mir hinabsehen, vom Scheitel bis zu den Sandalen – aber als er meinem Blick schließlich begegnet, ist er wieder da: Robotermodus. Der erfreute Ausdruck ist verschwunden.
Seine Manieren sind dagegen tadellos. Er kommt mir entgegen und streckt die Hand nach dem Schlafsack aus, den ich vor dem Bauch trage. Seine Hände sind groß wie die eines Holzfällers, aber die Nägel sind ordentlich geschnitten, und die blendend weiße Hemdmanschette bildet einen messerscharfen Kontrast zu seinem gebräunten Handgelenk.
»Lass dir das abnehmen, ich packe es in den Kofferraum.« Seine langen Finger umfassen den Kordelzug des Beutels.
Ich murmle ein »Danke« und gebe ihm den Schlafsack. Der raue Klang seiner Stimme passt überhaupt nicht zu seinem Auftreten. Passend wäre eine steife, tonlose Stimme. Stattdessen wird jedes Wort von einem tiefen Grollen untermalt, als läge grober Kies unter seinem glatten Erscheinungsbild.
Auch das ist heiß. Ich verstehe nicht, warum er keine näselnde Fistelstimme hat. Einfach Glück, nehme ich an. Glück für ihn, Pech für mich.
Es überrascht mich nicht, dass sich sein Blick wieder verfinstert, als er mich ein zweites Mal streift und sich dann suchend hinter mich richtet. »Ist das dein ganzes Gepäck? Und ist Beth nicht bei dir?«
»Nein, ich habe noch einen Rucksack bei Beth in der Bibliothek. Ich musste mir nur noch schnell einen Schlafsack kaufen.« Dabei hätte ich mir vielleicht einen bei Bram kaufen können. Es sieht aus, als hätte er ein halbes Sportgeschäft in seinem Auto. »Kommt sie gleich raus? Ich gehe ihr entgegen und helfe ihr beim Tragen.«
»Ich weiß es nicht«, entgegnet er und findet wie ein Roboter beim Tetris-Spiel die perfekte Lücke für meinen Schlafsack zwischen dem Rest der säuberlich verstauten Ausrüstung. »Ich bin seit einer halben Stunde hier, aber sie reagiert nicht auf meine Nachrichten.«
Na, so was. Schätzungsweise ist er deswegen so frustriert. »Ich hole sie. Wahrscheinlich hat sie ihr Handy stumm gestellt. Wegen Bibliothek und so.«
Ich sage es leichtfertig und lade ihn sogar mit einem Lächeln ein, sich mit mir über Bethanys Wahl eines Wartezimmers zu amüsieren. Seine Antwort ist ein knappes Nicken.
Wow, ich freue mich jetzt schon auf die Reise.
Mit einem tiefen Seufzer mache ich mich auf den Weg. Das Bibliotheksgebäude liegt gleich hinter der Schleife, an der Bram parkt, aber bis zum Eingang muss man einen Rasenabschnitt überqueren. Brams Augen brennen mir ein Loch in den Rücken, also ignoriere ich ihn und schicke selbst eine Nachricht an Beth.
Hallo! Bin wieder auf dem Campus. Dein Bruder ist auch hier. Bist du in einem der Seminarräume? Oder eingeschlafen?
Ich habe Bram verschwiegen, dass Bethany nicht ganz in der Bibliothek ist, sondern im großen offenen Vorraum, wo es Polsterbänke mit hohen Rückenlehnen gibt, die jede Menge Platz und Privatsphäre bieten, besonders in den ruhigen Sommerstunden. Dort habe ich Bethany zurückgelassen, die mit ihrem Handy herumspielen wollte, bis ich zurückkomme. Warum sie nicht antwortet, verstehe ich auch nicht. Selbst ein Toilettengang hätte keine halbe Stunde gedauert, und wie ich Bethany kenne, hätte sie Bram sogar vom Klo aus geantwortet.
Im nächsten Moment vibriert das Handy in meiner Hand, und ein Foto von Bethany Gage erscheint auf dem Display. Es ist ein älteres Bild, aufgenommen vor zweieinhalb Jahren, als sie mir dieses Handy zu Weihnachten geschenkt hat. Ihr braunes Lockenhaar ist mittlerweile kürzer, aber die ausgeprägten Wangenknochen, das spitze Kinn und die leuchtenden karamellfarbenen Augen hat sie noch immer.
Obwohl ich das Leuchten seit ein paar Monaten nicht mehr gesehen habe. Ich hoffe, die Reise bringt es zurück.
Ich melde mich mit: »Du bist der einzige Mensch der Welt, der lieber telefoniert als schreibt.«
Ihr Lachen perlt noch immer ein wenig. »Ich will eben keine Beweise hinterlassen!«
»Dann hast du Pech, denn ich zeichne dieses Gespräch auf.« Ich drücke die Tür zum Vorraum auf und suche die Ecke ab, in der ich Bethany zurückgelassen habe. Auf der Bank liegt nur eine alte College-Zeitung. »Hey, ich steh vor der Bibliothek. Wo steckst du?«
»Äh, tja …« Sie lacht erneut, aber diesmal klingt es tonlos und gezwungen, nicht mehr leicht und perlend. »Du wirst mich hassen.«
»Werde ich nicht«, verspreche ich, doch mein Magen zieht sich zusammen. Denn bei genauerem Hinhören wird mir bewusst, dass ihre Stimme etwas distanziert klingt – wie über die Freisprechanlage im Auto. »Sitzt du im Auto?«
»Ja.«
»Musst du umparken? Ich dachte, deine Parkgenehmigung ginge über den Sommer.«
»Tut sie auch, aber …« Sie holt so tief Luft, dass ich beinahe höre, wie sich ihr Brustkorb weitet, dann sagt sie hastig: »Ich bin auf dem Weg nach Seaside, zu diesem Serenity-on-the-Sand-Center. Ich habe angerufen, und es gab einen freien Platz, also melde ich mich für das achtwöchige Programm an.«
Ach du Scheiße. Unsanft lasse ich mich auf die Bank fallen und ringe um Worte.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Serenity on the Sand ist eine Entzugsklinik für Frauen, ein Ort, an dem sie Bethany helfen können, aber ich hätte nie gedacht, dass sie dorthin geht. Nicht, nachdem sie meinen vorsichtigen Vorschlag, Hilfe in Anspruch zu nehmen, mit einem Lachen abgetan hat. Sie meinte, es würde schon wieder, es sei nur eine schwierige Phase, keine große Sache.
Und ganz bestimmt habe ich nicht erwartet, dass sie ausgerechnet jetzt gehen würde.
»Okay«, sage ich gedehnt – aber weil ich nicht will, dass sie ihre Entscheidung anzweifelt, füge ich mit Nachdruck hinzu: »Das wird dir guttun. Kann ich irgendwas für dich tun?«
Nachdem sie ihrem Bruder nicht geantwortet hat, ahne ich bereits, was kommt. »Kannst du es Bram sagen?«
Ich wusste es. Das Ziehen in meinem Magen wird stärker, trotzdem antworte ich, ohne zu zögern: »Klar.«
»Aber sag ihm nicht, warum. Oder wohin ich fahre.«
Das … wird schon etwas schwieriger. »Was? Warum?«
»Er flippt sonst aus und ist total enttäuscht von mir und lässt mich keinen Schritt mehr allein gehen. Ich zieh das hier durch, werde vollkommen clean, und er muss nie davon erfahren.«
Glaubt sie wirklich, dass es so einfach ist? Ein paar Wochen, und die Sache ist erledigt? So funktionieren Süchte nicht.
»Ich glaube, du solltest es ihm sagen. Er flippt vielleicht kurz aus, aber er wird zu dir halten. Du weißt, dass er zu dir halten wird. Und er wird auch nicht enttäuscht sein.«
Bram ist ein Idiot, aber er würde alles für seine Schwester tun. Sie hat mir tausend Mal erzählt, wie er in die Rolle der Eltern geschlüpft ist, nachdem sie gestorben sind. Sie stehen sich nahe. Viel näher als mein Bruder und ich. Er kümmert sich rührend um sie. Klar übertreibt er manchmal dabei, aber er würde sich eher die Hand abhacken, bevor er ihr wehtut.
Außerdem sind ihre Erfolgsaussichten nach der Therapie vermutlich besser, wenn jemand wie Bram hinter ihr steht. Es bringt nichts, es vor ihm zu verstecken.
»Ich möchte einfach nicht, dass er davon erfährt«, sagt sie kleinlaut. »Ich schaffe es nicht, wenn er Bescheid weiß.«
Lieber Gott. Ich kneife die Augen zu und suche nach Argumenten, um sie zu überzeugen.
Mein Schweigen verunsichert sie. Ihre Stimme bekommt einen schrillen, panischen Klang. »Wenn du es nicht kannst, Aspen, drehe ich um und komme zurück und vergesse die Sache. Also sag mir, wenn du es nicht kannst.«
»Nein«, sage ich. »Dreh nicht um. Ich mach das schon.«
»Versprich mir, dass du ihm nicht sagst, warum. Versprich es mir.«
»Ich verspreche es.« Und bete, dass ich es nicht bereuen werde. Ich reibe mir die Stirn und versuche, die einsetzenden Kopfschmerzen wegzumassieren. »Was soll ich ihm erzählen?«, frage ich.
»Sag ihm, dass ich etwas Eigenständiges tun wollte. Mich der Zukunft zuwenden, statt in der Vergangenheit zu schwelgen. Das wird ihm gefallen.«
Ganz klar. Das wird großartig ankommen. »Wie zum Beispiel …?«
»Irgendein Besinnungskurs vielleicht, wo er mich nicht erreichen kann, denn sie werden mir Handy und Laptop abnehmen, wenn ich dort ankomme. Die Frau hat gesagt, sie empfehlen, mindestens drei, vier Wochen sämtliche Kontakte nach außen abzubrechen. Damit ich mich auf die Heilung konzentrieren kann.«
Na prima. Bram kann noch nicht mal mit Bethany sprechen, um sich bestätigen zu lassen, was ich ihm erzähle? Er wird ausrasten.
Und ich kann es ihm nicht verübeln. Aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Hier geht es um seine Schwester. »Okay, irgendein Programm für Freaks, bei dem man den ganzen Tag lang Avengers-Fanfiction liest?«
Ihr Lachen perlt wieder. »Das vielleicht nicht gerade. Aber wie wäre es mit einem Kurs für kreatives Schreiben?«
»Du bist keine Schriftstellerin.« Meine Freundin hat es mehr mit Mathe und Statistik.
»Aber ich wollte einmal eine werden. In meiner Harry-Potter-Phase. Daran wird er sich erinnern. Sag ihm einfach, ich wollte mich noch einmal vergewissern, ob das MIT wirklich der richtige Weg für mich ist.«
Es ist ein merkwürdiger Zeitpunkt dafür, aber etwas Besseres wird uns so schnell nicht einfallen. »Okay. Aber er wird sich wundern, warum du ihm das nicht selbst erzählst.«
»Ich weiß. Aber ich kann ihn nicht anlügen. Ich knicke auf der Stelle ein, wenn er mich bedrängt. Du nicht. Du hältst dagegen.«
Ich muss gegen meinen Willen lachen. Da hat sie recht.
»Es wird schon nicht schlimm sein. Wahrscheinlich ist er froh, weil er so viele Meetings verschieben und alles Mögliche umorganisieren musste, um sich den Monat freizuschaufeln. Jetzt kann er seine Termine doch noch einhalten.«
Die Rettung für Roboter Bram. Ich hoffe, sie hat recht. »Das klingt ja fast, als würdest du ihm einen Gefallen tun. Jetzt kann er sich wieder daranmachen, seine Milliarden zu verdienen.«
»Ganz genau. Einen Gefallen!« Sie lacht. »Ach ja! Ich gebe deine Nummer als Notfallkontakt an, sollte also eine unbekannte Nummer bei dir anrufen, drangehen und nicht abweisen, wie du es sonst immer tust.«
Ich gehe immer davon aus, dass Anrufer eine Nachricht hinterlassen, wenn es wirklich wichtig ist. Aber ich kann die nächsten zwei Monate eine Ausnahme machen. »Okay.«
»Und es tut mir wirklich leid, Aspen.«
»Was?«, frage ich mit gerunzelter Stirn.
»Dass ich unsere Reise platzen lasse.«
»Ach so. Nein, das ist schon in Ordnung.« An die Reise hatte ich noch gar nicht gedacht. Und ich will auch nicht darüber nachdenken, dass mir das eigentlich ganz recht ist, weil ich mir jetzt einen Job suchen und den Sommer über ein bisschen Geld verdienen kann. Es käme mir mies vor, davon zu profitieren, dass sie krank ist. »Pass einfach auf dich auf.«
»Ich versuche es«, erwidert sie, dann seufzt sie tief, als hätte sie gerade eine Herkulesaufgabe bewältigt und sich von einer ungeheuren Last befreit. »Ich hab dich lieb, Aspen. Vielen Dank.«
Meine Augen brennen. »Ich hab dich auch lieb, Beth. Ruf mich an, wenn du kannst, okay?«
»Mach ich.«
Sie legt auf. Ich habe eine Aufgabe zu erledigen, doch ich stehe nicht sofort auf, denn mal ehrlich – ich muss meinen Mut zusammennehmen.
Es wird nicht gut gehen.
Ich stoße einen bebenden Seufzer aus, und mein Blick fällt auf die verwaiste College-Zeitung auf der Bank neben mir. Okay. Wenigstens ahne ich jetzt, warum Bethany so überstürzt aufgebrochen ist. In der rechten Spalte auf der Titelseite steht ein Nachruf auf eine Studentin, die direkt vor den Prüfungen an einer Überdosis gestorben ist. Vermutlich hat Bethany das gelesen und es mit der Angst zu tun bekommen.
Wahrscheinlich ist es auf lange Sicht das Beste. Auf kurze Sicht dagegen … Mist, das wird hässlich.
Aber ich würde noch ganz andere Sachen für Bethany tun, und sie auch für mich, da bin ich mir sicher. Fast komisch, wenn ich jetzt daran denke, wie schüchtern sie mir vor vier Jahren erschien, als wir uns kennengelernt haben. Sie war auch schüchtern, zumindest ein bisschen. Aber es brauchte fast ein ganzes Semester, bis ich merkte, dass Bethanys Zurückhaltung in Wirklichkeit die Angst war, niemand könnte sie um ihrer selbst willen mögen – und dass es einen Grund dafür gab, warum sie mir nie ein Bild von ihrem Bruder zeigte, bevor er aufkreuzte. Denn sie hatte schlechte Erfahrungen mit sogenannten Freundinnen gemacht. Mit Mädchen, die ihre Freundschaft gesucht hatten, um an ihren Bruder heranzukommen. Als wir uns also kennenlernten, war es ihr wichtig, dass ihr Bruder nichts mit unserer Freundschaft zu tun hatte – und als er schließlich auftauchte, hat es vermutlich nicht geschadet, dass ich ihn auf Anhieb doof fand.
Ich selbst wünschte mir die Freundschaft mit ihr genauso, kämpfte aber mit ganz anderen Ängsten. Auch ich hatte schon Freundinnen. Sie haben mich nicht ausgenutzt. Aber irgendwie hat sich das Geld zwischen uns gestellt.
Genauer gesagt der Umstand, dass ich keins hatte.
Dabei war es keine böse Absicht gewesen. Es war einfach … geschehen. Bevor mein Vater krank wurde, waren wir eine solide Mittelschichtfamilie, und meine Freunde, die ich seit der Grundschule kannte, kamen ebenfalls aus der Mittelschicht. Dann hatte meine Familie plötzlich kein Geld mehr, und die kleinen Extras außerhalb der Schule waren einfach nicht mehr drin. Irgendwann wurde ich nicht mehr zu Freizeitaktivitäten und Partys eingeladen – und als ich sie darauf ansprach, erklärten sie mir verlegen, sie meinten, ich hätte nicht genug Geld dafür.
Und das hatte ich auch nicht. Ich weiß, dass sie es gut meinten – sie dachten, sie würden mir die Peinlichkeit ersparen, ihre Einladungen ablehnen zu müssen. Aber so war es nicht.
Dann mussten wir unser Haus aufgeben und zogen in ein anderes Viertel, und es spielte ohnehin keine Rolle mehr. An der Highschool lernte ich neue Freunde kennen, die nicht mehr Geld hatten als ich, aber ich vergaß nie, dass manche Freundschaften nicht umsonst sind.
Deswegen hatte ich Angst, als ich nach Reed kam – ausgerechnet ich, an einem privaten College mit lauter reichen Studenten! – und Bethany meine Zimmergenossin wurde. Ich wollte ihr von Anfang an zeigen, dass wir auch ohne viel Geld Spaß haben können – zum Beispiel bei dem Rave, auf den ich sie an dem Abend mitnahm, als ich Bram traf.
Da waren wir also, zwei Erstsemestlerinnen an der Uni mit dem sehnlichen Wunsch, um unserer selbst willen gemocht zu werden, ganz gleich, mit wem wir verwandt waren oder wie viel Geld wir hatten. Und eines Abends, als wir zu zweit in unserem Zimmer waren, sturzbetrunken, kam alles ans Licht.
In dieser Nacht wurde Bethany zu mehr als einer Freundin. Sie wurde meine beste Freundin. Und ich ihre.
Ich würde alles für sie tun. Bram anzulügen, ist noch das Geringste. Doch das heißt nicht, dass es leicht wird.
Ich stähle mich mit einem tiefen Atemzug und stehe auf. Bringen wir es hinter uns.
Mit gestrafften Schultern gehe ich auf den Ausgang zu – bleibe aber stehen, als sich mein Handy meldet. Eine Nachricht von Bethany.
Dein Rucksack liegt an der Bücherausgabe.
Ach ja, der Rucksack. Der Großteil meiner Kleidung ist da drin, ich werde ihn also brauchen. Was ich dagegen nicht mehr brauche, ist mein brandneuer Schlafsack.
Mist, hoffentlich habe ich den Kassenzettel aufgehoben.
Der Weg über den Rasen zurück zum Wagen erscheint mir länger als der Hinweg. Diesmal bohrt sich Brams Blick nicht in meinen Rücken, diesmal blicke ich ihm entgegen, und jeder Schritt kostet mich mehr Überwindung.
Es ist offensichtlich, dass ich ohne Bethany komme. Ich sehe, wie er den Rucksack mustert, den ich mir über die Schulter geworfen habe. Es ist außerdem offensichtlich, dass ich das Gepäck bei mir habe, auf das Bethany aufpassen sollte. Vermutlich denkt er, dass Bethany gleich nachkommt. Dass sie vielleicht vor der Fahrt zum Mount Hood zur Toilette gegangen ist.
Ich suche fieberhaft nach einem Weg, es ihm schonend beizubringen, aber es gibt einfach keinen. Also lasse ich ein paar Schritte von ihm entfernt die Bombe platzen.
»Bethany kommt nicht.«
Seine Stirn zieht sich zusammen. »Was?«
»Sie sagt die Reise ab und macht stattdessen einen Workshop über kreatives Schreiben an der Küste.«
Es ist nicht verwunderlich, dass er mich nicht versteht. Forschend blickt er in mein Gesicht, dann in Richtung Bibliothek, als erwarte er, dass seine Schwester jeden Moment auftaucht. Als er einen Schritt nach vorne macht, als wollte er selbst nach ihr suchen, verstelle ich ihm den Weg.
Er schaut von oben auf mich herab. Sein Kiefer tritt hervor, und die Haut spannt über seinen Wangenknochen. Einen Moment lang glaube ich, er wird mich hochheben und zur Seite stellen. Doch er rührt mich nicht an.
Stattdessen presst er hervor: »Das ist nicht lustig.«
»Da gebe ich dir recht. Es ist auch kein Witz«, erkläre ich. »Sie hat mich gerade angerufen. Sie sitzt schon im Auto und ist unterwegs.« Als sein Blick auf meinen Rucksack fällt, füge ich hinzu: »Den hat sie an der Bücherausgabe für mich hinterlegt. Ehrlich, ich schwöre, ich verarsch dich nicht.«
Ich zeige ihm das Handy mit unseren Nachrichten. In der ersten vom Vormittag frage ich Bethany, wann Bram zum Campus kommt, in der letzten erkundige ich mich, ob sie eingeschlafen ist, gefolgt von ihrer Nachricht, wo ich meinen Rucksack finde.
Kopfschüttelnd sieht er auf. Er versteht es noch immer nicht, und es überrascht mich nicht, als er sein eigenes Handy zückt und darauf herumtippt.
Er will sie selbst anrufen. »Was genau hat sie gesagt?«
»Dass dieser Workshop …«
Ich werde von Bethanys Voicemail-Ansage unterbrochen, denn Bram hat sein Handy auf laut gestellt. Es hat kein einziges Mal geklingelt. Sie hat ihr Handy ausgeschaltet – und nachdem ich gerade noch mit ihr gesprochen habe, heißt das, sie hat es nur getan, damit ihr Bruder sie nicht erreichen kann.
Ich beiße mir auf die Lippe, während Bram zum gleichen Schluss kommt. Der Schreck lässt sein Gesicht erschlaffen, als hätte man ihn geohrfeigt, und ich frage mich, ob Bethany ihr Handy schon jemals ausgeschaltet hat, damit er sie nicht anrufen kann.
Vermutlich nicht.
Ruhig fahre ich fort: »Sie meinte, mit diesem Workshop könnte sie herausfinden, ob sie sich auch wirklich für die richtige Laufbahn entschieden hat. Denn wenn nicht, möchte sie auf keinen Fall die Chance vertun, etwas anderes zu machen.«
»Die Chance vertun, Schriftstellerin zu werden?« Er hätte genauso gut Trapeztänzerin sagen können, so ungläubig klingt er.
»Ich war auch überrascht«, sage ich ehrlich. »Aber sie meint, sie hätte früher viel geschrieben. In ihrer Harry-Potter-Phase.«
Er blinzelt. Blinzelt noch mal. Als wäre das ein erneuter Schlag. Er zieht die Finger durchs Haar, tritt einen Schritt zurück und blickt in den Himmel. Frustriert. Aber er denkt darüber nach.
Schließlich sieht er mich an. Noch immer ist seine Stirn gekräuselt. »Warum ausgerechnet jetzt?«
Ich ziehe die Schultern hoch. »Keine Ahnung. Sie sagte etwas von wegen ›den Blick in die Zukunft richten, statt in der Vergangenheit zu schwelgen‹.« Wenn ich so recht überlege, kommen mir die Worte bekannt vor. »Vielleicht hat sie sich die Abschlussrede bei unserer Zeugnisvergabe zu Herzen genommen. Der Redner hat was in diese Richtung gesagt.«
Meine letzte Bemerkung ruft eine unerwartet heftige Reaktion hervor. Bram wird blass, sein Gesicht verzieht sich.
Er wendet den Kopf. Als er spricht, klingt seine Stimme noch rauer als zuvor: »Ist es, weil ich letztes Wochenende nicht zur Abschlussfeier gekommen bin?«
Sein Flieger nach Portland hatte sich verspätet, auf dem Rückweg von einer Geschäftsreise in den Westen. Jetzt tut es mir leid, dass ich die Feier erwähnt habe.
»Nein.« Wäre es nicht Bram gewesen, hätte ich seinen Arm berührt, um meinen Worten Nachdruck zu verleihen. Stattdessen verschränke ich die Arme vor der Brust. »Sie wusste, dass du deine Termine zusammenschieben musstest, um einen Monat für die Reise freizunehmen, und keinen Spielraum für Umbuchungen hattest. Und dass du wirklich kommen wolltest.«
Im Grunde war er praktisch dabei gewesen. Vor der feierlichen Zeugnisvergabe hat er mit Bethany geskypt und sie in Talar und Doktorhut gesehen. Er hat sogar mir steif gratuliert, nachdem sie uns gezwungen hat, einander zu begrüßen. Und ich habe ein Video von ihrem Gang zum Podium gemacht, das sie ihm geschickt hat. Er hat also nicht viel verpasst.
Aber Bethany ging es letztes Wochenende nicht gut, und ich weiß nicht, was sie hatte. Sie war mit meiner Mom, meiner Tante und mir beim Essen – und trank zu viel dabei –, doch als ich vorschlug, den Rest des Wochenendes nicht bei meiner Mom zu Hause zu verbringen wie geplant, sondern mit ihr, bestand sie darauf, dass ich gehe. Sie meinte, sie wollte sich in unserem Zimmer vergraben, Jessica Jones schauen und viel schlafen.
Als ich am Montag zurückkam – und zwar um vier Uhr morgens, weil mich meine Mutter und meine Tante auf dem Weg zum Flughafen absetzten –, sah sie aus, als hätte sie gar nicht geschlafen. Oder auch nur Zeit im Bett verbracht und ferngesehen. Bis heute weiß ich nicht, was sie getrieben hat, mit wem oder wo. Ich weiß nur, dass sie blass war und verstört wirkte, dass sie nach Gras und Alkohol roch und auf keinen Fall darüber reden wollte.
Wüsste Bram davon, würde er sich schuldig fühlen. Verdammt, ich fühle mich ja selbst schuldig. Ich habe den Verdacht, dass dieser Nachruf in der Campuszeitung nicht das Einzige war, was sie verschreckt und zu diesem Schritt bewogen hat.
»Sie meinte, du wärst vermutlich froh«, fahre ich jetzt fort. »Weil du so viele Termine verschieben musstest, und jetzt kannst du sie doch einhalten.«
Er sieht mich ungläubig an. »Froh«, wiederholt er tonlos.
Und ich weiß nicht, was ich sagen soll, denn glücklich habe ich ihn selten erlebt, aber so richtig unglücklich noch nie. Bis jetzt. In seinen Augen spiegeln sich Sorge und Verwirrung und Schuld, und ich glaube, dass ihm seine Geschäftstreffen total egal sind.
Aus seiner Stimme klingt verhaltener Schmerz, als er über den Rasen blickt und mich fragt: »Warum hat sie mir das nicht einfach selbst erzählt?«
Ich bleibe so nah an der Wahrheit wie möglich: »Sie hatte Angst, sich nicht vor dir behaupten zu können und dann doch nicht zu gehen.«
»Warum sollte sie sich vor mir behaupten müssen?«





























