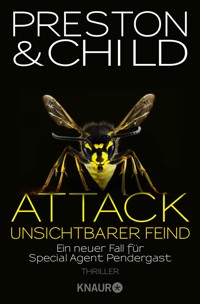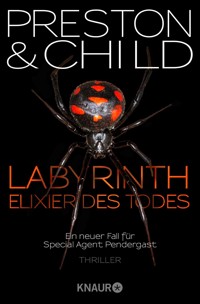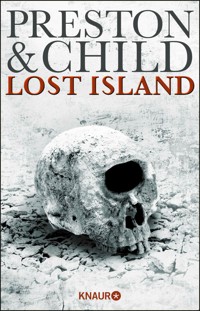
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Gideon Crew
- Sprache: Deutsch
Agent Gideon Crew erhält den Auftrag, aus einer Ausstellung in New York eine bestimmte Seite aus einer berühmten frühmittelalterlichen Handschrift zu stehlen. Ein gefundenes Fressen für den begnadeten Kunstdieb – der Coup gelingt. Auf dem Pergament schimmert eine alte Seekarte hindurch. Sie kündet von einer Reise, die vor Jahrtausenden in der Ägäis begann und zu einer Karibikinsel führte. Dort gab es offenbar eine Heilpflanze, die Kranke gesund macht und das Leben verlängert. Klar, dass dies ein Milliardengeschäft wäre. Gideon bricht zu einer hochgefährlichen Expedition auf, um die Insel ausfindig zu machen, und er wird den Verdacht nicht los, dass die alte Karte womöglich die Irrfahrten des Odysseus abbilden könnte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Douglas Preston / Lincoln Child
Lost Island Expedition in den Tod
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Agent Gideon Crew erhält den Auftrag, aus einer Ausstellung in New York eine bestimmte Seite aus einer berühmten frühmittelalterlichen Handschrift zu stehlen. Ein gefundenes Fressen für den begnadeten Kunstdieb – der Coup gelingt. Auf dem Pergament schimmert eine alte Seekarte hindurch. Sie kündet von einer Reise, die vor Jahrtausenden in der Ägäis begann und zu einer Karibikinsel führte. Dort gab es offenbar eine Heilpflanze, die Kranke gesund macht und das Leben verlängert. Klar, dass dies ein Milliardengeschäft wäre. Gideon bricht zu einer hochgefährlichen Expedition auf, um die Insel ausfindig zu machen, und er wird den Verdacht nicht los, dass die alte Karte womöglich die Irrfahrten des Odysseus abbilden könnte …
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
Epilog
Danksagung
Über die Autoren
Lincoln Child widmet dieses Buch seiner Frau Luchie
Douglas Preston widmet dieses Buch Joshua Reynolds
1
Das Konferenzzimmer im Gebäude der Effective Engineering Solutions leerte sich. Nachdem alle gegangen waren, blieb Gideon Crew mit Eli Glinn und Manuel Garza allein in dem spartanischen Raum hoch über den Straßen von Manhattan zurück.
Mit seiner verkrüppelten Hand deutete Glinn auf einen Stuhl am Konferenztisch. »Gideon, bitte setzen Sie sich.«
Gideon nahm Platz. Er spürte bereits, dass diese Besprechung, die mit einer Feier seines erfolgreichen Abschlusses des jüngsten Projekts für EES begonnen hatte, zu etwas anderem mutierte.
»Sie haben große Strapazen durchgemacht«, sagte Glinn. »Nicht nur die körperlich anstrengende Verbrecherjagd, sondern auch die, ähm, emotionale Belastung. Sind Sie sicher, dass Sie sich gleich in etwas Neues stürzen wollen?«
»Ja, ganz sicher«, antwortete Gideon.
Glinn sah ihn aufmerksam an – ein langer, forschender Blick –, dann nickte er. »Ausgezeichnet. Es freut mich zu hören, dass Sie bei uns bleiben wollen, als unser …«, er hielt inne, suchte nach einem Wort, »… Sonderbeauftragter. Wir buchen Ihnen eine Suite in einem Hotel um die Ecke, damit Sie eine Bleibe haben, solange Sie sich eine Wohnung suchen. Ich weiß ja, wie sehr Sie es hassen, Ihrem geliebten Santa Fe fern zu sein, aber gerade jetzt ist es sehr interessant in New York. Zum Beispiel läuft in der Morgan Library gerade eine Sonderausstellung – das Book of Kells, eine Leihgabe der irischen Regierung. Sie haben natürlich schon einmal vom Book of Kells gehört?«
»Vage.«
»Es handelt sich um die schönste illuminierte Handschrift, die weltweit existiert. Sie gilt als Irlands größter nationaler Schatz.«
Gideon schwieg.
Glinn sah auf seine Armbanduhr. »Wollen Sie sie sich nicht einmal zusammen mit mir anschauen? Ich bin ein großer Liebhaber illuminierter Handschriften. Jeden Tag wird eine Seite umgeblättert. Sehr aufregend.«
Gideon zögerte. »Illuminierte Handschriften sind nicht gerade mein Interessengebiet.«
»Ah, aber ich hatte so gehofft, Sie würden mich zu der Ausstellung begleiten«, sagte Glinn. »Sie werden das Book of Kells lieben. Es ist bisher nur ein einziges Mal außerhalb Irlands ausgestellt worden, außerdem ist es nur eine Woche hier. Es wäre schade, wenn Sie die Ausstellung verpassen. Wenn wir gleich gehen, kommen wir gerade noch rechtzeitig zur letzten Stunde, bevor das Museum schließt.«
»Vielleicht könnten wir am Montag hingehen.«
»Und die Seite verpassen, die heute ausgestellt wird – für immer? Nein, wir gehen sofort los.«
Gideon musste lachen, Glinns Ernsthaftigkeit amüsierte ihn. Der Mann hatte ja so obskure Interessen. »Ehrlich gesagt ist mir das verdammte Book of Kells völlig egal.«
»Ah, das wird aber nicht so bleiben.«
Als er die Schärfe in Glinns Ton vernahm, stutzte Gideon. »Und warum?«
»Weil Ihr neuer Auftrag sein wird, es zu stehlen.«
2
Gideon betrat hinter Eli Glinn den East Room der Morgan Library. Obwohl der prächtige Saal voller Besucher war, bot er einen überwältigenden Anblick. Gideon war seit der Renovierung nicht mehr in der Morgan gewesen – er hatte ihre Schätze immer allzu verführerisch gefunden – und sofort wieder verzaubert von den bemalten Gewölbedecken, den zweistöckigen Reihen prachtvoller Folianten, dem gewaltigen Marmorkamin, den opulenten Wandteppichen, dem Mobiliar und dem dicken burgunderfarbenen Teppich. Glinn, der den Joystick seines elektrischen Rollstuhls mit seiner klauenähnlichen Hand steuerte, rollte aggressiv in den Raum, wobei er sich vordrängelte und den Umstand nutzte, dass die Leute Behinderten in der Regel Platz machten. Nicht lange, und sie waren ganz vorn in der Schlange angekommen, wo das Book of Kells in einer großen Vitrine ausgestellt war.
»Was für ein Raum«, murmelte Gideon und blickte sich um. Instinktiv nahm er die vielen aggressiv sichtbaren Details der hochmodernen Security wahr, angefangen von den aufmerksamen Wachleuten, über den einzigen Eingang und die Kameraobjektive, die in den Deckenprofilen blinkten, bis hin zu den Bewegungsmeldern und Infrarotlaseranordnungen. Und das war noch nicht alles, denn beim Betreten des Saals war ihm auch die Seitenkante der massiven Stahltür aufgefallen, mit der sich der Raum im Handumdrehen verriegeln ließ.
Glinn folgte seinem Blick an die Decke. »Wunderschön, nicht wahr? Die Gemälde dort stammen von H. Siddons Mowbray, die Spandrillen zeigen die zwölf Tierkreiszeichen. J. P. Morgan war Mitglied in einem exklusiven Dining-Club, der nur zwölf Mitglieder aufnahm, von denen jedes einen Codenamen besaß – die Bezeichnung eines Tierkreiszeichens. Es heißt, die Anordnung der Zeichen und die anderen seltsamen Symbole in den Deckengemälden bezögen sich auf Schlüsselereignisse in seinem Leben.«
Gideons Blick fiel auf den großen Kamin, der die eine Seite des Saals zierte. Sogar in dessen fein gemeißelten Einkerbungen waren Sicherheitseinrichtungen zu erkennen. Einige davon hatte er noch nie gesehen. Und ihre Funktionsweise verstand er auch nicht.
»Der Wandteppich über dem Kamin«, fuhr Glinn fort, »ist flämisch, aus dem sechzehnten Jahrhundert. Er stellt eine der sieben Todsünden dar, die Habgier.« Er lachte leise auf. »Interessante Wahl von Mr. J. Pierpont Morgan, finden Sie nicht?«
Gideon wandte seine Aufmerksamkeit der Vitrine zu, in der das Book of Kells ausgestellt war. Keine Frage, das Glas war kugelsicher, und es handelte sich auch nicht um die übliche blaue Sorte, sondern um Panzerglas – wahrscheinlich zweischalig, Sicherheitsstufe P6B –, was es nicht nur kugelsicher machte, sondern auch vor Explosionen, Hammerschlägen und Axthieben schützte. Er spähte in die Vitrine und ignorierte dabei den sagenhaften und unersetzlichen Schatz, den es barg. Stattdessen musterte er die mehrstufige Sicherheitsvorkehrung darin und ordnete sie ein: Bewegungsmelder, Sensoren zur Messung des atmosphärischen Drucks, Infrarot-Wärmedetektoren und sogar etwas, das wie ein Sensor zur Messung der Luftzusammensetzung aussah.
Ganz klar: Jede Störung würde dazu führen, dass die Stahltür sich augenblicklich schloss – wodurch der Saal verriegelt würde und der Dieb darin eingeschlossen wäre.
Und das waren nur die sichtbaren Sicherheitsmaßnahmen.
»Atemberaubend, nicht wahr?«, sagte Glinn leise.
»Es jagt mir eine Heidenangst ein.«
»Wie bitte?« Glinn blickte verwirrt drein.
»Entschuldigen Sie. Sie meinten sicher das Buch …« Er betrachtete es zum ersten Mal. »Interessant.«
»So könnte man es auch ausdrücken. Die Ursprünge des Buchs liegen im Dunkeln. Manche behaupten, der heilige Columban persönlich habe es um 590 nach Christus geschaffen. Andere glauben, unbekannte Mönche hätten es zweihundert Jahre später hergestellt, zur Feier seines zweihundertsten Todestages. Die Herstellung des Buchs wurde in Iona begonnen, anschließend wurde es in die Abtei in Kells gebracht, wo die Buchmalereien hinzugefügt wurden. Und dort wurde es gut versteckt aufbewahrt, denn die Abtei wurde immer wieder von Wikingern überfallen und geplündert. Die haben das Buch aber nie gefunden.«
Gideon schaute sich die Handschrift genauer an. Wider Willen faszinierten ihn die erstaunlich komplexen abstrakten Muster, die in ihrer Tiefe geradezu fraktal wirkten.
»Bei der heute ausgestellten Seite handelt es sich um das Folio 34r«, erklärte Glinn. »Das berühmte Chi-Ro-Monogramm.«
»Chi Ro? Was ist das?«
»Chi und Ro sind im Griechischen die ersten beiden Buchstaben des Wortes Christus. Die eigentliche Erzählung des Lebens Jesu beginnt im Matthäusevangelium mit Vers eins, Abschnitt achtzehn. In den frühen illuminierten Evangelien hat man diese Seite oft verziert. Das erste Wort der Erzählung lautet Christus. Im Buch von Kells nehmen diese ersten beiden Buchstaben, Chi und Ro, die gesamte Seite ein.«
Die Besucher hinter ihnen begannen zu drängeln, und Gideon spürte, wie ihm jemand mit dem Ellbogen einen leichten Stoß versetzte.
Im Flüsterton fuhr Glinn fort: »Sehen Sie sich diese verschlungenen Verzierungen an! Man kann alle Arten von seltsamen Dingen darin entdecken – Tiere, Insekten, Vögel, Engel, winzige Köpfe, Kreuze, Blumen. Von den atemberaubend komplexen Flechtwerkmustern ganz zu schweigen, der Traum eines jeden Mathematikers … Und dann diese leuchtenden Farben! Das Gold, das Grün, das Gelb, das Violett! Das ist die bedeutendste Seite der bedeutendsten illuminierten Handschrift, die es gibt. Kein Wunder, dass das Buch als größter nationaler Schatz Irlands gilt. Schauen Sie es doch nur einmal an!«
Es war das erste Mal überhaupt, dass Gideon in Glinns Tonfall so etwas wie Bewunderung hörte. Er beugte sich weiter vor, so nahe an die Vitrine, dass sein Atem das Glas beschlug.
»Entschuldigen Sie, aber andere Besucher möchten auch drankommen«, ließ sich von weiter hinten eine ungeduldige Stimme vernehmen.
Als kleinen Test streckte Gideon die Hand aus und legte sie an das Glas.
Sofort erklang ein leises Piepen, und ein Wachmann rief aus: »Hände weg von dem Glas, bitte! Sie, Sir – Hände weg!«
Das brachte Stimmung in die ungeduldige Menschenmenge. »Nun machen Sie schon, Freundchen, lassen Sie auch mal jemand andern ran!«, tönte die Stimme eines Besuchers. Etliche murmelten ihre Zustimmung.
Mit einem langen Seufzer des Bedauerns umfasste Glinn mit seinem verkümmerten Finger den Joystick. Leise surrend fuhr der Rollstuhl zur Seite, Gideon hinterdrein. Einige Augenblicke später standen sie wieder draußen auf der Madison Avenue, der Verkehr brauste vorbei, Taxis hupten.
Im grellen Licht kniff Gideon die Augen zusammen. »Nur damit ich Sie richtig verstehe: Sie wollen, dass ich das Buch stehle?«
Beruhigend legte Glinn ihm die Hand auf den Arm. »Nein, nicht das gesamte Buch. Nur dieses eine kleine Pergamentblatt, das wir uns angeschaut haben, Nummer 34r.«
»Und warum?«
Schweigen. »Haben Sie jemals gehört, dass ich so eine Frage beantwortet habe?«, entgegnete Glinn gut gelaunt, während ihre Limousine langsam vorfuhr, um sie beide zurück zur Little West 12th Street zu chauffieren.
3
Drei Tage später. Erfrischt nach einigen Schwimmrunden auf dem Dach-Swimmingpool des ultrahippen Hotels Gansevoort stand Gideon Crew splitternackt in seiner Suite hoch über dem Meatpacking District von New York und blickte hinunter auf das Kingsize-Bett, das mit Zeichnungen und Plänen übersät war. Sie bildeten die Alarmanlage des East Room der Morgan Library in allen Einzelheiten ab.
Die Vorbereitungen zur Ausleihe des Book of Kells seitens der irischen Regierung an die Morgan Library hatten acht Jahre in Anspruch genommen. Das Projekt war mit Schwierigkeiten gespickt gewesen. Der Hauptgrund bestand darin, dass im Jahr 2000 eines der Folios ins australische Canberra entsandt worden war, wo es ausgestellt werden sollte. Aufgrund von Reibung und Pigmentverlust wurden dabei etliche Seiten beschädigt – wofür man das Vibrieren der Flugzeugmotoren verantwortlich machte –, und jetzt war die irische Regierung höchst abgeneigt, eine weitere Ausleihe zu riskieren.
James Watermain, der milliardenschwere irisch-amerikanische Gründer der Watermain Group, hatte es sich zur persönlichen Aufgabe gemacht, das Buch in die Vereinigten Staaten zu holen. Dem für sein Charisma und seinen Charme bekannten Mann gelang es, den irischen Premierminister und schließlich auch die irische Regierung davon zu überzeugen, es auszuleihen, allerdings nur unter strengsten Auflagen. Eine dieser Auflagen sah die komplette Überholung der Alarmanlage des East Room der Morgan Library vor, die Watermain aus eigener Tasche bezahlte.
Watermain hatte zunächst versucht, die Handschrift im Smithsonian auszustellen. Die Leute von der Sicherheitsabteilung des Museums hatten sich jedoch nicht bereit gezeigt, die notwendige Hightech-Aufrüstung vorzunehmen, weshalb alle Bemühungen vergebens waren. Insgeheim freute sich Gideon über die Nachricht. Denn trotz seiner fürchterlichen Kindheitserinnerungen an Washington D.C. – schließlich war dort sein Vater umgebracht worden – war er in späteren Jahren ab und zu wieder auf Besuch dort hingefahren und hatte die Stadt als etwas langweiliges, ja verschlafenes Sammelsurium schöner Denkmäler und zeitloser Dokumente empfunden. Doch erst einige Wochen zuvor war er nach Washington zitiert worden, um eine Auszeichnung für seine jüngsten Erfolge in Fort Detrick in Empfang zu nehmen. Zu seinem nicht geringen Entsetzen – vielleicht wegen des elften September, vielleicht auch einfach infolge der neuen Sicherheitsvorkehrungen und der unvermeidlichen Zunahme der Bürokratie – glich die damals angenehme, entspannte Hauptstadt inzwischen eher einem Militärcamp. Metropolitan Police, Capitol Police, Park Police, State Department Police, US Mint Police, Secret Service Police, Special Police – etwa zwei Dutzend Polizeitruppen verstopften die Stadt mit ihrer Präsenz, alle bewaffnet und alle mit der Befugnis ausgestattet, jeden Pechvogel von Autofahrer oder Besucher anzuhalten und festzunehmen. (Zumindest laut einem von Gideons Taxifahrern, der früher einmal selbst bei der Polizei gewesen war.) Während er sich nach all den überflüssigen Polizisten mit ihren sich überlappenden Zuständigkeiten umschaute, spürte er geradezu, wie seine Steuerdollars verbrannt wurden.
Der Gipfel war dann, dass er später, nach seiner Abreise, einen Strafbescheid in der Post vorfand: Irgendeine Sicherheitskamera hatte aufgezeichnet, wie er auf der New York Avenue einige Meilen schneller als die erlaubten 35 Meilen gefahren war, worauf man ihm – mitsamt dem unscharfen Foto seines Kfz-Zeichens – ein Strafmandat in Höhe von 125 Dollar zugesandt hatte. Nur bestand realistischerweise keine Möglichkeit, Widerspruch gegen die Zahlungsaufforderung einzulegen – höchstens, wenn er nach Washington zurückkehrte und persönlich vor Gericht erschien. Und natürlich war seine Erinnerung an das eigentliche Geschehnis derart vage, dass er es überhaupt nicht mehr rekonstruieren konnte. Hatte denn wirklich in der Nähe ein Verkehrsschild gestanden, das ein Tempolimit von 35 Meilen pro Stunde anzeigte? War er wirklich zu schnell gefahren? Wo genau lag eigentlich die New York Avenue? Viele Tage waren seither vergangen – wie sollte sich ein redlicher Bürger denn an so etwas noch erinnern? Und so hatte er zweierlei getan: Erstens hatte er das Bußgeld bezahlt und zweitens sich geschworen, für sehr, sehr lange Zeit nicht mehr nach Washington D.C. zurückzukehren. Was seiner Ansicht nach früher ein schönes, beständiges Sinnbild der Bedeutung und Größe des Landes gewesen war, war zu einem Stadtstaat entartet, der wie besessen seinen eklatant aufgeblähten Haushalt auszugleichen versuchte.
Vielleicht empfand Gideon, der kurz zuvor von seinem Forellenbach zurückgekehrt war, aber auch nur den Schmerz der Rückkehr ins urbane Leben. Wie auch immer, ihn würden keine zehn Pferde mehr zurück ins Smithsonian bringen.
Und nun dachte er darüber nach – während seine Gedanken in die Gegenwart zurückkehrten –, wie Glinn es eigentlich angestellt hatte, die gesamte Technik, die Elektroinstallation und die Schaltpläne des Sicherheitssystems in die Finger zu bekommen. Hier war jeder Schaltkreis, jeder Sensor, jede Spezifikation detailliert aufgeführt. Doch was nützte ihm das? Noch nie im Leben hatte er so ein Sicherheitssystem gesehen – er hatte sich so eine Alarmanlage nicht einmal vorstellen können. Da waren die üblichen mehrstufigen Sicherheitsebenen, die redundanten und geschützten Systeme, die Back-up-Stromversorgung und alles, was ein Einbrecher erwarten konnte. Aber das war nur der Anfang.
Der East Room war jetzt im Grunde ein Tresorraum. Ursprünglich war er aus doppelschaligen Mauern aus fast einem Meter dicken Vermont-Kalksteinblöcken erbaut worden. Der einzige Zugang zum Saal war mit einer Stahlschiebetür gesichert, deren Flügel von der Decke herunterrasselten und sich aus dem Boden erhoben, sobald ein Alarm ausgelöst wurde, und den Raum verriegelten. Nirgendwo gab es Fenster, weil Lichteinfall mit dem Schutz und der Erhaltung von Büchern nicht vereinbar war. Die Gewölbedecke bestand aus geschüttetem, unfassbar dickem Stahlbeton. Den Fußboden bildete eine massive Platte aus verstärktem Beton, darauf waren Marmorplatten verlegt. Zusätzlich zu dieser ganzen ursprünglichen Armierung war auf Ersuchen der irischen Regierung eine äußere Schicht nachgerüstet worden, bestehend aus Edelstahlplattierung und Sensoren.
Nachts war der Raum vollständig abgeriegelt. Drinnen war er durch Laserstrahlgitter und Infrarotsensoren auf mehreren Wellenlängen gesichert, darunter einer, der selbst den kleinsten Hinweis auf Körperwärme registrierte. Nicht einmal eine Maus (und vermutlich nicht einmal eine Kakerlake) konnten sich in dem Raum bewegen, ohne entdeckt zu werden. Die Überwachungskameras liefen Tag und Nacht, und die Überwachungsmonitore waren mit extrem gut geschulten, handverlesenen Sicherheitsleuten von höchstem Kaliber besetzt.
Tagsüber, wenn die Ausstellung geöffnet hatte, mussten die Besucher sämtliche Taschen und Kameras abgeben und einen Metalldetektor passieren. Im und vor dem Saal befanden sich Wachleute und mehr Kameras als in einem Spielcasino in Las Vegas. In der Vitrine, in der das Buch ausgestellt wurde, herrschte eine Atmosphäre aus reinem Argon. In ihr befanden sich Sensoren, die sofort Alarm schlugen, wenn sie auch nur den Hauch eines anderen Gases registrierten, und das sogar in so niedriger Konzentration wie ein Millionstel. Bei jeder Berührung des Buchs würde die Stahltür den Saal derart schnell verriegeln, dass nicht einmal ein 100-Meter-Olympia-Läufer es aus der Vitrine nehmen und damit zum Ausgang laufen könnte, ehe der sich schloss.
Seit Tagen suchte Gideon nun schon nach Schwachstellen im System. Alle Sicherheitsanlagen hatten Schwächen, und fast immer hingen diese entweder mit menschlichem Versagen, mit Programmierfehlern oder damit zusammen, dass eine Anlage zu komplex war, um sie vollständig begreifen zu können. Aber die Entwickler des Systems hatten diese Beschränkungen ins Kalkül gezogen. Denn das System war zwar tatsächlich komplex, es war aber modular in dem Sinne, dass jede Komponente recht simpel war und unabhängig von den anderen existierte. Die Softwareprogramme waren einfach, und einige Sicherheitsebenen waren vollständig mechanisch, ohne jede rechnergestützte Steuerung. Die Redundanz war derart groß, dass die Mehrfachsysteme versagen oder geschwächt werden konnten, ohne dass letztlich die Sicherheit des Buchs beeinträchtigt wurde.
Natürlich bestand auch die Möglichkeit, die Alarmanlage ein- und auszuschalten, denn das Buch wurde ja täglich umgeblättert. Doch selbst dies war ungemein gut geplant worden. Um das System herunterzufahren, waren drei Personen erforderlich, von denen jede einen einfachen, eigenen Code besaß, den sie sich eingeprägt hatte. Es gab weder richtige Schlüssel noch niedergeschriebene Codes oder irgendetwas, was gestohlen werden konnte. Und diese drei Personen waren gewissermaßen unberührbar. Es handelte sich um John Watermain selbst, den Leiter der Morgan Library sowie den stellvertretenden Bürgermeister von New York. Einer könnte zwar vielleicht korrupt oder anfällig für Social Engineering sein, aber bei zweien wäre das äußerst schwierig und bei dreien ausgeschlossen.
Und was würde passieren, wenn eine dieser Personen starb? Für den Fall gab es einen Ersatzmann, eine vierte Person – die zufällig der Premierminister Irlands höchstpersönlich war.
Und bei einem Brand? In einem solchen Notfall würde das Buch sicherlich rasch entfernt werden müssen. Doch die Spezifikationen befassten sich mit dieser Möglichkeit auf ungewöhnliche Weise. Denn das Buch würde im Brandfall gar nicht entfernt werden, sondern vollständig vor Ort geschützt. Die Vitrine stellte dabei die erste Verteidigungslinie dar, sie war in der Lage, einem schweren Brand zu widerstehen; die zweite Verteidigungslinie bildete das feuerfeste Behältnis, das sich im Inneren der Vitrine befand, das Buch umschloss und es auf diese Weise selbst vor einem ausgedehnten Feuer schützte. Zudem waren im East Room redundante, hochmoderne Brandbekämpfungskomponenten installiert, die jedes Feuer ersticken würden, lange bevor es sich ausbreitete. Ähnliche Systeme schützten das Buch gegen Erdbeben, Wassereinbruch und Terrorangriffe. Ungefähr das Einzige, wovor es nicht geschützt war, war ein Atombombenabwurf.
Gideon stieß einen langen Seufzer aus, schlenderte hinüber zum Ankleidezimmer und betrachtete seine Garderobe. Es wurde Zeit, sich zum Abendessen umzuziehen. Er hatte sich als lockere Tarnung für die Rolle eines jungen, hippen Dotcom-Millionärs entschieden, eine Rolle, die er schon einmal erfolgreich eingesetzt hatte. Er zog einen schwarzen Rollkragenpullover von St. Croix hervor, eine abgetragene Levi’s und Bass Weejuns Loafers – man musste sein Outfit schließlich ein bisschen mischen – und kleidete sich damit ein.
Er hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Das war normal. Gideon zog ein elegantes, außergewöhnliches Abendessen drei billigen Mahlzeiten vor. Essen war für ihn mehr ein Ritual und weniger bloße Nahrungsaufnahme.
Er schaute wieder auf die Uhr. Es war noch zu früh, um zu Abend zu essen, aber nach drei Tagen, in denen er in diesem Zimmer eingepfercht gewesen war und auf die Schautafeln gestarrt hatte, fühlte er sich ruhelos. Noch immer musste er eine Lücke, einen Riss, ja, den kleinsten Haarspalt in diesem Sicherheitssystem finden. Seit er damit begonnen hatte, während seiner Teenagerzeit Kunstmuseen und Kulturvereine zu bestehlen, war er zu dem Schluss gelangt, dass es so etwas wie das perfekte Sicherheitssystem nicht gab. Jedes System war angreifbar, entweder in technischer Hinsicht oder mit Hilfe von Techniken des Social Engineering.
Das war immer seine Überzeugung gewesen. Bis jetzt.
Verdammt, er musste mal Pause machen. Er ging ins Badezimmer und kämmte sich die nassen Haare, danach klatschte er ein Truefitt-&-Hill-Aftershave auf, um den Chlorgeruch nach seinen Schwimmrunden im Pool zu überdecken. Dann trat er aus der Hotelsuite und hängte das Bitte nicht stören-Schild an den Türknauf.
Es war ein heißer Abend im August im Meatpacking District. Die Schönen weilten draußen in den Hamptons, stattdessen waren die kopfsteingepflasterten Straßen mit jungen, hip aussehenden Touristen bevölkert – der Stadtteil hatte sich in den letzten Jahren zu einem der schicksten Viertel in Manhattan entwickelt.
Er ging um den Block ins Spice Market, setzte sich an den Tresen in der Bar und bestellte einen Martini. Während er an seinem Drink nippte, frönte er einer seiner Lieblingsbeschäftigungen: Er beobachtete die Leute um sich herum und stellte sich jedes Detail in ihrem Leben vor, von ihrem Beruf bis zum Aussehen ihres Hundes. Aber sosehr er sich auch bemühte, er kam einfach nicht in die richtige Stimmung. Zum ersten Mal war er auf ein Sicherheitssystem gestoßen, das von richtig intelligenten Leuten entwickelt worden war – Leuten, die noch intelligenter waren als er. Das verdammte Book of Kells würde schwieriger zu stehlen sein als die Mona Lisa.
Während er über dieses Problem nachgrübelte, wurde seine sowieso schon schlechte Laune noch schlechter. Die Leute um ihn herum waren wohlhabend und kultiviert, sie redeten, lachten, tranken und aßen – und fingen an, ihn zu verärgern. Er stellte sich vor, dass es keine Menschen wären, sondern schnatternde Äffchen, die komplizierte Körperpflegerituale vollführten. Diese Vorstellung milderte seinen Ärger ein wenig.
Sein Glas war leer. Vor langer Zeit hatte er gelernt, dass es keine gute Idee war, ein zweites Glas zu bestellen. Nicht dass er ein Alkoholproblem hatte, natürlich nicht, aber nach zwei Drinks überschritt er anscheinend irgendeine Grenze, was zu einem dritten führte und sogar zu einem vierten, und das endete dann unweigerlich darin, dass er sich an eines dieser schicken, blonden, plappernden Äffchen heranmachte …
Er bestellte einen zweiten Drink.
Während er daran nippte und sich marginal besser fühlte, was den Zustand der Welt betraf, und der Alkohol seine Wirkung entfaltete, kam ihm eine kleine Idee. Wenn es tatsächlich nicht möglich war, das Buch von Kells zu stehlen – und tief im Inneren ahnte er, dass dies der Fall war –, dann müsste er eben jemand anders dazu bringen, es für ihn aus dem Saal zu schaffen … mit der vollen Kooperation jener drei Personen. Das würde allerdings Techniken des Social Engineering erfordern, die weitaus ausgeklügelter wären als alles, was er bisher eingesetzt hatte.
Und da begann sich in seinem vom Alkohol leicht umnebelten Zustand eine Möglichkeit abzuzeichnen, wie er das hinbekommen könnte.
Sein dritter Drink kam, und Gideon ließ den Blick in der eleganten Bar umherschweifen. Am anderen Ende saß eine Frau, nicht unbedingt die attraktivste Frau im Raum – etwas pummelig und mit Brille. Aber sie hatte, was er persönlich an Frauen am anziehendsten fand: ein ironisches, intelligentes Funkeln in den Augen. Als sie sich umschaute, hatte er den Eindruck, dass sie die Szenerie ringsum genauso amüsant fand wie er.
Er griff nach seinem fast leeren Glas, ging zu ihr hin und warf einen kurzen Blick auf den Barhocker. »Darf ich?«
Sie musterte ihn von oben bis unten. »Ich glaub schon. Arbeiten Sie in der Computerbranche?«
Er lachte und setzte seine selbstironischste Miene auf. »Nein, aber bei mir ist drin, was draufsteht. Warum fragen Sie?«
»Wegen des Steve-Jobs-Outfits. Schwarzer Rollkragenpullover und Jeans.«
»Ich überlege nicht gern, was ich am Morgen trage.«
Sie wandte sich zum Barkeeper um. »Zwei Beefeater-Martinis, ohne Eis, zwei Oliven, dirty.«
»Sie geben mir einen aus?«
»Haben Sie was dagegen?«
Er beugte sich vor. »Überhaupt nicht, aber woher wissen Sie, was ich trinke?«
»Ich beobachte Sie schon, seit Sie in die Bar gekommen sind.«
»Im Ernst? Warum mich?«
»Weil Sie wie ein verlorener Junge aussehen.«
Gideon merkte, dass er rot wurde. Die Beobachtungen der Frau waren vielleicht ein kleines bisschen zu scharfsinnig, und er kam sich entlarvt vor. »Sind wir nicht alle ein wenig verloren?«
Sie lächelte und sagte: »Ich denke, wir werden schon miteinander auskommen.«
Die Drinks kamen, und sie stießen an.
»Auf das Verlorensein«, sagte Gideon.
4
Das Geschäft von Griggs and Wellington, Rare Books and Manuscripts lag direkt an der Ecke zur Portobello Road. Es handelte sich um einen dieser Antiquitätenläden, die von der Portobello weggezogen waren, aber nicht ganz den Erfolg gehabt hatten, den sie sehr, sehr angestrengt zu erreichen versuchten. Als Gideon den Laden betrat, fiel ihm sofort die Fassade aus britischem Snobismus auf, die den billigen East-End-Ramsch allerdings nicht ganz verdeckte. Der Ladenbesitzer, ein junger Brite in übertriebener Savile-Row-Garderobe, bestätigte Gideons Verdacht schon gleich beim Eintreten, denn sein schnöseliger Upperclass-Akzent konnte die Cockney-Herkunft fast, aber nicht ganz überdecken.
»Kann ich Ihnen helfen, Sir?«
Gideon, der selbst einen teuren Ralph-Lauren-Anzug trug, schenkte dem Ladenbesitzer ein etwas begriffsstutziges, ›amerikanisches‹ Lächeln. »Nun, ich habe mich gefragt, ob ich mir einmal die Seite der alten Handschrift, die Sie dort im Fenster haben, ansehen könnte.« Trotz aller Bemühungen, seinen Texas-Akzent zu unterdrücken, war dieser doch ein wenig durchgekommen.
»Aber selbstverständlich«, sagte der Ladenbesitzer. »Sie meinen das illuminierte Stundenbuch?«
»Genau.«
Der Mann ging zur Auslage, schloss sie auf und nahm die kleine Buchseite heraus, die in einer steifen Plastikhülle steckte. Mit sichtlicher Ehrfurcht legte er die Seite auf ein mit schwarzem Samt bezogenes Tablett, das er im Handumdrehen unter dem Verkaufstresen hervorgeholt hatte, dann legte er es unter das kreisrunde Licht, das ein Deckenstrahler spendete. Es handelte sich um eine Szene aus dem Evangelium, mit einem illusionistischen Blumen-Bordürenmuster; die Szene in der Mitte zeigte die Jungfrau Maria, unter einem Bogengewölbe sitzend, während ein Engel aus einem blauen Himmel herabsteigt. Maria weicht angstvoll zurück.
»Die Seite ist ganz reizend«, murmelte der Ladenbesitzer. »Sie haben ein gutes Auge, Sir.«
»Erzählen Sie mir etwas darüber«, bat Gideon.
»Sie stammt aus einem flämischen Stundenbuch, das etwa auf das Jahr 1440 datiert – ein wirklich schönes Buch. Ein sehr schönes Buch«, wiederholte der Mann. Seine Stimme klang ganz gedämpft vor Bewunderung. »Man nimmt an, dass es aus der Werkstatt des Meisters der Privilegien von Gent und Flandern stammt.«
»Verstehe«, sagte Gideon. »Nett.«
»Die Seite stellt natürlich Mariä Verkündigung dar«, fügte der Antiquitätenhändler hinzu.
»Und wie viel kostet sie?«
»Wir haben diese sehr seltene Seite mit viertausendsechshundert Pfund gepreist.« Der Tonfall des Mannes klang ein wenig gepresst, als sei ihm das Sprechen über Geld unangenehm.
»Wie viel ist das umgerechnet in Dollar? Achttausend?« Gideon betrachtete die Seite genauer.
»Möchten Sie es unter einer Lupe betrachten?«
»Wie bitte? Ja, danke.«
Während Gideon sich die Seite genauer anschaute, redete der Händler weiter, dabei hielt er die Hände verschränkt, und seine mit blumigem Akzent vorgebrachten Sätze füllten den ganzen Laden aus. »Wie Sie vermutlich wissen«, sagte er, wobei sein Ton andeutete, dass Gideon dies sicherlich nicht wusste, »haben sich die mittelalterlichen Stundenbücher aus monastischen Gebetszyklen entwickelt und wurden später dann für private Andachten vereinfacht. Zu ihnen gehören einige der schönsten existierenden Werke der mittelalterlichen Kunst. Sie waren unglaublich teuer – im fünfzehnten Jahrhundert lag der Preis für ein Buch ungefähr so hoch wie der für einen guten Bauernhof, samt Gebäuden und allem. Nur Königshäuser, der Adel und die ganz Reichen konnten sich so ein Buch leisten. Schauen Sie sich nur einmal die Details an! Und die Farben. Insbesondere möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf das Blau des Himmels lenken – das Pigment wurde aus zerstoßenem Lapislazuli hergestellt, das im Mittelalter teurer war als Gold. Der einzige Fundort von Lapis in jener Zeit war Afghanistan.«
»Verstehe.«
»Sind Sie Sammler?«, fragte der Händler.
»O nein. Ich suche nur nach einem Geschenk zum Hochzeitstag für meine Frau. Sie ist fromm.« Gideon stieß ein leises Lachen aus und gab damit zu verstehen, dass er es keinesfalls war.
»Darf ich mich vorstellen?«, sagte der Händler. »Sir Colin Griggs meine Name.«
Gideon blickte auf zu dem Mann, der ihm da sein kleines weißes Händchen entgegenstreckte, das Kinn leicht vorgereckt, in kerzengerader Haltung. Er war genauso wenig ein »Sir« wie Gideon ein Lord. Er ergriff die Hand und schüttelte sie enthusiastisch. »Gideon Crew. Aus Texas. Tut mir leid, aber ich kann kein ›Sir‹ vor meinen Namen setzen. Ich bin ja kaum ein Mister.« Er lachte dröhnend.
»Ah, Texas, der Staat des einzelnen Sterns. Sie haben einen exzellenten Geschmack, Mr. Crew. Darf ich Ihnen weitere Fragen zu der Seite beantworten?«
»Woher weiß ich, dass sie echt ist?«
»Ich kann Ihnen versichern, dass sie ohne jeden Zweifel echt ist. Wir stehen hinter allem, was wir verkaufen. Wir laden Sie ein, die Seite nach Ihrem Kauf von einem Experten begutachten zu lassen. Wenn es irgendwelche Zweifel gibt, erstatten wir Ihnen das Geld natürlich sofort zurück.«
»Sehr schön. Aber … nun ja, ich muss schon sagen – diese viertausendsechshundert Pfund sind eine Menge Geld … wie wär’s mit viertausend, plus/minus.«
Sir Colin baute sich auf zu einem Rammbock des Missfallens. »Tut mir leid, Mr. Crew, aber wir hier bei Griggs and Wellington handeln nicht.«
Gideon schenkte dem versnobten Briten ein freundliches Texas-Lächeln. »Ach, lassen wir doch diese Spielchen. Alles ist verhandelbar.« Er zückte seine Kreditkarte. »Viertausend, oder ich gehe.«
Die Missbilligung in Sir Colins Miene nahm ein wenig ab. »Für jemanden, der die Seite so sehr zu schätzen weiß wie Sie könnte ich vermutlich eine Ausnahme machen und den Preis auf viertausendvierhundert herabsetzen.«
»Viertausendzweihundert.«
Sir Colins Miene ließ darauf schließen, dass er das Gespräch als peinigend und unangenehm empfand. »Viertausenddreihundert.«
5
Nachdem er kurz ins Hotel zurückgefahren war, um die Kleidung zu wechseln, machte Gideon sich mit der kostbaren Buchseite auf den Weg ins Londoner Büro des Auktionshauses Sotheby’s, wo der Abschlusstest für seinen Plan stattfinden sollte. Auf dem fünf Kilometer langen Spaziergang lernte er einige faszinierende Seitenstraßen und auch den Hyde Park kennen. Es war ein strahlender Spätsommertag, die uralten Bäume im Park waren voll belaubt, Schäfchenwolken schwebten am Himmel wie Segelschiffe, auf den Rasenflächen wimmelte es von Menschen. London war eine außergewöhnliche Stadt, und er nahm sich vor, wirklich mehr Zeit hier zu verbringen – vielleicht sogar hier zu leben.
Dann aber fiel ihm seine tödliche Erkrankung ein, und er schlug sich solche Gedanken rasch aus dem Kopf.
Das Sotheby’s-Gebäude war ein unprätentiöser, vierstöckiger Bau aus dem neunzehnten Jahrhundert und erst kürzlich weiß gestrichen worden. Die Mitarbeiter reagierten außerordentlich beflissen, als sie die Manuskriptseite mit der Miniatur sahen, die er bei ihnen versteigern lassen wollte, und so wurde er in ein hübsches kleines Büro im dritten Stock geführt, wo er begrüßt wurde von einem reizenden, rundlichen Mann mit Goldrandbrille und Einstein-Frisur, der in seinem altmodischen Tweedanzug mit Weste und goldener Uhrkette wie eine Figur aus einem Roman von Dickens aussah. Er galt (Gideon hatte seine Hausaufgaben gemacht) als der größte Experte für illuminierte Handschriften.
»Nanu!«, sagte der Mann, der nach Tabak und vielleicht sogar einem Hauch Whisky roch. »Was haben wir denn da?« Er streckte Gideon seine dicke Hand hin. »Brian MacKilda, zu Ihren Diensten!« Er sprach, als sei er ständig außer Atem, und unterstrich seine Sätze mit kleinen Schnaufern, als habe er Mühe, Luft zu bekommen.
»Ich habe hier eine Seite aus einer illuminierten Handschrift, die ich in eine Auktion geben möchte.« Gideon hielt ihm die kleine Ledermappe hin.
»Ausgezeichnet. Schauen wir sie uns einmal an.« MacKilda trat um den Schreibtisch herum, zog eine Schublade auf und holte eine Lupe hervor, die er vor sein großes, zwinkerndes Auge hielt. Dann rückte er eine Speziallampe zurecht, die einen weißen Lichtkreis auf ein weiches schwarzes Tablett warf, nahm die Mappe zur Hand, zog die Seite, die Gideon kurz zuvor erworben hatte, aus ihrer Hülle und sah sie sich mehrmals nickend genauer an. Dabei wippten seine zerzausten Haare, begleitet von zustimmendem Gemurmel.
Dann legte er die Seite unter die Lampe. Mehrere Minuten verstrichen, in denen er die Seite mit der Lupe begutachtete, wobei er weitere tierartige Töne von sich gab, die alle positiv klangen. Danach schaltete MacKilda die helle Lampe aus, wühlte in der Schublade seines Schreibtischs und zog eine kleine, merkwürdig aussehende Taschenlampe mit einer quadratischen Vorderseite hervor. Er hielt sie nahe an die Seite und schaltete sie an. Sie spendete ein tief ultraviolettes Licht. MacKilda leuchtete hierin und dorthin, hielt kurz inne und schaltete die Lampe dann wieder aus. Die Töne verwandelten sich jählings in ablehnendes Schnaufen und Keuchen.
»Oje«, sagte der Mann schließlich. »Oje, oje, oje.« Darauf folgte mehrmaliges Gekeuche.
»Gibt es ein Problem?«
MacKilda schüttelte betrübt den Kopf. »Eine Fälschung.«
»Wie bitte? Wie kann das sein? Ich habe viertausend Pfund dafür bezahlt!«
Der Mann schaute ihn betrübt an. »Unsere Branche, Sir, ist leider voll von Fälschungen. Voll!« Wobei er das v besonders stark betonte.
»Aber wie können Sie das denn definitiv sagen, wenn Sie nur fünf Sekunden lang ein Licht darauf werfen? Gibt es denn keine anderen Tests?«
Langer Seufzer. »Es gibt viele Tests, sehr viele. Raman-Spektrokospie, Röntgenfluoreszenzanalyse, Karbon vierzehn. Aber in diesem Fall sind Tests nicht erforderlich.«
»Ich begreife das nicht. Eine Fünf-Sekunden-Untersuchung reicht aus?«
»Erlauben Sie mir, Ihnen die Sache zu erläutern.« MacKilda holte tief Luft, gefolgt von Schnaubgeräuschen und einem ausgiebigen Räuspern. »Die Buchmaler des Mittelalters haben in der Regel mineralische Pigmente für ihre Farben verwendet. Das Blau stammte aus zermahlenem Lapislazuli, das Zinnober aus Zinnabarit und Schwefel. Das Grün aus zerstoßenem Machalit oder Grünspan. Und das Weiß wurde normalerweise aus Blei hergestellt, häufig in Verbindung mit Gips oder Kalk.« Er machte eine Pause und schnaufte erneut. »Also: Der Punkt ist, dass einige dieser Mineralien unter ultraviolettem Licht stark fluoreszieren, andere dagegen auf bestimmte Weise ihre Farbe verändern.« Er hielt inne, atmete schwer. »Aber schauen Sie sich das hier mal an.«
Noch einmal leuchtete er mit der Schwarzlicht-Taschenlampe auf die Manuskriptseite. Deren Oberfläche blieb dunkel, stumpf, unverändert. »Da, sehen Sie? Nichts!« Er schaltete die Taschenlampe aus. »Bei diesen Pigmenten handelt es sich somit um billige Anilinfarben, von denen keine auf UV-Licht reagiert.«
»Aber die Seite sieht doch so echt aus!«, sagte Gideon fast flehentlich. »Bitte schauen Sie sie sich noch einmal an, bitte. Sie muss echt sein!«
Mit einem weiteren Stoßseufzer wandte sich MacKilda erneut der Seite zu und betrachtete sie tatsächlich länger als fünf Sekunden. »Zugegeben, die Arbeit ist recht gut. Da habe ich mich zunächst wohl täuschen lassen. Und das Pergament scheint auch original zu sein. Aber warum ein Fälscher mit solch offensichtlichem Talent sich die Mühe gemacht hat, eine derartige Fälschung herzustellen, und dann Anilinfarben verwendet, ist mir ein Rätsel. Ich vermute, sie stammt aus China. Früher kamen die meisten Fälschungen aus Russland, in jüngster Zeit haben wir aber auch schon ein paar aus Fernost gesehen. Die Chinesen sind ein wenig naiv, daher die Anilinfarben, aber sie werden aufholen, leider.« Er schüttelte den Kopf, seine Haare wippten, und dann hielt er Gideon die Seite hin. »Es handelt sich hier mit absoluter Sicherheit und ohne jeden Zweifel um eine Fälschung.« Und dies unterstrich er mit einem letzten Wippen seiner Haare und lautem Schnaufen.
6
Julia Thrum Murphy, zweiunddreißig Jahre alt, hatte sich im Auto auf den weiten Weg von Bryn Mawr in Pennsylvania, wo sie am College als Juniorprofessorin romanische Sprachen unterrichtete, nach New York gemacht, um sich das Book of Kells an seinem letzten Wochenende in den Vereinigten Staaten anzusehen. Es war ein strahlender Sonntagnachmittag, allerdings ein wenig warm in der Stadt, und was sie befürchtet hatte, stellte sich als richtig heraus: Die Ausstellung war brechend voll.
An der Kasse wurde ihr von einer gestressten Angestellten mitgeteilt, dass die Wartezeit, und zwar nur die, um in den East Room zu kommen, rund eine Dreiviertelstunde betrage. Und dann gebe es da noch die lange, sich langsam bewegende Schlange im Raum selbst, die eventuell noch mal eine halbe Stunde Wartezeit bedeuten könne oder mehr.
Eineinviertel Stunden. Als sie das hörte, hätte Julia fast beschlossen, die Ausstellung sausen zu lassen und hinauf zu den Kreuzgängen zu gehen, um sich stattdessen die Einhorn-Wandteppiche anzuschauen. Dann aber entschied sie zu warten. Denn nur so, das wusste sie, würde sie Gelegenheit bekommen, das Buch von Kells außerhalb Irlands zu Gesicht zu bekommen.
Also löste sie die 25-Dollar-Eintrittskarte, gab ihre Handtasche und ihre Fotokamera ab, ging durch den Metalldetektor und stellte sich an. Erst wenn einzelne Besucher den East Room verließen, wurden andere hineingelassen, und so rückte die Schlange nur langsam vor. Schließlich, nach vierzig Minuten, kam sie am Kopf der Warteschlange an, und ihr wurde mit einem Nicken bedeutet, dass sie nun den East Room betreten dürfe.
Im Saal war es fast noch schlimmer. Die Menschenmenge bewegte sich im Schneckentempo zwischen Pfosten und Samtkordeln voran, die es mit jeder Sicherheitsschleuse an einem Flughafen hätten aufnehmen können. Den Besuchern wurde knapp eine Minute Zeit eingeräumt, um das Buch in Augenschein zu nehmen, dann begannen die Wachleute höflich zu murmeln, sie sollten bitte weitergehen, weitergehen.
Eineinviertel Stunden warten für eine Minute des Vergnügens. Ein bisschen wie Sex, dachte sie verdrossen, während sie sich in der gewundenen Warteschlange langsam voranbewegte.
Genau in diesem Moment lächelte ihr ein etwa gleichaltriger Mann zu, ein wenig vor ihr in der anderen Richtung in der Schlange gehend, und zwar etwas freundlicher, als es die Höflichkeit gebot. Sie erschrak ein wenig ob seines schurkisch guten Aussehens und der Kombination aus rabenschwarzem Haar und blauen Augen: ein Typus, den ihre Mutter als »dunklen Iren« bezeichnet hätte. Als er sie weiterhin anlächelte, schaute Julia weg. Schließlich war sie neugierige Blicke gewohnt; denn glücklicherweise war sie nicht nur mit Grips geboren, sondern auch mit einer gewissen geschmeidigen Schönheit, die sie mit Hilfe von Pilates, Yoga und Joggen aufrechterhielt. Obwohl Professorin, fühlte sie sich so gar nicht hingezogen zu ihren schwabbeligen, wichtigtuerischen und oftmals hohlen Kollegen am Bryn Mawr. Nicht dass etwas ernsthaft nicht mit ihnen stimmte, aber offen gesagt stand sie einfach nicht auf diesen Männertyp. Andererseits war es schwierig, außerhalb der akademischen Welt einen Mann zu finden, der ihr intellektuell ebenbürtig war. Sie konnte sich zwar vorstellen, einen armen Schlucker zu heiraten, ja sogar einen hässlichen Mann – niemals aber würde sie jemanden ehelichen, der weniger intelligent war als sie.
Während Julia diesen Gedanken nachhing, rückte die Warteschlange langsam vor, und der Mann, der sie angelächelt hatte, näherte sich ihr erneut. Als sie Seite an Seite standen, beugte er sich zu ihr herüber und sprach sie in gedämpftem Tonfall an: »Wir müssen aufhören, uns auf diese Weise zu treffen.«
Der Satz war nicht originell, aber sie lachte trotzdem. Immerhin, der Mann wirkte nicht ganz dumm.
Er ging weiter, und die parallelen Schlangen rückten zentimeterweise voran. Julia bemerkte, dass sie mit dem nächsten Annäherungsversuch rechnete, ihr Herz schlug sogar ein wenig schneller. Sie schaute sich in der dichten, aber geordneten Menschenmenge im East Room um und suchte nach ihm. Wo steckte er denn bloß? Aber das war doch verrückt, ganz flatterig zu werden wegen irgendeines wildfremden Kerls. Sie hatte wohl viel zu lange wie eine Nonne gelebt.
Und dann, ganz plötzlich, passierte es. Ein Lichtblitz, dem ein irrsinnig lauter Knall folgte, so laut, dass Julias Herz vor Schreck einen Hüpfer machte und sie sich inmitten eines Chors aus Geschrei und Gekreische auf den Boden warf. Sofort dachte sie: Terrorangriff, und während ihr dieser Gedanke durch den Kopf schoss, schrillte der Alarm, und der Saal füllte sich augenblicklich mit dichtem, vollkommen undurchsichtigem Rauch, der alles in ein höllengleiches, gelblich braunes Zwielicht tauchte, in dem sie nichts sehen, sondern nur die sinnlosen hysterischen Rufe und Schreie ihrer Mit-Museumsbesucher hören konnte.
Dann ertönte ein hohler Knall, der klang, als treffe Stahl auf Stahl, unmittelbar gefolgt vom Bumm einer weiteren, nun gedämpften Explosion.
Julia lag auf dem Boden, Seite an Seite mit Dutzenden anderer Leute, begab sich in eine abwehrende Fötushaltung und schützte ihren Kopf, während sich das hysterische Kreischen fortsetzte. Sie blieb ganz ruhig und, ein wenig zu ihrer eigenen Überraschung, gelassen. Nach einigen Augenblicken vernahm sie ein paar geschriene Befehle – Wachpersonal, das versuchte, die Leute zu beruhigen –, dazu Sirenen und das jähe Getöse der Luftwälzanlage.
Rasch verzog sich der Qualm, und die Lichter gingen wieder an. Fast wie von Zauberhand hatte sich der Rauch verzogen, eingesogen in die Gitter der Luftumwälzanlage, die jetzt, nach der Entfernung der gestrichenen Deckenplatten, freilag.
Langsam ließ das Kreischen nach, und Julia setzte sich auf und schaute sich um, um zu sehen, was passiert war. Als Erstes fiel ihr auf, dass das Behältnis, in dem sich das Book of Kells befunden hatte, zerbrochen und eine Ecke der Vitrine von etwas verschmutzt war, was irgendeine Art Detonation gewesen sein musste. Das Buch befand sich nicht mehr in der Vitrine – es war gestohlen worden. Aber nein, nicht gestohlen, denn da lag es ja, auf dem Boden neben der Vitrine, aufgeschlagen und in Unordnung.
Und da wurde ihr bewusst, dass sie alle eingeschlossen waren, denn der einzige Zugang in den East Room war jetzt von einer durchgehenden Platte aus Edelstahl blockiert.
Der nächste Gedanke, der ihr mit einiger Erleichterung durch den Kopf ging, lautete, dass es sich hier um nichts weiter handelte als um einen fehlgeschlagenen Raubüberfall.
7
Nun dienten die Pfosten und Kordeln einem anderen Zweck: Sie erlaubten dem Wachpersonal, die wütende, im East Room eingeschlossene Menschenmenge im Griff zu behalten, solange die Security sich ein Bild von der Lage machte.
Zusammen mit allen anderen wurde Julia Thrum Murphy zu einer Seite des Saals gescheucht, während das halbe Dutzend Sicherheitsbedienstete das Book of Kells sicherten und untersuchten und sich mit ihren Kollegen außerhalb des East Room lebhaft per Funk austauschten. Für Julia wurde immer offensichtlicher, dass es sich hier um einen versuchten Raubüberfall handelte: die Blendgranate und der Rauch, die als Ablenkungsmanöver eingesetzt worden waren, die gedämpfte Sprengladung, die die Vitrine zerbersten ließ, das Buch, das entfernt worden war – aber der Dieb war offenbar nicht in der Lage gewesen, es aus dem Raum zu schaffen, bevor sich die stählerne Sicherheitstür herabsenkte. Also hatte er das Buch fallen gelassen und war wieder in der Menge untergetaucht.
Und das bedeutete, dass der Dieb noch immer zusammen mit ihnen allen im East Room eingeschlossen war – eine Tatsache, die auch den Wachleuten klar ersichtlich war. Offenbar stand ihr eine lange Geduldsprobe bevor. Es war zwar etwas Ruhe unter den Besuchern eingekehrt, es herrschte aber nach wie vor ein gewisses Chaos, wobei die unvermeidlichen Hysteriker Szenen veranstalteten und ein paar findige junge Leute anscheinend nicht bestehende Verletzungen geltend machten, ganz bestimmt, um sich etwas Geld dazuzuverdienen. Mehrere Ärzte in der Menschenmenge waren vorgetreten und untersuchten sie.
Irgendwie begann Julia richtig Spaß an der Sache zu haben.
Jetzt brachte ein schwitzender Wachmann sie und einige weitere Besucher an einen anderen Ort im Saal, wo sie auf einmal wieder neben dem Mann mit dem schurkisch-attraktiven Gesicht und den dunklen Haaren stand.
Wieder lächelte er sie an. »Na, amüsieren Sie sich gut?«
»Ja, das tue ich.«
»Ich auch. Ist Ihnen eigentlich bewusst«, fuhr er fort, »dass der Pseudo-Dieb sich nach wie vor hier im Saal aufhält?«
Pseudo. Männer mit großem Vokabular gefielen ihr.
»Also …« Der schurkisch-attraktive Mann lächelte. »Schauen Sie sich um. Mal sehen, ob wir ihn herausfischen können.«
Das machte Spaß. Julia blickte sich um und suchte die Gesichter der Anwesenden ab. »Ich kann keine offensichtlichen Ganoven erkennen.«
»Es ist immer die Person, die man am wenigsten verdächtigt.«
»Das wären dann Sie.«
Er lachte, beugte sich zu ihr herüber und streckte die Hand aus. »Gideon Crew.«
»Julia Murphy.«
»Murphy, Sie sind nicht ganz zufällig Irin?« Er hob schalkhaft die Augenbrauen.
»Und Crew? Was ist das für ein Name?«
»Ein bedeutender Name mit altwalisischen Ursprung. Soll heißen, bevor ein Crew die Sparbüchse des Gerichtsvollziehers klaute und als blinder Passagier nach Amerika abhaute.«
»Ihre Vorfahren stammen also aus ebenso guter Familie wie meine.«
Die Wachleute waren schon dabei, die Besucher in einer Reihe aufzustellen und für die Befragung einzuteilen. Der Einsatzleiter – jedenfalls zierten mehrere Litzen seine Schulterstücke – trat vor und hob die Hände. »Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit!«
Der allgemeine Tumult legte sich.
»Leider können wir Sie erst aus dem Saal entlassen, wenn Sie alle befragt worden sind«, verkündete er. »Es würde die ganze Sache sehr beschleunigen, wenn Sie bitte alle kooperieren würden.«
Gemurmel, Einwände. »Ich will hier raus!«, rief einer der Hysteriker, untermalt von einem Chor der Zustimmung.
Der Kommandeur hob die Hand. »Ich verspreche Ihnen, wir werden Sie schnellstmöglich gehen lassen. Dafür benötigen wir aber Ihre Hilfe. Wir hatten hier eben einen versuchten Raub des Book of Kells, und es gibt bestimmte Verfahrensweisen, die befolgt werden müssen. Ich bitte Sie also um ein wenig Geduld.«
Wieder Gemurmel, Beschwerden, Proteste.
»Also, was machen Sie beruflich?«, fragte Gideon.
»Ich unterrichte am Bryn Mawr romanische Sprachen – Französisch, Italienisch, Spanisch und ein bisschen Latein.«
»Bryn Mawr«, sagte er. »Eine Professorin. Nett.«
»Und Sie?«
Der Mann zögerte. »Bis vor kurzem war ich am Nationalen Laboratorium in Los Alamos beschäftigt. Ich bin zurzeit beurlaubt.«
Julia war verblüfft, ja verdutzt. »Los Alamos? Sie meinen, da, wo die Atombomben gebaut werden?«
»Nicht gebaut. Entwickelt.«
»Machen Sie das wirklich? Bomben entwickeln?«
»Unter anderem.«
War das ein Witz? Nein. Sie wusste nicht, ob sie nun beeindruckt oder entsetzt sein sollte. Aber wenigstens war er nicht noch einer von diesen dummen gutaussehenden Männern.
»Ich weiß«, fuhr er abwehrend fort. »Vielleicht klingen die Angaben zu meinem Beruf etwas dürftig. Aber wirklich, ich bin ein amerikanischer Staatsbürger, der seine Pflicht tut, um seine Heimat zu schützen und das alles.«
Julia schüttelte den Kopf. »Ich sehe Sie förmlich vor mir, wie Sie so auf einem Empfang im Fachbereich im Bryn Mawr reden. O Gott, die Leute würden Sie als Mörder abstempeln.«
»Und was denken Sie?«
Sie sah ihn mit festem Blick an. »Interessiert es Sie denn, was ich denke?«
Er erwiderte den Blick; sie war ein wenig verdutzt von der Intensität. »Ja.«
Er betonte das so merkwürdig, dass sie errötete, und als sie merkte, dass sie rot wurde, wurde sie noch roter. »Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich glaube.« Mehr brachte sie einfach nicht heraus.
Ein paar Minuten lang schwiegen sie. Sie blickte hinüber zu der Stelle, wo das Buch wieder auf seine Stütze gelegt worden war. Mehrere Wachleute beugten sich darüber und untersuchten es enorm sorgfältig, blätterten die Seiten mit weiß behandschuhten Fingern um. Sie wurden anscheinend immer aufgeregter. Kurz darauf riefen sie dem Kommandeur etwas zu, der herübereilte. Es folgte eine kurze, intensive Besprechung, und dann sprach der Kommandeur hektisch in sein Funkgerät. Die Besucher, die die Veränderung bemerkten, verfielen in Schweigen.
Wieder hob der Teamleiter seinen Arm. »Ich benötige Ihre Aufmerksamkeit. Wie es scheint, ist eine Seite aus dem Book of Kells herausgeschnitten worden und fehlt.«
Ein kollektives Oh und Ah unter den Besuchern.
»Die Seite muss sich noch hier in diesem Saal befinden. Deshalb fürchte ich, dass niemand den Raum verlassen darf, ohne befragt und durchsucht worden zu sein. Wir erhalten die notwendigen Berechtigungen, während wir sprechen. Die Sicherheitstür muss so lange geschlossen bleiben, bis wir die fehlende Seite wiedergefunden haben. Wir dürfen niemanden aus dem Raum lassen, ohne eine gründliche Leibesvisitation vorgenommen zu haben.«
»Oha«, sagte Julia. »Jetzt kommt’s dicke.«
Gideon Crew blickte sich im Saal um, mit geschürzten Lippen, seine blauen Augen blitzten. »Haben Sie den Dieb schon identifiziert?«
»Ich glaube immer noch, dass Sie es sind. Sie stammen aus einer Familie von Dieben, und Sie sehen wirklich ein bisschen wie ein Schurke aus. Und außerdem … wirken Sie nervös.«
Er lachte. »Und ich bin überzeugt, dass Sie der Dieb sind. Eine Professorin für romanische Sprachen am Bryn Mawr – das nenne ich eine perfekte Tarnung.«
Die Besucher wurden nun zwischen den Pfosten hindurch zu jener Stelle geführt, wo die Wachleute einen provisorischen Bereich errichtet hatten, um die Leibesvisitationen durchzuführen, hinter einer Bücherwand, abgetrennt durch einen schweren Vorhang. Diejenigen, die durchsucht worden waren, wurden in einen weiteren Wartebereich geführt, wobei beide Gruppen voneinander getrennt gehalten wurden. Der Saal war nach wie vor durch die Stahltür verriegelt.
Mehrere Besucher setzten ihre Proteste fort. Die Temperatur im Raum stieg. »Wir werden wohl den ganzen Nachmittag hier verbringen«, sagte Julia. Die ganze Situation, so neu sie auch war, begann sie zu langweilen. Sie hatte noch eine lange Rückfahrt nach Bryn Mawr vor sich. Vielleicht sollte sie lieber in der Stadt bleiben und am Montag zurückfahren. Dann müsste sie zwar die Seminare am Vormittag ausfallen lassen, aber wenigstens hätte sie eine gute Ausrede. Sie blickte zu Gideon Crew hinüber und überlegte träge, ob er wohl eine Wohnung in der Stadt hatte.
»Im Ernst, ich kann hier drin keine offensichtlichen Ganoven sehen«, sagte er zu ihr. »Nur einen Haufen langweilige alte Weiße mit Namen wie Murphy oder O’Toole.«
Plötzlich erklang ein Schrei. Einer der Wachleute, der den Raum durchsucht hatte, rief irgendetwas und gestikulierte wie verrückt. Er kniete neben einem Bücherschrank, dessen Glastür offen stand. Der Teamleiter und weitere Wachleute gingen hinüber, und alle beugten sich vor, um sich irgendetwas genauer anzuschauen. Für Julia sah es wie ein Stück Papier aus, das zwischen zwei Büchern steckte. Weitere Aktivitäten und Diskussionen. Schließlich wurde das Etwas mit Handschuhen hervorgezogen. Ein einzelnes Blatt Pergament, das ziemlich so aussah wie eine Seite aus dem Book of Kells. Es wurde zu dem Buch hinübergebracht, das inzwischen wieder auf seinem Gestell lag, worauf eine lange Untersuchung und eine zweite geflüsterte Beratschlagung folgten.
Abermals machte der Leiter des Sicherheitspersonals eine Geste, dass die Besucher still sein sollten. »Wie es scheint«, sagte er, »haben wir die fehlende Seite gefunden.«
Lautes Murmeln der Erleichterung.
»Ich befürchte aber, dass wir Sie alle trotzdem befragen und durchsuchen müssen, bevor wir die Sicherheitstür dort öffnen können.«
Ein paar vereinzelte wütende Proteste.
»Je eher Sie alle der Vorgehensweise zustimmen«, sagte der Kommandeur erschöpft, »umso eher werden wir alle hier herauskommen.«
Kollektives Stöhnen. »O Gott«, sagte Julia. »Bei diesem Tempo bin ich erst um Mitternacht wieder zurück in Bryn Mawr. Wie ich es hasse, nachts Auto zu fahren.«
»Sie können doch bei mir übernachten. Ich habe eine Suite im Hotel Gansevoort, mit Blick auf den High Line Park.«
Sie schaute ihn an und stellte ein wenig gekränkt fest, dass ihr Herzschlag sich bei diesem Gedanken erheblich beschleunigte. »Ist das so etwas wie ein unanständiger Antrag?«
»Eigentlich ja. Wir werden im Hotelrestaurant wundervoll zu Abend essen und uns über Atomphysik und französische Literatur unterhalten, und dann gehen wir auf mein Zimmer und haben leidenschaftlichen und unanständigen Sex.«
»Sie sind furchtbar direkt.«
»Vita brevis«, sagte er schlicht. Und dieses lateinische Zitat war der Grund, mehr als alles andere, weshalb sie ja sagte.
8
Es war ein frischer Sommermorgen; Gideon ging den einen Häuserblock von seinem Hotel zum Büro von Effective Engineering Solutions in der Little West 12th Street.
Dr. Julia Thrum Murphy. Er empfand mehr als nur einen Hauch von Reue. Sosehr er ihre Gesellschaft genossen hatte, er durfte sich in keinerlei Art von Beziehung verstricken, mit niemandem, nicht jetzt, da ein Todesurteil wie ein Damoklesschwert über ihm schwebte. Es wäre ihr gegenüber nicht fair. Sie wiederum schien ganz glücklich gewesen zu sein mit ihrem One-Night-Stand und hatte sich ohne jeden reuevollen Ton in der Stimme von ihm verabschiedet. Er würde sie gern wiedersehen – aber es sollte nicht sein.
Wütend wischte er seine Schlüsselkarte durch den Schlitz, und flüsterleise öffnete sich die unansehnliche Tür zu den Räumen von EES. Er durchquerte die riesigen Laborflächen mit ihren unter Laken verborgenen Modellen und Versuchsaufbauten, den Technikern in weißen Kitteln, die sich leise unterhielten oder sich irgendetwas auf Klemmbretter notierten; und dann begab er sich ins Konferenzzimmer im obersten Stock des Gebäudes. Dort fand er nur den verdrießlichen, namenlosen Livrierten vor, der wartete und Kaffee servierte. Gideon nahm Platz, verschränkte die Arme hinterm Kopf und lehnte sich zurück. »Einen doppelten Espresso, kein Zucker, danke.«
Der Mann verließ den Raum. Einen Augenblick später kam Glinn herein, eine fast arktische Kälte ausstrahlend. Schweigend dirigierte er seinen elektrischen Rollstuhl zum Kopfende des Konferenztischs, das surrende Geräusch des Motors war die einzige Begrüßung, die Gideon bekam. Kurz darauf betrat Manuel Garza den Raum, Glinns draufgängerischer persönlicher Berater, gefolgt von einem halben Dutzend weiterer EES-Mitarbeiter. Niemand sagte ein Wort. Der Kellner ging herum und nahm von allen die Bestellung für Kaffee oder Tee entgegen. Kaum war er gegangen, drückte Glinn einen Knopf auf der kleinen Konsole neben dem Tisch – offenbar startete er ein Aufzeichnungsgerät – und begann dann in neutralem Tonfall zu sprechen, nannte Datum und Zeit, die Namen der Anwesenden. Danach verstummte er, ließ seinen Blick durch den Raum schweifen und endete bei Gideon.
»Anscheinend sind aller guten Dinge doch nicht drei, oder, Dr. Crew?«
Als Gideon nichts darauf antwortete, drehte sich Glinn zu der Gruppe um, die am Tisch saß. »Dr. Crew hat für uns zwei erfolgreiche Operationen durchgeführt, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Bedauerlicherweise hat sich das Book of Kells als zu anspruchsvoll erwiesen. Nach dem Desaster am gestrigen Tag wird das Buch noch heute Nachmittag nach Irland zurückkehren, in einem gecharterten Jet, umgeben von einem unknackbaren Sicherheitssystem.«
Gideon hörte sich diese Aussage mit verschränkten Armen an.
»Diese stümperhafte und amateurhafte Operation von Dr. Crew hat, wie ich leider sagen muss, unseren Kunden in enorme Schwierigkeiten gebracht. Sie hat in Irland und den Vereinigten Staaten einen internationalen Skandal ausgelöst. Wir haben die Gelegenheit versäumt, die Chi-Rho-Seite in unseren Besitz zu bringen.« Glinn sah sich um. »Mit anderen Worten: Wir sind gescheitert.«
Ernstes Gemurmel unter den Anwesenden. Glinn wandte sich wieder zu Gideon um und richtete sein graues Auge auf ihn. »Haben Sie etwas dazu zu sagen?«
Gideon legte die Arme auf den Tisch. »Nicht wirklich. Außer dass sich das Buch noch nicht außer Landes befindet. Es könnte immer noch etwas passieren.«
»Es könnte immer noch etwas passieren«, wiederholte Garza ätzend sarkastisch. Ein frostiges Schweigen folgte.
»Man weiß ja nie«, fuhr Gideon fort. »Denken Sie doch einmal an Yogi Berra. ›Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist‹.«
Glinns unerschütterliche Fassade zeigte Risse. »Ersparen Sie uns diese abgedroschenen Sprüche. Wir müssen sofort handeln, damit wir den Schaden, den dieses Desaster verursacht hat, begrenzen können.«
»Es ist noch kein Desaster. Der Flug nach Dublin startet um achtzehn Uhr. Bis dahin sind es noch zehn Stunden.«
Glinn runzelte die Stirn. »Wollen Sie damit sagen, dass Sie einen neuen Plan haben, wie Sie die Seite stehlen können, deren Erwerb Ihnen gestern auf so auffällige Weise misslungen ist?«
»Ich finde es bedauerlich, dass Sie nicht mehr Vertrauen in mich haben, Eli.«
»Aber sollten Sie doch irgendeinen Plan B haben, dann bin ich sicher, dass wir ihn gerne hören möchten.«
»Nein, ich habe keinen Plan B. Und zwar, weil Plan A immer noch im Gange ist.«
»Das nennen Sie einen Plan?«, unterbrach ihn Garza. »Ihr Versuch, die Seite zu stehlen, scheitert auf die schlimmstmögliche Art und Weise, wobei auch noch Ihre Personalien aufgenommen werden und wir Gott danken können, dass Sie nicht tatsächlich erwischt wurden. Die ganze Geschichte steht in den Vereinigten Staaten und Europa auf allen Titelseiten. Was für ein Plan!«
»Wissen Sie, wo sich das Buch derzeit befindet?«, fragte Glinn ruhig.
»Nein.«
Wieder tauschten die im Raum Anwesenden ungläubige Blicke aus.
»Ich habe unsere Leute ein wenig recherchieren lassen«, sagte Glinn, »und deshalb weiß ich, wo sich das Book of Kells im Moment befindet: in einem unüberwindlichen Tresor unter dem Citicorp-Gebäude. Der Premierminister von Irland persönlich befindet sich auf dem Weg hierher, um es in seine Heimat zurückzueskortieren. Es wird in seinem persönlichen Besitz sein – vom Citicorp-Tresor bis zu einem Tresorraum in der Bank von Irland, bewacht von den strengsten Sicherheitsvorkehrungen, die der US Secret Service und Interpol liefern können, dazu Straßen, die für jeglichen Verkehr gesperrt sind, Charterjet, das ganze Programm. Und Sie glauben, Sie haben noch immer eine Chance, das Buch zu stehlen?«
»Die Chi-Rho-Seite zu stehlen, ja.« Gideon schaute auf die Uhr.
»Und wieso sind Sie da so sicher?«
»Weil Sie am Ende des heutigen Nachmittags erfahren werden – aus der Nachrichtenquelle Ihrer Wahl –, dass es sich bei der Seite, die beim versuchten Raubüberfall aus dem Book of Kells herausgeschnitten wurde, um eine Fälschung handelt und dass die echte Seite fehlt und mutmaßlich gestohlen wurde.«
Schockierte Blicke am ganzen Tisch.
»Ist das wahr?«, fragte Glinn.
»Natürlich.«
»Nun«, sagte Glinn nach einem Moment und erwiderte Gideons Blick mit feinem, kaltem Lächeln. »Das ist außerordentlich. Obwohl, Sie hätten uns dieses Drama durchaus ersparen können.«