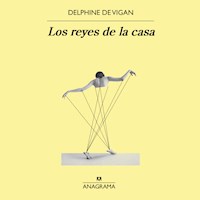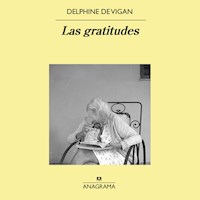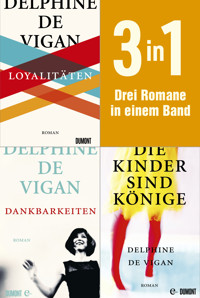
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Romane von Delphine de Vigan, einer der bekanntesten Gegenwartsautorinnen Frankreichs! Loyalitäten: Der 12-jährige Théo ist ein stiller, aber guter Schüler und ein vorbildlicher Sohn: selbstständig und fürsorglich. Er scheint zu funktionieren. Doch eine Lehrerin schlägt Alarm, und auch die Mutter seines besten Freundes beobachtet ihn mit Misstrauen. Die beiden Frauen haben die richtige Ahnung: Théo ist mit seinem Leben überfordert und sucht einen gefährlichen Ausweg. In ihrem Roman erzählt Delphine de Vigan von der manchmal gefährlichen Komplexität unserer Beziehungen. Dabei erweist sie sich einmal mehr als unbestechliche Chronistin zwischenmenschlicher Missstände. Dankbarkeiten: Von dem Tag an, an dem sie spürt, dass sie ihre Unabhängigkeit verliert, beginnt Michka zu träumen: von der Vergangenheit, von Versäumnissen und Verlorenem. Tatsächlich verliert die weltoffene alte Frau nach und nach Wörter, ersetzt sie durch ähnlich klingende. Nur zwei junge Menschen, Marie und Jérôme, verstehen, was in ihr vorgeht. Je mehr Michka um ihre Ausdruckskraft ringt, desto dringlicher wird ihr Wunsch, einem Ehepaar, das ihr einst das Leben gerettet hat, ihre Dankbarkeit zu zeigen. Und so bittet sie Marie, eine Suchanzeige aufzugeben. Klarsichtig und scharfsinnig zeigt Delphine de Vigan, was uns am Ende bleibt: Zuneigung, Mitgefühl, Dankbarkeit. Und zugleich würdigt sie in ›Dankbarkeiten‹ all diejenigen, die uns zu den Menschen gemacht haben, die wir sind. Die Kinder sind Könige: Mélanie war als junges Mädchen ein großer Fan von Formaten wie ›Big Brother‹. Sie hatte stets davon geträumt, gesehen und berühmt zu werden. Jahre später, als Mutter zweier Kinder, ist es ihr gelungen: Sie ist eine erfolgreiche YouTuberin mit Tausenden von Followern. Objekt ihrer Videos und Posts sind ihre Kinder, die auf Schritt und Tritt gefilmt werden. Seit Kurzem kommt ihre kleine Tochter Kimmy dem Filmen jedoch immer unwilliger nach. Mélanie tut das als eine Laune ab. Denn wie könnte man die unendliche Liebe, die ihnen aus dem Netz entgegenkommt, als Last empfinden? Doch kurz darauf verschwindet Kimmy nach einem Versteckspiel spurlos. Der Roman "Die Kinder sind Könige" wurde 2024 von Disney als Serie adaptiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über die Bücher
Drei Romane von Delphine de Vigan, einer der bekanntesten Gegenwartsautorinnen Frankreichs!
Loyalitäten
Der 12-jährige Théo ist ein stiller, aber guter Schüler und ein vorbildlicher Sohn: selbstständig und fürsorglich. Er scheint zu funktionieren. Doch eine Lehrerin schlägt Alarm, und auch die Mutter seines besten Freundes beobachtet ihn mit Misstrauen. Die beiden Frauen haben die richtige Ahnung: Théo ist mit seinem Leben überfordert und sucht einen gefährlichen Ausweg.
In ihrem Roman erzählt Delphine de Vigan von der manchmal gefährlichen Komplexität unserer Beziehungen. Dabei erweist sie sich einmal mehr als unbestechliche Chronistin zwischenmenschlicher Missstände.
Dankbarkeiten
Von dem Tag an, an dem sie spürt, dass sie ihre Unabhängigkeit verliert, beginnt Michka zu träumen: von der Vergangenheit, von Versäumnissen und Verlorenem. Tatsächlich verliert die weltoffene alte Frau nach und nach Wörter, ersetzt sie durch ähnlich klingende. Nur zwei junge Menschen, Marie und Jérôme, verstehen, was in ihr vorgeht. Je mehr Michka um ihre Ausdruckskraft ringt, desto dringlicher wird ihr Wunsch, einem Ehepaar, das ihr einst das Leben gerettet hat, ihre Dankbarkeit zu zeigen. Und so bittet sie Marie, eine Suchanzeige aufzugeben.
Klarsichtig und scharfsinnig zeigt Delphine de Vigan, was uns am Ende bleibt: Zuneigung, Mitgefühl, Dankbarkeit. Und zugleich würdigt sie in ›Dankbarkeiten‹ all diejenigen, die uns zu den Menschen gemacht haben, die wir sind.
Die Kinder sind Könige
Mélanie war als junges Mädchen ein großer Fan von Formaten wie ›Big Brother‹. Sie hatte stets davon geträumt, gesehen und berühmt zu werden. Jahre später, als Mutter zweier Kinder, ist es ihr gelungen: Sie ist eine erfolgreiche YouTuberin mit Tausenden von Followern.
Objekt ihrer Videos und Posts sind ihre Kinder, die auf Schritt und Tritt gefilmt werden. Seit Kurzem kommt ihre kleine Tochter Kimmy dem Filmen jedoch immer unwilliger nach. Mélanie tut das als eine Laune ab. Denn wie könnte man die unendliche Liebe, die ihnen aus dem Netz entgegenkommt, als Last empfinden? Doch kurz darauf verschwindet Kimmy nach einem Versteckspiel spurlos.
Der Roman wurde von Disney als Serie adaptiert.
© Francesca Mantovani/Editions Gallimard
Über die Autorin und die Übersetzerin
Delphine de Vigan, geboren 1966, erreichte ihren endgültigen Durchbruch als Schriftstellerin mit dem Roman ›No & ich‹ (2007), für den sie mit dem Prix des Libraires und dem Prix Rotary International 2008 ausgezeichnet wurde. Ihr Roman ›Nach einer wahren Geschichte‹ (DuMont 2016) stand wochenlang auf der Bestsellerliste in Frankreich und erhielt 2015 den Prix Renaudot. Zuletzt erschienen bei DuMont ihre Romane ›Dankbarkeiten‹ (2020), ›Das Lächeln meiner Mutter‹ (2021) und ›Die Kinder sind Könige‹ (2022). Die Autorin lebt mit ihren Kindern in Paris.
Doris Heinemann, geboren 1957, studierte Romanistik und Germanistik in Köln und Montpellier, arbeitete als Sprachlehrerin, als Übersetzerin im Generalsekretariat des EG-Ministerrats und übersetzt seit 1997Literatur, u.a. von Christian Gailly, Gabriel Chevallier, Theresa Révay, Yann Queffélec, Jean-Claude Derey und Olivier Rolin.
Delphine de Vigan
Loyalitäten,
Dankbarkeiten &
Die Kinder sind Könige
Drei Romane in einem Band
Aus dem Französischen von Doris Heinemann
Vollständige E-Book-Ausgabe der auf Deutsch im DuMont Buchverlag erschienenen Werke ›Loyalitäten‹ (© 2018), ›Dankbarkeiten‹ (© 2020) und ›Die Kinder sind Könige‹ (© 2022)
E-Book 2025
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Die französischen Originalausgaben erschienen 2018 unter dem Titel ›Les loyautés‹ (© Éditions Jean-Claude Lattès, 2018) und 2019 unter dem Titel ›Les gratitudes‹ (© Editions Jean-Claude Lattès, 2019) bei Editions JC Lattès, Paris und 2021 unter dem Titel ›Les enfants sont rois‹ (© Éditions Gallimard, 2021) bei Gallimard, Paris.
© 2025 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Übersetzung: Doris Heinemann
Covergestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Coverabbildung ›Dankbarkeiten‹: © Suteishi/Gettyimages
Coverabbildung ›Die Kinder sind Könige‹: © plainpicture/Pupa Neumann
Satz ›Loyalitäten‹ und ›Die Kinder sind Könige‹: Angelika Kudella, Köln
Satz ›Dankbarkeiten‹: Fagott, Ffm
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book: 978-3-7558-1122-0
www.dumont-buchverlag.de
Zitatnachweise ›Die Kinder sind Könige‹:
Stephen King, ›Das Leben und das Schreiben‹, © 2000 Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH. Übersetzung: Andrea Fischer
Der Abdruck der Textstelle aus Annie Ernaux, ›Die Jahre‹ [1] erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp Verlags. Annie Ernaux, ›Die Jahre‹. Aus dem Französischen von Sonja Finck. © 2017 Suhrkamp Verlag, Berlin
Delphine de Vigan
LOYALITÄTEN
Roman
Aus dem Französischen von Doris Heinemann
LOYALITÄTEN
Das sind die unsichtbaren Verbindungen, die uns mit den anderen – den Toten wie den Lebenden – verbinden, leise gemachte Versprechungen, deren Auswirkungen wir nicht kennen, still gehaltene Treue, das sind Verträge, die wir zuallermeist mit uns selbst geschlossen haben, Befehle, die wir hingenommen, aber nie gehört haben, und in den Nischen unserer Erinnerungen nistende Schulden.
Das sind die Gesetze der Kindheit, die in unseren Körpern schlummern, die Werte, in deren Namen wir uns aufrecht halten, die Fundamente, die es uns ermöglichen, Widerstand zu leisten, unlesbare Grundsätze, die an uns nagen und uns einschließen. Unsere Flügel und unsere Fesseln.
Das sind die Sprungbretter, auf denen sich unsere Kräfte entfalten, und die Gruben, in denen wir unsere Träume begraben.
HÉLÈNE
Ich dachte, der Kleine sei misshandelt worden, das dachte ich sehr bald, vielleicht nicht an den ersten Tagen, aber nicht lange nach Schuljahresbeginn, es war etwas an seiner Art, sich zu halten, sich dem Blick zu entziehen, das kenne ich, das kenne ich nur zu gut, diese Art, mit der Umgebung zu verschmelzen, transparent zu werden. Aber bei mir funktioniert das nicht. Schläge habe ich als Kind selbst bekommen, und die Spuren habe ich bis zum Schluss verborgen, also kann man mir da nichts vormachen. Ich sage »der Kleine«, weil man sie wirklich nur zu sehen braucht, die Jungs dieses Alters mit ihrem mädchenhaft weichen Haar, ihrer zarten Stimme und dieser Unsicherheit, die all ihren Bewegungen anhaftet, man muss sie nur sehen, wie sie erstaunt die Augen aufreißen oder mit zitternden Lippen die Hände hinter dem Rücken verschlingen, weil sie ausgeschimpft werden, man würde ihnen nicht die geringste Missetat unterstellen. Und doch besteht kein Zweifel, das ist das Alter, in dem es mit den wirklich schlimmen Dummheiten anfängt.
Einige Wochen nach Schuljahresbeginn bat ich den Schulleiter um ein Gespräch über Théo Lubin. Ich musste es mehrmals erklären. Nein, weder Spuren noch vertrauliche Mitteilungen, nur etwas im Verhalten des Schülers, etwas wie eine Abschottung, eine besondere Art, sich der Aufmerksamkeit zu entziehen. Monsieur Nemours musste erst einmal lachen: sich der Aufmerksamkeit entziehen – würde dies nicht für die halbe Klasse gelten? Ja, natürlich wusste ich, was er meinte: diese ihre Gewohnheit, auf dem Stuhl zusammenzusinken, um nicht drangenommen zu werden, in ihrem Rucksack zu kramen oder plötzlich den Tisch mit einer Aufmerksamkeit zu betrachten, als hinge das Wohl des ganzen Viertels davon ab. Die erkenne ich, ohne auch nur aufblicken zu müssen. Aber damit hatte es nichts zu tun. Ich fragte, was über den Schüler und seine Familie bekannt sei. Es müssten doch irgendwelche Informationen in den Unterlagen zu finden sein, Anmerkungen, ein früherer Hinweis. Der Schulleiter sah die Kommentare in den Zeugnissen noch einmal genau durch, tatsächlich hatten mehrere Lehrer im vergangenen Schuljahr bemerkt, wie stumm er war, aber mehr auch nicht. Er las mir die Kommentare laut vor: »sehr introvertierter Schüler«, »müsste mehr am Unterricht teilnehmen«, »gute Leistungen, aber zu schweigsam« und so weiter. Die Eltern leben getrennt, der Kleine in wechselnder Obhut, also nichts wirklich Ungewöhnliches. Der Schulleiter fragte mich, ob Théo sich mit anderen Jungen in der Klasse angefreundet habe, und ich konnte nichts Gegenteiliges behaupten, denn sie stecken immer zusammen, die beiden, sie haben sich gesucht und gefunden, das gleiche Engelsgesicht, dieselbe Haarfarbe, derselbe helle Teint, man könnte sie für Zwillinge halten. Ich beobachte sie durchs Fenster, wenn sie auf dem Pausenhof sind, sie bilden einen einzigen unzugänglichen Körper, eine Art Qualle, die sich plötzlich zusammenzieht, wenn sich jemand nähert, um sich dann, wenn die Gefahr vorüber ist, wieder auszudehnen. Die wenigen Momente, in denen ich Théo lächeln sehe, sind die, in denen er mit Mathis Guillaume zusammen ist und kein Erwachsener ihren Sicherheitsabstand unterschreitet.
Das Einzige, was den Schulleiter stutzig werden ließ, war ein Bericht, den die Schulschwester am Ende des vergangenen Schuljahrs geschrieben hatte. Der Bericht lag nicht in der Schulakte. Frédéric war es gewesen, der mir geraten hatte, für alle Fälle mal in der Krankenstation nachzufragen. Ende Mai hatte Théo darum gebeten, die Klasse verlassen zu dürfen. Wegen Kopfschmerzen, wie er sagte. Die Krankenschwester erwähnte ein ausweichendes Verhalten und völlig uneindeutige Symptome. Sie hat außerdem festgehalten, dass er gerötete Augen hatte. Théo habe behauptet, er brauche immer sehr viel Zeit, um einzuschlafen, manchmal könne er sogar die ganze Nacht lang nicht schlafen. Unten auf dem Blatt hat sie in Rot »anfälliger Schüler« geschrieben und es dreimal unterstrichen. Anschließend hat sie die Akte wahrscheinlich zugeklappt und wieder in den Schrank geräumt. Ich konnte sie nicht mehr dazu befragen, weil sie die Schule inzwischen verlassen hat.
Ohne dieses Dokument hätte ich nie erreicht, dass Théo von der neuen Schulschwester einbestellt wurde.
Ich sprach mit Frédéric darüber, er schien mir beunruhigt. Er sagte mir, ich solle mir diese Geschichte nicht allzu sehr zu Herzen nehmen. Seit einiger Zeit wirke ich erschöpft und extrem angespannt auf ihn, kurz vorm Zerspringen, so formulierte er es, und ich dachte sofort an das Messer, das mein Vater in der Küchenschublade aufbewahrte, wo es jedermann zugänglich war, ein Springmesser, mit dessen Sicherung er ständig spielte, ganz mechanisch, um seine Nerven zu beruhigen.
THÉO
Es ist eine Wärmewelle, die er nicht zu beschreiben weiß, brennend, versengend und schmerzlich und tröstlich zugleich, ein Moment, wie man ihn nicht oft erlebt und der bestimmt einen Namen trägt, den er nicht kennt, einen chemischen, physiologischen Namen, der seine Intensität ausdrückt und etwas mit Verbrennung oder Explosion oder Detonation zu tun hat. Er ist zwölfeinhalb, und wollte er auf die Fragen, die ihm die Erwachsenen stellen – »Welchen Beruf möchtest du später ausüben?«, »Was machst du am liebsten?«, »Was willst du werden?« –, ehrlich antworten und wäre da nicht seine Angst, ihm brächen dann sofort die letzten anscheinend noch bestehenden Möglichkeiten weg, Halt zu finden, würde er ohne jedes Zögern sagen: Ich liebe es, den Alkohol in meinem Körper zu spüren. Erst im Mund, dieser Augenblick, wenn die Kehle die Flüssigkeit aufnimmt, und dann diese wenigen Zehntelsekunden, in denen die Wärme in seinen Magen hinuntergleitet, er könnte ihrer Spur sogar mit dem Finger folgen. Er mag diese feuchte Welle, die ihm den Nacken streichelt und sich in seinen Gliedern wie ein Betäubungsmittel ausbreitet.
Er trinkt aus der Flasche und muss mehrmals husten. Mathis, der ihm gegenübersitzt, beobachtet ihn und lacht. Théo denkt an den Drachen in dem Bilderbuch, das ihm seine Mutter immer vorgelesen hat, als er klein war, an den gigantischen Körper, die wie mit dem Messer gezogenen Schlitzaugen und das offene Maul mit den Reißzähnen, die spitzer waren als die von bissigen Hunden. Wie gern wäre er dieses riesige Tier mit den Schwimmhäuten zwischen den Krallen, das alles verbrennen kann. Er atmet tief durch und setzt die Flasche noch einmal an. Wenn er sich vom Alkohol betäuben lässt, wenn er sich dessen Weg durch den Körper vorzustellen versucht, denkt er an eins der Schaubilder, die Madame Destrée im Unterricht verteilt und auf denen sie alles benennen müssen: Zeig den Weg des Apfels und nenne die an der Verdauung beteiligten Organe. Bei diesem Gedanken muss er lächeln, zum Spaß verändert er die Aufgabe. Zeig den Weg des Wodkas; male seinen Weg bunt nach; berechne die Zeit, die die ersten drei Schlucke brauchen, um bis in dein Blut zu gelangen … Er lacht vor sich hin, und Mathis lacht über dieses Lachen.
Nach einigen Minuten explodiert etwas in seinem Hirn, eine Tür wird mit dem Fuß aufgestoßen, es entsteht ein mächtiger Luftzug voller Staub, und jetzt steht ihm das Bild eines Wildwest-Saloons vor Augen, dessen Flügeltüren kreischend auffliegen. Einen Augenblick lang ist er der Cowboy in Reitstiefeln, der durch das Halbdunkel auf die Theke zugeht und dessen Sporen über den Boden scharren. Als er den Ellbogen auf den Tresen stützt und einen Whisky bestellt, hat er das Gefühl, alles sei aufgehoben, die Angst und die Erinnerungen. Die Raubvogelklauen, die seine Brust ständig zusammendrücken, haben sich endlich gelöst. Er schließt die Augen, alles ist weggewaschen, ja, und alles kann beginnen.
Mathis nimmt ihm die Flasche aus der Hand und setzt sie an den Mund. Jeder ist mal dran. Etwas Wodka fließt daneben, ein durchsichtiges Rinnsal läuft über Mathis’ Kinn. Théo protestiert: »Wieder ausspucken gilt nicht.« Also schluckt Mathis alles auf einmal, Tränen treten ihm in die Augen, er hustet, hält die Hand vor den Mund, und Théo fragt sich einen Augenblick lang, ob Mathis sich nicht übergeben muss, doch nach einigen Sekunden lacht Mathis unwillkürlich noch lauter auf. Hastig drückt ihm Théo die Hand auf den Mund, um ihn zum Schweigen zu bringen. Mathis hört auf zu lachen.
Sie halten den Atem an, reglos lauschen sie auf die Geräusche ringsum. Von Ferne ist die Stimme eines Lehrers zu hören, die sie nicht identifizieren können, ein tonloser Monolog, aus dem kein Wort hervorsticht.
Sie sind in ihrem Versteck, in ihrer Zuflucht. Das hier ist ihr Gebiet. Unter der Treppe zur Mensa haben sie eine leere Nische entdeckt, etwa ein Quadratmeter, auf dem sie fast stehen können. Um den Zugang zu ihr zu versperren, wurde ein großer Schrank davorgestellt, doch mit ein wenig Geschick können sie sich unter ihm hindurchzwängen. Es ist alles eine Sache des richtigen Augenblicks. Sie verstecken sich in der Toilette, bis alle Schüler wieder in den Klassenräumen sind. Und warten dann einige Minuten, bis sich der Aufseher entfernt hat, der jede Stunde nachsieht, ob sich irgendwelche Schüler auf den Gängen herumtreiben.
Jedes Mal, wenn es ihnen gelungen ist, sich hinter den Schrank zu schlängeln, stellen sie fest, dass es inzwischen um wenige Zentimeter geht. In einigen Monaten werden sie es nicht mehr schaffen.
Mathis hält ihm die Flasche hin.
Nach einem letzten Schluck leckt sich Théo über die Lippen, er mag diesen Geschmack nach Salz und nach Metall, der lange, manchmal sogar mehrere Stunden lang, im Mund bleibt.
Der Abstand zwischen Zeigefinger und Daumen zeigt ihnen, wie viel sie getrunken haben. Sie versuchen mehrmals zu messen, können jedoch beide nicht verhindern, dass der Finger verrutscht, und prusten jedes Mal los.
Sie haben viel mehr getrunken als beim letzten Mal.
Und beim nächsten Mal werden sie noch viel mehr trinken.
Das ist ihr Pakt, ihr Geheimnis.
Mathis nimmt die Flasche zurück, wickelt sie in Papier und schiebt sie dann in seinen Rucksack.
Sie nehmen jeder zwei Dragees Airwaves-Kaugummi Menthol-Lakritz. Sie kauen gewissenhaft, um das Aroma freizusetzen, und schieben den Kaugummi im Mund hin und her, nur diese Sorte kann den Geruch überdecken. Sie warten den richtigen Moment ab, um ihr Versteck zu verlassen.
Sobald sie stehen, fühlt sich alles ganz anders an. Théos Kopf schwankt vor und zurück, aber es ist nicht zu sehen.
Auf Zehenspitzen geht er über einen flüssigen Teppich mit geometrischem Muster, er fühlt sich außerhalb seiner selbst, einfach neben sich, als hätte er seinen Körper verlassen, würde ihn aber noch bei der Hand halten.
Die Geräusche der Schule dringen kaum bis zu ihm vor, sie werden gedämpft von einem unsichtbaren saugfähigen Material, das ihn beschützt.
Eines Tages möchte er gern das Bewusstsein verlieren, völlig.
Sich für ein paar Stunden oder für immer in das dicke Gewebe der Trunkenheit fallen, sich davon bedecken, begraben lassen, er weiß, dass so etwas vorkommt.
HÉLÈNE
Ich beobachte ihn unwillkürlich. Ich merke genau, dass meine Aufmerksamkeit unablässig zu ihm zurückkehrt. Ich zwinge mich, die anderen anzusehen, jeden einzeln, wenn ich spreche und sie zuhören oder wenn sie sich Montagvormittags auf ihren schriftlichen Test konzentrieren. Und just am Montag sah ich ihn noch blasser als sonst in den Unterricht kommen. Er wirkte wie ein Kind, das am Wochenende kein Auge zugetan hat. Er machte die gleichen Bewegungen wie die anderen – Jacke ausziehen, Stuhl vorrücken, Eastpak-Rucksack auf den Tisch stellen, Reißverschluss öffnen, Arbeitsheft herausnehmen –, und ich kann nicht einmal behaupten, er sei mir langsamer als sonst vorgekommen oder fahriger; dennoch sah ich, dass er am Ende seiner Kräfte war. Zu Beginn der Stunde dachte ich, er würde einschlafen, weil ihm das seit Schuljahresbeginn schon ein oder zwei Mal passiert ist.
Als ich später im Lehrerzimmer über Théo sprach, wies mich Frédéric ohne jede Ironie darauf hin, dass er nicht der Einzige in einer solchen Verfassung sei. Sie verbrächten so viel Zeit vor ihren Bildschirmen, dass wir pausenlos warnende Hinweise geben müssten, wenn wir uns um jeden müde wirkenden Schüler sorgen wollten. Augenringe würden also gar nichts beweisen.
Es ist irrational, das weiß ich.
Ich habe nichts. Absolut nichts. Keine Tatsache, keinen Beweis.
Frédéric versucht meine Befürchtungen zu beschwichtigen. Und meine Ungeduld. Die Schulschwester hat gesagt, sie würde ihn zu sich bestellen. Sie wird es tun.
Neulich versuchte ich ihm dieses Gefühl einer ablaufenden Frist zu erklären, das mich seit Tagen bedrückt, als wäre ohne unser Wissen eine Eieruhr aufgezogen worden und als verstriche kostbare Zeit, ohne dass wir das Ticken hörten, als würden wir uns in einem schweigenden Zug auf etwas Absurdes zubewegen, dessen Auswirkungen wir uns nicht vorstellen können.
Frédéric sagte noch einmal, dass ich überreizt wirke.
»Du bist diejenige, die sich ausruhen sollte«, sagte er.
Heute Morgen habe ich die Unterrichtseinheit über die Verdauung fortgesetzt. Théo richtete sich plötzlich auf und hörte aufmerksamer zu als sonst. Ich zeichnete das Schema über die Flüssigkeitsaufnahme an die Tafel, und er zeichnete es ungewöhnlich geduldig in sein Heft ab.
Als er nach der Stunde an mir vorbeikam, um den Klassenraum zu verlassen, konnte ich nicht anders, ich hielt ihn zurück. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren war, ich legte ihm die Hand auf die Schulter, damit er mir zuhörte, und sagte: »Théo, bitte bleib noch einen Augenblick.« Sofort lief empörtes Gemurmel durch die Gruppe: Wie kam ich dazu, ohne expliziten Grund einen Schüler zurückzuhalten, wo doch in der vergangenen Unterrichtsstunde nichts vorgefallen war, das meine Bitte rechtfertigte? Ich wartete, bis alle draußen waren. Théo stand mit gesenktem Kopf da. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber ich konnte auch nicht mehr zurück, ich musste einen Vorwand, eine Frage, irgendetwas finden. Was war bloß in mich gefahren? Als sich die Tür endlich hinter dem letzten Schüler (Mathis Guillaume, natürlich) geschlossen hatte, war mir immer noch nichts eingefallen. Die Stille dauerte einige Sekunden. Théo fixierte seine Nikes. Und dann hob er den Kopf, ich glaube, da sah er mich zum ersten Mal wirklich an, ohne meinem Blick irgendwie auszuweichen. Wortlos sah er mich an, und ich habe bei einem Jungen dieses Alters noch nie einen derart intensiven Blick erlebt. Er wirkte nicht erstaunt, auch nicht ungeduldig. Er sah mich an, und in seinem Blick lag keine Frage – als wäre es ganz normal, dass es so weit gekommen war, als wäre das alles vorherbestimmt gewesen und ganz natürlich. Und genauso natürlich war die Sackgasse, in der wir steckten, diese Unmöglichkeit, noch irgendeinen Schritt zu tun, etwas zu versuchen, was auch immer. Er sah mich an, als hätte er den Impuls verstanden, der mich dazu bewogen hatte, ihn zurückzuhalten, und als verstünde er ebenso, dass ich nicht weiter gehen konnte. Er wusste genau, was ich empfand.
Er wusste, dass ich es wusste und dass ich nichts für ihn tun konnte.
Das war es, was ich in diesem Augenblick dachte. Und mit einem Mal war meine Kehle wie zugeschnürt.
Ich weiß nicht, wie lange das dauerte, in meinem Kopf purzelten die Wörter durcheinander – Eltern, Zuhause, Müdigkeit, Traurigkeit, alles in Ordnung? –, doch keins davon führte zur Formulierung einer Frage, die ich mir ihm gegenüber hätte erlauben dürfen.
Schließlich lächelte ich, glaube ich, und dann hörte ich mich mit einer Stimme, die nicht meine war, einer unsicheren Stimme, die ich an mir nicht kannte, fragen:
»Bist du diese Woche bei deinem Vater oder bei deiner Mutter?«
Er zögerte, bevor er antwortete.
»Bei meinem Vater. Jedenfalls bis heute Abend.«
Er nahm seinen Rucksack, warf ihn sich über die Schulter und gab damit das Signal zum Aufbruch, das ich ihm schon längst hätte gewähren müssen. Er ging auf die Tür zu.
Kurz bevor er den Klassenraum verließ, drehte er sich noch einmal zu mir um und sagte:
»Aber wenn Sie mit meinen Eltern sprechen wollen, kommt meine Mutter.«
THÉO
Nach Schulschluss trieb er sich noch zehn Minuten vor dem collège herum, und dann ging er bei seinem Vater vorbei, um seine Sachen zu holen. Die Vorhänge waren nicht aufgezogen worden, er knipste nur in der Küche das Licht an, um zu seinem Zimmer zu gehen. Als er das Wohnzimmer durchquerte, hörte er ein seltsames Geräusch, ein ersticktes, auf- und abschwellendes Knistern, irgendwo musste ein Insekt gefangen sein. Er versuchte im Dunkeln die Geräuschquelle auszumachen, doch dann begriff er, dass das Radio seit dem Morgen weitergelaufen, der Ton aber so leise gedreht worden war, dass man die Worte nicht mehr verstehen konnte.
Jeden Freitag dasselbe Ritual: alles zusammensuchen, die Kleidungsstücke, die Sneaker, sämtliche Bücher, die Aktenordner und Arbeitshefte, den Schläger für die Tischtennis-AG, das Lineal, das Pauspapier, die Filzstifte, die Zeichenmappe. Bloß nichts vergessen. Jeden Freitag zieht er, beladen wie ein Muli, von einem Ort zum anderen.
Die Leute in der Metro sehen ihn an, vermutlich fürchten sie, er könne hinfallen oder zusammenbrechen, dieser kleine, unter den vielen Beuteln und Taschen schwankende Körper. Er beugt sich, aber er gibt nicht nach. Lehnt es ab, sich zu setzen.
Im Aufzug, vor der Ankunft am anderen Ufer, legt er seine Last ab und genehmigt sich endlich ein wenig Zeit zum Durchatmen.
Das ist es, was er jeden Freitag zur etwa gleichen Uhrzeit leisten muss: diesen Umzug von einer Welt in die andere, ohne Brücke, ohne Fährmann. Zwei nichtleere Mengen ohne jede Schnittmenge.
Acht Metrostationen entfernt: eine andere Kultur, andere Sitten, eine andere Sprache. Er hat nur wenige Minuten Zeit, um sich zu akklimatisieren.
Es ist 18Uhr30, als er die Tür öffnet, und seine Mutter ist schon da.
Sie sitzt in der Küche und schneidet Gemüse in feine Scheiben, dessen Form ihn interessiert, er würde gern fragen, wie es heißt, aber das ist jetzt nicht der passende Moment.
Sie sieht ihn an, mustert ihn, ein schweigender Scanner, das Radar-Auge, sie kann nicht anders. Sie schnüffelt an ihm. Eine Woche lang hat sie ihn nicht gesehen, doch es gibt keine Umarmung, es ist die Spur des anderen, die sie ebenso sucht, wie sie sie fürchtet, die Spur des Feindes.
Das ist für sie unerträglich: wenn er von der anderen Seite zurückkommt. Théo hat ihn sehr schnell verstanden, diesen Argwohn, den sie ausstrahlt, wenn er von seinem Vater zurückkehrt, und diesen Abwehrimpuls, den sie kaum verbergen kann.
Übrigens sagt sie meistens, noch bevor sie ihm Guten Tag sagt: »Geh duschen!«
Von den Tagen, die er bei seinem Vater verbracht hat, wird keine Rede sein. Die sind ein völlig lichtundurchlässiger Raum-Zeit-Riss, dessen Vorhandensein geleugnet wird. Sie wird keine Fragen stellen, das weiß er. Sie wird nicht fragen, ob er eine gute Woche gehabt habe oder ob es ihm gut gehe. Sie wird nicht fragen, ob er gut gegessen und geschlafen habe, was er getan und erlebt habe. Sie wird den Lauf der Dinge an dem Punkt weitergehen lassen, wo sie ihn eine Woche zuvor zurückgelassen haben, ganz so, als wäre nichts geschehen, als könnte nichts geschehen. Eine Woche seines Lebens aus dem Kalender gestrichen. Wenn er nicht seinen Quo-Vadis-Kalender hätte – in dem er für jeden verbrachten Tag aus der betreffenden Seite sorgsam die perforierte Ecke herauslöst –, könnte er selbst daran zweifeln, diese Woche erlebt zu haben.
Er wird die Kleidungsstücke, die er trägt, in die schmutzige Wäsche tun, ausnahmslos alle, und zwar getrennt in einer Plastiktüte, weil sie nicht will, dass sie mit den anderen in Berührung kommen. Unter der Dusche wird das warme Wasser den Geruch wegwaschen, den sie nicht erträgt.
In den Stunden nach seiner Rückkehr wird sie ihn mit diesem bösen Blick verfolgen, der ihr nicht einmal bewusst ist, den er jedoch bestens kennt, mit diesem inquisitorischen Blick. Denn unablässig forscht sie bei ihrem Sohn, der noch keine dreizehn Jahre alt ist, nach der Bewegung, dem Tonfall, der Haltung des Mannes, dessen Namen sie nicht mehr nennt. Jede reale oder unterstellte Nachahmung oder Ähnlichkeit bringt sie außer sich und führt zu einer sofortigen Gegenmaßnahme, diese Krankheit muss unverzüglich ausgerottet werden. Nun sieh doch mal, wie du dich hältst, leg deine Hände nicht so hin, setz dich richtig auf den Stuhl, nicht nur auf die Kante, hampel nicht so rum, halt dich gerade, man könnte meinen, du wärst der andere.
Geh auf dein Zimmer.
Wenn sie von seinem Vater spricht, wenn die Umstände sie dazu zwingen, von dem Mann zu sprechen, mit dem sie verheiratet war und bei dem ihr Sohn gerade eine ganze Woche verbracht hat, wenn sie es sich nicht ersparen kann, spricht sie nie seinen Vornamen aus.
Sie sagt »der andere«, »der Scheißkerl«, »der erbärmliche Wicht«.
»Dieser Knallkopf« oder »der Widerling«, wenn sie mit ihren Freundinnen telefoniert.
Théo steckt es ein, sein zarter Körper ist von Wörtern durchlöchert, doch sie sieht es nicht. Die Wörter zerstören ihn, es ist ein unerträglicher Ultraschall, ein Larsen-Effekt, den nur er zu hören scheint, eine unhörbare Frequenz, die ihm das Hirn zerreißt.
In der Nacht nach seiner Rückkehr wird er von einem schrillen, fernen Ton geweckt. Ein hoher Ton, ein störendes Pfeifen, das aus seinem Innern kommt. Wenn er die Handflächen auf die Ohren drückt, nimmt es zunächst zu und lässt dann nach. Das nennt sich »Tinnitus«. Das hat er auf einer Gesundheitsseite im Internet gelesen. Das Geräusch tritt immer häufiger auf, mitten in der Nacht. Anfangs dachte er, es komme von außen. Er stand auf. Ging in die Küche, horchte an den Haushaltsgeräten, den Wasserrohren im Badezimmer, öffnete die Wohnungstür. Und dann begriff er es.
Das Geräusch ist in seinem Kopf. Wenn das Geräusch endlich aufhört, kann er nicht mehr einschlafen.
Er hat nur eine einzige Erinnerung an seine Eltern aus der Zeit, als sie noch zusammen waren.
Seine Mutter sitzt auf einem steifen, mit einem senffarbenen, plüschigen Stoff bezogenen Sofa. (Tatsächlich ist er sich nicht sicher, dass er sich wirklich an das Sofa erinnert, es könnte sein, dass er sich die Einzelheiten dieses Bildes anhand eines Fotos zusammengebaut hat; das hat ihnen Madame Destrée zu Beginn des Schuljahrs im Zusammenhang mit dem Gedächtnis erklärt; es gibt Dinge, die man behält, andere, die man verändert oder sich ausdenkt, und noch andere, die man sich zu eigen macht.) Seine Mutter sitzt sehr aufrecht und angespannt da, sie lehnt sich nicht an. Sein Vater geht vor ihr auf und ab, er spricht nicht, er ist wie ein Tier, das in seinem Käfig hin und her streicht. Théo sitzt auf dem Boden oder vielleicht auch neben seiner Mutter, die ihn aber nicht berührt. Er muss den Kopf heben, um sie zu beobachten. Mit vier Jahren und wenigen Monaten ist er der wachsame Zuschauer eines schwelenden Kriegs, der sehr bald ausbrechen wird.
Und dann kommen die Wörter, die seine Mutter ausspricht, Wörter, die ihn sofort verletzen, ihm den Atem rauben, sich in seine Festplatte brennen, Erwachsenenwörter, die etwas in sich tragen, dessen Bedeutung er nicht versteht, dessen Macht er aber spürt. Seine Mutter sieht zu Boden, doch was sie sagt, ist an seinen Vater gerichtet:
»Du ekelst mich an.«
Sie haben seine Anwesenheit vergessen, oder aber sie denken, er sei noch zu klein, um das zu verstehen, sich daran zu erinnern, doch gerade weil diese Wörter etwas enthalten, das sein Verständnis übersteigt, etwas Festes und vielleicht ein bisschen Schleimiges, wird er sich an sie erinnern.
In diesem Augenblick können sich weder sie noch er vorstellen, dass ihr vier Jahre und ein paar Monate alter Sohn nur eine einzige Erinnerung an sie beide als Paar haben wird, und zwar diese.
Théo kommt aus der Dusche, er hat sich frische Sachen angezogen. Er denkt an Madame Destrée, die wissen wollte, bei welchem Elternteil er die Woche verbringt. Sie hat ihn irgendwie komisch angesehen. Als er Mathis am Ausgang eingeholt hatte, hat er zu ihm gesagt: »Diese Frau hat einfach einen Knall.« Doch als er jetzt daran zurückdenkt, geht ihm eine heiße Scham über die Stirn und breitet sich bis zu seinem Hals aus. Er bereut diesen Satz.
Seine Mutter ist immer noch in der Küche, sie hört zerstreut eine Radiosendung, während sie die Vorbereitungen für das Abendessen abschließt. Er fragt, ob er sich auf YouTube Videos ansehen darf.
Nein.
Er solle lieber seine Hausaufgaben machen. Er sei doch sicher mit einigem im Rückstand.
Einige Stunden lang, vielleicht bis zum nächsten Tag, wird sie ihn dafür büßen lassen, dass er feindlichen Boden betreten hat, dass er ihren Regeln und ihrer Kontrolle entwischt ist und sich gut amüsiert hat.
Denn sie kann sich genau vorstellen, dass er es weidlich ausgenutzt hat, dass er die ganze Woche nichts getan hat, dass er nur auf Bildschirme gestarrt, sich mit Chips vollgestopft, zu viel Cola getrunken hat und viel zu lange aufgeblieben ist.
Das ist es, was sie vermutet.
Es ist egal, was sie vermutet.
Er wird ihr ohnehin nicht widersprechen.
HÉLÈNE
Die Schulschwester hatte Théo diese Woche zu sich bestellt.
Am Tag darauf schlug sie mir vor, mit ihr einen Kaffee zu trinken, damit wir darüber sprechen könnten. Sie kam um die Mittagszeit ins Lehrerzimmer. Sie berichtete mir detailliert über das Gespräch, das sie mit ihm geführt hatte. Sie sprach mit mir wie mit einer Kranken, als hätte ihr jemand gesagt, man müsse mich schonen, vorsichtig mit mir umgehen.
Als Erstes hatte sie Théo erklärt, mehrere Lehrer machten sich wegen seiner großen Müdigkeit Sorgen. Man habe ihr gesagt, er sei ein oder zwei Mal während des Unterrichts eingeschlafen. Und es falle ihm schwer, sich länger zu konzentrieren.
Sie wollte von ihm wissen, was los sei, wie er sich fühle.
Théo fragte sie, ob ich es gewesen sei, die ihn denunziert habe.
Sie antwortete, niemand habe ihn denunziert, und erklärte ihm wieder, dass sich mehrere Lehrer wegen seiner Müdigkeit Sorgen machten und sichergehen wollten, dass alles in Ordnung sei. Mehr nicht.
Er entspannte sich ein wenig.
Und gab zu, dass er große Einschlafschwierigkeiten habe oder vielmehr nachts oft aufwache. Mehrmals sagte er, dass er weder auf dem Tablet noch mit dem Gameboy spiele – oder jedenfalls nur selten. Sie versuchte, ihn über seine Familie zu befragen, brachte aber nichts aus ihm heraus. Seine Mutter ist leitende Angestellte in einem pharmazeutischen Labor, sein Vater Informatiker. Die wechselnde Obhut wurde bei ihrer Trennung festgelegt, die schon mehrere Jahre zurückliegt. Sie fragte ihn, wie es mit seinen Eltern laufe, und er antwortete nicht sonderlich begeistert, aber doch sofort: »Gut.«
Sie gibt zu, dass er ihr ängstlich vorgekommen sei, ein bisschen in der Defensive. Aber nicht mehr, als durch die Situation zu erklären gewesen sei, er sei ja als einziger Schüler seiner Klasse einbestellt worden. Sie fragte ihn, ob sie ihn abhorchen dürfe, Schlafmangel bringe nämlich manchmal Wachstums- und Entwicklungsverzögerungen mit sich, er hatte nichts dagegen.
Er hat auf dem Körper keinerlei Spuren. Eine glatte, unberührte, intakte Haut. Nicht der geringste Kratzer, die geringste Narbe. Seine Größe und sein Gewicht liegen ein bisschen unter der für sein Alter üblichen Kurve, aber nicht in alarmierendem Ausmaß.
Sie hat einen Brief an seine Mutter geschrieben und ihn Théo mitgegeben.
Darin hat sie auf die Schläfrigkeit während des Unterrichts und die Notwendigkeit hingewiesen, den Hausarzt aufzusuchen, um diese Schlafprobleme zu lösen.
Sie hat Théo gesagt, er könne sie jederzeit besuchen und sich während der kurzen Pausen zwischen den Unterrichtsstunden bei ihr ausruhen, wenn er müde sei.
Sie hat ihren Job gemacht, ich kann nichts Gegenteiliges behaupten. Sie hat die Regeln unserer Institution befolgt. Sie versprach mir, weiterhin wachsam zu sein. Und kehrte in ihr kleines aseptisches Revier zurück, glänzende Kacheln, geschützter Raum, Geborgenheit. Ich blieb im Lehrerzimmer, ich schaffte es nicht aufzustehen. Ich saß mit dem Rücken zur Tür, vor mir einen Stapel Hefte und einen Plastikbecher, auf dessen Grund der Kaffee kalt wurde, den ich nicht mehr hinunterbrachte. Steh auf und geh nach Hause, sagte ich mir. Mein Unterricht war beendet, und ich spürte, wie die Woge anschwoll, ein Kloaken-Reflux, stinkendes Brackwasser. Die dunkle Flut der Erinnerungen begann wieder zur Oberfläche aufzusteigen, zuerst die Geräusche, der klapprige Kühlschrank, asthmatisch schnaufend, als Hintergrundmusik Fernsehjingles, Lachen, anfeuernde Worte, Applaus, und dann die Bilder: vom Nikotin gelb gewordene Vorhänge, wackelige Stühle, angeschlagener Nippes.
Nichts in diesem Zimmer scheint ganz heil zu sein, aber im Fernseher dreht sich das Glücksrad, und alle haben viel Spaß, erstes Rätsel, ich kaufe ein A, ich nenne ein N, das Rad dreht sich immer noch, irgendwen wird das Glück treffen, ich wünsche Ihnen viel Glück.
Auch wir haben ein Spiel, mein Vater und ich, unser eigenes, zur gleichen Zeit wie das im Fernsehen, es beginnt einfach so, ohne Vorwarnung, ohne Grund; während ich gerade male oder meine Hausaufgaben mache, zerreißt die erste Frage die Luft und kündigt die Folter an: »Hélène, du weißt doch alles, wann wurde die Guillotine erfunden?«
Ich bin acht Jahre alt, elf, dreizehn, ich bin immer am selben Platz, sitze am Küchentisch, die Hände flach auf der Wachstuchdecke. Mein Vater ist früh nach Hause gekommen, er denkt sich Quizfragen für seine Tochter aus, die in der Schule gut mitarbeitet, na wenn schon. Sie liest Bücher und will, so sagt sie, Lehrerin werden, und das ist, als würde sie ihm ins Gesicht spucken, denn er wurde aus der Schule geschmissen. Da sie so schlau tut, wird er ihr Fragen stellen, um zu sehen, was sie weiß.
Eine falsche Antwort: ein Klaps auf den Kopf.
Zwei falsche Antworten: eine Ohrfeige.
Drei falsche Antworten: Er stößt mich vom Hocker, und ich falle zu Boden.
Vier falsche Antworten: Ich liege noch auf dem Boden, und er gibt mir einen Fußtritt.
Wann wurde Johanna von Orléans heiliggesprochen?
In welchem Jahr gewann Karl Martell die Schlacht von Poitiers?
Manchmal sind die Fragen dieselben wie in der Fernsehserie, manchmal auch nicht. Die Regeln ändern sich ständig.
Ich konzentriere mich, was nicht einfach ist beim Lärm der Ratesendung, die Musik ist so laut, und jetzt drehen Sie wieder, Roselyne, bravo, Sie haben den Kopf nicht verloren, ha, ha, ha, und jetzt müssen Sie eine Redewendung erraten, hören Sie gut zu, Roselyne, ich liege auf der Erde, bin wie jedes Mal zu Boden gegangen, ich darf nicht aufstehen, ich suche nicht mehr nach Antworten, ich bereite mich auf den nächsten Schlag vor, es war »Luftschlösser bauen«, Roselyne, schade. Ich weine nie.
Die Fragen haben keinen Sinn mehr, und er tritt mich von allen Seiten, ich schütze meinen Kopf, ich krümme mich auf dem Fliesenboden und versuche auszuweichen, bei den Tritten in den Bauch bleibt mir die Luft weg, solide Halbstiefel mit runden Kappen, mein Vater trägt Sicherheitsschuhe, obwohl er jetzt auf der anderen Seite der Glasscheibe arbeitet, und Sie haben sich diesen Ring mit Saphiren und Diamanten ausgesucht, Roselyne, Sie bekommen ihn mit einem in-ter-natio-nalen gem-mo-lo-gi-schen Zertifikat, wonach er 9900 Francs wert ist, da nehmen Sie doch sehr hübsche Geschenke mit nach Hause.
Ich bin vierzehn Jahre alt, ich liege auf dem Boden, als meine Mutter nach Hause kommt, ich habe vielleicht für ein paar Sekunden oder Minuten das Bewusstsein verloren. Als ich aufstehe, läuft Blut zwischen meinen Beinen herunter, eine scharlachrote Schlange windet sich an meiner Wade hinunter und sucht Unterschlupf in meinem Söckchen. Meine Mutter fragt mich, ob ich meine Regel habe, ich sage Nein.
Einige Wochen später, ich sitze im Matheunterricht, zerreißt mir der Schmerz den Unterleib, ich habe Mühe zu atmen und mein Stöhnen zu unterdrücken, der Lehrer merkt, dass ich nicht mehr zuhöre. Er befragt mich über das, was er gerade gesagt hat, ich kann ihm nicht antworten. Die Wände drehen sich schneller als das Glücksrad, der Boden saugt mich an. Ich weiß nicht einmal mehr, worum es im Unterricht geht. Der Lehrer schickt mich empört vor die Tür. Auf dem Gang werde ich ohnmächtig.
Im Krankenhaus entdecken sie die entzündete Gebärmutter. Kein schöner Anblick.
Ich sagte, ich sei vom Gepäckträger auf eine Betonkante gefallen, ich weiß noch nicht, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann.
Ich bin siebzehn Jahre alt, ich habe das Abitur, und ich gehe weg. Mein Vater ist gerade an Krebs gestorben, sein Siechtum dauerte zwei Jahre, zwei Jahre Waffenstillstand, ohne Ratespiele und Schläge, nur hin und wieder ein paar Ohrfeigen, wenn ich in Reichweite war.
Jetzt war mein Vater am Boden. Meine Mutter hat sich bis zum Schluss um ihn gekümmert.
Ich bin siebzehn, ich werde studieren, ich werde Lehrerin, ich werde nichts vergessen.
CÉCILE
Ich führe Selbstgespräche. Zu Hause, wenn ich allein bin, und auf der Straße, wenn ich sicher bin, dass mich niemand sieht. Ja, stimmt, ich spreche mit mir selbst, aber es wäre treffender zu sagen, dass ein Teil von mir mit dem anderen spricht. Ich sage mir: »Du schaffst es«, »Du hast es gut hingekriegt« oder »So darfst du nicht weitermachen«. Das sind nur Beispiele. Vor einigen Wochen, als ich ihn kennenlernte, habe ich genau das Dr.Felsenberg zu erklären versucht, diese Sache mit den zwei Teilen von mir. Beim allerersten Mal. Er fand, das verdiene genauere Beschreibung. Gut. Es ist so, dass ein Teil von mir, der dynamisch und in einer Stimmung ist, die ich als »positiv« bezeichnen würde, sich an den anderen Teil wendet. An meinen schwachen Teil. Sagen wir der Einfachheit halber, an den Teil, der ein Problem macht.
Weder mein Mann noch die Kinder wissen, dass ich zu Dr.Felsenberg gehe, und das ist gut so. Zur Zeit unseres wöchentlichen Termins bin ich offiziell in einem Yogakurs, der außer auf dem großen Kalender in unserer Küche nirgends existiert.
Ich führe Selbstgespräche, ja, um mich zu beruhigen, zu trösten und mir Mut zu machen. Ich duze mich, denn meine beiden Teile kennen sich ja schon lange. Mir ist durchaus bewusst, dass das lächerlich erscheinen mag. Oder besorgniserregend. Doch Fakt ist, dass der Teil von mir, der sich an den anderen wendet, immer zuversichtlich und beruhigend wirkt. Er sieht an allem die gute Seite, immer die Vorteile und behält in den meisten Fällen das letzte Wort. Dieser Teil neigt absolut nicht zur Panik.
Und wenn ich abends zu Bett gehe, kommt es nicht selten vor, dass er mir gratuliert.
Meine beiden Teile haben schon immer existiert. Irgendwie vorhandene Kräfte, die jedoch bisher nicht untereinander kommunizierten, jedenfalls nicht über meine Stimme. Das ist deutlich jüngeren Datums.
Dr.Felsenberg fragte mich übrigens, ob ein Ereignis oder ein Erlebnis diese Stimme hervorgebracht oder wiedererweckt habe. Während ich noch schweigend nachdachte, stellte er mir schon die nächste Frage.
Er wollte wissen, ob ich bereits als junges Mädchen Selbstgespräche geführt hätte, zum Beispiel beim Lernen. Oder zu Beginn meiner Ehe. Oder als ich aufgehört hätte zu arbeiten. Ich bin sicher, damals nicht.
»Das ist an sich kein Problem, wissen Sie, viele Leute führen Selbstgespräche«, sagte Dr.Felsenberg zu mir. »Aber für Sie ist es eins, weil Sie es erwähnt haben.« Er wollte, dass ich darüber nachdenke. Er war der Meinung, wir sollten gemeinsam überlegen, wozu diese Gespräche zwischen mir und mir dienen.
Ich brauchte mehrere Sitzungen, bis mir bewusst wurde (und ich zuzugeben bereit war), dass die Stimme kurz vor der Entdeckung aufgetaucht ist, die ich auf dem Computer meines Mannes gemacht habe. Und noch weitere Sitzungen, bis ich im Arbeitszimmer von Dr.Felsenberg wirklich klar sagte, was ich entdeckt hatte.
Was ich an jenem Tag und an den Tagen danach, als ich zu suchen begann, gesehen habe, kann ich nur in Andeutungen und Umschreibungen sagen, ich bin nicht imstande, es schwarz auf weiß zu Papier zu bringen.
Denn diese Worte sind schändlich und grauenvoll.
Als ich gestern Abend nach Hause kam, traf ich Mathis und seinen Freund zu Hause an. Normalerweise hätten sie zu dieser Zeit in der Schule sein sollen. Mein Sohn behauptete, der Musiklehrer sei krank, aber ich sah sofort, dass er log.
Sie wirkten seltsam. Alle beide. Mathis mag es nicht, wenn ich einfach in sein Zimmer komme, also blieb ich an der Schwelle stehen und wartete, versuchte zu verstehen, was nicht stimmte. Sie saßen auf dem Boden, alles war aufgeräumt, sie hatten kein Spiel oder Buch hervorgeholt, und ich fragte mich, was sie da trieben. Théo sah zu Boden. Er fixierte einen Punkt auf dem Teppichboden, als beobachtete er eine Kolonie mikroskopisch kleiner Insekten, die nur er sehen konnte.
Ich habe ein Problem mit diesem Jungen. Ehrlich gesagt mag ich ihn nicht. Ich weiß, es ist schrecklich, so zu denken, er ist ja nur ein zwölf Jahre altes Kind und insgesamt eher gut erzogen, aber er hat etwas an sich, das mich stört, so ist das nun mal. Ich habe mich davor gehütet, etwas davon zu Mathis zu sagen, der ihn verehrt, als wäre er mit übernatürlichen Kräften begabt, aber ich, nein, ich werde mit ihm nicht warm. Ich weiß wirklich nicht, was er an ihm findet. Auf der Grundschule hatte Mathis einen Freund, den ich sehr mochte. Sie verstanden sich wunderbar, sie stritten sich nie. Doch am Ende des vierten Schuljahrs zog der Kleine um.
Im letzten Jahr, als Mathis in die sechste Klasse kam, lernte er Théo kennen, und von da an gab es für ihn nichts anderes mehr. Er schloss sich sofort ihm und nur ihm an und verteidigt ihn mit Klauen und Zähnen, wenn ich auch nur den kleinsten Vorbehalt oder eine Frage in Sachen Théo äußere.
Ich fragte, ob sie schon ihren Nachmittagsimbiss gehabt hätten, und mein Sohn antwortete, sie hätten keinen Hunger. Dann ließ ich sie allein.
Trotz allem werde ich den Gedanken nicht los, dass Théo Mathis auf die schiefe Bahn zieht, dass er einen schlechten Einfluss auf ihn hat. Er ist härter als unser Sohn, weniger sentimental, wahrscheinlich bewundert Mathis ihn deshalb so sehr. Neulich Abend nach dem Essen habe ich versucht, mit meinem Mann darüber zu sprechen. Seit mir klar war, womit William seine Abende in Wirklichkeit verbringt, hatte ich – einmal abgesehen von dem mehrheitlich prosaischen Informationsaustausch, der uns ein gemeinsames Leben ermöglicht – nicht mehr versucht, mit ihm zu kommunizieren. Im Grunde hatte ich wochenlang nur aus der Ferne seine kleinen Spielchen und seine Lügen verfolgt.
Wie jeden Abend zog er sich nach dem Abendessen in sein Arbeitszimmer zurück.
Ich klopfte an die Tür. Ich war versucht einzutreten, ohne seine Aufforderung abzuwarten, eine unverhoffte Gelegenheit, ihn auf frischer Tat zu ertappen. Es vergingen mehrere Sekunden, bis er mich hereinrief. Der Bildschirm des Computers war schwarz, er hatte seine Jacke ausgezogen und ein paar Papiere vor sich ausgebreitet. Ich setzte mich in den Sessel und begann von Mathis zu sprechen, von dem negativen Einfluss, den sein Freund meiner Meinung nach auf ihn ausübt. Ich erklärte, aus welchen Gründen ich das Gefühl hätte, dass diese Freundschaft unseren Sohn verstörte, und nannte aufs Geratewohl einige Beispiele. William schien mir aufmerksam und ohne jede Ungeduld zuzuhören. Als ich meinen kleinen Vortrag beendete, kam mir folgender Satz in den Sinn: Jetzt sitzt du in der Höhle des Teufels und ihm genau gegenüber. Es war albern und völlig übertrieben, und wenn William es gehört hätte, hätte er sich ganz sicher wieder über meine unbeholfenen Formulierungen lustig gemacht, doch von jenem Augenblick an konnte ich mich nicht mehr von diesem Satz und seinem starken Nachhall lösen. William forderte genaue Tatsachen. Zeichen für Rückschritte, nach unten verlaufende Kurven, etwas Quantifizierbares. Welche Beweise hätte ich? Mathis’ Schulnoten seien sehr in Ordnung, er wisse nicht, wo das Problem sei. Ich bilde mir da etwas ein. Fakt ist: William glaubt immer, dass ich mir etwas einbilde. Über alles. Daraus ist übrigens eine ziemlich wirksame Methode geworden, ein Gespräch sanft zu beenden. »Du bildest dir etwas ein.«
Tatsächlich interessiert sich mein Mann für das, was ich ihm erzähle, insgesamt recht wenig. Das ist einer der Gründe dafür, dass ich ihm fast nichts erzähle. Das war nicht immer so. Als wir uns kennenlernten, haben wir nächtelang miteinander geredet. Von William habe ich fast alles gelernt. Die Wörter, die Gesten, wie man sich hält, wie man lacht, wie man sich benimmt. Er kannte die Codes und hatte die Schlüssel.
Ich weiß nicht, wann wir aufgehört haben zu reden. Vor langer Zeit, so viel ist sicher. Aber das Erschreckendste ist, dass ich es nicht bemerkt habe.
Heute Morgen ist Mathis vor mir aufgestanden. Als ich in die Küche kam, war er dabei, sich sein Frühstück zu machen.
Ich setzte mich und sah ihm einige Minuten lang zu: diese eine Spur demonstrative Lässigkeit in seiner Art, die Gegenstände in die Hand zu nehmen, die Schranktüren von allein zugehen zu lassen, diese aufschießende Gereiztheit, wenn ich ihn anspreche oder ihm eine Frage stelle. Da begriff ich, dass er an der Schwelle war, genau an der Schwelle. Es gärt und flüstert schon in ihm wie ein Virus, es ist in jeder Zelle seines Körpers aktiv, auch wenn mit bloßem Auge nichts zu erkennen ist. Mathis ist noch kein Jugendlicher – oder vielmehr: Man sieht es noch nicht. Es ist eine Sache von Wochen, vielleicht nur von Tagen.
MATHIS
Am ersten Schultag in der sechsten Klasse hatte er sich die mittlere Reihe ausgesucht. Und dann seinen Platz: in der Mitte der mittleren Reihe. Nicht zu nah an der Tafel und nicht zu weit von ihr entfernt. Weder vorn noch hinten. Dort, wo er auf den ersten Blick am wenigsten Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Dank der Liste, die auf dem überdachten Teil des Schulhofs ausgehängt worden war, hatte er festgestellt, dass er keinen der Schüler hier kannte. Die aus der Grundschule waren alle auf andere Klassen verteilt worden.
Als die Tür geschlossen wurde, saß noch niemand neben ihm. Er wagte es nicht, die anderen anzusehen, die paarweise dasaßen, dicht an dicht, und miteinander flüsterten. Überall in der Klasse begann bereits das Getuschel, ein leichtes, schwebendes Flüstern, das der Lehrer, noch, in Grenzen zu halten wusste. Er war von allen Vertraulichkeiten ausgeschlossen. Noch nie hatte er sich so einsam gefühlt. So verwundbar. Die Mädchen vor ihm hatten sich bereits zweimal zu ihm herumgedreht und ihn gemustert.
Nach zehn Minuten klopfte es an der Tür. Herein kam die Beratungslehrerin mit einem Schüler, den er noch nie gesehen hatte. Théo Lubin hatte sich in den Fluren verirrt und seine Klasse nicht gefunden. Ein spöttisches leises Pfeifen ging durch die Reihen. Der Lehrer zeigte auf den leeren Platz neben Mathis. Théo setzte sich. Mathis schob seine Sachen, die keineswegs zu viel fremden Platz einnahmen, zur Seite, um den Spätankömmling zu empfangen und ihm zu zeigen, dass er willkommen war. Er versuchte seinen Blick aufzufangen, um ihm zuzulächeln, doch Théo hielt den Blick weiterhin gesenkt. Er holte sein Mäppchen und sein Heft aus dem Rucksack, dann murmelte er, immer noch mit gesenktem Kopf: »Danke.«
In der Stunde danach setzten sie sich wieder nebeneinander.
An den Tagen darauf suchten sie gemeinsam die Turnhalle, das Büro der Beratungslehrerin, die Mensa und die Klassenzimmer, deren Nummerierung keiner Logik folgte. Sie machten sich den neuen Raum zu eigen, der ihnen damals grenzenlos erschien und den sie heute bis in den letzten Winkel kennen.
Sie brauchten nicht miteinander zu sprechen, um zu erkennen, dass sie sich verstanden. Sie brauchten sich bloß anzusehen; stillschweigende – soziale, affektive, emotionale – Übereinstimmungen, abstrakte, flüchtige Zeichen gegenseitigen Erkennens, die sie jedoch nicht zu benennen gewusst hätten. Von da an hielten sie zusammen.
Mathis weiß, wie sehr Théos Schweigsamkeit die anderen beeindruckt. Mädchen wie Jungs. Théo spricht wenig, aber er lässt sich nichts gefallen. Er wird gefürchtet. Respektiert. Er hat sich nie prügeln, nicht einmal drohen müssen. In seinem Innern grollt etwas, das jeden von einem Angriff und Kommentar abhält. An seiner Seite ist Mathis geschützt, riskiert er nichts.
Als Mathis in diesem Schuljahr am ersten Schultag auf der Liste sah, dass sie wieder in derselben Klasse waren, empfand er eine enorme Erleichterung. Wenn man ihn gefragt hätte, hätte er nicht gewusst, ob er seinet- oder Théos wegen so erleichtert war. Jetzt, einige Monate nach Schuljahresbeginn, scheint ihm, dass sein Freund noch düsterer als zuvor ist. Er hat oft das Gefühl, dass Théo eine Rolle spielt, so tut als ob. Er ist da, gleich neben ihm, geht von einem Klassenraum in den anderen, wartet in der Mensaschlange, räumt seine Sachen zusammen, sein Fach auf, sein Tablett weg, aber in Wirklichkeit hält er sich aus allem heraus. Und manchmal, wenn sie sich vor dem Monoprix trennen, wenn er Théo zur Metrostation gehen sieht, breitet sich in seiner Brust eine vage Angst aus, die ihm den Atem nimmt.
Mathis ist es, der seiner Mutter das Geld stiehlt. Sie ist völlig arglos. Lässt ihre Handtasche herumliegen, achtet nicht auf das Kleingeld. Er nimmt nur Geldstücke, nie Scheine. Er hebt vorsichtig ab, ein oder zwei Euro auf einmal, nie mehr. Das reicht für die kleinen Flaschen, fünf Euro für den La-Martiniquaise-Rum, sechs Euro für den Poliakov-Wodka. Sie gehen in den kleinen Lebensmittelladen am Ende der Straße, da ist es zwar teurer als woanders, aber der Mann stellt keine Fragen. Große Flaschen beschafft man sich besser über Hugos großen Bruder Baptiste, der auf dem benachbarten lycée in die elfte Klasse geht. Er ist noch nicht volljährig, wirkt aber älter, als er ist. Er wird im Supermarkt nicht nach seinem Ausweis gefragt. Er verlangt einen kleinen Aufpreis von ihnen. An guten Tagen macht er ihnen ein Sonderangebot.
Mathis versteckt die Geldstücke in einem Ebenholzkästchen, das seine Schwester ihm geschenkt hat. Weil es innen mit geblümtem Stoff ausgeschlagen ist, fand er, es sehe nach einem Ding für Mädchen aus, aber das Kästchen hat den Vorzug, abschließbar zu sein, und enthält jetzt seine Beute.
Morgen nach dem Mittagessen haben sie eine Freistunde. Wenn niemand auf dem Gang ist, werden sie sich wieder in ihr Versteck quetschen und den Rum trinken, den sie gestern gekauft haben. Théo hat gesagt, dass er im Kopf explodiert, mehr noch als der Wodka. Er hat mit der Hand eine Pistole nachgeahmt, den Lauf aus zwei Fingern auf die Schläfe gerichtet und so getan, als drücke er ab.
THÉO
Er hat den dicken Pulli, den er zu Weihnachten bekommen hat, bei seinem Vater vergessen, dabei hatte seine Mutter ihn gebeten, ihn nicht dorthin mitzunehmen. Sie hat es nicht gleich gemerkt, aber heute, wo es kalt geworden ist, wundert sie sich, dass er ihn nicht angezogen hat. Sie ist furchtbar verärgert, das sieht man, sie hat alle Mühe, die Zeichen ihres Zorns, die Théo so gut kennt, zu verbergen. »Den sehen wir so bald nicht wieder«, sagt sie mehrmals. Der Pulli ist in Gefahr, von den Tiefen des Nichts verschluckt. Sie bezieht sich auf das Territorium des Feindes, den sie nicht nennt. Einen von unbekannten Regeln regierten Ort, an dem es Wochen dauert, bis die Kleidungsstücke gewaschen werden, und wo die Gegenstände verschwinden, um nie wieder aufzutauchen.
Théo verspricht, ihn beim nächsten Mal mitzubringen.
Nein, er wird es nicht vergessen.
Es fällt ihr schwer, zu einem anderen Thema überzugehen, das sieht er.
Als er kleiner war, bis etwa zum vierten Schuljahr, war sie es, die seinen Rucksack packte, bevor er zu seinem Vater ging. Mit der Begründung, sie kämen oft spät und manchmal gar nicht zurück, suchte sie die am wenigsten schönen, die verschlissensten Kleidungsstücke aus. Am Freitagabend begleitete sie ihn in der Metro dorthin und ließ seine Hand vor dem Hochhaus los. Anfangs, als Théo noch zu klein war, um allein den Aufzug zu nehmen, kam sein Vater nach unten und erwartete ihn auf der anderen Seite der Glastür. Seine Eltern begegneten sich nicht, sie sahen sich nicht an, jeder blieb auf seiner Seite der gläsernen Grenze. Als wäre er eine gegen eine unbekannte Ware ausgetauschte Geisel, betrat Théo die Eingangshalle und durchquerte die neutrale Zone, er wagte kaum auf den Knopf zu drücken. Am Freitag der Woche darauf stellte sein Vater zur selben Uhrzeit auf einem anderen Boulevard den Motor seines Wagens aus und wartete, bis Théo im Haus war, bevor er den Wagen wieder anließ und wegfuhr. In einem anderen Treppenhaus schloss ihn seine Mutter fest in die Arme. Sie küsste ihn immer wieder, streichelte sein Gesicht, sein Haar, und sah ihn von oben bis unten und von unten bis oben an, so erleichtert, als wäre er wundersamerweise einer rätselhaften Katastrophe entronnen.
Er erinnert sich noch an einen Tag vor langer Zeit – er musste in der ersten oder zweiten Klasse gewesen sein –, da hatte seine Mutter, als sie den Inhalt seiner Tasche nach der Rückkehr vom Vater überprüfte, die Hose nicht finden können, die sie ihm wenige Wochen zuvor gekauft hatte. Sie begann, alle Kleidungsstücke einzeln herauszuziehen, als ginge es um Leben oder Tod, und warf sie zornig durch die Luft. Und dann, nachdem sie hatte feststellen müssen, dass die Hose tatsächlich fehlte, begann sie zu weinen. Théo sah sie verblüfft an, seine Mutter kniete vor einer Sporttasche, von Schluchzen geschüttelt, und er nahm ihren Schmerz wahr, er wütete auch durch seinen eigenen Körper, doch eins verstand er nicht: Warum war das so schlimm?
Seine Mutter begann zu klagen, dass sein Vater nicht einmal imstande sei, alle Sachen zusammenzupacken. (Jedes Mal, wenn sie etwas Schlechtes über seinen Vater sagte, war da dieses Unbehagen, dieser Krampf in seinem Magen, und in seinen Ohren setzte das schrille Pfeifen ein.) Er musste zugeben, dass er selbst die Tasche gepackt hatte. Er hatte sich große Mühe gegeben, alle seine Sachen zusammenzusuchen, aber die Hose hatte er nicht gesehen, wahrscheinlich war sie in der schmutzigen Wäsche gelandet. Und plötzlich hatte seine Mutter gebrüllt: »Kann diese Schlampe nicht einmal die Waschmaschine anstellen?«
Als sich seine Eltern scheiden ließen, zog sein Vater in eine neue Wohnung, in der er immer noch lebt. Im Wohnzimmer hat er eine Trennwand eingezogen, damit Théo ein eigenes Zimmer hat. In den Monaten nach der Trennung traf sich sein Vater mit einer anderen Frau, die von seiner Mutter als »die blöde Kuh« oder »die Schlampe« bezeichnet wurde. Die Schlampe kam an manchen Abenden zu seinem Vater, blieb aber nie über Nacht. Sie arbeitete in derselben Firma wie sein Vater, sie hatten sich wohl im Aufzug oder in der Kantine kennengelernt, so jedenfalls hatte sich Théo ihre Begegnung vorgestellt, er hatte die Szene mehrmals zu rekonstruieren versucht, obwohl er sich die Kulisse kaum vorstellen konnte: Es war ihm unmöglich, sich auszumalen, wie das Büro aussah, dieser Ort, an den sich sein Vater täglich begab und der außerhalb des Périphérique lag.
Er erinnert sich noch an einen Frühlingstag, als er mit seinem Vater und dieser Frau im Vergnügungspark Jardin d’Acclimatation gewesen war, er musste sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein. Er war auf dem Trampolin und der Kartingbahn gewesen und hatte mit Bällen auf Dosen geworfen. Später am Nachmittag hatten sie sich alle drei im Spiegelkabinett verirrt, dann hatten sie einen Kahn bestiegen und sich für eine Zeit, die ihm herrlich lang erschienen war, den Verzauberten Fluss hinuntertreiben lassen. Später hatten sie Zuckerwatte gegessen. Die Schlampe war nett. Durch sie hatten sie diese von Barrieren und Zäunen geschützte wunderbare Welt kennengelernt, diese Welt, in der die Kinder Könige waren. Diese Frau hatte wahrscheinlich etwas mit diesem Ort zu tun, denn sie kannte ihn bis in den letzten Winkel. Sie war es gewesen, die sie durch die Wege geführt und ihnen die Tickets gegeben hatte, und sein Vater hatte sie mit einer solchen Hingabe angesehen, dass Théo daraus geschlossen hatte, ihr gehöre der ganze Vergnügungspark.
Doch am Tag darauf kehrte er mit Bauchschmerzen zu seiner Mutter zurück. Er fühlte sich traurig. Schuldig. Er hatte mit dieser Frau gelacht und Geschenke von ihr angenommen.
Etwas Süßliches, Klebriges war an seinen Händen haften geblieben.
Anfangs stellte ihm seine Mutter noch Fragen, wenn er von seinem Vater zurückkam. Sie tat völlig unschuldig, als wäre er nicht imstande, ihre Winkelzüge zu erkennen, und versuchte durch Umwege und Umschreibungen, deren Ziele ihm völlig klar waren, Informationen aus ihm herauszulocken.
Um möglichst wenig sagen zu müssen, tat Théo so, als hätte er die Fragen nicht verstanden, oder aber er antwortete ausweichend.
In jener Zeit fing seine Mutter oft einfach so, ohne Vorankündigung, an zu weinen, weil sie den Deckel des Marmeladenglases nicht aufbekam, weil sie einen verschollenen Gegenstand nicht wiederfinden konnte, weil der Fernseher nicht mehr funktionierte, weil sie müde war. Und jedes Mal war ihm, als würde er das Leid seiner Mutter in seinen eigenen Körper aufnehmen. Manchmal war es ein elektrischer Schlag, manchmal ein Schnitt oder ein Faustschlag, aber immer war es sein Körper, in dem sich der Schmerz fortsetzte, als müsse Théo seinen Teil tragen.
Anfangs fragte sie ihn jedes Mal, wenn er von seinem Vater zurückkam: »Hattest du Spaß? Hast du auch nicht geweint? Hast du an Maman gedacht?« Er hätte nicht zu sagen gewusst, warum, aber er fühlte sich sofort wie in einer Falle. Er wusste nie, ob er seine Mutter beruhigen und ihr sagen sollte, alles sei gut gelaufen, oder ob er im Gegenteil behaupten sollte, er habe sich gelangweilt und sie habe ihm gefehlt. Einmal, als ihr Théo wahrscheinlich zu fröhlich erschien nach der Woche auf der anderen Seite, war das Gesicht seiner Mutter furchtbar traurig geworden. Sie schwieg, und er hatte Angst, dass sie wieder anfangen würde zu weinen. Doch nach einigen Minuten sagte sie seufzend:
»Alles, was zählt, ist, dass du glücklich bist. Wenn du mich nicht brauchst, gehe ich fort, weißt du. Vielleicht verreise ich. Und ruhe mich aus.«
Théo lernte sehr schnell, die Rolle zu spielen, die von ihm erwartet wurde. Sparsam gesprochene Worte, neutraler Gesichtsausdruck, gesenkter Blick. Man musste sich unbedingt bedeckt halten. Auf beiden Seiten der Grenze drängte sich das Schweigen als das beste, das am wenigsten gefährliche Verhalten auf.
Nach einer Weile, deren Dauer er nicht einschätzen kann, verschwand die Schlampe. Soweit er es sich damals anhand von hier und da aufgeschnappten Fetzen von Telefongesprächen zusammenreimen konnte, hatte diese Frau Kinder, die es nicht gut gefunden hätten, dass sie sich ohne sie im Jardin d’Acclimatation amüsierte, und einen Mann, den sie nicht hatte verlassen wollen.
Nach und nach hörte seine Mutter auf zu weinen. Sie verkaufte die Möbel und kaufte andere, schönere, dann strich sie die Wohnung neu. Théo durfte die Farbe für sein Schlafzimmer und für die Küche aussuchen.
Sie hörte auf, Fragen zu stellen, wenn er von der Woche bei seinem Vater zurückkehrte. Sie fragte nicht mehr, was er gemacht habe und mit wem. Ob er Spaß gehabt habe. Sie fing stattdessen an, das Thema zu vermeiden. Sie wollte nichts mehr wissen.
Heute hat diese Zeit, die er außerhalb ihres Einflussbereichs verbringt, aufgehört zu existieren. Eines Abends erklärte sie Théo, sie habe einen Strich unter das alles gezogen und wolle nie wieder etwas davon hören.
Sein Vater existiert nicht mehr. Sie hat aufgehört, seinen Namen auszusprechen.
HÉLÈNE
Ich wollte, dass der Fall Théo Lubin bei der nächsten Sitzung des Präventivteams besprochen würde. Frédéric überredete mich dazu, noch ein wenig abzuwarten. Seiner Meinung nach hatte ich noch nicht genug Material, das einen solchen Antrag rechtfertigte. Zudem hinterlasse die Besprechung eines Falls immer Spuren, es könnten für Théo oder seine Familie hinterher Nachteile entstehen, das dürfe man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Sah ich etwa so aus, als würde ich das auf die leichte Schulter nehmen? Ich wache jede Nacht auf, weil mir die Angst den Atem nimmt, und brauche oft mehrere Stunden, um wieder einzuschlafen. Ich habe keine Lust mehr, mit meinen Freunden auszugehen oder ins Kino, ich verweigere mich jeder Zerstreuung. Ohnehin ist der Fall eigentlich keiner, ich habe kein Beweisstück für die Akte, und ich müsste entgegen der Empfehlung der Schulschwester handeln, die es nicht für nötig hält, die Eltern einzubestellen, obwohl sie bislang noch keine Antwort auf ihren Brief an die Mutter bekommen hat.
Ich willigte ein, noch ein wenig zu warten. Und Frédéric versprach mir, Théo besonders im Auge zu behalten, obwohl er die siebte Klasse nur eine Stunde in der Woche unterrichtet.