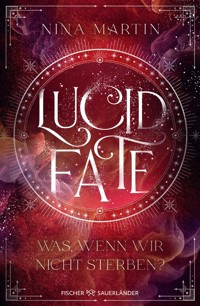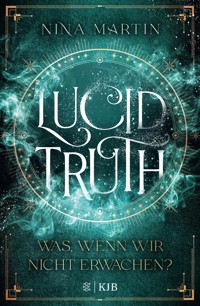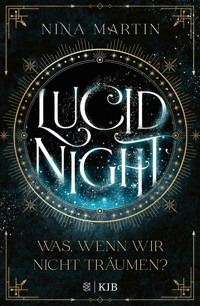
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: "Lucid"-Reihe
- Sprache: Deutsch
Zwei starke Heldinnen, ein angestaubtes System und eine Traumwelt in Gefahr: Mit Lucid Night erscheint Nina Martins atemberaubende Fantasy-Trilogie über die Macht der Träume. Voller Abenteuer, Romantik und Charaktere mit Identifikationspotential. Ein dicht erzähltes Highlight für Mädchen und Jungen ab 14 Jahren. Selena und Ria: die eine in Griechenland, die andere in Berlin. Zwei Mädchen, die sich nie getroffen haben, und die doch eine außergewöhnliche Gabe verbindet: Sie sind Traumgängerinnen. Sie können selbst nicht träumen, doch in die Träume anderer Menschen einsteigen und diese verändern. Etwas, das eigentlich nicht möglich sein kann. Denn diese Gabe ist nur Männern vorbehalten – zumindest, wenn man der mächtigen Traumunion Glauben schenkt. Als Yunus, der Vorzeigetraumgänger der Union, auf Rias Gabe aufmerksam wird, verändert sich alles. Plötzlich berichten alle Medien von der ersten Traumgängerin. Und schon bald finden sich Selena und Ria in einem Machtkampf wieder, der nicht nur über das Schicksal der Traumwelt Somna entscheiden wird, sondern über das der ganzen Welt … Phantastisch, spannend und unfassbar real – Lucid Night ist der Auftakt der traumhaften Contemporary-Fantasy-Trilogie von Nina Martin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Nina Martin
Lucid Night
Was, wenn wir nicht träumen?
Biografie
Nina Martin, Jahrgang 1991, erzählt schon seit ihrer Kindheit Geschichten. Durch eine persönliche Erfahrung mit dem Thema Sterblichkeit, entschied sie, ihren Traum vom Schreiben endlich zu leben. Lucid Night ist ihr Jugendbuch-Debüt. Heute wohnt sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Zürich. Weitere Informationen zur Autorin auf Instagram unter ninamartin_books
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden Sie unter www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2023 Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Dahlhaus & Blommel Media Design, Vreden nach einer Idee von Alexander Kopainski unter Verwendung von Motiven von Shutterstock
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-0517-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
1 Selena
2 Ria
3 Selena
4 Ria
5 Selena
6 Ria
7 Selena
8 Ria
9 Selena
10 Ria
11 Selena
12 Ria
13 Selena
14 Ria
15 Selena
16 Ria
17 Selena
18 Ria
19 Selena
20 Ria
21 Selena
22 Ria
23 Selena
24 Ria
25 Selena
26 Ria
27 Selena
28 Ria
29 Selena
30 Ria
31 Selena
32 Ria
33 Selena
Epilog
Danksagung
Für meine Mutter,
die meine Geschichten aufschrieb,
noch bevor ich selbst schreiben konnte
1Selena
Ich schiebe mich durch die Menschen und sauge tief die Luft ein. Es sind die gewohnten Gerüche. Die Fische und das Salz des Meeres, der Duft des Marktes. Auch wenn ich mir abends den Schweiß abwasche, kann ich sie manchmal noch an meinen Armen riechen.
Hier riecht es besonders gut. Hier, wo einer der Stände mit gebratenen Brassen, Forellen und Barschen steht. Ich strecke die Tüte mit meinen Einkäufen vor mir aus und dränge mich durch die laut schwatzenden Menschen. Dann biege ich ab.
Die Gasse, die sich in immer enger werdenden Windungen den Hügel hinaufzieht, stülpt ihren Schatten über mich, und der wohltuend kühle Meereswind bläst mir in den Nacken. Langsam lasse ich das Gerede der Menschen auf dem Markt hinter mir. Wie der Fischfang heute lief, wer gerade auf eine große Reise gegangen ist, bei wem eine Schwangerschaft vermutet wird.
Weiter und weiter klettere ich in die Schläfrigkeit unseres Dorfes hinauf, vorbei an den weißen Häuschen mit Blumenkästen und geschlossenen Fensterläden. Die Plastiktüte in meiner Hand raschelt bei jedem Schritt.
Als ich auf die Straße trete, die sich hinauf zu unserem Haus zieht, wische ich mir mit der Hand die lockigen Haare aus dem Gesicht. Sofort treibt ein Windstoß sie mir wieder in die Augen. Ich drehe mich um und lasse den Blick über das Dorf schweifen, das sich mittlerweile ein gutes Stück unter mir befindet: Von hier oben sieht das Treiben der Menschen fast rhythmisch aus, friedlich. Die Sonne taucht den Hang in ein goldenes Licht. Ich liebe diese Tageszeit. Diese paar Minuten, in denen der Himmel noch einmal alles zum Strahlen bringt, bevor die Sonne rot hinter den umliegenden Inseln untergeht. Es ist, als wolle der Tag sein eigenes Werk noch einmal im besten Licht erscheinen lassen, ehe er es der Nacht überlässt.
Ich setze mich auf die Mauer am Rande der Straße, will noch nicht zurück nach Hause. Ich kann die Anspannung meiner Mutter nicht ertragen, die sich an Tagen wie diesem aufbaut. Sie wird immer schweigsamer, sieht andauernd auf die Uhr und läuft mit versteinerter Miene durch die Gegend. Es ist Angst. Da bin ich mir sicher. Aber ich weigere mich, ihre Angst zu übernehmen.
Die Sonne wandert immer weiter Richtung Horizont, die Marktstände im Dorf werden zusammengepackt, und irgendwann weiß ich, dass ich nach Hause muss. Ich wende mich wieder zum Hang und zwinge mich, meine Schritte zu beschleunigen. Es ist nicht mehr weit. Um eine Straßenbiegung geht es noch, dann stehe ich vor unserer kleinen, weiß getünchten Mauer.
Mit der Schulter werfe ich mich gegen die Tür zum Hof, und das Schloss springt knackend auf.
»Selena, du sollst das doch nicht immer machen!«
Meine Mutter steht im Hof, das dunkle Haar zu einem dicken Knoten gebunden, und sieht mir verärgert entgegen.
»Ich hab den Fisch, Mama«, ignoriere ich ihre Ermahnung.
Sie schnalzt mit der Zunge. »Leg ihn in die Küche und geh dich umziehen. Dein Onkel ist gleich da.«
Ihr Blick huscht zum Gästehaus hinüber, in das heute neue Feriengäste eingezogen sind.
Ich verkneife mir einen Kommentar, betrete das Haus und lege die Tüte mit dem Fisch auf den Küchentisch. Dann steige ich die Treppe hinauf in mein Zimmer.
Dort angekommen werfe ich mein Handy auf den Schreibtisch und öffne den Schrank. Wie immer wähle ich enganliegende Sportkleidung. Man weiß nie, was einen erwartet. Besser, man ist vorbereitet. Sobald ich in der schwarzen Hose und dem roten Langarmshirt stecke, nehme ich ein Haargummi von dem Nagel an der Wand, direkt neben meinem Spiegel. Ich fahre mir durch die Haare. Das Salz des Meeres hat sich daraufgelegt, sich mit dem Schweiß des Tages vermischt und lässt meine Haare nun in schwarzen, schimmernden Strähnen herabhängen.
Die Haare zu fettig, das Kinn zu breit, die Nase zu eckig, der Körper zu klein. Aber was soll ich mit Schönheit schon anfangen? Hier auf der Insel sieht mich eh niemand außer den Dorfbewohnern und ein paar Gästen, die in unserem Ferienapartment wohnen.
Ich binde meine Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen und wende mich von meinem Spiegelbild ab. Dann verlasse ich das Zimmer und steige die Treppe hinunter.
In der Küche ist meine Mutter dabei, Kartoffeln zu kochen und den Fisch zu braten. Wortlos beginne ich damit, Teller auf den Tisch zu stellen.
Vor dem Fenster hat sich die Dämmerung über unseren Hof gelegt. In der Küche ist nichts zu hören außer dem Zischen des Öls und dem Klappern der Teller zwischen meinen Fingern. Ich sage nichts, weil ich weiß, dass absolut nichts meiner Mutter die Nervosität nehmen kann. Zumindest nichts, was ich sagen könnte. Oder eher: Nichts, was ich bereit wäre zu sagen. Würde ich das Ganze jetzt abblasen, behaupten, dass es doch nicht notwendig wäre – das würde sie vermutlich erleichtern. Aber das geht nicht. Mein ganzer Körper lechzt danach, wieder zu träumen. Länger als ein, zwei Wochen halte ich es einfach nicht aus, ohne in einen Traum einzusteigen.
»Aber du bleibst nur ganz kurz drinnen, ja?«, sagt meine Mutter plötzlich.
»Ich bleibe so lange, wie es nötig ist.«
»Und wenn du jemanden von der Traumunion siehst, kommst du sofort zurück, ja?«
»Natürlich.«
Meine Mutter nickt zögernd, als würde sie diese Antwort tatsächlich beruhigen.
Ich kann nicht fassen, dass wir jedes Mal dasselbe Gespräch führen.
In diesem Moment klingelt es. Erleichtert stelle ich den letzten Teller ab und betätige den Summer, der unser Tor aufspringen lässt. Als ich wenige Sekunden später die Haustür öffne, strömt angenehm kühle Abendluft in unser Wohnzimmer. Mein Onkel kommt mir mit seiner Tochter an der Hand entgegen. Wie immer trägt Loukas ein herzliches Lächeln auf dem Gesicht und drückt mir zur Begrüßung einen Kuss direkt aufs Ohr, der mein Trommelfell schmerzhaft vibrieren lässt.
»Hallo, Eleni«, begrüße ich meine Cousine, gehe in die Knie und ziehe die Sechsjährige in eine Umarmung. Ich kann keine Nervosität in ihren Augen entdecken, eher positive Aufregung. Das ist gut. Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team.
»Können wir heute wieder fliegen? Oder in die Achterbahn? Oder ausreiten?«, flüstert sie mir zu.
»Ich gebe mein Bestes«, raune ich zurück.
Zufrieden wendet sich meine Cousine ab und begrüßt meine Mutter. Dann verschwindet sie mit ihrem Vater die Treppe hinauf – wie immer an solchen Abenden hat Eleni bereits früh gegessen und kann es kaum erwarten schlafen zu gehen. Ich kann ihre Schritte durch die Zimmerdecke hören. So leise wie möglich stellen meine Mutter und ich den Fisch und die Beilagen auf den Tisch. Oben wird es still.
Irgendwann kommt mein Onkel die knarzende Treppe herunter. »Sie ist eingeschlafen.« Er lächelt erleichtert, als er die Küche betritt. »Heute war ich mir nicht sicher – sie war den ganzen Tag so aufgeregt.«
Er lässt sich auf einen Stuhl sinken und sieht zufrieden auf das Essen vor sich. Neben meiner Mutter sieht er hünenhaft aus. Manchmal kann ich gar nicht glauben, dass die beiden Geschwister sind. Wo Loukas groß und breitgebaut ist, ist meine Mutter klein und zierlich. Wo er die Entspannung selbst ist, macht sie sich viel zu viele Sorgen. Nur die krausen Haare haben beide geerbt, genau wie ich.
»Träumt Eleni in letzter Zeit denn gut?«, fragt meine Mutter beiläufig und schiebt sich eine Gabel mit Kartoffeln in den Mund.
Mein Onkel und ich wechseln einen Blick. Wir wissen beide, weshalb sie das fragt.
»Gerade schlafen ja alle schlecht.« Loukas räuspert sich.
Meine Mutter nickt, ohne von ihrem Essen aufzusehen.
Ja, alle schlafen schlecht. Oder vielmehr: Alle träumen schlecht. Anfangs haben die Leute im Dorf noch Witze darüber gemacht. Doch dann wurde klar, dass es sich um ein weltweites Phänomen handelt, das die Zahlen übermüdeter Autofahrer und Unfälle in die Höhe schnellen lässt. Jetzt macht keiner mehr Witze. Jetzt diskutieren die Experten und Forscherinnen im Fernsehen über die Gründe und fordern Aufklärung.
»Und? Wie lief dein Tag, Loukas?«, versuche ich wenig geschickt das Thema zu wechseln.
Mein Onkel und ich unterhalten uns über den Fischfang und über die Fußballschuhe, die ich neulich zu meinem sechzehnten Geburtstag bekommen habe.
Irgendwann haben wir alle aufgegessen, und meine Mutter verkündet, dass sie die Küche aufräumen würde, wir sollten schon mal ohne sie hochgehen.
Ich nicke, bevor ich mit leicht schlechtem Gewissen und wachsender Aufregung die Treppe hinaufsteige.
Das, was ich vorhabe, ist gefährlich. Das weiß ich, seit ich aufgehört habe zu träumen. Seit ich meinen Vater das letzte Mal gesehen habe … Aber trotzdem kann ich nicht anders: Ich freue mich auf die Traumwelt!
Leise betreten Loukas und ich mein Zimmer. Eleni liegt in meinem Bett unter der dünnen Decke und atmet tief. Im Schein der Nachttischlampe betrachte ich ihr Gesicht und lächle. Sie träumt. Das kann ich am Zucken ihrer Augenlider erkennen. Als würde ihr Blick darunter immer wieder hin- und herfliegen. Wir haben Glück. Normalerweise dauert es ein paar Stunden, und Loukas und ich schlafen zwischendrin nicht selten ein, ehe wir Eleni in einer Traumphase erwischen. Manchmal ist es erst in den frühen Morgenstunden so weit.
Mein Onkel grinst erleichtert.
»Bereit?«, fragt er und setzt sich behutsam neben meine Cousine aufs Bett.
Ich nicke und kann die Vorfreude kaum verbergen. Muss ich aber auch nicht. Meine Mutter ist ja nicht da.
Vorsichtig beuge ich mich über Eleni. So sanft ich kann, lege ich meine Stirn an ihre und meine Hände auf ihre dunklen Locken. Jetzt muss ich loslassen. Mein Gehirn von Leere durchfluten lassen, mich nur auf Eleni konzentrieren, die im Traum nervös zuckt. Ich spüre das gewohnte Gefühl in meinem Inneren, während eine Welle aus Emotionen auf mich zurollt und mich verschluckt. Diesmal sind es Angst und Verwirrung, die über mich hereinbrechen. Ich bemühe mich, mich den Emotionen vollkommen hinzugeben, meine eigenen Gedanken auszuschalten – und die Welt löst sich auf: Elenis warme Haut an meiner Stirn, die weiche Matratze unter mir, die Atemgeräusche meines Onkels. Dann spüre ich, wie das gewohnte helle Strahlen durch meine Lider drängt, ehe es wieder dunkler wird. Ich schlage die Augen auf.
Vor mir türmt sich etwas auf. Riesig, dunkel und tosend. Mir bleibt kaum Zeit, Luft zu holen, da werde ich von der gewaltigen Welle erfasst und durch kalte, undurchsichtige Wassermassen gewirbelt. Sofort spüre ich Panik in mir aufwallen, weiß nicht, wo unten und oben ist. Auf so einen Albtraum war ich nicht vorbereitet.
Irgendwo unter dem Adrenalin, das mir plötzlich durch die Adern jagt, weiß ich, was zu tun ist. Das hier ist ein Traum. Ich kann das. Hier gehorcht mir alles.
Ich mobilisiere alle Kraftreserven meines nach Sauerstoff schreienden Gehirns – und entspanne mich. Widerstandslos lasse ich meinen Körper von den Wogen herumreißen, gebe mich der Macht der Natur hin und schaffe es einen winzigen Moment, die Panik in mir zu ersticken. Dieser Moment ist alles, was ich brauche. Ich spüre, wie die Wassermassen, die mich in die Tiefe ziehen, an Kraft verlieren. Und das gibt mir neue Zuversicht.
Kurz darauf legt sich der Druck auf meinem Kopf, verschwindet die Kälte des Wassers, und endlich kann ich einen tiefen Atemzug nehmen. Unter Wasser. Ich kann unter Wasser atmen. Euphorie durchströmt mich. Ich liebe Somna. In der Traumwelt ist alles möglich.
Während ich dem Licht entgegentauche, das durch die Wasseroberfläche bricht, spüre ich, wie sich das Meer um mich herum immer weiter beruhigt. Zwischen sanft hin- und herschaukelnden Wellen tauche ich auf.
Ich muss lachen. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich nun Eleni entdecke, die nur ein paar Meter von mir entfernt ungläubig das ruhige Meer betrachtet. Ihre Erleichterung überträgt sich durch den Traum auf mich und rieselt durch meinen Körper. Im strahlenden Sonnenschein schwimme ich zu meiner Cousine herüber.
Als sie mich bemerkt, kann ich es in ihren Augen sehen: wie ihr zunächst unfokussierter Blick klarer wird, sie zu begreifen beginnt. Abwartend beobachte ich sie. Sobald Eleni erkennt, dass sie sich in einem Traum befindet, können zweierlei Dinge passieren: Entweder sie erschrickt sich und fällt direkt aus dem Traum hinaus zurück in mein Zimmer, oder aber sie schafft es, sich im Traum zu halten, und wir beide können zusammen im bewussten Zustand Somna erkunden. Letzteres macht ziemlich viel Spaß. Und auch heute zeigt Eleni, dass sie eine talentierte Klarträumerin ist: Sie grinst mich an und offenbart die Zahnlücke zwischen ihren Milchzähnen, die sie auch im Traum nicht eingebüßt hat.
»Los, komm«, rufe ich, tauche unter und schwimme los.
Ein Glücksgefühl jagt durch meinen Körper, während ich mich mit kräftigen Armzügen durchs Wasser schiebe. Ich liebe es, mich zu bewegen! Das nun warme, ruhige Wasser streift an meinen Seiten entlang, und ich nehme Fahrt auf. Wie immer bleibt die Unterwasserwelt um mich herum verschwommen, so, als hätte ich einen Teil meiner Sehkraft eingebüßt. Lediglich Träumer und alle Dinge, die sie sehen, treten auch in Somna für mich in aller Klarheit heraus.
»Nur der Blick eines Träumers lässt die Dinge klar erscheinen.« So habe ich es einmal meinem Onkel erklärt und bin mir dabei ziemlich philosophisch vorgekommen.
Ich höre Eleni hinter mir kichern und drehe mich um. Sie hat sich in eine Meerjungfrau verwandelt. Ich unterdrücke den Drang, die Augen zu verdrehen. Jedes Mal, wenn Eleni in ihren Träumen aufwacht, gibt sie sich die Form irgendeines Fabelwesens.
Wir jagen über den Sandboden, entdecken einen Fischschwarm, in den wir uns hineinstürzen, und lassen uns von der Strömung tragen.
Irgendwann tauchen wir wieder auf, und ich kann in der Ferne die Umrisse einer Insel erkennen, die mir bekannt vorkommt. Eleni entdeckt sie ebenfalls und steuert kichernd und mit kräftigen Schwanzbewegungen darauf zu.
Wie erwartet taucht kurz darauf die Kaimauer unserer Insel vor uns auf. Die Fischerboote unserer Nachbarn sind davor vertäut, und auf dem kleinen Marktplatz kann ich einen riesigen Eisstand ausmachen.
Ich drehe mich zu Eleni um.
»Warst du das?«, frage ich, obwohl ich die Antwort bereits kenne.
Sie gluckst zufrieden.
Ich schwimme zum Landungssteg und greife nach dem glitschigen Holz.
»Na gut«, sage ich, »dann holen wir uns ein Eis.«
Ich stemme mich auf den Steg und ziehe Eleni – wieder zum Menschen geworden – ebenfalls hinauf.
Kurz schließe ich die Augen und merke sofort, wie mich warme, trockene Kleidung umhüllt.
Als ich die Augen wieder öffne, ist Eleni bereits an mir vorbei über den Steg und zum Eisstand gerannt. Ich folge ihr.
Genau wie auf unserer wirklichen Insel scheint auch hier die Sonne wärmend auf den Marktplatz herab. Nur fehlen die Verkaufsstände, und irgendwie ist hier alles etwas besser in Schuss, als es in Wirklichkeit der Fall ist: Die verschwommenen Fassaden der Häuser glänzen, die Pflastersteine unter meinen Füßen fühlen sich an wie glattpoliert.
Ich gehe auf den Eiswagen zu, der in aller Klarheit aus der Unschärfe seiner Umgebung hervorsticht. Eleni streckt mir ein Eis entgegen, das ich dankend annehme. Dann lasse ich den Blick schweifen. Es sind einige Leute auf dem Marktplatz. Die meisten gehören zur Traumkulisse: Sie sind unscharfe Silhouetten, deren Gesichtszüge nur dann hervortreten, wenn Eleni sie ansieht – Traumstatisten. Und zwischen ihnen erstaunlich viele Träumer, die gestochen scharf aus der verschwommenen Masse heraustreten. Ich behalte sie im Auge, man kann nie wissen.
Zusammen mit Eleni setze ich mich auf eine Bank, und wir essen unser Eis. Es schmeckt köstlich. Zum Glück, denn so richtig weiß man in Somna nie, was man bekommt. Hier kann es einem auch passieren, dass das Eis nach Käsefüßen schmeckt oder sich plötzlich in ein Ungeheuer verwandelt – oder in sonst etwas, was dem Unterbewusstsein der Träumer gerade entspringt. Aber gerade dieser Nervenkitzel – nicht zu wissen, ob die Idylle jeden Moment in sich zusammenbrechen könnte – lässt das Eis noch besser schmecken.
»Können wir für immer hierbleiben, Sel?«, fragt Eleni neben mir, und ich spüre, wie ihre Zufriedenheit durch mich hindurchströmt.
Gerade will ich lachend zu einer Antwort ansetzen, da bleibt mein Blick an etwas hängen: Ein Augenpaar, das mich von der anderen Seite des Marktplatzes her ansieht. Es fühlt sich wie ein elektrischer Schlag an, der durch meinen Körper fährt. Mein Herz beginnt zu rasen, und ich setze mich auf. Es ist, als hätte etwas in mir nur darauf gewartet. Auf den Beweis, dass die Idylle trügt. Auf dieses Mädchen, die Züge klar wie die einer Träumerin, doch der Blick eindeutig fokussierter.
Wir sehen uns an, bis sich eine Gruppe von Träumern zwischen uns schiebt.
Ich beuge mich zur Seite, um an dem Rücken eines korpulenten Mannes vorbeizuspähen. Doch das Mädchen ist verschwunden.
Jäh zieht eine Gänsehaut über meinen Körper. Habe ich mir das gerade eingebildet? Nein. Die Fremde hat mich angesehen – fokussiert, wach … und wissend.
»Wenn du jemanden von der Traumunion siehst, kommst du sofort zurück«, hallt die Stimme meiner Mutter in meinem Kopf wider.
Aber das kann nicht sein. Sie kann nicht von der Traumunion sein. Sie ist ein Mädchen.
Dennoch, auch wenn ich mich von der Angst meiner Mutter nicht anstecken lassen möchte, werde ich das Gefühl nicht los, dass hier etwas nicht stimmt.
Mein gesamter Körper spannt sich an. Elenis Zufriedenheit, die mich durchströmt, hält mich gerade noch davon ab, von der Bank aufzuspringen. Dann passiert es. Im Augenwinkel nehme ich eine jähe Bewegung wahr, erkenne eine schwarz gekleidete Silhouette und weiß intuitiv, dass es das Mädchen ist. Ich wirble herum.
Sie steht regungslos da, die Augen auf mich gerichtet. Aus der Nähe ist ihr Blick noch intensiver. Und in diesem Moment wird mir klar, dass ich das Mädchen schon einmal gesehen habe. In Somna? In der wachen Welt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur: Da ist eine Vertrautheit, die mich gleichzeitig beruhigt und eine erneute Welle des Schocks durch meinen Körper jagt. Für einen kurzen Moment kann ich nichts tun als sie anzustarren. Sie starrt zurück.
Die glatten schwarzen Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden, über den breiten Wangenknochen funkeln dunkle Augen.
»Hi.« Sie haucht das Wort mehr, als dass sie es sagt. Mein Blick zuckt über ihren Körper. Keine Uniform. Keine Traumgängerkette. Und doch. Das hier ist keine schlichte Klarträumerin. Das weiß ich mit absoluter Sicherheit. Obwohl das unmöglich ist. Unmöglich.
Langsam und kontrolliert erhebe ich mich von der Bank.
»Was willst du von mir?« Meine Stimme ist brüchig.
Sie blinzelt.
»Ich … Du bist Theo Parkers Tochter, nicht wahr?«
Etwas in mir löst sich und stürzt ins Bodenlose. Sie kennt meinen Vater. Meinen Vater. Ich weiche zurück und stoße rücklings mit jemandem zusammen. Im Augenwinkel sehe ich, wie Eleni erschrocken aufspringt.
Noch immer suche ich nach etwas, das die Fremde als Mitglied der Traumunion verrät. Woher kennt dieses Mädchen meinen Vater?
Sie macht einen Schritt auf mich zu, will nach mir greifen. Da stolpere ich und falle auf harte Pflastersteine. Die Eiswaffel in meiner Hand zerbricht, und die klebrig kalte Masse verteilt sich über meine Finger.
»Selena!«
Das Mädchen steht über mir. Ihr Ausdruck ist so wach, so drängend. Mein Herz hämmert.
»Eleni! Weg hier!«, rufe ich meiner Cousine zu und sehe, wie sich die Augen der Fremden weiten.
»Nein! Warte!«, ruft sie, beugt sich abrupt zu mir herunter und packt meinen Arm. Ihr Griff ist fester, als ich es erwartet habe. Ich höre Eleni – oder mich selbst – aufschreien, ganz sicher bin ich mir nicht. Dann schaffe ich es, mich loszureißen. Weg.Sofort weg.
Wie eine äußere Schale fällt der Traum von mir ab, und darunter spüre ich eine andere Realität: Meinen gebeugten Rücken, die Matratze unter mir und Elenis schweißnasse Locken zwischen meinen Fingern.
Ich fahre auf. Die Eiscreme an meiner Hand verklebt Elenis Haare. Ohne nachzudenken, wische ich die Reste am Bettlaken ab.
»Du bist ja schon wieder da«, höre ich Loukas hinter mir. Doch ich sehe mich nicht zu ihm um, sondern rüttele an Elenis Schultern, bis diese die Augen aufreißt und hektisch meinen Blick sucht.
»Sorry«, flüstere ich und umarme sie, »aber du musst kurz den Traum wechseln, okay?«
Elenis Atem stößt warm und hektisch gegen meinen Hals. Ich streichle ihr über den Rücken und warte, bis er sich ein wenig verlangsamt.
»Es war nur ein Albtraum. Du kannst jetzt weiterschlafen. Denk an was ganz anderes. Athen. Denk an Athen, ja?« Ich schenke ihr ein hoffentlich beruhigendes Lächeln und bette sie wieder auf ihr Kissen.
»Was ist los?«, fragt Loukas, nachdem Eleni die Augen wieder geschlossen hat.
Ich versuche meinen Gesichtsausdruck so entspannt wie möglich wirken zu lassen.
»Nichts.« Ich schlucke. »Nur ein schlechter Traum.«
Er sieht von mir zu Eleni, zu dem Eis auf dem Bettlaken.
»Du solltest Eleni mal Schwimmunterricht geben«, bemerke ich beiläufig, aber mein Onkel fällt nicht so leicht auf mein Lächeln herein wie meine Cousine.
»Was ist passiert?«, brummt er und will nach meinem Arm greifen – ganz wie das Mädchen eben in Somna. Ich zucke zurück. Eine tiefe Furche entsteht zwischen den Augenbrauen meines Onkels.
»Was ist passiert, Sel?«, wiederholt er sanft.
Ja. Was ist eigentlich passiert? Was genau an diesem Mädchen hat mich so aus der Fassung gebracht? Der Blick meines Onkels bringt ein wenig Klarheit in meinen Kopf zurück.
»Da war ein Mädchen …«, beginne ich.
»Ein Mädchen?«
»Ja, eine junge Frau. Ungefähr in meinem Alter. Und sie …«, ich zögere, »sie war wach.«
»Eine Klarträumerin?«
Ich schüttele den Kopf und sehe, wie die Furche auf Loukas’ Stirn immer tiefer wird. Sein Zweifel hängt in der Luft, aber er spricht ihn nicht aus. Das muss er auch nicht – ich weiß genau, was er denkt. Es gibt keine weiblichen Traumgänger. Zumindest keine außer mir.
»Ist ja auch egal. Ich bin jedenfalls abgehauen. Mama wäre stolz auf mich.«
Ich höre den Sarkasmus in meiner Stimme und rutsche von Loukas weg. Irgendwo in mir spüre ich den Impuls, einfach wieder in Elenis Traum einzusteigen und zu dem Marktplatz zurückzukehren. Vielleicht ist das Mädchen noch da.
Loukas betrachtet mich nachdenklich. »Dir ist klar, dass du vorsichtig sein musst, Sel«, sagt er, und ich weiß, dass er mir ansieht, was ich denke.
Ohne seinem Blick zu begegnen, lege ich mich neben Eleni auf die Matratze. Mein Arm pocht im Rhythmus meines Herzschlags, genau dort, wo die Fremde ihn gepackt hat. Vorsichtig sein. Ja. Vorsichtig bin ich schon mein ganzes Leben lang. Aber plötzlich weiß ich nicht mehr, wie lange ich das noch sein kann.
Ich lege meinen Kopf neben den der schlafenden Eleni, starre an die Zimmerdecke, lausche ihren Atemzügen und den dumpfen Schritten, mit denen Loukas mein Zimmer verlässt. Vor meinen halb geschlossenen Augen schwimmt das Gesicht der Fremden.
Im Türrahmen webt eine Spinne ein Netz. Sie bewegt sich schleichend und effizient, nie hastig, während sie ihren Faden hervorpresst. Immer dichter wird das Netz. Eine Fliege surrt in der gegenüberliegenden Zimmerecke.
2Ria
Es ist erst kurz nach drei. Ich seufze und greife nach meinem Smartphone. Eine Nachricht von Lil, die mit Basso und den anderen einen Skandinavien-Trip macht, sonst nichts. Mein Hocker quietscht, als ich mein Gewicht verlagere. Seit zwei Stunden und siebenunddreißig Minuten sitze ich schon hier hinter dem Empfangstresen, quietsche und warte. Zwischendrin darf ich immer wieder aufstehen und Besucher begrüßen. Die Zeit wird in diesem Sommerjob zu einer klebrigen Masse, bei der sich keine Sekunde von der vorherigen lösen mag.
Dabei habe ich mich so auf den Job gefreut und sogar den Skandinavien-Trip dafür sausen lassen. Aber die letzten Tage des Herumsitzens haben mir gezeigt, was für eine miserable Entscheidung das war. Wie gern würde ich jetzt mit Lil und den anderen durch die Gebirge Norwegens wandern und ins kalte Wasser der Fjorde springen.
Mein Blick gleitet durch die riesige Fensterfront, vorbei an der Sicherheitsschleuse mit den Polizisten und Metalldetektoren hinaus in die Hitze Berlins. Auf dem Vorplatz hocken ein paar Schüler mit ihren Pausenbroten in der Sonne. Einige spielen an ihren Handys, andere unterhalten sich. Vermutlich sind sie hier, um sich den neuen Sitz der Traumunion anzusehen und im multimedialen Besucherzentrum nebenan etwas über die Geschichte der Traumgänger zu lernen.
Ich beuge mich vor, um nach meiner Trinkflasche auf der Arbeitsfläche des Empfangs zu greifen, und spüre das Piksen meines Namensschilds an der Brust. Ria Maywald, Traumunion steht darauf. Immerhin klingt das so, als würde ich hierhin gehören.
Während ich trinke, beobachte ich Luisa, die einer Gruppe junger Männer gerade den Weg zur Einführungsveranstaltung erklärt. Wie immer hat sie eine Mischung aus Langeweile und Überheblichkeit auf dem von blonden Haaren umrahmten Gesicht. Die Hierarchie zwischen uns ist klar. Luisa bekommt die coolen Aufgaben, ich nicht. So einfach ist das.
Genauso simpel wie der Grund dafür. Mein Vater ist zwar Pressesprecher der Traumunion, aber er ist ein ganz gewöhnlicher Träumer. Ihr Vater ist ein Erlbach, ein Traumkommissar aus einer uralten Traumgängerfamilie. Das ist etwas ganz anderes.
Die Männergruppe geht davon, in Richtung Innenhof. Luisa lässt sich auf ihren Hocker fallen und schlägt die langen Beine übereinander. Ihr Hocker quietscht nicht.
»Als ob irgendwer von denen wirklich ein Traumgänger wäre«, sagt sie, ohne die Stimme zu senken. »Die sind doch nur zum Gaffen hier. Ich verstehe nicht, warum wir dieses Theater nötig haben.«
Ich zucke mit den Schultern und hoffe, dass mein Gesichtsausdruck die Art von Zustimmung zeigt, die sie sich wünscht. Mir fällt auf, dass sie »wir« gesagt hat. Mich meint sie damit aber sicherlich nicht.
»Ich gehe mal aufs Klo«, sage ich, erhebe mich von meinem Hocker und schlendere, so langsam ich kann, zur Damentoilette. Wie so oft in alten Berliner Gebäuden, die früher einmal Fabrikhallen waren und heute zu imposanten Lofts oder Büros umgebaut wurden, befinden sich die Toiletten unpraktisch weit weg von Orten wie dem Eingangsfoyer. Aber mir ist das gerade recht. Langsam gehe ich den Gang entlang. Vorbei an alten Fotografien in modernen Silberrahmen und unter stylischen Lampen hindurch, die perfekt zum hippen Fabrikcharme der Backsteinwände passen. Die Fotos stammen von der offiziellen Gründung der internationalen Traumunion nach Ende des großen Traumkriegs. Eine Gruppe anzugtragender Männer steht vor dem ehemaligen Hauptgebäude der Union, einer imposanten Villa, die die Gewichtigkeit der Aufgabe unterstreicht: die Ordnung der Welt zu bewachen und Einmischungen in die Träume der Menschen zu verhindern. Lächeln war damals wohl nicht erlaubt.
Schnell gehe ich weiter, um den grimmigen Blicken der Männer auf den Fotografien zu entkommen. Ein paar Meter den Gang hinunter werden die Bilder farbig und die Personen auf ihnen besser gelaunt. Ich sehe den aktuellen Generalsekretär Giacomo Laurenti strahlend bei der Einweihung des heutigen Hauptgebäudes, in dem ich mich gerade befinde. Auf einem weiteren Foto schüttelt er dem amerikanischen Präsidenten die Hand. Die beiden sind umringt von berühmten Traumkommissaren, allesamt Mitglieder großer Traumgängerfamilien. Ein paar Meter weiter lächelt Luisas Vater Wolfgang Erlbach aus einem der Rahmen heraus. Ob sie weiß, dass das Foto hier hängt? Wie muss sich das anfühlen, dass die eigene Familie in den Gängen der internationalen Traumunion verewigt ist? Vermutlich trägt sie deshalb immer diese Überheblichkeit zur Schau.
Der Vorraum der Damentoilette empfängt mich mit Neonlicht und dem leisen Surren der Lüftung. Mein Blick streift den Spiegel. Zahlreiche meiner dünnen, roten Haare stehen wie elektrisch aufgeladen am Scheitel ab. Mit den Handflächen streiche ich mir über den Kopf und betaste die brüchigen Haarspitzen, die auf meinen Schultern aufliegen. Ich sollte mal wieder zum Frisör …
Hübsch bin ich trotzdem. Zumindest wird mir das immer wieder gesagt. Die gerade Nase, die reine Haut, die vielen Sommersprossen. Hübsch, aber nicht zu hübsch. Nicht hübsch genug, um aufzufallen. Hübsch eben, aber nicht schön.
Ich wähle die erste Kabine. In Hockstellung über der Schüssel hängend – schließlich weiß ich nicht, wann die Brille das letzte Mal geputzt wurde –, starre ich auf meine Füße in den Sandalen. Noch viereinhalb Tage, dann ist dieser Aushilfsjob vorbei. Wie ich das finde, weiß ich selbst noch nicht. Ich hatte mir so viel davon versprochen. Nichts ist wahr geworden. Wie absurd zu glauben, dass mir ein paar Tage im Hauptsitz der Traumunion Antworten geben könnten.
Fest steht jedenfalls, dass ich nicht vorhabe, meinen Freunden zu erzählen, wie öde es hier wirklich war. Ich werde nur das Positive betonen: Wer kann schon behaupten, hinter die Kulissen der berühmten Traumunion geschaut zu haben? Und immerhin bin ich in Berlin – das ist schon mal cooler als die Münchner Vorstadt, in der meine Mutter und mein kleines Zimmer auf mich warten …
Als ich zurück zum Empfangstresen komme, überreicht Luisa gerade einem Jungen sein Namensschild. Die Eltern, die hinter ihm stehen, sehen sich schüchtern im Foyer um. Ich frage mich, was sie von diesem Gebäude halten. Ich finde, die Traumunion wirkt, als habe sie es nicht nötig, ihre Wichtigkeit zu zeigen, und als würde sie sie gerade dadurch zur Schau stellen: Unauffällig drückt sich der riesige, von einer roten Backsteinmauer umgebene Komplex an das Spreeufer. Zahlreiche Kameras erfassen jeden Winkel des ehemaligen Fabrikgeländes. Die einschüchternde Bescheidenheit wird im Inneren des Gebäudes fortgesetzt, in dem man von stylischer Leere und dem Motto der Traumunion empfangen wird. Protector non dominus.Hüter, nicht Herrscher, steht in silbernen Lettern an der Wand hinter unserem Empfangstresen. Darunter prangt das Logo der Union: zwei sich überlappende Kreise, der eine etwas dicker und größer als der andere, mit dem Schriftzug International Somnatic Union.
Ich schenke dem Jungen vor dem Tresen ein bestärkendes Lächeln. Er ist ein paar Jahre jünger als ich. Vielleicht vierzehn. In diesem Moment flüstert er seinen Eltern etwas in einer Sprache zu, die nach Mandarin klingt. Vielleicht ist er ja eines der Kinder, die bereits im Ausland getestet und für einen zweiten Test extra nach Berlin geflogen wurden. Am gestrigen Testtag war ein solches Kind der einzige neue Traumgänger. Wobei die vielversprechendsten Kandidaten in der Regel noch ein wenig jünger sind: Kaum einer hält die Panikattacken und mentale Belastung, die mit der Traumlosigkeit einhergehen, länger als bis ins Teenageralter aus. Die Nervosität ist immer das erste Zeichen für die Traumgängerfähigkeit. Ich lasse mich auf meinen Hocker fallen und atme tief ein und aus.
Als die Familie den Gang hinunter verschwindet, vibriert Luisas Handy schnarrend auf dem Tresen. Sie greift danach.
»Okay. Echt? Natürlich. Wann? … Gut. Bis gleich.«
Sie legt auf. Interessiert betrachte ich sie. Auf ihrem Gesicht scheinen unterschiedliche Emotionen um die Oberhand zu streiten. Mit angespannter, aber entschlossener Miene wendet sie sich mir schließlich zu.
»Mein Vater kommt mich gleich abholen.« Sie stockt. »Mit den Traumministern von Deutschland und Brasilien. Ich begleite sie bei einer Führung durch die Neubauten.«
»Oh«, sage ich. Natürlich. Der Traumgänger-Papa lässt seine Beziehungen spielen.
Ich kann es mir nicht verkneifen: »Das ist doch super. Für dein nächstes Praktikum im Ministerium.«
Luisa nickt nur, dann zuckt ihr Blick zu ihrer Armbanduhr.
Da fällt mir etwas ein, und ich spüre, wie sich ein aufgeregtes Kribbeln in mir ausbreitet.
»Und die Einführungsveranstaltung?«
»Die musst du heute übernehmen.«
Das sind die Worte, auf die ich nun schon seit Tagen warte. Seit die Testtage und unser Sommerjob hier angefangen haben, um genau zu sein. Denn die Einführungsveranstaltung war bisher fest in Luisas Hand. Jeden Tag habe ich hinter ihr hergesehen und sie beneidet, dass sie den Generalsekretär Giacomo Laurenti live sehen darf. Dass sie sich anhören kann, was er über die Traumunion, die Ausbildung und das Traumgehen erzählt.
Ich lasse mein Handydisplay aufleuchten. In ein paar Minuten geht die Veranstaltung los. Ich bebe innerlich. Das hier ist die Gelegenheit, endlich mehr Details zu erfahren. Eine kleine Chance, diesen Sommerjob doch noch lohnenswert zu machen.
Ich warte nicht länger ab, ob Luisa sich doch noch anders entscheidet, sondern laufe mit einer hastigen Verabschiedung auf den Lippen los, den breiten Gang entlang und durch eine Doppeltür hinaus in den riesigen, mit Kies ausgelegten Innenhof.
Mit so viel Autorität wie möglich steuere ich auf das ehemalige Kesselhaus zu, in dem sich heutzutage ein Versammlungssaal befindet. Ich trete durch die gläsernen Doppelflügeltüren und sehe mich einer überraschend großen Menschenmenge gegenüber. In etlichen Stuhlreihen und auf seitlich aufgestellten, mehrreihigen Tribünen sitzen die Menschen, die Luisa und ich im Laufe der letzten Stunden im Foyer begrüßt haben. Es sind fast ausschließlich Männer, aber auch ein paar Frauen und Mädchen sind darunter – als Begleitpersonen.
Ich gehe auf den Tisch der Tontechnik zu, denn natürlich weiß ich, was Luisas Aufgabe hier ist, und ich habe nicht vor, mich zu blamieren. Sie assistiert der Technikerin, falls es Probleme bei der Präsentation gibt.
Ich versuche mir meine Aufregung nicht anmerken zu lassen, als ich hinter dem schwarzen Pult mit den vielen Tasten und bei der mich nickend begrüßenden Technikerin ankomme.
Neben dem Pult steht ein Stuhl, auf dem ich mich jetzt niederlasse. Ich gebe mein Bestes, so auszusehen, als ob ich das hier jeden Tag mache. Aber ich kann es mir nicht verkneifen, den Hals zu recken, als wenig später das Murmeln und Wispern im Saal verstummt und Giacomo Laurenti die Bühne betritt. Ich halte die Luft an.
Giacomo, der sich in diesem Moment seinen Zuhörern vorstellt, zeigt ein strahlendes Lächeln. Überhaupt scheint alles an ihm zu strahlen. Der sonnengebräunte Teint seiner Haut. Das enge, weiße T-Shirt mit dem V-Ausschnitt, das er unter seinem maßgeschneiderten Jackett trägt. Der grüne Anhänger, der an einer silbernen Kette auf genau diesem T-Shirt baumelt. Und sogar das graue Haar, das bei ihm nicht alternd, sondern stilvoll wirkt. Auch dass er sich überall beim Vornamen nennen lässt, kann nicht verschleiern, dass er einer der mächtigsten Traumgänger ist – der Generalsekretär der Traumunion.
Jetzt gleitet sein Blick durch den Raum.
»Willkommen bei den Testtagen der Traumunion. Jedes Jahr freue ich mich auf diese Zeit. Auf all die neuen Traumgänger, die ich danach in der Ausbildung begrüßen darf. Es ist eine geliebte Tradition geworden, unsere Tore für ein paar Tage im Sommer zu öffnen und nicht nur nach neuen Traumgängern zu suchen, sondern Ihnen allen die Chance zu geben, die Traumunion von innen kennenzulernen.«
Nur an wenigen Stellen merkt man Giacomos Englisch an, dass er kein Muttersprachler ist. Laut meinem Vater soll er bereits als Jugendlicher nach Berlin gekommen sein und mittlerweile unzählige Sprachen fließend sprechen.
»Die letzten Tage waren sehr aufregend, mit über zweihundert Testpersonen. Mir wurde gesagt, dass gerade siebenundachtzig hoffnungsvolle Menschen in diesem Raum sitzen, die nach eigenen Aussagen noch nie geträumt haben. Dies ist ein besonderer Tag für uns alle. Die Gabe des Traumgehens ist außergewöhnlich. Derzeit kennen wir nur knapp sechshundert Traumgänger. Und trotzdem sind unsere jährlichen Testtage der Ort, an dem regelmäßig neue entdeckt werden. Sie, die hier jetzt vor mir sitzen, sind aus der ganzen Welt zu uns gekommen und haben teilweise sogar schon einen Test in Ihrem Heimatland hinter sich. Ich bin überzeugt, dass unter Ihnen der ein oder andere Traumgänger zu finden ist.«
Er lächelt das Publikum an, und sein Optimismus scheint auf die Menschen im Saal überzugehen. In meiner Nähe grinsen sich ein paar der jüngeren Besucher aufgeregt zu.
»Wir wollen eine Gemeinschaft sein. Deshalb versammeln wir alle Traumgänger für die Ausbildung hier in Berlin, wo sie zu einer großen Familie zusammenwachsen. Doch diese Gemeinschaft ist nicht nur eine der Traumgänger, sondern eine Union aller Menschen, die sich für sicheres und freies Träumen einsetzen.« Kurz hält er inne, bevor er eindringlich fortfährt. »Nie wieder sollen sich Menschen in ihren eigenen Träumen nicht sicher fühlen. Nie wieder soll Somna Auswirkungen auf Corpora – unsere wache Welt haben. Nie wieder soll es für politische Absichten missbraucht werden. Dafür steht die Traumunion. Wir Traumgänger haben aus unseren Fehlern gelernt und wollen unserer Aufgabe gerecht werden. Das tun wir nun schon seit fast siebzig Jahren. Seit dem Ende des großen Traumkriegs, den so viele von uns glücklicherweise nur noch aus den Geschichtsbüchern kennen. Protector non dominus. Hüter, nicht Herrscher. Das ist unser Motto. Und das wird das Motto eines jeden werden, der heute in die Traumgängerausbildung aufgenommen wird.«
»Was ist mit den Albträumen? Was macht ihr dagegen?«, schallt es plötzlich durch den Saal.
Ich setze mich aufrecht hin, um den Rufer auszumachen. Die Menschen im Saal sehen sich ebenfalls suchend um. Mein Blick fliegt zurück zu Giacomo.
Auf seinem lächelnden Gesicht kann ich ein Zögern ausmachen, bevor er sagt: »Ich würde Sie bitten, mit solchen Fragen bis zur Pressenkonferenz zu warten, sollten Sie von der Presse sein.«
Ich beobachte, wie sich ein Mann, dessen Shirt den Aufdruck Security trägt, durch die Stuhlreihen schiebt und sich zu jemandem herunterbeugt, den ich nicht erkennen kann. Nach einem kurzen Wortwechsel nickt der Sicherheitsmann und verlässt die Stuhlreihe wieder.
Giacomo spricht schon weiter. »Um Ihnen einen Eindruck zu geben, was unsere neuen Traumgänger erwartet, sollten sie für die Ausbildung in Frage kommen, wollen wir Ihnen aus erster Hand ein wenig darüber erzählen. Dafür bitte ich Yunus Dede auf die Bühne.«
Giacomo macht eine ausladende Geste, und mir stockt der Atem. Vor fünfzehn Minuten habe ich mich noch auf dem Klo verkrochen und nach Norwegen gewünscht, und jetzt bin ich im selben Raum wie Yunus Dede. Diese Einführungsveranstaltung ist sogar noch besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Warum hat Luisa das nie erwähnt? Soll ich ein Beweisfoto für Lil machen?
Yunus hält die Kamera seines Smartphones auf uns Zuschauer gerichtet, während er in wenigen Sätzen die Stufen zur Bühne hinaufspringt. Die Menschen im Saal beginnen aufgeregt zu klatschen. Erst als Yunus sich neben Giacomo auf einem der schicken Ledersessel niederlässt und das Handy wegsteckt, ebbt der Applaus ab. Mit einer Aura der absoluten Entspannung lächelt er dem Publikum zu. Seine Augen funkeln unter den dichten, schwarzen Brauen.
Kein Wunder, dass er sich auf der Bühne so wohl fühlt. Yunus Dede ist der Vorzeigetraumgänger der Union. Alle Leute in meinem Alter folgen ihm auf seinen Social-Media-Kanälen, auf denen er vom Leben in der Traumunion erzählt. Vermutlich hat er gerade eine Story aufgenommen, während er die Bühne betreten hat. Ich nehme mir vor, sie mir später anzusehen.
»Yunus ist Traumgänger und besucht bei uns die zwölfte Klasse«, erklärt Giacomo, als würden das nicht alle wissen. »Yunus, wie bist du in die Traumgängerausbildung gekommen?«
Yunus greift nach einem Mikro, das neben ihm auf einem Beistelltisch liegt.
»Erst mal hallo. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.« Sein Lächeln gleitet durch den Raum. Er ist ein Profi.
»Ich war damals neun Jahre alt. Also ganz im üblichen Alter für eine erste Testung. Meine komplette Familie ist zum Test mitgekommen. Wir waren alle ziemlich aufgeregt. Wobei ich sagen muss, dass mir meine Eltern erst lange nicht geglaubt haben, obwohl ich ihnen immer wieder erzählt habe, dass ich nicht träume. Nach dem Test war das dann natürlich anders. Danach bin ich hier im Internat eingezogen und habe meine Traumgängerkette bekommen.« Seine Finger greifen nach dem grünen Anhänger, der auf seiner Brust baumelt.
»Und wie würdest du das Leben und den Unterricht hier im Internat beschreiben? Wie können sich unsere Besucher den Alltag in der Traumunion vorstellen?«, fragt Giacomo.
»Das ist von Tag zu Tag unterschiedlich«, sagt Yunus und lächelt. Täusche ich mich, oder wirkt es eine Spur gekünstelt? »Zum einen gibt es auch hier den ganz normalen Unterricht – Englisch, Mathe und so weiter. Aber dann gibt es natürlich das Emotionstraining und Aufenthalte in Somna. Und …« Es knackt. Sehr laut. Yunus Lippen bewegen sich weiter, aber seine Stimme ist nur noch gedämpft zu hören. Er sieht auf das Mikrophon in seiner Hand. Die dichten Augenbrauen wandern in die Höhe, während er es schüttelt. Wieder knackt es in den Lautsprechern.
»Hey. Mädchen.« Ich werde unsanft an der Schulter berührt. Es ist die Tontechnikerin. »Bring ihm das.« Sie hält mir ein Mikrophon vors Gesicht und nickt in Richtung Bühne. »Los, beweg dich.«
Wieder knackt es. Giacomo, der selbst ein Headset trägt, nimmt Yunus auf der Bühne das kaputte Mikro aus der Hand. Die Lautsprecher piepsen unangenehm. Ich greife nach dem Ersatz und stehe auf.
Mir wird schlagartig heiß, als ich begreife, dass ich gleich die Bühne betreten muss. Die Stuhlreihen gleiten an mir vorbei, und als ich bei den vorderen Reihen angekommen bin, kann ich die Blicke der Zuschauer auf mir spüren. Hastig springe ich die Stufen empor, die mich aufs Bühnenpodest bringen. Die beiden Männer sehen mich erleichtert an, und Giacomo schenkt mir ein breites Lächeln. Noch ein paar Schritte, dann bin ich bei ihnen. Ich halte Yunus das Mikro hin. Als er danach greift, berühren sich unsere Finger. Bestimmt bekomme ich gleich wieder die roten Flecken, die immer auf meinem Hals brennen, wenn ich aufgeregt bin. Ich spüre, wie mein Herz rast, und kann nichts dagegen tun.
Ich versuche ein Lächeln, das mir ziemlich sicher misslingt, drehe mich um und laufe fast in einen kleinen Beistelltisch hinein, auf dem zwei Gläser Wasser stehen.
»Test, Test«, höre ich Yunus hinter mir sagen und erstarre. Ich habe das Mikro nicht angeschaltet. Blut rauscht mir in den Kopf. Ich wirbele herum.
»Du musst es anschalten«, sage ich, greife ruppig danach und schiebe den grauen Regler nach oben. Yunus grinst mich schief an.
»Test, Test«, hallt es jetzt durch den Saal.
»Danke dir«, sagt Giacomo und entlässt mich mit einem Nicken von der Bühne. Hastig gehe ich in Richtung der Treppe und versuche nicht auf das Publikum zu achten, deren Blicke ich noch immer wie eine heiße Decke auf mir spüre. Mit eiligen Schritten kehre ich zurück zur Tontechnikerin.
Ich setze mich wieder auf meinen Stuhl und versuche so normal wie möglich auszusehen, während das Blut noch immer in meinen Ohren rauscht und rote Flecken auf meinem Hals kribbeln. Obwohl mir niemand mehr Beachtung schenkt, wollen sich mein Herzschlag und meine Atmung nur langsam beruhigen. Ich versuche, mich mit aller Macht zusammenzureißen. Ich darf nichts verpassen, was auf der Bühne gesagt wird. Dafür bin ich doch hier. Im Kopf gehe ich noch mal die Liste der Fragen durch, auf die ich Antworten brauche: Wie steigt man in einen Traum ein? Gibt es wirklich keine weiblichen Traumgänger? Woran liegt das? Und wenn das so ist, was zum Teufel stimmt dann nicht mit mir? Bei dem letzten Gedanken hämmert mein Herz noch schneller. Ich atme tief ein und versuche mich mit aller Macht zu beruhigen. Wie so viele Male zuvor … Doch mein Gehirn steckt in einer Art Fluchtmodus fest, und Yunus’ und Giacomos Ausführungen über die Ausbildung und die anschließend mögliche Karriere als Traumkommissar gehen in dem Rauschen in meinen Ohren unter.
Als ich meinen Herzschlag wieder einigermaßen unter Kontrolle habe, endet die Einführungsveranstaltung auch schon. Ich starre auf die Bühne, während sich die Zuschauer erheben und nach draußen zu den Führungen oder zu ihren Testterminen gehen. Ich kann nicht fassen, dass keine meiner Fragen beantwortet wurde. Und dass ich noch nicht mal ein Beweisfoto von Yunus Dede gemacht habe, das ich Lil schicken könnte.
»Ey. Holst du mir mal die Mikros von der Bühne?«, fragt mich die Technikerin. Ich reiße mich zusammen, nicke und gehe los.
Auf der Bühne hat sich ein Pulk von Menschen um Giacomo gebildet. Yunus ist nirgendwo zu sehen. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, die Bühne jetzt zu betreten, wo sie nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit steht.
Gerade sammle ich die Mikros ein, die auf den Sesseln liegen, da höre ich hinter mir ein Räuspern.
»Ähm. Entschuldigung.«
Ich drehe mich um. Vor mir steht ein Mädchen von vielleicht neun oder zehn Jahren. Ihre Arme umklammern den Rucksack vor ihrem Körper wie einen schützenden Schild.
»Du bist doch von der Traumunion, oder? Weißt du, wo ich einen Testtermin ausmachen kann?«
»Einen Testtermin?«
»Ja.«
»Für den Traumgängertest?«
»Ja.«
Ich runzele die Stirn.
»Hat dein Bruder oder wen auch immer du begleitest denn keinen Termin?«
Unsicher schaut das Mädchen zum Ausgang. »Doch.«
Ich folge ihrem Blick und sehe einen Jungen an der Tür stehen, der uns beobachtet.
Jetzt holt die Kleine Luft und umfasst ihren Rucksack noch enger, als hätte sie Angst, er könnte ihr jeden Moment herunterfallen. »Aber ich hätte auch gern einen Termin.«
Ich starre sie an, unfähig, etwas zu sagen. Dann kommen mir die einzigen Worte über die Lippen, die mein Gehirn in diesem Moment ausspuckt: »Wieso denn? Du kannst kein Traumgänger sein.«
Sie zögert nicht. Vermutlich hat sie genau mit dieser Antwort gerechnet. »Aber ich träume nicht. Wirklich. Ich habe noch nie geträumt.«
Etwas in mir versteift sich. Ich öffne den Mund, aber es kommt keine Antwort heraus, sondern nur ein seltsames Geräusch, das eine Mischung aus Lachen und Stöhnen ist. Ich hole Luft und presse schließlich hervor: »Weißt du eigentlich, was du da sagst? Es gibt keine weiblichen Traumgänger.«
Ich schaffe es sogar, ein Lächeln auf mein Gesicht zu zwingen. Sie ist noch klein. Vermutlich ist es nur eine Phase. Sie wird diese Phantasie irgendwann hinter sich lassen. Genauso wie ich es tun muss.
Enttäuschung macht sich auf dem Gesicht des Mädchens breit. »Ich wäre so gerne Traumgängerin.«
Sind das Tränen in ihren Augen, oder ist das das Licht?
Vermutlich hätte jede andere Person jetzt verständnisvoll reagiert. Hätte sie getröstet und ihr gesagt, dass sie so viele andere Möglichkeiten hat als Frau. Hätte sie zum Informationsstand geführt, um ihr ein paar Sticker mit dem Logo der Traumunion zu schenken. Aber ich stehe nur da, sehe sie an und hasse mich dafür, dass ich all diese Dinge nicht tue.
»Es gibt keine Traumgängerinnen, das weißt du genau. Also vergiss den Test, und erzähl nicht in aller Öffentlichkeit so einen Quatsch«, sage ich mit einer Härte in der Stimme, die mich selbst erschreckt.
Jetzt bin ich mir sicher, dass da Tränen in den Augen des Mädchens glitzern. Ich bin ein Monster.
»Achte nicht auf sie, sie meint es nicht so.«
Die Stimme hinter mir ist so sanft, dass ich sie kaum wiedererkenne. Doch als ich mich umdrehe, durchfährt es mich wie ein Blitz. Es ist Yunus Dede.
Er beugt sich zu dem Mädchen herunter und umfasst mit den Händen ihre Schultern. »Lass dir von niemanden einreden, dass du etwas nicht tun kannst, hörst du? Wenn dir etwas wichtig ist, musst du darum kämpfen.«
Das Mädchen ist sprachlos. Ich auch.
»Wie heißt du?«
»Vivi«, piepst das Mädchen.
»Also, Vivi«, sagt Yunus. »Heute klappt es vielleicht nicht mit dem Test für dich. Aber wer weiß, vielleicht eines Tages?«
Vivi sieht ihn an wie eine Erscheinung, und vermutlich steht mein Gesichtsausdruck dem in nichts nach. Fassungslos schaue ich zu, wie er ihr eine Autogrammkarte gibt und sie davonläuft, stolz, als hätte sie den Test bestanden.
Langsam richtet Yunus sich auf und wendet sich zu mir um.
»Was sollte das?« In seinen Augen sehe ich Ärger, der mir eine erneute Woge Hitze über den Rücken fahren lässt.
»Was?«, gebe ich nur von mir.
»So geht man doch nicht mit einem kleinen Mädchen um«, sagt er, schüttelt den Kopf und will mich einfach stehen lassen, als sich etwas in mir löst.
»Aha. Aber kleinen Mädchen falsche Hoffnungen machen, das ist okay, oder wie?«
Keine Ahnung, was in mich gefahren ist, doch ich kann die Worte nicht aufhalten: »Sie wird niemals einen Test machen, und das weißt du ganz genau. Und sie weiß das auch. Auch wenn sie es noch nicht wahrhaben will. Du hast doch keine Ahnung, wie das ist als Mädchen!«
Er wendet sich um. Eine seiner Brauen wandert in die Höhe, und in seinen dunklen Augen blitzt etwas auf. Sein Blick wird so intensiv, dass ich fast vor ihm zurückweiche.
»Man muss nicht immer alles so hinnehmen, wie es scheint«, sagt er.
»Du hast doch keine Ahnung«, wiederhole ich, und im selben Moment meldet sich eine Stimme in meinem Kopf, die mich daran erinnert, dass das hier Yunus Dede ist. Yunus Dede. Wenn einer Ahnung hat, dann vermutlich er.
Jetzt grinst er plötzlich. »Dann erklär es mir gern.«
Meine Finger pressen sich um die Mikros, suchen Halt. Ich muss sofort hier weg. Sonst fliegt die Tür in meinem Inneren auf, die ich um alles in der Welt geschlossen halten muss. Sonst werden die Wellen der Panik, die ich nur zu gut kenne, durch meinen Körper branden und alles in Beschlag nehmen. Und das darf nicht passieren. Nicht hier. Nicht im Herzen der Traumunion. Und schon gar nicht vor ihrem Vorzeigetraumgänger Nummer eins.
Ich drehe mich abrupt um und laufe in Richtung der kleinen Treppe, die von der Bühne führt.
»Hey«, ruft Yunus hinter mir. »Warte mal.«
Ich höre Schritte, dann stellt er sich mir in den Weg. Sein Blick huscht über das Namensschild an meiner Brust.
»Ria.«
Er legt eine Hand auf meinen Arm. Es ist, als würden seine Finger mich verbrennen.
»Lass mich!«
Ich reiße mich los, stürze aus dem Saal und renne durch die Menge der Besucher, bis ich endlich eine abgelegene Toilette finde, in der ich ein paar Minuten oder vielleicht auch Stunden auf dem Klodeckel sitze und an die Kabinentür starre. Habe ich gerade ernsthaft Yunus Dede angebrüllt und bin dann vor ihm davongelaufen? Hätte ich gerade fast eine meiner Panikattacken direkt im Hauptsitz der Traumunion bekommen? Bei dem Gedanken wird mir übel.
Erst als von außen jemand energisch an der Kabinentür rüttelt, überwinde ich mich, die Mikros zu der schlechtgelaunten Tontechnikerin zurückzubringen und ihre Vorwürfe über mich ergehen zu lassen. Hoffentlich erzählt sie Luisa nichts davon. Aber vermutlich würde die mich eh nie wieder in die Einführungsveranstaltung lassen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob ich das in den nächsten Tagen noch mal durchstehen würde.
Ich verziehe mich in eines der oberen Stockwerke und helfe dabei, die Besucher zu ihren Tests zu führen.
Irgendwann sind die Letzten gegangen, und ich trete durch den Haupteingang der Traumunion. Langsam durchquere ich die Wärme des weitläufigen Vorplatzes und setze mich auf ein paar schattige Treppenstufen, direkt an der Straße. Die Luft riecht nach aufgeheiztem Asphalt und Abgasen, und die Stufe trägt noch die Wärme der weitergezogenen Sonne in sich. Mein Handy vibriert.
Hole dich ab. Dauert noch, steht da.
Ich sehe den Autos vor mir zu. Feierabendverkehr. Mit den aufziehenden Wolken kriecht die Schwüle durch die Straße. Ich spiele an meinem Smartphone herum. Wenn Passanten an mir vorbeilaufen, tippe ich besonders konzentriert auf das Display. Sie müssen ja nicht wissen, dass ich nur durch meinen Social-Media-Feed scrolle. Dass ich Yunus Dedes Profil betrachte und dann energisch die App schließe.
Irgendwann hält ein schwarzer BMW direkt vor mir und hupt. Ich stehe auf und steige in den Wagen.
»Hi, Papa.«
»Hey.«
Er nickt mir zu, ehe er den Blinker setzt und sich wieder im Verkehr einordnet.
»War etwas hektisch heute. Musstest du lange warten?«
Ich schüttele den Kopf und betrachte ihn von der Seite. Er wirkt blass. Aber vermutlich ist es nur der zunehmend weiße Schimmer seiner Haare, die nicht grau werden, sondern einfach nur an Farbe verlieren. Als wolle der ganze Mann am liebsten nach und nach verschwinden – ein sehr unpassendes Bedürfnis, wenn man Pressesprecher der Traumunion ist. Kurz muss ich an den Zwischenrufer bei der Einführungsveranstaltung denken. In den Pressekonferenzen bekommt mein Vater solche Fragen vermutlich täglich zu hören, seit die Sache mit den Albträumen losgegangen ist. Kurz erwäge ich, ihn danach zu fragen, entscheide mich dann aber dagegen. Nach dem Zusammentreffen mit Yunus Dede fehlt mir die Energie für ein Gespräch.
Das Klingeln des Handys meines Vaters erlöst uns von der Stille im Wagen. Mit einem entschuldigenden »Sorry« nimmt er das Gespräch über sein In-Ear-Headphone an, das er im linken Ohr trägt. So etwas wie Feierabend gibt es in seinem Job nicht. Das war schon immer so, auch bevor die Menschen angefangen haben, sich über die Albträume zu beschweren.
Ich lasse das Fenster herunter. Schwüle Stadtluft dringt ins Innere des Wagens, nimmt mir ein wenig der Beklemmung. Ich atme tief ein und beobachte die Reihen der Häuser und Autos, die an uns vorbeigleiten.
Neben mir beendet mein Vater sein Telefonat und versucht ein Gesprächsthema mit mir zu finden. Er spricht über seine Urlaubspläne mit Anna und Kilian. Spanien. Sobald ich wieder in München bin, wird es für die drei losgehen. Wie schön. Kilians neuer Hund. Kilian wird sich so freuen, wenn er ihn nächste Woche zu seinem dritten Geburtstag bekommt. Wie schön. Anna hat vor, heute Abend Spaghetti mit Sahnesauce zu kochen. Extra für mich, weil es mein Lieblingsessen ist. Wie schön. Und habe ich mit meiner Mutter telefoniert? Ich soll doch bitte liebe Grüße ausrichten.
Irgendwann klingelt sein Handy erneut, und ich habe den Verdacht, dass wir beide erleichtert sind.
Ein paar Minuten später rollt der Wagen durch die ruhigen Straßen Potsdams und hält vor der alten Villa, die von Eichen umrahmt auf einer großen Rasenfläche steht. Am Tor gibt es drei beschriftete Klingeln. Ein Name ist Maywald. Die anderen hat sich Anna ausgedacht, damit Einbrecher denken, es sei ein Mehrfamilienhaus.
Mein Vater fährt über den Schotterweg und parkt unter dem hölzernen Carport. Der Motor verstummt.
»Hat man eigentlich noch nie Frauen auf die Traumgängergabe getestet, Papa?«, murmele ich in die plötzliche Stille hinein.
Überrascht sieht er mich an.
»Doch. Aber keine Frau hat jemals die Gabe gezeigt, das weißt du doch. Das muss irgendwelche physiologischen Gründe haben.« Er wedelt mit der Hand grob in die Richtung meines Körpers, als würde das irgendetwas erklären.
Ich reiße mich zusammen und stelle meine nächste Frage: »Aber was ist, wenn es doch Ausnahmen gibt?«
»Rieschen, diese Phase hast du doch längst überwunden.«
Die Art, wie er meinen Kosenamen benutzt, und das herablassende Verständnis in seinem Blick machen mich wütend. Ich beiße auf meiner Wange herum. Mein Vater ist der einzige Mensch, der diese Wut in mir auslösen kann.
Im Seitenspiegel des Autos sehe ich, wie die Haustür hinter uns aufgeht und Kilian auf dem Treppenabsatz erscheint.
Ich schnalle mich ab, reiße die Autotür auf und atme tief ein.
»Riiii!«, ruft mein Halbbruder vom Hauseingang her.
»Kili!«
Ich lächle und breite die Arme aus, während er auf mich zurennt.
Ich muss vergessen, was das Mädchen zu mir gesagt hat. Muss vergessen, was das kurze Treffen mit Yunus Dede in mir ausgelöst hat. Und vor allem muss ich die Wahrheit vergessen, die niemand hören will.
3Selena
Langsam lasse ich meinen Blick über den Horizont gleiten. Im Dunst, der über dem Meer aufsteigt, kann ich den schmalen blauen Streifen nur verschwommen erkennen. Wie mit zu feuchter Farbe gemalt, geht er direkt in das Hellblau des Morgenhimmels über. All das lässt mich an Somna denken. Ich blinzele in die aufsteigende Sonne hinein, die die über dem Meer treibenden Wolken von unten anstrahlt, und wische mir den Schlaf aus den Augen. Obwohl ich Frühaufsteherin bin, wäre ich heute gerne noch etwas länger liegen geblieben. Nach den gestrigen Ereignissen habe ich schlecht geschlafen. Wie zu laute Stimmen gingen mir die Gedanken durch den Kopf und ließen mich immer wieder hochschrecken.
Hinter mir schläft das Dorf noch. Ich sitze auf der Kaimauer am Marktplatz – ungefähr dort, wo ich gestern in Somna mit Eleni ein Eis gegessen habe. Dort, wo die Fremde aufgetaucht ist. Woher kannte sie den Namen meines Vater? Ist sie wirklich eine Traumgängerin? Genau wie ich? Je länger ich letzte Nacht darüber nachgedacht habe, desto sicherer bin ich mir geworden. Ich bin nicht allein. Es gibt noch andere Mädchen, die traumgehen können. Habe ich das nicht immer vermutet?
Ich kaue auf meiner Wange herum.
Warum nur bin ich so schnell abgehauen? Vor der einzigen Person, die mich verstehen könnte? Die mir Antworten liefern könnte …
Antworten. Ich brauche endlich Antworten. Das immerhin hat mir die fremde Traumgängerin klargemacht.
Ich rutsche von der Kaimauer herab und überquere den Marktplatz. Auf dem Weg die Straße hinauf zu unserem Haus ziehe ich mein Handy hervor. Doch eine Internetsuche mit den Stichwörtern »weiblich« und »Traumgänger« spuckt nur die üblichen Erklärungen aus. Traumgänger seien immer männlich. Zumindest sei das bei allen bisher bekannten Traumgängern der Fall. Die Forschung habe noch keine genaue Antwort auf das Warum gefunden.
Ich werfe mich mit der Schulter gegen das Tor zu unserem Hof, woraufhin es scheppernd auffliegt. Das Haus und die angrenzende Ferienwohnung liegen friedlich in der frischen Morgenluft, umhüllt vom Zwitschern der Vögel. Schnell husche ich ins Haus, streife die Schuhe ab und laufe so leise wie möglich die Treppe hinauf. Wahrscheinlich ist meine Mutter mit ihrer morgendlichen Yoga-Routine beschäftigt. Ich meide die Stufen, von denen ich weiß, dass sie knarzen, und komme beinahe geräuschlos auf dem oberen Treppenabsatz zum Stehen. Rechts von mir befindet sich das Arbeitszimmer meiner Mutter.
Ich weiß, dass das, was ich gleich tun werde, ein absoluter Vertrauensbruch ist. Aber was habe ich für eine Wahl, wenn meine Mutter mir nie etwas erzählt?
Vorsichtig betrete ich das Arbeitszimmer, wo mich das gewohnte Durcheinander erwartet. Die Fensterläden sind geöffnet, und die Morgensonne fließt über den großen, hölzernen Schreibtisch. Auf und um den Tisch herum stapeln sich Bücher in unterschiedliche Höhen. Doch ich weiß genau, wonach ich suche. Lautlos durchquere ich den Raum, umrunde die Bücherstapel und erreiche den Einbauschrank. Die Scharniere ächzen, als ich die Tür öffne.
Ich setze mich im Schneidersitz auf die Dielenbretter und horche. Nebenan knarzt etwas. Offenbar hatte ich recht mit meiner Yoga-Vermutung. Jetzt. Nicht weiter nachdenken. Nicht das schlechte Gewissen zulassen, das langsam in mir emporkriecht.
Ich räume ein paar der Ordner zur Seite, in denen meine Mutter langweilige Dinge wie Bankunterlagen und Versicherungspolicen verstaut. Vermutlich hat sie gedacht, dass ich hier niemals nachsehen würde. Aber ich habe ihr Versteck bereits vor ein paar Jahren entdeckt und die kleine Box gefunden, die sie hinter den Ordnern aufbewahrt. Geöffnet habe ich sie jedoch nie. Bis jetzt.
Vorsichtig ziehe ich sie aus dem Schrank und lege sie mir auf den Schoß. Es ist eine unscheinbare, graue Schachtel, auf der in der Handschrift meiner Mutter der Name Theo steht. Theo – der Name meines Vaters. Theo Parker.
Das immerhin weiß ich über ihn. Und ich weiß, dass er ein Traumgänger war. Doch außer ein paar verschwommenen Erinnerungen an seine sporadischen Besuche bei uns und einem dumpfen, schmerzhaften Ziehen in meiner Magengrube, wenn ich an ihn denke, ist mir nichts von ihm geblieben.
Vor meinem inneren Auge taucht das Bild meiner Mutter auf, die weinend auf dem Boden kniet, mich an sich drückt und mir sagt, dass mein Vater tot sei. Damals muss ich ungefähr sechs Jahre alt gewesen sein. Seitdem habe ich nie wieder geträumt. Und ich habe das Wort »Papa« nie wieder in unserem Haus erwähnt. Zumindest nicht, ohne dass meine Mutter mit schmerzerfülltem, angstvollem Blick das Zimmer verlassen hätte.
Ich schlucke, während meine Finger den Rand der Box entlangfahren. Mach schon.Bevor du es dir anders überlegst. Ich hebe den Deckel der Schachtel.