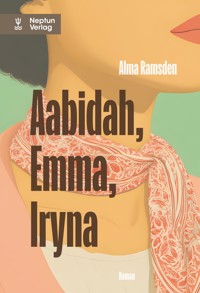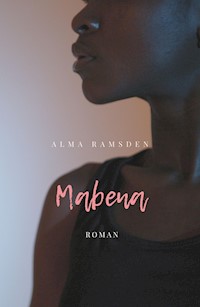
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gerda wie noch? Die junge Frau kann sich nicht einmal an den Nachnamen jener Vertrauensperson erinnern, die ihr zu Seite stand, als sie täglich stundenlang die Schatten an der Wand betrachtet hatte. Nun möchte sie Gerda wiederfinden. Einzig deswegen ist sie nach der Trennung von ihrem Mann zurückgekehrt nach Johannesburg. Doch Gerda ist inzwischen spurlos verschwunden. Also macht sich die junge Frau auf die Suche nach ihr - und sieht sich plötzlich mit jenen kriminellen Machenschaften konfrontiert, denen Gerda bereits auf der Spur war. Eine Spur, die sie nun aufnimmt in der Hoffnung, Gerdas Nachforschungen zu beenden und Gerda zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
ALMA RAMSDEN
***
MABENA
Roman
© 2021 Alma Ramsden
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-31394-1
Hardcover:
978-3-347-31395-8
e-Book:
978-3-347-33521-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Prolog
Eine Frau, sie ist soeben 35 geworden, hat einen wiederkehrenden Traum: Sie geht mit Gerda im Zoo Lake Park spazieren, sie trägt einen Picknickkorb, Gerda eine Decke, auf der sie sich ausbreiten werden. Sie werden den ganzen Tag im Park verbringen. Das haben die Freundinnen oft getan, und es ist eine ihrer besten Erinnerungen an Johannesburg. Der Park ist unter der Woche ausgestorben: Die Familien, jungen Pärchen und Gruppen von Freunden, die sich am Samstag und Sonntag auf dem Rasen tummeln, finden sich unter der Woche nicht hier ein. Ab und zu sieht man einen Hundesitter, der seine zwei, drei oder auch mehr Hunde ausführt. Ein paar Obdachlose schlafen im Schatten der Bäume, doch sind es überraschend wenige. Die Wasservögel haben das Gebiet übernommen: Sie, die an den Wochenenden vor dem Lärm ins Gebüsch flüchten, haben sich nun ihr Revier zurückerobert. Sie stellen die größte Gefahr in den verlassenen Parks Johannesburgs dar, denn sie scheuen sich nicht davor, mit allen Mitteln die mitgebrachten Snacks der wenigen Besucher zu ergattern.
Die beiden Frauen entfalten das Tuch in sicherer Distanz zu den Wasservögeln und packen ihre Esswaren aus. Wie immer haben sie viel zu viel dabei, sie schauen ihren Proviant an und sagen, dass sie niemals alles essen werden. Und dann, ein paar Stunden später, werden sie dennoch alles verputzt haben. Sie bleiben oft den ganzen Nachmittag im Park – diese Tage sind für beide die seltene Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen und alles vergessen zu können, was ihnen das Leben schwermacht.
Die Frau, die diesen Traum in ihrer Wohnung in einem wohlhabenden Stadtviertel im Süden Rio de Janeiros träumt, weiß, dass ihre Freundin damals etwas belastete, doch diese sprach nicht gerne über ihre Angelegenheiten. So fragt sie sie auch im Traum – wie damals im echten Leben – nicht danach, denn sie weiß, wenn Gerda nicht von selbst erzählt, wird sie auch auf Fragen keine Antwort geben.
Dennoch ist die Stimmung unbeschwert. Sie genießen beide das Beisammensein, das Miteinanderscherzen und Lästern.
In diesem wiederkehrenden Traum ereignet sich nie etwas, das die Idylle stört und das dazu führen könnte, sie aus dem Schlaf aufschrecken zu lassen. Tagsüber ist die Frau überzeugt: Wenn sie nicht irgendwann aufgeweckt würde durch den Wecker, den sie sich am Vorabend auf spätestens elf Uhr stellt, damit sie nicht den ganzen Tag verschläft, dann würde sie diesen Traum ewig weiter träumen, sie würde nie wieder aufwachen, und es würde daher nie etwas anderes als sie und Gerda und den verlassenen Park mit den Enten und Schwänen geben.
Doch diesen Morgen wird sie aus ihrem Schlaf geschreckt. Wodurch? Ihr Mann ist schon lange fort, sie hat so tief geschlafen, dass sie ihn nicht hat aufstehen hören. Sie schaut auf die Uhr. Es ist neun. Etwas ist anders heute, denkt sie, etwas ist merkwürdig. Dann erst spürt sie den Schmerz. Und dann weiß sie, was los ist, denn auch dies ist ein wiederkehrendes Phänomen, aber kein Traum, sondern Realität. Diesmal bleibt sie ruhig, die Panik, die sie die ersten beiden Male heimgesucht hat, macht sich nicht in ihr breit. Sie weiß nun schon, was zu tun ist.
Als es vorüber ist, kehrt sie zurück ins Schlafzimmer, wo sie lange auf dem Bett sitzen bleibt und die Schatten an der Wand ihr gegenüber anstarrt.
Einige Stunden später ruft sie vom Handy ihren Mann an. Von dem, was soeben passiert ist, sagt sie nichts. Sie sagt bloß: „Ich gehe nicht mit dir nach Kanada. Ich verlasse dich.“
Und zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt sie sich wieder ein kleines bisschen frei und glücklich.
Kapitel 1
Gerda, dachte ich, während ich darauf wartete, dass der Beamte die Begutachtung meines Passes abschloss und mit einem Stempel meine Einreise besiegelte. Ich starrte am Häuschen des gelangweilten, pedantisch arbeitenden Beamten vorbei an die Wand der Empfangshalle. An ihr hingen zwischen Plakaten, auf denen lachende Südafrikaner Touristen in Südafrika willkommen hießen, und Werbeplakaten für eine große Bank auch Flyer, die auf Menschenhandel aufmerksam machten und mit Notrufnummern für Betroffene versehen waren.
Gerda wie noch? Ich wusste es nicht. Sie hatte sich einfach als Gerda vorgestellt, mir ihren Nachnamen nie gesagt. Hatte sie ihn mir nicht sagen wollen? Es nicht für nötig gehalten? Oder hätte es an mir gelegen, danach zu fragen? Gerda, meine beste Freundin in den knapp zwei Jahren, die ich in Johannesburg verbracht hatte. Eine der zwei Frauen, denen ich mich hatte anvertrauen können, in deren Nähe ich mich wohl gefühlt hatte. Und dennoch wusste ich nicht einmal ihren Nachnamen. Wie sehr wünschte ich mir nun, da ich sie unbedingt finden wollte, dass ich sie einmal danach gefragt hätte – aber ich hatte viel zu spät erkannt, wie wichtig sie mir war.
Der Beamte händigte mir meinen nun mit einem Stempel versehenen Pass aus – „OR TAMBO INTERNATIONAL AIRPORT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ENTRY (816) 2010-08-03 VALID UNTIL 2010-11-01 CONDITIONS: HOLIDAY“ stand innerhalb des viereckigen Stempelabdrucks - und winkte mich durch. Ich lief durch die Empfangshalle, vorbei an wartenden Angehörigen und Freunden. Auf mich wartete niemand.
Sobald ich aus der Masse der ankommenden Passagiere heraustrat, begann ich zu frieren. Wie gut ich mich an diese Kälte erinnerte – sie war die intensivste Erinnerung an meine Zeit im südlichen Afrika.
Es ist kalt, als sie das erste Mal ihr neues Heim betreten, um sich davon zu überzeugen, dass ihnen das Grundstück, das der Makler ihnen über die halbe Erdkugel hinweg vermittelt hat, auch wirklich zusagt. Die Kälte kommt von außerhalb, aber auch von innerhalb des Hauses – die Kälte scheint von den Wänden des Hauses auszustrahlen.
„Kann man nicht die Heizung anschalten, damit es bis zum Einzugstermin schön warm ist?“, fragt die junge Ehefrau.
„Es gibt keine Heizung“, entgegnet der Makler mit einem bemüht humorvoll wirkenden Lächeln.
Sie ist perplex. Ein großer Garten mit Swimmingpool, ein Aufenthaltsraum mit Billardtisch, eine eingebaute Bar, aber keine Heizung.
„Man könnte natürlich“, fügt der Makler rasch hinzu, als er ihre entsetzte Miene sieht, „eine Heizung einbauen lassen. Oder Heizkörper kaufen.“
Auch beim Einzug ist es kalt. Weil sie selbst nur regungslos dasteht und die Männer beim Ausladen und Einrichten beobachtet. Während ihr Mann sie immer wieder fragt, wo sie dieses und jenes haben will, dringt die Kälte leicht in sie ein und füllt sie bald ganz und gar aus.
Simon, der sich zunächst vehement sträubte, zurückzukehren nach Südafrika, ist nun seltsamerweise in seinem Element. Schon bei der Landung am O.R. Thambo International Airport hatte seine Frau die Veränderung bemerkt – seine oftmals gespielte Selbstsicherheit war in echtes Selbstbewusstsein übergegangen. Er hat es geschafft, den Dämonen seiner Kindheit Herr zu werden.
Obwohl ich nie ein sonderlich enges Verhältnis zu Simons Eltern gehabt hatte, stattete ich ihnen dennoch schon an meinem zweiten Abend in Johannesburg einen Besuch ab. Sie hatten mich zum Essen eingeladen, und so saß ich, wie in alten Zeiten, an dem großen Esstisch aus schwerem Eichenholz. Das Gespräch wurde von Simons Mutter geleitet, als handle es sich um ein Business Meeting. Sie warf Anekdoten aus ihrem Leben und Neuigkeiten aus den Nachrichten in die Runde, um die Diskussion anzuregen. Sie stellte Fragen, wenn die Stille ihr zu viel wurde, und verlangte detaillierte Antworten.
Simon war ein Leben lang von Frauen umgeben gewesen, die mir unähnlicher nicht hätten sein können. Das hatte mir oft Sorgen bereitet: Simon, so meine Vermutung, hatte unbewusst eine Frau als Ehefrau gewählt, die alles repräsentierte, was seine Mutter – und Andrea – nicht waren. Seine Mutter: engagiert, kritisch, dominant. Andrea: hochintelligent, ehrgeizig, bei allen beliebt. Beide mussten ihm stets ein Gefühl der Minderwertigkeit gegeben haben. Als Konsequenz davon hatte er eine Frau geheiratet, die unscheinbar, zurückhaltend und anspruchslos war.
„Und was machst du in Johannesburg“, fragte Simons Mutter beim Hauptgang. Diese Frage hatte natürlich kommen müssen.
Und ich war auf sie vorbereitet. Selbstverständlich sagte ich ihnen nicht die Wahrheit – dass ich jene Person suchte, die mir so viel bedeutet hatte während meines letzten Aufenthaltes, ohne die die zwei schlimmen Jahre unerträglich gewesen wären. Stattdessen behauptete ich, das Fernweh hätte mich gepackt, und ich wollte noch einmal Freiheit schnuppern, bevor ich zurückkehrte nach Europa in einen eintönigen Bürojob, den ich mir hatte suchen müssen, nun, da ich nicht mehr mit Simon zusammen war.
„Ich habe bereits einen Vertrag für eine neue Stelle unterschrieben, mit der ich anfangen werde, sobald ich zurückkehre“, antwortete ich auf die Frage, wie ich mir meine Zukunft vorstellte, wenn ich wieder in der Schweiz war. Dies war eine unverblümte Lüge, in Wahrheit hatte ich noch keinen Schimmer, was ich mit mir anfangen würde, noch nicht einmal der Zeitpunkt der Rückreise stand fest.
Das Abendessen endete früh. Als leidenschaftliche und gesundheitsbewusste Sportler gingen Simons Eltern früh schlafen, standen sie früh auf, und aßen sie abends wenig und zu früher Stunde. Ich, die Unsportliche, die gerne und viel aß und wohl nur dank ihrer guten Gene nicht dick geworden war, ging auch heute noch etwas hungrig nach Hause. Im Hotel machte ich mich dann über ein Päckchen Erdnüsse her, das ich in der Minibar fand, und trank dazu ein Bier. Das Abendessen ließ mich in beklemmter Stimmung zurück, wie das immer der Fall gewesen war nach einem Treffen mit Simons Eltern. Noch heute tat Simon mir ein bisschen leid, trotz aller Gleichgültigkeit, die ich ihm gegenüber in den letzten freudlosen Jahren unserer Ehe entwickelt hatte, denn mit diesen Eltern aufzuwachsen, war ein 18 Jahre währender Albtraum gewesen. Dies hatte er mir des Öfteren in unseren anfänglich sehr vertrauten Gesprächen gestanden. Die dunkle Seite seiner Mutter, die mir und allen anderen Leuten größtenteils verborgen blieb, war in seiner Kindheit Simons stetiger Begleiter gewesen: Er war seinem Grossvater, ihrem verhassten Vater, ähnlich, was sie ihm nicht verzeihen konnte. Und was lag näher, als ihre Frustration über dieses zwar gewollte, aber ungeliebte Kind, an dem Kind selbst auszulassen. Simons Vater hatte ihm keine Zuflucht vor den Attacken seiner Mutter geboten, er war zu beschäftigt gewesen mit seiner Arbeit und den vielen Sportarten, denen er mit Leib und Seele nachging. Kein Wunder, dass aus Simon schon in jungen Jahren ein Mensch geworden war, der in jeder Hinsicht seinen Eltern widersprach: Wie ich aß er viel und ungesund, trieb wenig Sport und trank zu viel. Zudem – und hier unterschieden wir uns – stürzte er sich in das Nachtleben jeder Stadt, in der er wohnte. Während sich seine Essgewohnheiten mit der Zeit gebessert hatten und er sogar angefangen hatte, Sport zu treiben, war er vom Alkohol und Nachtleben nie losgekommen – auch während unserer Ehe nicht. Doch genau diese Angewohnheiten, die andere Ehefrauen wohl bemängelt hätten, waren jene, die mich auch am Ende unserer Beziehung am wenigsten abgestoßen hatten. Was mich an Simon gestört hatte, waren jene Eigenschaften, die ihn trotz all seines Widerstandes seinen Eltern gleichen ließen: Er hatte sich mit derselben Leidenschaft in seine Karriere gestürzt, mit der seine Mutter sich ihren sozialen Aktivitäten und beide seiner Eltern sich dem Sport und dem gesunden Leben verschrieben hatten, und er betrachtete sich als den Nukleus eines Universums, das aus seiner Arbeit, seiner Beziehung und seinem sozialen Umfeld bestand. Und selbstverständlich gab es außerhalb dieses Universums nichts, was von Bedeutung war. Wie seine Mutter redete Simon gerne, doch im Gegensatz zu ihr nicht über die sozialen Probleme im Land, sondern vor allem über sich selbst. Simon war ständig von Leuten umgeben, die diese elende Schwatzhaftigkeit teilten, und wenn sie in der sozialen Hierarchie über ihm standen, war es an ihm, ihnen zuzuhören, und nicht umgekehrt. Weil er sich also in gewissen Situationen zurückhalten musste, hatte er dies nie zu Hause getan, bei mir, wo er sich endlich seinem Rededrang hingeben konnte. Es war wohl unter anderem aus diesem Grund, dass Simon und seine Mutter ständig aneinandergerieten, denn jedes Mal, wenn sie aufeinandertrafen, ging es darum, wer das Gespräch dominieren durfte. Ein Kampf, den Simons Mutter ausnahmslos gewann, denn sie hatte mehr Macht in der Familie und mehr Ausdauer als Simon. Simons Mutter war keine Frau, die verlieren konnte.
Der kleine Junge, der sich einst aus Angst vor seiner wütenden Mutter unter der Bettdecke versteckt hat, ist heute ein erwachsener Mann, ein bedeutender Mann. Jung und naiv hat er angefangen in einer globalen Firma, doch sein Engagement und sein Ehrgeiz, seine Ideen und seine Verhandlungssicherheit haben bei denen ganz oben Beachtung gefunden, und bald ist er in dem großen Unternehmen aufgestiegen. Heute ist er auf der ganzen Welt unterwegs. Überall, wo es wichtige Rohstoffe gibt, ist er zu finden. Es läuft gut, es läuft besser, als er es sich je hat träumen lassen. An seiner Seite ist eine hübsche Frau, deren einzige Makel sind, dass sie zu viel grübelt und stets danach strebt, sich selbst zu verwirklichen, und es dennoch nie tut. Dabei bietet er ihr alles – es fehlt ihr weder an Geld, noch an Zeit, noch an seiner vollen Unterstützung für sie. Manchmal ertappt er sich bei dem Wunsch, dass sie mehr wie Andrea wäre: ehrgeizig, selbstsicher, dennoch warm und liebenswürdig. Aber was macht er sich vor: Eine Frau wie Andrea gibt es kein zweites Mal, und seine zweite Wahl hätte viel schlimmer ausfallen können. Und er liebt es dennoch, dieses seltsame Wesen, das ihm das Leben oft so schwermacht.
Am nächsten Tag stand ich früh auf. Hunger und Tatendrang trieben mich aus dem Hotelbett und in den Frühstückssaal. Nach einem reichhaltigen Frühstück machte ich mich auf den Weg nach Rosebanki. Ich war mir der schieren Unmöglichkeit bewusst, Gerda zu finden. Mein einziger Anhaltspunkt war, dass sie in Soweto wohnte – zumindest in den Jahren, als ich in Johannesburg gelebt hatte. Ich war nicht naiv genug zu glauben, ich hätte eine Chance, sie in dem riesigen Township aufzuspüren ohne fremde Hilfe. So war mein erster Schritt, mich an ein Tourismusbüro zu wenden, das Touren durch Soweto anbot. Ich hoffte, man könnte mir jemanden vermitteln, der mich auf meiner Suche in dem riesigen Township begleiten und mir über sprachliche und kulturelle Barrieren hinweghelfen würde.
Das erste Büro war jedoch nicht geneigt, mir etwas anderes als die von ihnen organisierte Bustour anzubieten, obwohl ich mehrmals erklärte, dass ich keine Absicht hatte, das Haus von Nelson Mandela, das Apartheidmuseum oder andere Attraktionen zu besichtigen.
Ich klapperte drei weitere Tourismusbüros ab, mit dem gleichen Resultat, bevor ich beschloss, meinen Plan B anzuwenden. Ich begab mich zu einem Arbeitsvermittlungsbüro, das ich mir wie die Touristenbüros im Voraus im Internet herausgesucht hatte. Ich reichte dem dort arbeitenden Herrn meine Visitenkarte, die ich extra für solche Zwecke angefertigt hatte, und erklärte ihm, dass ich Verstärkung für mein Team benötigte: einen guten Fahrer, der sich insbesondere in Soweto gut auskannte, redegewandt, mit Schulabschluss.
Ich schloss mit den Worten: „Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Diskretion stehen an oberster Stelle.“
Der Mann hatte sich alles sorgfältig notiert und betrachtete nochmals meine Visitenkarte, auf der mein Name stand sowie „Privatdetektivin, Shepherd Street, Bryanston“. An dieser Straße hatten wir tatsächlich einst gewohnt. Ich hatte absichtlich diese Adresse verwendet, weil ich hoffte, sie würde Eindruck machen. Die Idee, mich als Privatdetektivin auszugeben, war mir kurz vor meinem Abflug gekommen, als ich eine Verfilmung von Agatha Christies „Tod auf dem Nil“ geschaut hatte. Warum sich nicht als Privatdetektivin ausgeben in einem Land, in dem einen so gut wie niemand kannte? Vor allem aber gab es mir die Legitimität, einer Person nachzustellen, ohne auf allzu großen Argwohn zu stoßen, da ich dies als rein professionellen Auftrag ausgeben konnte. Ich hatte keine Zweifel, dass man mir schnell jemanden vermitteln würde.
Kurz nach zwölf machte ich mich auf den Weg zurück ins Hotel. Doch kaum hatte ich das Auto erreicht, meldete sich mein Magen, darum beschloss ich, in einem der vielen Cafés in Rosebank zu Mittag zu essen. Ich bestellte ein getoastetes Sandwich mit Salat und einen Cappuccino, der prompt begleitet von einem großen Glas Wasser kam, und blickte auf das rege Treiben der Menschen, während ich den Milchschaum löffelte und über meine nächsten Schritte nachdachte.
Hier, in diesem Café in Rosebank, bemerkte ich zum ersten Mal die Veränderung, die Südafrika seit meinem Aufenthalt in den Jahren 2006 bis 2008 durchgemacht hatte. Um mich herum saßen Schwarze, Colouredsii, Inder und auch Weiße, doch Menschen dunkler Hautfarbe dominierten das Bild. Leicht erkennbar an ihrer religiösen Kleidung waren Hindus, Muslime, Juden. Junge Mädchen mit Kopftüchern liefern kichernd an mir vorbei, eine Gruppe älterer Frauen in farbigen Saris diskutierte lauthals in einer mir unverständlichen Sprache, junge Männer mit Kippas auf dem Kopf unterhielten sich angeregt am Tisch neben mir.
Natürlich hatte ich auch schon bei meinem letzten Aufenthalt Menschen aller Hautfarben und Religionen in einstmals den Weißen vorbehaltenen Gegenden gesehen – doch waren es so viele gewesen? Ich war nun mit den anderen Weißen deutlich in der Minderheit.
Mein Herz war plötzlich – vielleicht zum ersten Mal – voller Freude und Hoffnung für dieses Land. Ich musste mir größte Mühe geben, die Leute nicht anzustarren, so sehr faszinierte mich das Geschehen um mich herum. Um mich abzulenken, holte ich ein Notizbuch heraus und beschloss, meine Gedanken wieder Gerda zu widmen.
Als Nächstes würde ich zum Checkersiii in Crestaiv fahren, obwohl ich mir wenig Hoffnung machte, dass man mir dort weiterhelfen konnte. Gerda hatte sehr unregelmäßig dort gearbeitet, sie war lediglich für die ganz geschäftigen Zeiten eingestellt worden; sie hatte einen Vertrag auf Abruf gehabt. Gerda hatte trotz eines Stipendiums arbeiten müssen, da es ihre Lebenshaltungskosten nicht gedeckt hatte. Während sie bei mir angestellt gewesen war, hatte sie den Großteil ihres zusätzlichen Einkommens von mir bekommen. Ich hatte sie immer wieder gedrängt, weniger Zeit in ihren anderen Nebenjob zu investieren und sich dafür auf ihr Studium zu konzentrieren; in meiner Besessenheit war ich so weit gegangen, ihr anzubieten, sie für die Stunden, die sie nicht bei Checkers arbeitete, zu bezahlen.
Ob Gerda ihr Studium beendet hat? Ich hatte keine Ahnung. Schon damals hatte ich sie im Grunde kaum gekannt, und natürlich wusste ich heute nicht mehr über sie.
Warum hatte ich mir nicht die Mühe gemacht, alles, absolut alles über sie zu erfahren, bevor ich Johannesburg verlassen hatte, um sicherzustellen, dass der Kontakt nie abbrechen würde? Die Antwort war simpel: Ich hatte bewusst alle Stricke durchtrennt, die mich an diesen Ort banden. Ich hatte geglaubt, ich könnte nach meiner Abreise mein Leben neu aufbauen und wieder glücklich werden.
Ich hatte es nicht geschafft und darum saß ich nun hier, in diesem Café in Rosebank, mit einem Stapel gefälschter Visitenkarten in der Tasche.
Gerda fängt nur wenige Tage später bei dem Paar, das aus Übersee hergezogen ist, zu arbeiten an. Die junge Schweizerin hat eigentlich nicht vorgehabt, jemanden einzustellen. Früher benötigte sie nie Hilfe im Haushalt, auch nicht, als sie selbst Vollzeit arbeitete. Warum soll sie nun jemanden anstellen, wo sie noch nicht einmal eine Stelle in Aussicht hat, und sie bereits einen Gärtner hat, der einmal in der Woche kommt. Die Tage ziehen sich schon so in die Länge. Wenn sie nicht einmal mehr putzen, waschen und kochen muss, was bleibt ihr dann noch? Doch unter den Hausangestellten in der Nachbarschaft verbreitete es sich schnell, dass die Neuen noch keine Haushaltshilfe haben. Und so klingelt es täglich, oft mehrmals täglich, an ihrer Haustüre; die arbeitslosen Verwandten und Bekannten der Informantinnen bitten sie um Arbeit.
„Du kannst doch nicht immer ‚nein‘sagen“, meint Simon eines Tages, „diese Frauen wollen Arbeit.“
„Aber ich brauche niemanden.“
„Darum geht es nicht.“
„Worum geht es dann?“
Darauf antwortet er nicht.
„Na gut“, meint sie. „Die Nächste, die klingelt, stelle ich ein.“
Die Nächste, die klingelt, ist Gerda.
Sie führt kein Einstellungsgespräch mit ihr, fragt sie nichts Persönliches. Gerda klingelt, sagt ihren Vornamen, fragt nach Arbeit, und die Frau antwortet: „Du kannst zweimal in der Woche kommen.“
Ihre andere Haushaltshilfe, die ihr schon vor der Ankunft vermittelt wurde, und die auf ein höheres Pensum hofft, wird es ihr übelnehmen.
„Zweimal nur, Madam? Nicht mehr?“, fragt Gerda in tadellosem Englisch.
Eigentlich wollte sie nicht einmal „zweimal die Woche“ sagen, sondern nur: „einmal die Woche“.
„Zweimal“, wiederholt sie. „Öfter brauche ich dich einfach nicht.“
Gerda ist nicht zufrieden mit dem Angebot, drängt aber nicht weiter. Stattdessen macht sie sich sofort an die Arbeit.
Die junge Ausländerin ist darüber so verwirrt, dass sie es einfach geschehen lässt. Um nicht im Weg zu sein, begibt sie sich in ihr Schlafzimmer, wo sie den Rest des Tages verbringt, die Schatten an der Wand beobachtend. Seit ihrer Kindheit tut sie dies; es beruhigt sie wie keine andere Beschäftigung. Gerda meldet gegen vier Uhr nachmittags, sie sei fertig. In dieser Zeit hat sie alles, absolut alles, geputzt und aufgeräumt, was man nur in einem erst halb eingerichteten Haus putzen und aufräumen kann. Von da an hat ihre Arbeitgeberin noch mehr Zeit zum Nichtstun.
Simon hingegen arbeitet so viel wie noch nie in seinem Leben.
Ich bezahlte die Rechnung, gab ein großzügiges Trinkgeld und verließ das Café. Auf dem Weg zum Auto schlenderte ich durch die Massen und beobachtete weiterhin fasziniert die Leute um mich herum. Ich sah viele Männer, die mich an Simon erinnerten: Weiße in dunklen Anzügen, laut und selbstbewusst miteinander diskutierend und in schnellen Schritten durch die Menge gehend. Sie mussten in Eile sein, zurückkehren zu ihren Jobs, die es ihnen erlaubten, sich teure Anzüge zu kaufen. Ehrgeizige Männer am Anfang ihrer Karriere. Rückblickend realisierte ich: Simons Arbeitswut damals war seine Art und Weise gewesen, mit dem Umzug fertigzuwerden und sich selbst zu beweisen. Seinerzeit empfand ich es als das erste Anzeichen der Entfremdung, die letztendlich zur Trennung geführt hatte.
Für unsere Trennung gab es natürlich noch viele andere Gründe. Unter anderem, dass Simon sich immer das perfekte Familienleben gewünscht hatte mit mindestens zwei Kindern, die er am Abend, nach einem langen Tag bei der Arbeit, ins Bett stecken konnte. Mit der Zeit war dieses Thema zum Tabu geworden und hatte ihn vermutlich in seine lächerliche Affäre getrieben. Als ich davon erfahren hatte, war er mir aber schon so gleichgültig gewesen, dass ich mich geradezu über sie freute. Sie hatte mir erlaubt, mit dem Finger auf ihn zu zeigen, anstatt die Schuld bei mir selbst suchen zu müssen. Die Entscheidung, ihn zu verlassen, hatte auch nichts mit dieser Affäre zu tun, sondern einzig mit mir selbst: Ich wollte meine Vergangenheit aufarbeiten und mit mir selbst ins Reine kommen.
So war ich also, anstatt ihm noch einmal zu folgen, nach Johannesburg gegangen, um Gerda zu suchen.
Kapitel 2
Am nächsten Tag erschienen nacheinander drei vom Arbeitsbüro vermittelte Herren im Hotel, um sich vorzustellen. Alle waren sie übereifrig und erklärten wortreich, dass sie sich in Soweto bestens auskannten und daher sehr geeignet für die Aufgabe waren, die ich ihnen bot. Einer behauptete, schon einmal für einen Privatdetektiv gearbeitet zu haben, Referenzen besaß er allerdings keine.
Die Art der drei Herren, mich beeindrucken zu wollen, ging mir gleich auf die Nerven. Ich wünschte, eine Frau hätte sich gemeldet, obwohl mir klar war: Für diese Aufgabe war ein Mann viel geeigneter. Ich brauchte nicht nur jemanden, der sich in Soweto auskannte, sondern auch einen Beschützer. Ich brauchte jemanden, der mir die Männer vom Leibe halten konnte, und dafür kam nun mal nur ein Mann selbst in Frage.
Ich war bei Männern stets etwas auf der Hut. Ich misstraute ihnen von Grund auf und hatte sie oft im Verdacht, mich nicht ernst zu nehmen. Anders als Andrea, neben Gerda eine meiner wenigen Freundinnen in Johannesburg, war ich nicht selbstbewusst, und es wäre mir nie in den Sinn gekommen, mich in eine Sphäre zu drängen, die von Männern dominiert wird. Andrea, die zur Chefökonomin einer der größten und einflussreichsten Firmen Südafrikas aufgestiegen war, kannte diese Probleme nicht.
Die drei Herren schüchterten mich also trotz ihres lächerlichen Gehabes ein, was mich zutiefst verärgerte. Ich versprach, mich bei ihnen zu melden, wohl wissend, dass ich das nicht tun würde. Ich brauchte eine andere Lösung. Und wie so oft in der Vergangenheit, hielt Andrea diese für mich bereit.
Die Sonne scheint, und es weht ein leichter Wind, als er zum ersten Mal nach Kapstadt kommt. Dank der leichten Brise ist die Hitze erträglich und der Smog über der Stadt sehr gering, wodurch ihm ein atemberaubender erster Anblick auf den Tafelberg gewährt wird. Hier werde ich glücklich werden, beschließt der junge Mann, der eigentlich noch ein Teenager ist. Er ist mit hohen Erwartungen hierhergekommen und mit dem Ziel, der Enge zu entfliehen, die in einer europäischen Stadt, in der die Wohnungen klein und die Straßen verstopft sind, entsteht, sowie einer Familie, die mit vier Kindern gesegnet wurde. Seine Familie hier, sie hat ein riesiges Haus, er wird ein eigenes Zimmer haben, und nach der Schule im Pool baden können. Er freut sich auf diese Freiheiten, und er freut sich darauf, ein Jahr nichts für die Schule tun zu müssen, ohne von seinen Eltern ermahnt zu werden. Das Leben ist ausnahmsweise ganz auf Stephans Seite.
Stephan lernt kurz darauf eine bezaubernde Studentin kennen, verliebt sich so sehr in sie, wie er sich bereits in ihr Land verliebt hat, und kehrt schon nach wenigen Jahren zurück nach Südafrika, um einen Job zu suchen und um die Hand seiner Prinzessin anzuhalten. Und zerschlägt damit Simons Chancen auf eine Ehe mit seiner besten Freundin für immer.
Andrea, die ich an diesem Abend besuchte, wohnte inzwischen in einem reichen Vorort in einem Haus, wie ich es von einer Chefökonomin eines bedeutenden Unternehmens in diesem Land erwartet hatte: ein imposantes Gebäude mit eleganten Verzierungen und einem riesigen Garten, versteckt hinter einem hohen Zaun und dichten Büschen. Lukas, der Pförtner, konnte sich von meinen früheren Besuchen im alten Haus noch an mich erinnern und ließ mich ein. Ich fuhr vor die Haustüre und sprang aus dem Auto. Von der anderen Seite des Hauses hörte ich Andreas Hunde, zwei reizende, wunderschöne Labradorhunde, freudig bellen. Für einen Moment bildete ich mir ein, auch sie würden mich nach der langen Zeit wiedererkennen, aber das war natürlich Unsinn; bestimmt bellten sie bei jedem Besucher so freudig.
Andrea öffnete sogleich die Türe. Sie war durch das Gebell der Hunde und den Pförtner über mein Kommen informiert worden. Sie nahm mich in den Arm, drückte mich fest an sich und küsste mich.
Ich kannte Andrea nur als herzliche, warme Person, vermutete jedoch: Bei der Arbeit in ihrer Rolle der Chefökonomin war sie eine ganz andere.
Keine zehn Sekunden später stürmten Andreas zwei Kinder aus dem Haus und umarmten mich ebenfalls. Oft hatte ich auf sie aufgepasst, als ich in Johannesburg gewohnt hatte, obwohl dies nicht nötig gewesen wäre, weil Andrea genug Aufpasser für die Kinder hatte. Dennoch war sie froh darüber gewesen, denn die beiden hingen sehr an mir und hatten mich, immer nur mich als Babysitterin gewollt.
Ich schaffte es kaum, meine Tränen zu verbergen, als ich die beiden in den Arm nahm. Wie ihre Mutter waren sie offen und herzlich, sie scheuten keinen Körperkontakt, nicht einmal Sebastian, der mit seinen knapp zwölf Jahren fast schon ein Teenager war. Die Wärme ihrer vom Spielen erhitzten Körper und die aufrichtige Freude auf ihren Gesichtern waren genau das, was ich nach den langen Monaten der Einsamkeit nötig hatte. Ich hatte lange Zeit keinen Menschen mehr in den Armen gehalten.
Wir aßen gemeinsam zu Abend. Und wie anders als gestern verlief diese Mahlzeit! Die Kinder redeten viel und meist durcheinander. Andreas Ehemann, der ebenfalls ein sehr geselliger Mensch war, unterhielt sich angeregt mit seiner Frau, während die Kinder mich in Beschlag nahmen. Um neun Uhr schickten die Eltern sie ins Bett und bestanden trotz heftiger Proteste darauf, dass sie sich zurückzogen. Andrea wollte ohne die Unterbrechungen ihrer Sprösslinge mit mir sprechen. Und weil ihre Zeit spärlich war, war sie auf eine strikte Einhaltung ihres Zeitplans angewiesen. Stephan brachte Jasmine zu Bett und verfrachtete Sebastian, der behauptete, mit seinen elf Jahren wirklich zu alt zu sein, um schon um neun ins Bett zu gehen, vor den Fernseher, wo er ihm noch eine halbe Stunde gewährte. Stephan selbst zog sich mit der Ausrede zurück, noch einiges an Papierkram erledigen zu müssen.
So waren Andrea und ich schließlich alleine. Wie gut es mir tat, in ihrer Nähe zu sein, ihre Wärme zu spüren und die Wärme, die das ganze Heim und die Familie ausstrahlten. Das Haus der Familie Wolff war zwar luxuriös, aber nicht pompös und eingerichtet mit viel Charme. Trotz Personals herrschte eine kleine Unordnung, was davon zeugte, dass in diesem Haus mit viel Freude und Energie gelebt wurde.
„Wie geht es dir?“, fragte Andrea, und ich wusste, dass dies keine Floskel war. Andrea benutzte keine Floskeln: Wenn sie mich fragte, wie es mir ging, wollte sie dies wahrheitsgetreu wissen.
„Mir macht einiges zu schaffen“, gab ich zu. „Nicht so sehr die Trennung von Simon, sondern die Tatsache, dass ich zurückgekehrt bin in ein Land, das ich vor über zwei Jahren verlassen und in dem ich damals keinen Anschluss an das soziale und berufliche Leben gefunden habe.“
„Warum bist du dann zurückgekommen?“
„Wir sind überstürzt abgereist damals… Ich wollte nur noch weg von hier, weil es mir so schlecht ging. Nun bin ich zurückgekommen, um mit allem abzuschließen.“
„Womit abschließen? Was bezweckst du damit, hierher zu kommen? Warum glaubst du, dir würde es besser gehen, wenn du den Ort besuchst, an dem du so unglücklich warst?“
„Ich stelle mich meinen Dämonen.“
„Du wirst ihnen hier nicht auf offener Straße begegnen. Sie sind in dir und begleiten dich somit überall hin.“
Natürlich hatte Andrea Recht. Und trotzdem hatte ich herkommen müssen. Ich hatte herkommen müssen, um Gerda zu finden. Es war Gerda, nach der ich mich sehnte, und die mir helfen würde, mich meinen Dämonen zu stellen. Doch dies würde ich nicht einmal Andrea gestehen. Zu groß war meine Scham über das Leben, das ich einst geführt hatte. Andrea gegenüber hatte ich damals verheimlicht, wie schlecht es mir gegangen war – ich hatte mich am absoluten Tiefpunkt meines Lebens befunden und alles, was ich gehabt hatte damals, war ihre und Gerdas Freundschaft gewesen. Gerda, die ich ehrlicherweise nicht mal als Freundin bezeichnen konnte – meine Schwermut hatte es mir nicht erlaubt, dass wir uns wirklich nahekamen.
Noch größer als meine Scham über mein damaliges Leben aber war meine Reue darüber, dass ich zu spät erkannte hatte, wie viel mir Gerda bedeutet hatte. In einer idealen Welt hätte ich es nie so weit kommen lassen, dass ich sie nun suchen musste.
Kapitel 3
Am nächsten Tag fiel mir das Aufstehen schwer. Wie früher, wenn ich bei Andrea und ihrer Familie gewesen war, fühlte ich mich so geborgen wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Danach wieder alleine zu sein, war, wie aus dem warmen, gemütlichen Chalet, das ich von den Winterferien in meiner Heimat kannte, in die eiskalte Nachtluft hinauszutreten. Ich wollte den Schlaf verlängern und weiter die Geborgenheit des gestrigen Abends spüren.
Aber schlussendlich trieben mich die Gedanken an Gerda doch aus dem Bett. Gerda, wo bist du, und wie werde ich dich jemals finden?
Immerhin hatte ich gestern Abend ein Problem gelöst: Ich hatte einen Begleiter für meine Mission gefunden. Andreas Pförtner hatte einen Bruder, der gerade arbeitslos war und sich der Aufgabe mit Freude annehmen würde. Ich kannte ihn nicht, doch das spielte keine Rolle. Nicht in erster Linie seine Anstellung, sondern die feste Anstellung seines Bruders hing nun von seinem tadellosen Verhalten mir gegenüber ab; das war eine bessere Voraussetzung als jedes Einstellungsgespräch.
Fred, so hieß Lukas‘ Bruder, hatte versprochen, um zehn Uhr in der Hotellobby auf mich zu warten. Dies gab mir Zeit, in Ruhe zu frühstücken, mich von meinem kleinen Kater zu erholen und mir auszurechnen, wie lange ich es mir noch würde leisten können, in diesem komfortablen 4-Sterne-Hotel zu wohnen. Ich kam zum Schluss: nicht sehr lange. Je früher ich also eine andere Unterkunft fand, desto besser.
Pünktlich um zehn Uhr stand Fred in der Lobby. Lukas hatte ihn gestern trotz später Stunde noch angerufen und ihn gebeten, sich heute bei mir vorzustellen. Ich nahm ihn mit in eines der vom Hotel bereitgestellten Sitzungszimmer, um ihm seinen Auftrag zu erklären.
Andrea hatte ich nicht offenbart, wozu ich Freds Dienste benötigte, und sie war diskret genug gewesen, nicht nachzufragen. Da ich nicht nur ihre Freundin, sondern auch die Frau ihres besten Freundes war, hatte es in der Vergangenheit häufig Situationen gegeben, in denen wir einander nicht alles mitgeteilt hatten. Es war ein ungeschriebenes Gesetz zwischen uns, dass wir uns nicht auf Dinge ansprachen, die die andere nicht von sich aus offenlegte. Fred hingegen erklärte ich, während ich ihm meine Visitenkarte hinhielt:
„Ich möchte eine junge Frau namens Gerda finden, und ich bin auf deine Diskretion angewiesen – auch und ganz besonders gegenüber Andrea und Lukas.“
Ich wusste nicht, ob ich ihm in dieser Hinsicht vertrauen konnte, aber da ich keine Wahl hatte, beschloss ich, mir darüber zunächst keine Gedanken zu machen.
Vertrauen hin oder her – ich schien mit Fred echt Glück zu haben. Er wirkte kompetent, war höflich und zurückhaltend, und der Gedanke, für eine Privatdetektivin zu arbeiten, schien ihn zu begeistern.
Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, erklärte ich ihm, dass wir nun als Erstes zum Checkers in Cresta, ein Einkaufszentrum im gleichnamigen Stadtteil im Norden Johannesburgs, fahren würden.
„Sprich dort mit den Angestellten. Sag ihnen, dass du nach Gerda suchst. Sie hat vor über zwei Jahren dort gearbeitet. Hier ist ein Foto von ihr, das du ihnen zeigen kannst. Ich kenne ihren Nachnamen nicht, und wenn du einfach nach Gerda fragst, bist du vermutlich nicht sehr erfolgreich. Sage ihnen, du bist ihr Onkel – oder was auch immer –, und versuche, etwas, egal was, über Gerda zu erfahren. Danach fahren wir nach Soweto.“
Ich sagte bewusst „wir“, um ihm zu signalisieren: Von jetzt an waren wir ein Team.
Wir fuhren also nach Cresta. Ich hatte Fred gerne das Steuer überlassen und saß auf dem Beifahrersitz. Die Konversation verlief sehr entspannt, obwohl wir uns noch keine zwei Stunden kannten. Ich fühlte, wie meine anfängliche Anspannung wich, ich fühlte mich geborgen.
Im Einkaufszentrum Cresta ging ich einen Kaffee trinken, während Fred ins Checkers loszog. Es war besser, man sah uns nicht zusammen, während er seine Nachforschungen anstellte; ich hatte Angst, es könnte die Leute im Laden misstrauisch machen. Ich schlürfte einen Cappuccino und las ein Wirtschaftsmagazin, bekam aber wenig mit von den Artikeln, die ich überflog; meine Gedanken waren bei Fred und seinen Ermittlungen.
Nach knapp einer Stunde kam er zurück. Ich lud ihn zu einem Kaffee ein, doch er lehnte ab. Ich insistierte nicht, da ich merkte, dass er sich unwohl fühlte in diesem schicken Café, in dem vor allem weiße, gutbetuchte Frauen mittleren Alters saßen und wie ich an ihren Cappuccinos nippten. Darum gab ich vor, hungrig zu sein, und wir gingen zusammen in einen KFC. Dort ließ er sich gerne einladen. Wir aßen einen Hähnchen-Burger, während er mir von seinen Nachforschungen erzählte.
„Ich habe versucht, mit möglichst vielen Angestellten vom Checkers zu sprechen“, erzählte er mir. „Doch es war sehr schwierig, weil diese während der Arbeitszeit nicht einfach Pause machen dürfen, um zu schwatzen. Ich habe mich als Kunde ausgegeben,“ – an dieser Stelle lächelte er verschmitzt – „damit die Gespräche wie Konversationen zwischen Angestellten und einem Kunden, der Beratung benötigt, aussehen. Um ihnen keinen Ärger zu bereiten.“
Ich nickte anerkennend. Fred schien ideal für diese Art von Aufgabe zu sein.
„Von den wenigen Leuten, mit denen ich sprechen konnte, hat sich nur eine Dame an Gerda erinnert. Sie arbeitet schon seit sieben Jahren dort und hat Gerda als ein schüchternes, freundliches Mädchen in Erinnerung, das stets pünktlich und fleißig, aber sehr verschlossen gewesen ist. Sie hat sich nicht viel mit dem andern Personal abgegeben.“
Ich nickte. Das hörte sich in der Tat stark nach Gerda an.
„Sie hat sich den anderen überlegen gefühlt, hat die Dame gesagt, weil dieser Job nicht ihr Beruf war, sondern ein Mittel, ihr Studium zu finanzieren. Sie hat auch nie viel von sich erzählt, ist etwas arrogant gewesen.“
„Und hat sie gewusst, wie Gerda mit Nachnamen heißt?“, fragte ich.
An dieser Stelle druckste Fred etwas herum und spielte verlegen mit den Pommes in seinen Fingern. „Ich konnte die Leute doch nicht nach Gerdas Nachnamen fragen“, sagte er schließlich, „weil ich vorgab, ihr Onkel zu sein.“
Das konnte ich ihm natürlich nicht übelnehmen, schließlich hatte ich ihm dies vorgeschlagen. „Hast du sonst etwas über sie in Erfahrung gebracht?“
Freds Gesicht hellte sich auf. „Ja, sie wohnt – oder wohnte damals – in Protea Glen.“
Diese Information schränkte unsere Suche schon mal erheblich ein. Ich holte meinen Laptop hervor und schaute auf der Karte nach. Protea Glen lag im Südwesten Sowetos, dies stimmte mit meiner Erinnerung überein, denn Gerda hatte immer vom Südwesten gesprochen. Das riesige Soweto war nun auf einen mittelständischen Teil des Townships geschrumpft.
„Dann fahren wir nun dorthin“, entschied ich. Ich blickte auf die Uhr, es war kurz nach zwei. Noch etwa vier Stunden würde es hell sein, in spätestens eineinhalb Stunden würden wir in Soweto sein. Das gab uns genug Zeit für eine erste Nachforschung.
Fred selbst wohnte in Vereenegingv mit seiner Frau und seinen drei Kindern, hatte aber Verwandte in Soweto und sagte, er kenne sich gut genug aus, um den Weg ohne Wegbeschreibung zu finden.
Wir begaben uns zurück auf die N1, die in der kurzen Zeit noch belebter geworden war. In Kürze würde es kein Durchkommen mehr geben. Sollten wir erst nach der Rush Hour zurückfahren, auch wenn das bedeutete, bis Einbruch der Dunkelheit in Soweto bleiben zu müssen? Ich war der festen Überzeugung, dass die emotionalen Schäden verstopfter Straßen und stundenlanger Staus allgemein unterschätzt wurden. Für den Fall, dass wir im Stau steckenbleiben würden, hatte ich uns zuvor noch rasch zwei Packungen Simba Chips und zwei Flaschen Appletiservi gekauft.
Während der Fahrt starrte ich gedankenverloren aus dem Fenster. Die Shacksvii entlang des Highways, deren Anblick mich gegen Ende meines letzten Aufenthaltes in dieser Stadt nicht mehr bedrückt hatte, weil ich mich an ihn gewöhnt hatte, stimmten mich traurig, wie vor vier Jahren, als ich zum ersten Mal nach Johannesburg gekommen war. Damals hatte sich die Traurigkeit wie eine Decke auf mich gelegt und mich zu ersticken gedroht.
„Wir sind fast da“, kündigte mein Begleiter nach knapp einer Stunde an. Wir bogen vom Highway ab und fuhren mitten in ein Labyrinth von Shacks.
„Wie lange dauert es noch, bis wir in Protea Glen sind“, fragte ich. Ich wollte weg von den bedrückenden Shacks, normale Häuser sehen.
„Nicht weit, nur ein paar Minuten. Wo soll ich dich rauslassen, Madam?“
Eigentlich hatte ich mich einfach etwas umsehen wollen, um die Eindrücke der Gegend, in der Gerda angeblich gewohnt hatte, in mir aufzunehmen. Doch wo genau ich aus dem Auto steigen wollte, hatte ich mir nicht überlegt. Was war ich doch für eine schlechte Detektivin.
„Was meinst du, wo wir aussteigen sollen?“, fragte ich, mit starker Betonung auf das Du, um ihn wissen zu lassen, dass ich ihn in meine Entscheidungen integrierte. Ich stellte ihm diese Frage, wohl wissend, dass ich keine Antwort erwarten durfte.
Doch überraschenderweise hatte er eine für mich: „Fang doch in einer Kirche an. Jeder geht in die Kirche. In einer der Kirchen wird man sie sicher kennen.“
„Wie viele Kirchen gibt es in Protea Glen und Umgebung?“
Fred schüttelte den Kopf, er wusste es nicht. Es mussten Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte sein. Ich war bereits dabei, in Missmut zu versinken, als mich die Erinnerung wie ein Blitz traf.
„Die anglikanische Kirche“, sagte ich zu Fred. „Gerda hat mir gesagt, dass sie in eine anglikanische Kirche geht.“ Vermutlich würde es auch von dieser mehr als eine geben. Doch es war ein Anhaltspunkt.
Oder du könntest bei den Waisenhäusern anfangen, sagte ich zu mir selbst. Aber nein, dazu war es zu früh, das musste ich mir für später aufheben. Ich hatte zu wenige Anhaltspunkte, um dieser Spur zu folgen, denn ich hatte wenig erfahren über Gerdas Recherchen in den Waisenhäusern. Gerda war immer sehr verschlossen gewesen, wenn es um ihr Privatleben ging, und ich war zu sehr in meiner eigenen Welt gefangen gewesen, um aktiv nachzubohren. Bei der kleinsten Abwehr ihrerseits hatte ich aufgegeben, etwas in Erfahrung zu bringen über diese Aktivitäten.
In Protea Glen angelangt, hielt Fred das Auto in einer Seitenstraße an und fragte ein paar ältere Damen, die gemächlich des Weges schlenderten, wo die nächste anglikanische Kirche sei. Von dem in Zulu gesprochenen Satz verstand ich bloss Isonto, Kirche.
Die Frauen waren sich einig, wo sie war, jedoch nicht darüber, wie man am schnellsten dorthin gelangte. Sie diskutierten und gestikulierten, eine wurde laut, eine andere beschwichtigte. Fred hörte geduldig zu – die Damen waren älter als er, er schien ihnen den nötigen Respekt zollen zu wollen.
Schlussendlich einigten sie sich auf eine Wegbeschreibung. Fred nickte, bedankte sich und fuhr los. Nur wenige Minuten später parkte er vor der Kirche. Ich stieg aus, doch Fred beharrte darauf, im Auto zu warten. Ich drängte ihn nicht und ging alleine auf die Kirche zu.
Sie war verlassen, doch aus einem Raum, der sich hinter dem Kirchenschiff befand, glaubte ich, Stimmen zu hören. Ich begab mich dorthin.
In dem Raum saßen ein älterer Herr und eine ältere Dame. Sie unterhielten sich und tranken Tee; eine halb gegessene Packung Kekse lag auf dem Tisch. Sie blickten mich überrascht an, als ich eintrat.
„Kann ich dir helfen?“, fragte der Herr, vermutlich der Pastor.
Ich wollte zuerst meine falsche Identität als Detektivin angeben, überlegte es mir dann aber anders. Es würde die beiden vermutlich nur verwirren und sie wenig kooperativ machen.