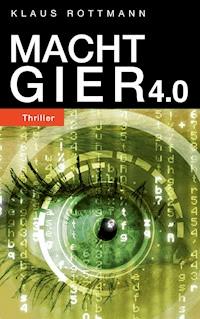
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Unternehmensberater Paul Stern erbt unerwartet eine ganze Firma – inklusive des Prototypen einer unglaublichen Erfindung: der "Greenbox". Sie verdoppelt die Reichweite von Elektrofahrzeugen und halbiert den Verbrauch elektrischer Geräte. Dieses Erbe rückt Paul ins Visier eines global agierenden Verbrechersyndikats, dem menschliche Werte und Gesetze fremd sind. Die Organisation will die "Greenbox" unbedingt in ihren Besitz bringen, und schreckt auch vor Mord und Entführung nicht zurück. Unversehens muss Paul nicht nur um sein eigenes Leben kämpfen - sondern auch um das Leben seiner entführten Freundin. Gut, dass er sich dabei blind auf einige sehr gute Freunde verlassen kann! Wird es ihnen gemeinsam gelingen, gegen diese machtgierige und weltweit agierende Organisation zu bestehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DANKSAGUNG
D ieser Thriller hat neben einer dunklen Seite, die in die tiefsten Abgründe der Menschheit eintaucht, auch eine helle und positive Botschaft.
Ganz gleich, was uns während unseres Lebens auf Erden auch an negativen Dingen zustoßen sollte: Nur die Liebe und die Freundschaften, die wir erfahren, machen unser Leben überhaupt erst so richtig lebenswert. Die Story ist gleichzeitig eine Verurteilung der Ungerechtigkeiten und Untaten, die sich täglich in der Welt ereignen. Aber vor allem ist sie eine Hommage an die Liebe und die Freundschaft!
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz besonders bei meinen Freunden Renate, Dagmar, Karin, Laura und Bernd für unsere jahrelange Freundschaft und ein erstes Lektorat bedanken. Ein ganz besonderer Dank gilt jedoch meiner Frau Heike; sie musste fast zwei Jahre lang jeden meiner kreativen »Ausbrüche« erdulden und durfte (musste ) diese dann mehr als einmal lesen.
Auch meinen Kater Mr Spock möchte ich nicht unerwähnt lassen – ihm gilt mein größter Dank. Oft hat er geduldig bei mir auf den Beinen gelegen, mir nächtelang beim Schreiben Gesellschaft geleistet und mich dabei mit seinen pulsierenden Krallen (die wie kleine Nadeln in meine Haut eindrangen) wach gehalten. Als Belohnung ist er nun ein Teil der Geschichte geworden.
Auch bei meinem Lektor Klaus Söhnel möchte ich mich hier noch einmal für seine tolle Unterstützung bedanken. Wir hatten gleich die richtige »Wellenlänge« und hoffen nun, dass Sie als Leser genauso viel Freude beim Lesen haben wie wir bei der Erstellung des Buches.
Es sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hier um eine rein fiktive Story handelt und es keinen Bezug zu lebenden Personen oder existierenden Unternehmen gibt.
Personen der Öffentlichkeit wurden aufgrund ihrer Funktion in diese frei erfundene Handlung integriert.
Denn wäre diese Story wahr, dann hätte ich wirklich Angst!
»Der Teufel ist ein Eichhörnchen«
Sprichwort
Manchmal kann aus etwas vermeintlich
Harmlosem unerwartet etwas Böses erwachsen …
Mein Name ist Paul Stern und bis vor einigen Wochen hatte ich noch ein vollkommen normales Leben …
Inhaltsverzeichnis
Schattenwelt
Krise in der Winter AG
Urlaub im Süden
Terror im Grand Canyon du Verdon
Der Einbruch
Das Erbe
Zweifel
Die Villa
Bremers Angebot
Ausgeliefert
Übernahme der Winter AG
Entführt
Verbündete
Der Austausch
»Spinnenjagd«
Sabrina Bremer
Daheim
Verzweiflung
Maulwurfsjagd
Bremer
Steinbergs Flucht
Macht
Der Absturz
Lee Wu
Die Falle
Kariba-See
Der zweite Maulwurf
Malaika
Auf einer Luxusjacht im Golf von Aden
Suche nach Philippe
Südafrikas Townships
Heiser Wüstenwind
Chaos-Strategie
Markus von Oppenheim
Showdown im Jemen
Die Frage
Ming
SCHATTENWELT
Der Himmel über Düsseldorf verdunkelte sich und das Grollen des Donners ließ die Fensterscheiben an den umliegenden Häusern hörbar vibrieren. Blitze erhellten die apokalyptische Dunkelheit der Nacht. Urplötzlich öffnete der Himmel seine Schleusen und spülte den Dreck der Straßen in die Kanalisation.
Andrea Wiese klopfte völlig durchnässt an die Haustür ihrer neuen Freundin und dachte: »Welch unglaubliches Glück, dass ich ihr begegnet bin – ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, diese unglaublichen Glücksgefühle je zu erleben.«
Lange hatte sie gesucht, vieles ausprobiert, viele Enttäuschungen erfahren. Sich immer gegen ihre Neigungen, ihre Fantasien gewehrt. Unzählige Freundschaften waren bereits daran zerbrochen. Ihre Ehe – ein weiterer Versuch, diese Veranlagung zu verdrängen – war ebenso kläglich gescheitert.
»All diese Spießer, diese Scheinheiligen, die ihre intimsten, geheimsten Wünsche unterdrücken und andere verurteilen, die ihre Sehnsüchte ausleben!«, fluchte sie in Gedanken vor sich hin. Sie hatte immer empfunden, dass sie anders war und nie wirklich verstanden wurde. Unzählige Therapien hatte sie bereits über sich ergehen lassen. Schon in ihrer Kindheit hatte es angefangen. Ja, selbst die Ehe ihrer Eltern ist an ihr, ihren Neigungen zerbrochen. Immer und immer wieder hatte man auf sie eingeredet und ständig neue Behandlungen an ihr ausprobiert. Zum Schluss hatten alle aufgegeben, sie aufgegeben.
Ständig hatte man dabei versucht, ihr einzureden, dass sie krank, nicht normal sei. Doch damit war jetzt endgültig Schluss!
Seit sie Lee kennengelernt hatte, die sie gelehrt hatte, dass ihre Neigungen vollkommen normal seien, blühte sie regelrecht auf. Andreas Neigungen wurden nun akzeptiert, besser noch, Lee führte sie immer weiter, immer tiefer in die Fantasiewelt ihrer Sehnsüchte hinein. Holte sie aus ihrer Leere heraus. Ließ ihre Fantasien wahr werden und befreite sie von ihren ständigen Selbstzweifeln. Nun ging es ihr wesentlich besser. Sie fühlte sich endlich befreit von den ihr auferlegten Zwängen. Zum ersten Mal in ihrem Leben war sie vollkommen glücklich, der Ekstase nah.
Die meisten Menschen strebten nach Liebe, Geborgenheit und Anerkennung. Andrea Wiese jedoch erfuhr ihre höchste Erfüllung und Befriedigung im Schmerz und in den Erniedrigungen, die ihr zugefügt wurden.
Welch ein Glücksgefühl durchströmte sie nun! Ein Hochgefühl, das kaum zu ertragen war. So lange hatte sie sich danach gesehnt – achtunddreißig Jahre darauf gewartet, ihren ersten tiefen, gewaltigen Orgasmus zu erleben.
Ein Beben, das ihren ganzen Körper erfasste, ja, ihn förmlich zerriss.
Atemberaubend und erfüllend war dieses Glücksgefühl, das sie so zum ersten Mal in ihrem Leben erfuhr. Mit Worten kaum zu beschreiben, wie glücklich sie nun war.
Seit drei Stunden lag sie nun schon nackt in embryonaler Stellung in dem kalten und dunklen Keller, in einem engen Metallkäfig gefangen. Dabei konnte sie sich nicht einen Zentimeter bewegen. Ihre Hautporen waren durch die Kälte angespannt und ihre Haut hatte das Muster einer fein strukturierten Raufasertapete angenommen. Ihre dünnen, feinen, fast unsichtbaren Härchen standen steil aufgerichtet von ihrer kalkweißen Haut ab. Ihr Atem ging schwer vor erregender Erwartung dessen, was Lee heute wieder mit ihr anstellen würde.
Als sie die Schritte auf der Kellertreppe hörte, hielt sie die Erregtheit kaum noch aus. Ihr Herz pochte schneller gegen die Brust, und vor lauter Lust hätte sie laut aufschreien können. Sie liebte die Demütigung, liebte den Schmerz, der ihr zugefügt wurde. Keiner zuvor hatte dies verstanden. Niemand zuvor hatte diese Erregtheit und Zufriedenheit in ihr ausgelöst. Sie liebte es, gedemütigt und benutzt zu werden.
Die unzähligen versteckten Piercings und Narben, die ihren Körper überzogen, zeugten von einem Körperkult, den viele nicht nachvollziehen konnten. Aber Lee war anders, sie war die Erste, die Andrea verstand und mit ihrer Lust nach Schmerzen umgehen konnte. Sie konnte sie an ihre Grenzen führen.
Sie war ihre erste wahre Liebe. Andrea liebte ihre Herrin bedingungslos.
Als sich die Kellertür geräuschlos öffnete, traf ein schwacher Lichtstrahl auf die Frau, die im Käfig eingeschlossen war. Auf ihren schlanken, geschundenen Körper.
Amnesty International würde das, was ihr Körper dokumentierte, als schwerste Form der Folter bezeichnen. Aber Andrea Wiese liebte ihren Körper. Sie liebte es, den Schmerz zu fühlen, diese Form der Demütigung und des Beherrschtwerdens zu erleben.
Die hochgewachsene schlanke Chinesin schritt langsam und streng blickend auf Andrea zu und befreite sie aus dem engen Metallkäfig.
»Steh auf und verneige dich vor deiner Herrin, du nichtsnutzige Sklavin!«, wies Lee Andrea streng an.
Tief gebeugt stand Andrea nun vor ihrer Herrin und genoss die Demütigung, die sie dabei erfuhr.
Neidisch auf ihre prallen Brüste – ihre eigenen waren eher Andeutungen einer leichten Erhebung –, hängte Lee nun kleine Gewichte an Andreas silberne, durch die Brustwarzen gestochene Ringe.
Leise, vor Lust und Erregtheit stöhnende Laute drangen aus Andreas Mund, als Lee die kleinen silbernen Gewichtskugeln mit einer Reitgerte in Schwingungen versetzte.
Bevor ihr Lustschmerz jedoch nachließ und zur Gewohnheit wurde, stoppte Lee die Behandlung. Sie stellte Andrea mit dem Rücken an eine kalte Kellerwand und fixierte sie mit ausgestreckten Armen durch Handfesseln. Ohne auch nur ein Wort mit ihr zu sprechen, spreizte sie Andreas Beine und schnallte ihre Fußgelenke mit ledernen Fesseln fest. In gekreuzigter Stellung mit gespreizten Beinen stand Andrea nun bewegungslos vor der Wand. Geschickt klebte Lee Elektroden auf Andreas immer noch mit Gänsehaut überzogenen Körper. Jede dieser Elektroden brachte sie gezielt an einem speziell ausgesuchten Nervenpunkt an. Hier lagen die empfindlichsten Nervenbahnen. Selbst Andreas zahlreichen Piercings wurden von ihr mitverkabelt. Andrea wurde immer erregter, Freudentränen liefen ihr übers Gesicht.
Sie dachte im gleichen Moment daran, was für ein Glücksfall es doch gewesen war, als Lee sie im Café zufällig angesprochen hatte. Wie aufregend es war, als Lee ihr die Brustwarzenpiercings gestochen hatte. Wie erregt und feucht Andrea geworden war, als Lee ihr die äußeren Schamlippen durchstoßen und ihr gleich mehrere silberne Ringe eingesetzt hatte. Wie bei einem Schnürschuh hatte sie ihr dann mit einer kleinen Silberkette die Scham verschlossen.
Lee war die Erste, die sie verstand. Die Erste, die ihre Sehnsüchte erahnte. Die Erste, die diese Gefühle in ihr auslöste.
Um ihr neues Kunstwerk zu vollenden, ihr Symbol der Macht über Andrea Wiese zu unterstreichen, hatte Lee die beiden Enden der Kette zusammengeführt und mit einem kleinen silbernen Vorhängeschloss, auf dem ein heller Diamant glitzerte, verschlossen. Sie wusste, Andrea würde es nie wagen, es abzunehmen.
Lee blickte zufrieden auf Andrea und wusste, dass sie ihr vollkommen hörig war. Genau so, wie sie es auch von allen anderen, die ihr dienten, erwartete. Gehorsam bis zum Äußersten. Schon in dem Café hatte sie in Andreas Blick das Verlangen nach Unterwerfung und Führung gesehen. Dies war eines ihrer vielen dunklen Talente, die Schwachen auszuwählen, um sie dann zu ihren willenlosen Werkzeugen zu erziehen.
Lee trug ein schwarzes, eng geschnittenes Seidenkleid, und ihre Hände waren mit schwarzen, dünnen Latexhandschuhen bedeckt. Nie würden Lees Hände Andreas Haut direkt berühren. Viel zu erregend war diese hauchdünne Distanz von weichem Latex zwischen ihnen.
Eine notwendige Distanz zwischen Herrin und Sklavin.
Lee gab Andrea genau das, wonach diese sich ihr Leben lang gesehnt hatte.
Langsam drehte Lee am Regler des Trafos, und sofort fing Andrea an, rhythmisch, dabei immer lauter stöhnend, zu zucken.
Als Lee am nächsten Morgen über den Flur zu ihrem Büro schritt, dachte sie: »Wie genial sich doch alles zusammengefügt hat, dass ich mit Andreas Fürsprache gleich eine Anstellung als Bremers Assistentin erhielt!« Wie genial sich doch alles zusammenfügte, wenn man nur die richtigen Methoden anwendete und die Schwächen eines Menschen kannte.
»Wie naiv und gutgläubig die meisten Menschen doch sind, wenn ihre wahren Sehnsüchte angesprochen werden!«, kam ihr in den Sinn, als sie Andrea in Bremers Büro treten sah.
Andrea trug im Büro immer Kleidung, die ihre geschundene Haut völlig verdeckte – meistens langärmelige Oberteile mit Hosen oder langen Röcken dazu. So konnte sie die Spuren ihrer Veranlagung geschickt vor der Öffentlichkeit verbergen. Nie hatte Lee sie bisher direkt berührt. Nie richtig mit ihr geschlafen. Je länger sie sich kannten, desto verlangender wurden Andreas Blicke. Lee ignorierte diese Blicke und sprach mit Andrea immer nur das Notwendigste. Dies war eine wichtige Komponente in ihrer Beziehung. Lee wusste: Je mehr Schmerzen sie Andrea zufügte, je mehr sie sie seelisch und körperlich quälte, desto mehr Macht hatte sie über sie.
Bremer saß, wie an jedem Arbeitstag, an seinem großen massiven Holzschreibtisch und blickte zufrieden aus der Fensterfront seines Büros.
Unter der Oberkasseler Brücke fuhren gerade zwei Schiffe rheinabwärts, während Bremer seinen Gedanken nachhing.
Alles lief im Moment perfekt nach Plan, nach seinem Plan …
Denn schon bald würde er ein weiteres Unternehmen sein eigen nennen. Besser noch: mit den dazugehörigen Patenten ein Vermögen verdienen.
Zwar hatte Bremer bereits ein Imperium an Unternehmen aufgebaut, aber er gehörte nicht zu den Männern, die so schnell zufrieden waren. Nein, er gehörte zu den Menschen, deren Gier nach Reichtum, aber vor allem nach noch mehr Macht schier unersättlich war.
Als Inhaber der Lohr Group hatte er Zugang zu allen wichtigen Wirtschafts- und Regierungsstellen in Europa und in weiten Teilen der restlichen Welt.
Dies alles war jedoch nur ein Teil seiner Geschäfte – der offizielle Teil. Seine wahren Aktivitäten lagen verdeckt, völlig verborgen vor der Öffentlichkeit.
Es klopfte an der Tür, und Bremer sagte, noch seinen Gedanken nachhängend: »Ja!«
Die Tür öffnete sich und seine Sekretärin trat in den Raum.
»Guten Morgen, Herr Bremer! Ich bringe Ihnen Ihre Korrespondenz«, begrüßte sie ihn höflich und legte den Stapel Post auf seinem Schreibtisch ab.
»Darf ich Ihnen Ihren Tee servieren?«, fragte Andrea Wiese ihren Chef schon fast schüchtern.
»Ja«, gab Bremer nur kurz zurück.
Bremer war mit seinen Gedanken immer noch ganz woanders.
Wie spannend war es doch, als der, den alle in der Organisation nur »die Spinne« nannten, ihn vor gut drei Wochen kontaktiert und ihm dann drei gescannte Seiten einer unglaublichen Erfindung übermittelt hatte. Selten kam es vor, dass sich Bremer für etwas begeistern konnte. Er hatte schon alles gesehen, alles erlebt, konnte sich alles leisten, was er begehrte. Es gab nichts mehr, was ihn wirklich überraschen oder gar aus der Ruhe zu bringen vermochte. Doch was die »Spinne« ihm da übermittelt hatte, war einfach unfassbar.
Malte Steinberg war ein Spitzel – ein Maulwurf in der Winter AG. Bremers Maulwurf. Bremer war einer der führenden Köpfe einer Organisation, die die ganze Welt umspannte. Bremer kontrollierte den europäischen Teil, den bis heute einflussreichsten Teil der Organisation. Über die »Spinne« wurde Bremer direkt mit Informationen versorgt, die über die einzelnen Landesvorsitzenden und die von ihnen geführten Spione gesammelt wurden.
Der Informationsfluss innerhalb dieser Organisation wurde in allen Ländern gleich geregelt: Die Spione, die auch »Maulwürfe« genannt wurden, waren in den größten und lukrativsten Unternehmen eingeschleust worden und versorgten ihre Landesvorsitzende mit den neusten Entwicklungen und wichtigsten Informationen.
Informationen, die dazu dienten, einen Technologievorsprung bei Neuentwicklungen zu erhalten – oder auch über noch nicht öffentlich bekannte personelle Veränderungen in den Vorstandsetagen der börsennotierten Unternehmen. Ebenso über Rückrufaktionen, die dazu führen konnten, dass sich der Aktienkurs eines Unternehmens schlagartig veränderte. Mit diesen Insiderinformationen konnten die Köpfe der Organisation, wie Bremer, Millionen verdienen.
Die »Spinne« war die einzige Person weltweit, die die Verbindung zwischen den Ländervorsitzenden und den Köpfen der Organisation aufrechterhielt. Die Spione selbst kannten nur ihren jeweiligen Landesvorsitzenden und die Landesvorsitzenden wiederum nur die »Spinne«.
Die »Spinne« jedoch hielt die Fäden und die Verbindung zu den Köpfen der Organisation zusammen – weltweit.
Als die »Spinne« Bremer die unglaubliche Information von Steinberg übermittelt hatte, hatte dies bei ihm wahre Begeisterungsstürme ausgelöst. Wenn das wirklich stimmte, dann hatte der Inhaber der Winter AG eine unfassbare Erfindung gemacht.
Eine Erfindung, mit der sich der Energieverbrauch aller elektrisch betriebenen Geräte um die Hälfte reduzieren ließe. Mit dieser Erfindung würden die Karten auf dem Energiemarkt ganz neu gemischt. Wer diese Erfindung kontrollierte, hatte Macht, viel Macht. Bremer hatte sofort erkannt, welch unglaubliches Potenzial in dieser Erfindung lag.
Seit Jahren unterhielt Bremer ein Netzwerk von Industriespionen. Die meisten Unternehmen investierten Unsummen in ihre Entwicklungsabteilungen. Doch Bremer hielt es wie die Chinesen und folgte damit der »Chinamethode«. Nicht ohne Grund konnte er in so kurzer Zeit ein solch riesiges Imperium aufbauen. Jahrelang hatte er in Malte Steinberg investiert. Er hatte ihn mit einem kleinen Vermögen unterstützt und damit seine Leidenschaft, seine Spielsucht finanziert. Doch nun zahlte sich auch diese Investition aus. Bremer war ein »Fuchs«, er wusste, dass nach der Zeit der Investition die Zeit der Ernte kommen würde.
Für Bremer war jetzt Zeit, zu ernten. Es war Zeit, seinen Gewinn zu machen.
Nur durch einen glücklichen Umstand war Steinberg auf die Erfindung von Horst Winter aufmerksam geworden.
Als Winter eines Tages in seinem Büro mit Steinberg die Testergebnisse eines neu entwickelten Steuergerätes besprach, klingelte das Telefon und das Krankenhaus teilte Winter mit, dass seine an Krebs erkrankte Frau während einer ihrer bereits unzähligen Chemobehandlungen einen Schwächeanfall erlitten hatte.
Voller Sorge um seine Frau war Winter sofort ins Krankenhaus geeilt und hatte nicht nur vergessen, sein Büro abzuschließen, sondern hatte auch noch seine Aktentasche liegen lassen.
Winters Sekretärin war ebenfalls nicht da – sie hatte einen Arzttermin. Dies war die Gelegenheit für Steinberg. Er wusste, dass Winter ein Erfinder war. Er kannte alle Geschichten, die im Unternehmen über Horst Winter erzählt wurden, und so wusste er auch, dass Winter irgendwo noch ein Geheimlabor betrieb. Das waren seine Informationen vom »Flurfunk«. Trotz intensiver Suche hatte er das Geheimlabor bis zu diesem Tag noch nicht gefunden.
Nachdem Winter das Büro fast schon fluchtartig verlassen hatte, um zu seiner Frau ins Krankenhaus zu fahren, ging Steinberg zurück in Winters Büro und durchsuchte dort sämtliche Unterlagen.
Neugier und Spielsucht waren Steinbergs Laster. In Winters Aktentasche fand er schließlich, was er suchte: eine Mappe mit der Aufschrift »Projekt Greenbox« und zwei grüne Plastikboxen, aus denen mehrere Kabel herausragten.
Er blätterte durch die Mappe, las die ersten Seiten und war verblüfft über das, was dort geschrieben stand.
Steinberg ärgerte sich, dass er ausgerechnet jetzt seine Kamera vergessen hatte. Er ging zum Kopierer im Vorzimmer und fing an, die ersten Seiten zu kopieren.
Gerade als der Kopierer die dritte Seite einzog, hörte Steinberg die Aufzugstür und Schritte auf dem Gang. Sofort schaltete er den Kopierer wieder aus, steckte sich die bereits kopierten Seiten unter sein Hemd und legte die Originale mit Mappe wieder in die Aktentasche zurück.
Er hatte Glück – unentdeckt schlich er aus Winters Büro und verschwand über das Treppenhaus.
Bremer wusste, dass sich mit dieser Erfindung nicht nur ein Vermögen verdienen ließ. Viel wichtiger war ihm, dass er damit seine Stellung innerhalb der Organisation noch weiter ausbauen konnte.
Besonders jetzt, da die Chinesen mehr Rechte forderten und innerhalb der Organisation immer mehr Macht beanspruchten. Selbst die Afrikaner probten den Aufstand; besonders die Nigerianer wurden immer dreister und machten in letzter Zeit richtig Druck.
Nachdem Bremer von Andrea Wiese den Tee serviert bekommen hatte, klopfte es erneut an der Tür und seine Tochter Sabrina trat ein.
Als Bremer sie erblickte, erhellten sich seine Augen zu einem Strahlen und er ließ seine gerade gehegten Gedanken sofort ziehen.
Da stand die Einzige, die er wirklich liebte, für die er wahre Gefühle hegte.
»Hallo Dad, genießt du wieder die Aussicht oder arbeitest du schon?«, sprach Sabrina flapsig und gut gelaunt ihren Vater an.
Nur sie durfte so mit ihm sprechen; eine andere Person in seinem Umfeld hätte sich das nie gewagt.
Sabrina Bremer war eine erstklassig ausgebildete Juristin und gerade mit der Übernahme der Winter AG betraut. Oft wurde sie unterschätzt. Viele sahen in ihr nur das, was sie gern sehen wollten: eine junge Frau, die auch auf den Laufstegen dieser Welt hätte Karriere machen können. Doch gerade durch ihr jugendliches Alter und ihr gutes Aussehen wurde sie bei Verhandlungen oft falsch eingeschätzt. Dies verschaffte ihr einen entscheidenden Vorteil, und so konnte sie bereits zahlreiche Erfolge vorweisen.
Sie hatte an den Eliteuniversitäten in England und den USA studiert, praktische Erfahrungen in den Auslandsniederlassungen der Lohr Group gesammelt und leitete nun seit über einem Jahr die Rechtsabteilung in der Hauptzentrale in Düsseldorf.
»Nein, mein Schatz, ich war natürlich schon fleißig«, antwortete Bremer mit einem Lächeln.
Sabrina Bremer kannte nur die eine Seite ihres Vaters, die des liebevollen und zuvorkommenden alleinerziehenden Vaters.
Ihre Mutter hatte sie nie kennengelernt, sie war bereits kurz nach ihrer Geburt an einem Krankenhauskeim gestorben.
Die dunkle, verbrecherische Seite ihres Vaters kannte Sabrina nicht.
Lee sah, wie Sabrina Bremer das Büro ihres Vaters verließ und auf dem Flur noch mit Andrea Wiese sprach – mit Andrea, ihrer doch so nützlichen Spionin … und gleichzeitig vollkommen hörigen Sklavin. »Welche interessanten Informationen ich bereits von ihr erfahren habe und was für gute Ohren Andrea doch hat!«, dachte Lee und beschloss, Andrea beim nächsten Mal ganz besonders zu belohnen …
Ohne Andrea hätte sie nie Kenntnis von der »Greenbox« in der Winter AG erhalten.
KRISE IN DER WINTER AG
E s war einer dieser typischen tristen und grauen Morgen im Bergischen Land – es war März.
Nur langsam wurde es heller und auf dem kleinen Dachfenster über meinem Bett liefen aneinandergereihte Regentropfen wie Bindfäden herunter.
Montagmorgen – was für ein bescheidener Start in die neue Woche. Konnte nicht die Sonne scheinen, die Vögel heiter zwitschern? Es war halt noch nicht April und ich wohnte ja auch nicht im Süden.
Ich schloss wieder die Augen und überlegte, was mich wohl in dieser Woche alles erwarten würde.
Zuerst stand heute der Besuch bei Horst Winter auf meiner Tagesordnung.
Horst war in den letzten Jahren fast wie ein Vater für mich geworden. Da meine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren, als ich acht Jahre alt war, bin ich bei meiner Oma aufgewachsen. Horst und seine Frau Inge sind in den letzten Jahren fast wie richtige Eltern für mich geworden.
Als ich meinen ersten Auftrag von der Winter AG als selbstständiger Berater erhielt, hatte ich mich mit Horst von Anfang an sehr gut verstanden. Schnell wurde aus unserer anfänglichen Geschäftsbeziehung eine tief verbundene Freundschaft.
Seit gut drei Wochen war ich wieder einmal für ihn und sein Unternehmen, die Winter AG, tätig.
Die Winter AG hatte sich schon früh auf die Produktion qualitativ hochwertiger Steuergeräte für nahezu alle namhaften Automobilhersteller in der ganzen Welt spezialisiert.
Ohne diese Steuergeräte, die wie kleine Computer arbeiteten, würde sich kein Fahrzeug mehr bewegen. Kein Motor würde mehr anspringen, keine Fahrzeugtür sich schließen.
Neben diesem Unternehmen besaß Horst noch unzählige Beteiligungen an anderen Unternehmen, die seine Patente nutzten.
Ein völlig unnötiger Produktionsfehler hatte vor gut drei Wochen dazu geführt, dass einer seiner größten Kunden, ein bedeutender Automobilhersteller in Deutschland, ihm einen Austausch all seiner betroffenen Produkte angedroht hatte.
Da ich Horst schon seit Jahren als selbstständiger Berater betreute und reichlich Erfahrung mit derartigen Problemen besaß, war er natürlich sehr froh darüber, dass ich im Lande war und seinen Auftrag übernehmen konnte.
Schnell war klar, wo die Ursache für das Problem lag. Nur – wie bringt man dies seinem Kunden bei? Das Ganze natürlich auch noch möglichst so, dass die entstehenden Kosten die Winter AG nicht gleich in die Insolvenz trieben.
Müsste die Winter AG den gesamten finanziellen Schaden der Reklamation alleine tragen, so reichte die Versicherung, die sie zum Glück abgeschlossen hatte, bei Weitem nicht aus. Schnell wäre hier ein Schaden von über fünfzig Millionen Euro zusammengekommen. Fünfzig Millionen Euro, was für ein Haufen Geld – einfach so »verbrannt«.
Ich predigte es meinen Kunden ja immer wieder, mehr in die Prävention zu investieren. Würde nur ein »Bruchteil« dieser Reklamations- und Rückrufkosten in präventive Maßnahmen gesteckt, wäre das Risiko eines solchen Schadens wesentlich geringer.
Was hätte ich mit fünfzig Millionen Euro nicht alles anstellen können …
In meinen Schulungen baute ich immer gern die Story vom letzten Großbrand in unserem eher ländlichen Ortsteil von Wuppertal ein – wie der Sicherheitsberater einer Versicherung einem sturen Bauern dazu riet, dringend die Verkabelung der elektrischen Installation in seinem technisch völlig veralteten Kuhstall zu erneuern.
Der Bauer, so sparsam und geizig, wie er nun einmal war, scheute die Kosten und schickte den Berater verärgert von seinem Hof. Knapp drei Monate später kam es, wie es kommen musste: Der Stall brannte samt Kühen vollständig ab.
Die Ortsfeuerwehr war rasch zum Löschen gekommen und verhinderte dadurch, dass auch noch das Wohnhaus mit abbrannte. Der Bauer dankte der Feuerwehr für ihre schnelle Hilfe und spendierte gleich noch einen Kasten Bier.
Warum auf den Berater hören und etwas investieren, wenn noch nichts passiert ist …?
Und die Moral von der Geschichte: Prävention ist ein undankbares Geschäft!
Fünfzig Millionen Euro auf meinem Konto und ich wäre mit Sicherheit heute Morgen irgendwo im Süden aufgewacht. Blauer Himmel, blaues Meer – was für ein schöner Gedanke.
Nachdem ich mich aus meinem Bett gequält, meinen ersten Kaffee genossen und meinem alten Kater Mr Spock das Frühstück serviert hatte, machte ich mich frisch geduscht und in meinem bequemen hellgrauen Anzug auf zur Winter AG.
Mein erster Termin an diesem Morgen war mit Heinz Moll. Moll war Produktionsleiter in der Abteilung, in der die fehlerhaften Steuergeräte produziert worden waren.
An der Pforte hielt ich wie beim Einchecken am Flughafen meine ID-Karte an einen Scanner. Eine grüne Lampe leuchtete auf und die Sicherheitsschleuse öffnete sich vor mir.
Müller, der Mann vom Wachdienst, grüßte freundlich. Er saß entspannt mit seinem beleibten Körper hinter einer Glasscheibe an der Pforte.
Das Betriebsklima in der Winter AG war außergewöhnlich gut für diese Branche – eigentlich ungewöhnlich für einen Zulieferbetrieb in der deutschen Automobilindustrie. Der Preiskampf und der Zeitdruck in diesen Unternehmen waren in den letzten Jahren enorm gestiegen, und ein Ende war noch lange nicht in Sicht. In immer kürzeren Zeitabständen und zu immer günstigeren Preisen mussten neue Produkte entwickelt und in Serie gebracht werden. Dies führte sehr schnell zu steigendem Stress in der gesamten Belegschaft.
Viele Produkte in der Automobilindustrie, die vor Jahren noch in Deutschland entwickelt und produziert worden waren, wurden mittlerweile im Ausland hergestellt. Der Kostendruck auf den deutschen Zulieferermarkt war seit Jahren und in allen Sparten nur allzu deutlich zu spüren.
Fast jedes Unternehmen hatte mittlerweile mindestens einen weiteren Standort in Osteuropa oder Asien. Die Zulieferer mussten den Automobilherstellern folgen, um so wenigstens einen Teil des wachsenden Kostendruckes aufzufangen.
Wer in dieser Branche ganz vorne mitmischen wollte, kam nicht umhin, sich der Globalisierung zu stellen. Selbst kleine mittelständische Unternehmen hatten bereits mindestens einen weiteren Standort oder ein Joint Venture im Ausland.
So verschwanden in Deutschland nicht nur die eher niedrig dotierten Arbeitsplätze in den Fertigungsbereichen, sondern es floss durch den damit verbundenen Wissensaustausch auch das gesamte Know-how ins Ausland ab. Was nutzten den Firmen da noch ihre Patente. Selbst Fachleute konnten die Plagiate nicht mehr so einfach von den Originalen unterscheiden.
Horst hatte sich bis dahin immer erfolgreich gegen eine Verlagerung ins Ausland gewehrt. Aber der Druck der großen Automobilhersteller war enorm.
Nur durch seinen Technologievorsprung und seine hohe Automatisierungstiefe konnte Horsts Unternehmen bisher immer überzeugen. Umso ärgerlicher war nun das aktuelle Problem.
Trotz der aktuellen Krisenstimmung und des drohenden finanziellen Schadens, der auf die Winter AG zukommen konnte, war Horst zwar angespannt, aber seinen Mitarbeitern gegenüber nicht ungehalten. Er legt immer größten Wert auf ein persönliches und freundliches Betriebsklima. Jeder in seinem Unternehmen, der ein persönliches Anliegen hatte, konnte sich bei ihm einen Termin geben lassen. Regelmäßig ging er durch das gesamte Unternehmen und nahm sich Zeit für persönliche Gespräche mit seinen Mitarbeitern. Er sprach sowohl mit den Abteilungsleitern als auch mit den Mitarbeitern direkt an den Montageanlagen. Er kannte jeden mit Namen – was für ein Gedächtnis!
Horst nahm sich Zeit für seine Mitarbeiter, selbst wenn dies dazu führte, dass er deswegen selbst noch bis tief in die Nacht arbeiten musste.
Ich bewunderte ihn für seine Ruhe und Geduld, die er dabei immer an den Tag legte.
Bevor ich nun jedoch den eigentlichen Produktionsbereich betreten konnte, musste ich erst einmal meine bequemen Straßenschuhe gegen klobige Sicherheitsschuhe mit einer antistatischen Sohle tauschen. Ich zog einen weißen Overall über meinen Anzug und stülpte mir eine Einweg-Papiermütze über die Haare. In der spiegelnden Glasscheibe der Tür sah ich das Ergebnis – ich sah schon einmal deutlich besser aus.
Auf dem Laufsteg bei Heidi Klum hätte ich in diesem Outfit vermutlich viel Aufmerksamkeit erregt, aber mit Sicherheit wäre ich keine Runde weitergekommen …
In diesem und den meisten anderen Fertigungsbereichen, die ich nun betrat, war diese Kleidung jedoch Vorschrift. Hier wurden unter Reinraumklima hochempfindliche Elektronikteile verbaut. Die gesamte Luft wurde ständig abgesaugt und gefiltert. Die Temperatur stand konstant auf einundzwanzig Grad Celsius und ein leichter Unterdruck verhinderte ein Aufwirbeln des verbleibenden Mikrostaubs.
»Der ideale Arbeitsbereich für alle Allergiker«, schoss mir in den Sinn, als ich den Reißverschluss des Overalls zuzog.
Ein Operationssaal enthielt vermutlich mehr Staub und Keime als diese Produktionsstätte. Umso ärgerlicher war es, dass ausgerechnet hier der Produktionsfehler aufgetreten war – ein Fehler, der die gesamte Fahrzeugelektronik lahmlegen konnte.
Wieder öffnete ich eine Sicherheitsschleuse mit meiner ID-Karte und trat ein. Hinter mir schloss sich die Tür automatisch. Ziemlich laut tauschte nun ein Ventilator die gesamte Luft in der Schleuse aus, bevor sich vor mir die eigentliche Tür zur Produktionshalle öffnete.
Jede Schleuse hatte Platz für eine Person. Es gab vier Schleusen pro Produktionsbereich.
Gut, dass ich nicht jeden Tag in die Produktion musste …
In der großen Produktionshalle überkam mich in den ersten Minuten immer ein leichtes Frösteln. Eine »Gänsehaut« überzog meine Unterarme. Erst nach einigen Minuten hatte sich mein Körper auf die immer konstante Raumtemperatur in dieser Halle eingestellt.
Ich fand Moll an einer Produktionsanlage, wo er gerade die Feinjustierung an einem automatischen Greifer vornahm. Heinz Moll war in diesem Produktionsbereich der verantwortliche Abteilungsleiter. Er war einer derjenigen, die die Winter AG seit der ersten Stunde begleitet hatten. Für ihn war die Arbeit mehr als nur ein Job.
Moll war immer noch persönlich schwer betroffen. Ausgerechnet in seinem Verantwortungsbereich war der Fehler aufgetreten, der dem Unternehmen jetzt diesen Ärger bereitete. Moll war seit fast vierzig Jahren bei der Winter AG.
Zwar hatten Horst und ich ihm schon gefühlte einhundert Mal versichert, dass es nicht sein persönlicher Fehler gewesen war, der zu diesem Problem geführt hatte. Aber Moll sah dies anders. Das Ganze »zehrte« immer noch sehr an seiner »Produktionsleiterehre«. Die eigentliche Fehlerursache war wieder einmal mehr der Tatsache geschuldet, dass ein neues Produkt viel zu schnell auf den Markt gebracht worden war. Verzögerungen in der Entwicklungsphase gingen erneut auf Kosten der Serienerprobung. Bei dem vorliegenden Problem hatte man bei der Programmierung eines Lasers vergessen, die Einzeltoleranzen der Bauteile hinreichend zu berücksichtigen. So war es ab und an vorgekommen, dass einzelne Bauteile nicht richtig mit der Hauptplatine verbunden worden waren.
Zwar wurden alle Platinen nach der Fertigung geprüft, aber dennoch fielen ungefähr zwanzig Prozent aller Steuergeräte später im Fahrzeug aus – zur Freude der Werkstätten und zum Ärger der Kunden.
Bei einer Prüftemperatur von einundzwanzig Grad Celsius war meist noch alles in Ordnung. Die Platinen wurden verpackt und bei den Automobilherstellern in den Fahrzeugen verbaut.
Stand jedoch ein Fahrzeug einmal in der Sonne oder wurde der Motor richtig heiß, so stiegen die Temperaturen im Steuergerät rasch an. Die einzelnen Komponenten dehnten sich unterschiedlich aus und die schlecht gelötete Verbindung wurde unterbrochen.
In diesem Fall lief der Motor des Fahrzeuges meist noch weiter, wenn er denn einmal an war. Andere Funktionen wie die Scheibenwischer, das Navigationsgerät, das Radio und sogar die komplette Fahrzeugbeleuchtung konnten jedoch plötzlich ausfallen. Im Regen und bei Dunkelheit konnte das im schlimmsten Fall zu folgenschweren Unfällen führen.
Zusammen mit Moll entnahm ich einige der gerade produzierten Platinen, um die Lötverbindung zu prüfen. Jede Lötstelle untersuchten wir sorgfältig am Monitor eines Röntgengerätes. Nachdem wir uns erneut davon überzeugt hatten, dass mit der geänderten Programmierung nun wieder alles in Ordnung war, gingen wir zusammen in den für uns gebuchten Besprechungsraum.
Hier wartete schon das restliche Krisenteam auf uns. In den letzten Wochen hatten wir hier intensiv an dem Problem gearbeitet. Alle wichtigen Bereiche waren durch Mitarbeiter vertreten und jedes Teammitglied war zu einhundert Prozent für dieses Problem freigestellt. Das Risiko, das in dieser Kundenreklamation lag, wurde von Anfang an richtig eingestuft. Schnell hatte Horst reagiert und konsequent gehandelt.
Im Besprechungsraum waren Sabine Petri aus der Entwicklung, Rolf Schönherr aus der Qualitätssicherung und Karin Dorr aus der Logistik. Eine wirklich attraktive Frau.
Karin war in meinem Alter, und schnell waren wir beim »Du«.
Beim Anblick ihres wohlgeformten Körpers und ihrer strahlend blauen Augen fiel es mir immer schwer, mich auf meine Aufgabe zu konzentrieren.
Was sollte ich auch machen? Ich war ja schließlich schon seit Wochen – gefühlte hundert Jahre – wieder unfreiwilliger Single. Leider verliefen jedoch all meine Annäherungsversuche bei Karin im Sande.
Wie ich später von Malte erfuhr, war Karin gerade frisch verliebt. »Du hast deine ›Balzzeit‹ bei ihr um gute zwei Wochen verpasst«, sagte mir Malte mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
Ein echter Spaßvogel, dieser Malte. Malte Steinberg war im Testlabor beschäftigt und hatte den entscheidenden Hinweis gebracht, als wir noch auf der Suche nach der eigentlichen Fehlerursache waren. Das Schwierigste bei solchen Problemen war es meistens, die eigentliche Grundursache des Fehlers zu verstehen, den Zusammenhang zwischen »Ursache und Wirkung«.
Das war für mich immer das Aufregendste und Spannendste an solchen Aufträgen. Ich liebte die Suche nach der eigentlichen Ursache eines Problems. Das war für mich immer die größte Herausforderung in meinem Job als Krisenmanager.
Erst wenn die eigentliche Ursache verstanden und die Zusammenhänge klar waren, konnte man sich um die nachhaltige Abstellung eines Fehlers kümmern. Alles andere wäre ein Stochern im Nebel gewesen.
Hinterher hörte sich das Ganze immer einfach und leicht an: Fehler finden und abstellen.
Am Anfang, wenn ich die Ursachen eines Fehlers noch nicht kannte, die Zusammenhänge noch nicht verstanden waren, trotzdem täglich weitergeliefert werden musste, da sonst ein ganzes Automobilwerk stillstand, da lagen die Nerven schon einmal blank.
Auch Peter Sorwa aus der IT-Abteilung gehörte zu unserem Team. Ein eher stiller und zurückhaltender Typ. Ein Mann, der nur sprach, wenn er unbedingt musste. Politiker hätte er nie werden können, aber für die Programmierung der Anlagensteuerung war er ein erstklassiger Mann. Noch nie war ihm bisher ein solcher Fehler bei der Programmierung unterlaufen. Aber wie überall im Leben gab es immer ein erstes Mal.
Nach meiner Präsentation zur weiteren Vorgehensweise und Prüfung aller bisher umgesetzten Maßnahmen war ich gegen Mittag mit allen wichtigen Aufgaben fertig.
Horst rief mich an und bat mich, in seinem Büro vorbeizuschauen. Für heute war alles Notwendige besprochen, alles lief wie geplant, und so machte ich mich gut gelaunt auf den Weg zum Chef. Ich verließ Gebäude 3 über einen gläsernen Verbindungsgang, der zwei Gebäude miteinander verband. Dies war der schnellste Weg, um in das gegenüberliegende Verwaltungsgebäude zu gelangen.
Das Firmengelände bestand aus fünf modernen, mehrgeschossigen Gebäuderiegeln, die jeweils in der dritten Etage mit Glasbrücken untereinander verbunden waren. Regelmäßig ließ Horst alles modernisieren und auf den neuesten Stand bringen. Jährlich investierte er hohe Beträge in die Modernisierung. Der Lohn des Ganzen: Er besaß eines der modernsten Unternehmen im Land.
Die Verwaltung war mit ihren fünf Etagen das höchste Gebäude. Hier hatte Horst sein Büro und somit einen hervorragenden Ausblick über sein gut eingezäuntes und gesichertes Firmengelände.
Darauf, was hier alles entwickelt und produziert wurde, hätte so manch ein Konkurrent gern einmal einen Blick geworfen. Zwar hatte es schon diverse Hacker- und Spionageangriffe gegeben, aber dank eines hervorragenden und ausgeklügelten Sicherheitskonzeptes wurden bisher alle Angriffe rechtzeitig erkannt und abgewehrt.
Alleine die eigens entwickelten, hochmodernen Produktionsanlagen und -technologien, die hier zum Einsatz kamen, waren schon etwas Besonderes. Vermutlich die modernsten in Deutschland – wenn nicht sogar weltweit.
Daher war es auch nicht weiter verwunderlich, dass Fotohandys in allen Fertigungsbereichen strengstens verboten waren.
Horst investierte jährlich einen immer größer werdenden Betrag in die Aufrüstung der Sicherheitsmaßnahmen, denn die Angriffe waren in den letzten Jahren immer raffinierter geworden.
Um ein wenig Fitnesstraining vor dem Mittagessen zu betreiben, nahm ich für die letzten beiden Etagen die Treppe.
Auf dem Flur in der Chefetage kam mir eine sehr elegant gekleidete und äußerst hübsche junge Frau entgegen. Eine Frau, die ich hier bisher noch nie erblickt hatte. Ich schaute ihr in die Augen, grüßte sie mit meinem freundlichsten und charmantesten »Hallo!« und setzte dabei ein unwiderstehliches Lächeln auf.
Unsere Blicke trafen sich nur kurz, aber ich hatte das Gefühl, sie schaute mir direkt ins »Herz« und konnte jeden meiner aufkeimenden unanständigen Gedanken erahnen …
Sie hatte wunderschöne rehbraune Augen, und diese Augen passten – wie dafür gemacht – zu ihren tiefschwarzen Haaren, die sie offen trug und die bis zu den Schultern reichten.
Als Dank für meine freundliche Begrüßung erhielt ich beim Vorbeigehen ein kurzes Lächeln zurück.
Eine Frau, nach der man sich umdrehte, umdrehen musste, was ich natürlich auch gleich tat. Die Art, wie sie mit ihren hohen Schuhen, eigentlich einige Zentimeter zu hoch fürs Büro, elegant wie ein Model auf dem Laufsteg den Gang hinunterschritt, verriet, dass sie einhundertprozentig wusste, welche Wirkung sie auf Männer hatte.
Dieser Typ Frau war einfach nur schön anzuschauen, aber leider auch sehr anstrengend, denn jeder Mann würde sie gern einmal als »Trophäe« erobern …
Mit Sicherheit ahnte sie, dass ich hinter ihr herblickte, und mit Sicherheit passierte ihr dies auch nicht zum ersten Mal.
Beine wie ein Reh, ein Hüftschaukeln wie – Paul, ermahnte ich mich, konzentriere dich mal lieber wieder auf deine Aufgaben hier.
Als ich das Vorzimmer von Horst betrat, blickte seine Sekretärin Frau Lieder nur kurz zu mir auf und sagte mir in ihrer sehr eigenen und trockenen Art: »Sie können gleich durchgehen, Herr Winter erwartet Sie schon!«.
Zwar fühlte ich mich nicht unbedingt wie Bond, aber insgeheim hatte ich ihr den Spitznamen »Miss Moneypenny« gegeben. Ihr spröder Charme hatte mich dazu inspiriert. Und dann tippte »Miss Moneypenny« auch schon wieder wie wild auf ihrer PC-Tastatur herum.
Frau Lieder war so um die fünfzig, eher der Typ »graue Maus« – der absolute Kontrast zu der jungen Dame, der ich gerade auf dem Gang begegnet war. Ich kannte sie nun schon seit mehreren Jahren, seitdem ich für die Winter AG arbeitete, aber richtig warm bin ich mit ihr nie geworden. Mit einer anderen Frisur und einem moderneren Outfit könnte sie bestimmt einiges mehr aus sich machen. Sie wäre die richtige Kandidatin für diese »Vorher-Nachher-Shows«.
Bei dem Gedanken, Miss Moneypenny im TV zu sehen, musste ich innerlich lachen, und so ging ich mit einem Lächeln im Gesicht in das Büro von Horst.
Horst war ein Mann, der mit seinen achtundsechzig Jahren wesentlich jünger aussah, als er war. Er war von kleiner Statur, eher der Genießer, aber dennoch dynamisch in allen seinen Taten.
Als ich in den Raum trat, blickte er kurz von seinem Laptop auf und bot mir einen Platz in seiner Besprechungsecke an. Er beendete seinen begonnenen Satz und setzte sich dann zu mir.
Sein Büro war immer sehr aufgeräumt. Ordnung und Sauberkeit waren das, was er seinen Mitarbeitern abverlangte und selbst konsequent vorlebte. Wenn er auch sonst sehr tolerant war, bei diesem Thema war er kompromisslos.
Irgendetwas schien ihn aufgewühlt zu haben. Ich vermutete, dass dies mit dem Damenbesuch zusammenhing, und musste bei diesem Gedanken schmunzeln.
Wir sprachen über den aktuellen Stand der Kundenreklamation, und dank Maltes gezielten Hinweisen aus dem Testlabor hatten wir das eigentliche Problem in einer atemberaubenden Zeit erkannt und gelöst. »Ich muss jetzt nur noch einige Gespräche mit dem Kunden führen, um die Gesamtkosten zu verhandeln. Aber auch hier habe ich schon eine gute Strategie ausgearbeitet. Wenn alles gut verläuft, sollte bald ein für alle zufriedenstellender Abschluss erfolgen«, teilte ich Horst mit.
Horst schlug vor, dem gesamten Team für den engagierten Einsatz eine kleine Erfolgsprämie zu zahlen. Ich fand, dass dies eine gute Idee war, und bestärkte ihn darin, sie rasch umzusetzen.
Alle im Team hatten ausgezeichnete Arbeit geleistet. So konnten, innerhalb weniger Wochen sämtliche bereits ausgelieferten fehlerhaften Produkte ausgetauscht werden.
Im Nachhinein hörte sich alles immer ganz einfach an. Steht man jedoch am Anfang eines Problems und kennt den Ausgang des Ganzen nicht, ist die Anspannung sehr groß.
Je höher der mögliche finanzielle Schaden und je enger die Termine, desto größer ist die Herausforderung. Genau wegen dieser ständigen neuen Herausforderungen liebte ich meinen Job so sehr.
Horst erzählte, dass er trotz des möglichen finanziellen Schadens, der aus der Kundenreklamation nun auf die Winter AG zukommen könnte, ein lukratives Kaufangebot für sein Unternehmen erhalten hatte.
Zwar fiele es ihm immer noch schwer loszulassen und sein Lebenswerk, die Winter AG, gerade jetzt zu verkaufen. Aber er war sehr froh darüber, nun mehr Zeit mit Inge, seiner schwer an Krebs erkrankten Frau, verbringen zu können.
Im Kaufvertrag hatte Horst mit dem neuen Eigentümer vereinbart, dass keinem seiner jetzigen Mitarbeiter in den nächsten fünf Jahren gekündigt werden durfte.
Inge und Horst hatten keine Kinder, und als er mir die Firma schon einmal vor einem Jahr als Nachfolger angeboten hatte, hatte ich mich über sein Vertrauen sehr gefreut, aber dennoch abgelehnt.
Leider, so fuhr Horst fort, hatte der neue Inhaber seine eigenen Berater, sodass mein Job bei der Winter AG wohl zukünftig wegfallen würde. »Schade«, dachte ich, »ich habe mit den Mitarbeitern immer gern zusammengearbeitet.« Mit vielen von ihnen war ich bereits per Du.
Im Laufe der letzten Jahre hatte sich zwischen Horst und mir ein echtes Vater-Sohn-Verhältnis entwickelt. Wir verstanden uns von Anfang an prächtig, auch wenn wir nicht in allen Angelegenheiten immer die gleiche Ansicht teilten. Selbst bei den schwierigsten Themen kam es zwischen uns nie zu einem bösen Wort. Sachlich und meist noch mit viel Witz und Humor hatten wir gemeinsam so manches schwierige Problem gemeistert.
Horst war immer für eine Überraschung gut. Unvergessen ist für mich das Erlebnis, als er einmal auf einer Belegschaftsversammlung zur Karnevalszeit in einem Clownkostüm zum Rednerpult schritt. Ganz sachlich und ruhig präsentierte er zwanzig Minuten lang die Firmenzahlen. Einfach unglaublich, dass der Geschäftsführer eines so großen Unternehmens in einer solchen Aufmachung vor die Belegschaft trat …
Damals, in dieser besagten Versammlung, waren die anwesenden Mitarbeiter schon sehr irritiert als er ans Rednerpult ging. Die Geräuschkulisse in der Kantine war entsprechend laut. Als er jedoch mit seiner ruhigen und angenehmen Stimme die Rede begann, wurde es schlagartig ruhig im Saal. Alle Anwesenden hörten ihm trotz seiner irritierenden Aufmachung aufmerksam zu. Ich glaube, Horst hätte anziehen können, was er wollte – er hatte immer den ganzen Respekt seiner Mitarbeiter. Selbst wenn er vollkommen nackt am Rednerpult gestanden hätte, hätten seine Mitarbeiter ihm immer aufmerksam zugehört.
Respekt bekam man nicht geschenkt. Respekt musste man sich verdienen. Horst hatte sich seinen Respekt nicht durch schöne Worte verdient. Seine Taten hatten ihn zu dem gemacht, was er war. Ein Mann, der das tat, was er sagte.
Horst war absolut integer und ein Unternehmer mit einem sozialen Gewissen. Ein Mann, der sich seiner Verantwortung bewusst war. Ein Mann, der Verantwortung übernahm. Horst war mein großes Vorbild.
Als er mit seiner zwanzigminütigen Rede fertig war, schaute er ruhig in die Gesichter seiner immer noch irritiert dreinblickenden Mitarbeiter und kündigte dann mit einem Grinsen im Gesicht die Gruppe »Bläck Fööss« an.
Alle Mitarbeiter blickten noch irritierter zu Horst auf, der nun breit lachend am Rednerpult stand. Die Kantine war bis auf den letzten Platz gefüllt. Es herrschte eine unglaubliche Stille. Noch nie hatte ich zuvor eine solche Ruhe in diesem Saal erlebt.
Die Stille wurde plötzlich durch das Geräusch des sich öffnenden elektrischen Rolltores beendet. Ein Tor, durch das normalerweise die Warenlieferungen für die Küche transportiert wurden. Auf einer fahrbaren Bühne wurden die »Bläck Fööss« samt Instrumenten und Verstärker von einem Gabelstapler in die Halle gezogen.
Lautstark stimmte die Gruppe »De kölsche Jung« an. Der Saal bebte binnen Sekunden und aus der Belegschaftsversammlung wurde eine unvergessene Belegschaftsfeier. Erst da verstand ich, warum Horst unbedingt wollte, dass ich an dieser Versammlung teilnehmen sollte.
Bis auf »Miss Moneypenny« und Horst war niemand in diesen Show-Akt eingeweiht gewesen. Umso größer waren die Überraschung und die Freude für alle Mitarbeiter, als die »Bläck Fööss« den Saal zum Überkochen brachten. An diesem Tag herrschte Ausnahmezustand in der Winter AG. Dies war Horsts Art, seinen Mitarbeitern für ihre geleistete Arbeit zu danken.
Horst war ein Typ, der sich nicht leicht in eine bestimmte Schublade stecken ließ. Er hatte sich seinen Erfolg hart erarbeitet. Seine ersten Millionen hatte er mit Erfindungen gemacht, die er in seinem Keller entwickelte und anschließend patentieren ließ. Die Lizenzen vermarktete er äußerst gewinnbringend und legte so den Grundstock für die Gründung seiner Firma.
Noch heute zog er sich, wenn seine knapp bemessene Zeit es zuließ, in sein »Geheimlabor« zurück. Manchmal nächtelang. In seine, wie er es nannte, »Wunderkammer«.
Selbst ich hatte dieses »Geheimlabor« nie von innen gesehen. Und ich wusste, dass Horst mir hundertprozentig vertraute. Nie hätte er mir sonst seine Firma als Nachfolger angeboten.
Einmal, während eines schönen Grillabends bei Inge und Horst im Garten, brachte ich das Thema zur Sprache, dass ich doch unbedingt einmal in seine »Wunderkammer« schauen möchte, der Neugier wegen. Horst lächelte nur und schwieg.
Lachend meinte Inge, dass nicht einmal sie – und sie wären ja schließlich schon mehr als vierzig Jahre miteinander verheiratet – je seine »Wunderkammer« zu Gesicht bekommen hätte.
Damit war das Thema abgehakt und ich wusste, dass meine Neugier nie befriedigt werden würde.
Noch immer in seinem Büro sitzend, versprach ich Horst, das aktuelle Problem zur Zufriedenheit aller schnell zum Abschluss zu bringen. Riskante Aufträge wie dieser reizten mich immer sehr. An solchen Aufträgen konnte man sich schnell die Finger verbrennen und seinen guten Ruf ruinieren. Bei derartigen Schadenssummen ging es meist hoch her, und genau diese Anspannung brauchte ich nun einmal.
Die einen pflegten riskante Hobbys, um einen Nervenkitzel zu erleben, ich suchte mir halt solch kritische Aufträge aus.
Klar wollte der neue Eigentümer nicht die »Katze im Sack« kaufen. Wäre der Käufer der Winter AG nicht clever, würde seine Unternehmensgruppe mit Sicherheit nicht zu den TOP 100 in Europa zählen.
Plötzlich hörten wir, wie von dem firmeneigenen Heliport her ein lautes Dröhnen durch das geschlossene Fenster drang. Wir standen auf, schauten aus dem Fenster und sahen, wie die hübsche junge Dame, die ich zuvor auf dem Flur getroffen hatte, nun in einen Hubschrauber stieg. Auf dem seitlich angebrachten Firmenlogo stand »Lohr Group«.
Ich schaute Horst fragend an, und er antwortete mit einem verzückten Lächeln im Gesicht: »Sabrina Bremer, die Tochter des neuen Inhabers. Sie wird wohl die Geschäftsführerin der Winter AG werden.«
Ich staunte nicht schlecht über den Auftritt beziehungsweise Abgang dieser wirklich attraktiven und noch recht jungen Dame.
Ich bat Horst, doch bei dem neuen Inhaber unbedingt ein »gutes Wort« für mich einzulegen – mit dem Ausblick auf eine solche Chefin –, schließlich sei ich doch sein bester Berater …
Horst legte seine Hand auf meine Schulter und lachte dabei herzlich.
Plötzlich, während der Helikopter mit einem lauten Dröhnen aufstieg, klingelte das Telefon.
Fast hätten wir es überhört.
Es war Stein. Er war der Leiter der IT-Abteilung und gleichzeitig verantwortlich für die Werkssicherheit.
Horst möge dringend ins Testlabor kommen, es sei etwas Schreckliches passiert. Horst bat mich, ihn zu begleiten, und wir machten uns eilig auf den Weg. Stein wollte trotz Nachfrage nicht sagen, was passiert ist. Entsprechend neugierig waren wir.
Die im Testlabor beschäftigten Mitarbeiter waren sichtlich verstört und zeigten in Richtung des Raumes, in denen die Produkttests durchgeführt wurden.
Um einzutreten, musste normalerweise auch hier jeder seine ID-Karte an den Eingangsterminal halten.
Nur wenige hatten für diesen Raum eine Zutrittsberechtigung.
Diesmal stand die Tür jedoch weit offen. Wir traten ein und sahen Stein.
Er stand völlig geschockt und kreidebleich im Gesicht vor einer offenen Klimakammer.
Die übrigen fünf Klimakammern, die so groß waren, dass ein ganzes Auto in ihnen Platz hatte, waren verschlossen.
Wir gingen auf ihn zu und schauten nun auch in die Klimakammer hinein.
Peter Sorwa saß auf einem Stuhl in der Mitte der Klimakammer.
Ich schaute ihm ins Gesicht und blickte in seine weit aufgerissenen toten Augen. Sein Mund war leicht geöffnet und fast schien es so, als wollte er noch etwas sagen. Er war komplett mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Er war erfroren.
Uns bot sich ein grausames Bild, das ich wohl nie wieder vergessen werde. Horst und ich waren genauso geschockt wie Stein. Zwar hatte es schon einmal den ein oder anderen Werksunfall gegeben, aber einen Toten, den hatte es in der Winter AG bisher noch nie gegeben.
Horst wies Stein an, die Polizei zu rufen, und dann verließen wir den Raum. Immer noch völlig blass im Gesicht, setzte Horst sich erschöpft auf einen Stuhl, blickte mich an und sagte noch vollkommen mitgenommen: »Was hatte Sorwa in dem Testlabor zu suchen? Er hatte doch eigentlich gar keinen Zutritt für diesen Bereich.«
Sorwa gehörte zu den IT-Spezialisten, deren Arbeitsbereich im Gebäude 5 auf der zweiten Etage lag. Hier bei den Klimakammern hatte er eigentlich nichts verloren.
Die Polizei traf ein; ein Hauptkommissar Braun leitete die Ermittlungen. Braun schien vom Alter her kurz vor der Pensionierung zu stehen, und mit seinen längeren, ergrauten Haaren wirkte er wie einer, der dem Modetrend der sechziger Jahre treu geblieben ist.
Trotz seines Alters und seines modisch total veralteten Anzuges strahlte er die Gelassenheit und Souveränität eines erfahrenen Tatort-Ermittlers aus.
Als Erstes sichtete er den Fundort von Sorwa und fing dann sofort an, die Anwesenden zu befragen.
Die drei Mitarbeiter der Spurensicherung, die zusammen mit Braun eingetroffen waren, liefen in ihrer weißen Schutzkleidung durch den Raum und untersuchten alles äußerst sorgfältig. Auch der Terminal für die Zutrittsberechtigung wurde gründlich von einem Techniker der Spurensicherung untersucht.
Nach gut vier Stunden war die Spurensicherung abgeschlossen und der Raum wurde wieder freigegeben.
Horst und ich hatten uns während der Untersuchung in sein Büro zurückgezogen und warteten dort auf Hauptkommissar Braun.
Der Kommissar wurde von Miss Moneypenny ins Büro geführt.
Wir saßen wieder in der Besprechungsecke und Miss Moneypenny schenkte allen einen Kaffee ein, als uns Braun seine ersten Erkenntnisse mitteilte. Braun wusste, dass Horst nicht irgendjemand in Wuppertal war. Horst war einer der größten Arbeitgeber der Stadt. Entsprechend sorgsam wählte er seine Worte.
Nach Lage und Sichtung der ersten Spuren konnte eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden, erklärte er.
Bei dem Wort »Fremdeinwirkung« schaute ich Braun recht irritiert an. Was sollte es denn sonst gewesen sein?
Es konnte sich doch nur um einen Unfall oder Selbstmord handeln. »Wer sollte denn hier, in der Winter AG, Sorwa so etwas antun wollen?«, fragte ich mich, ohne dies jedoch laut zu äußern.
Auch nach weiteren zwei Wochen gab es keine neueren Erkenntnisse über Sorwas Todesumstände.
Sorwa hatte allein und zurückgezogen in einem Mehrfamilienhaus in Cronenberg gelebt. Seine Nachbarn beschrieben ihn als unauffälligen, zwar stillen, aber immer höflichen Mitbewohner.
Auch technisch war mit der Klimakammer alles in Ordnung gewesen. Die Notentriegelung war in einem ordnungsgemäßen Zustand. Jederzeit hätte er die Kammer verlassen können …
Einzig in seiner Wohnung fanden die Beamten sehr viele Firmenunterlagen, die mit der Programmierung der fehlerhaften Anlage in Zusammenhang standen. Sorwa hatte alle Programmversionen ausgedruckt und an die Wand geklebt.
Mit einem gelben Markierungsstift hatte er das Speicherdatum und die Uhrzeiten hervorgehoben.
Dies war das einzig Merkwürdige, was Braun gefunden hatte.
Merkwürdig deshalb, weil es Sorwa nicht erlaubt war, Firmenunterlagen mit nach Hause zu nehmen, und er sich sonst immer sehr strikt an Anweisungen gehalten hatte.
Die Polizei stellte ihre Untersuchungen ein, da auch die Autopsie keine weiteren Erkenntnisse geliefert hatte.
Die Akte Sorwa wurde mit dem Vermerk »Selbstmord« geschlossen.
Hatte er sich das Problem etwa so zu Herzen genommen? Niemand, nicht einmal Horst, hatte ihm je einen persönlichen Vorwurf wegen der falschen Programmierung des Lasers gemacht.
Ganz gleich, in welcher Branche: Fehler passierten nun einmal. Besonders dann, wenn man unter extremem Zeitdruck steht.
Die ganzen letzten Wochen hatte Sorwa, wie sonst auch, gemeinsam mit uns an der Lösung des Problems gearbeitet. Bei unseren gemeinsamen Besprechungen war er meist ruhig und zurückhaltend gewesen. Aber er war ja grundsätzlich eher der stillere Typ. Und so machte ich mir natürlich auch keine Gedanken darüber, dass er sich das Problem so zu Herzen hätte nehmen können.
Es gibt im Leben meist mehr Fragen als Antworten. Viele Fragen beantworten sich mit der Zeit von selbst, aber einige werden wohl für immer unbeantwortet bleiben. Welche Probleme und Sorgen Sorwa auch hatte – wir werden seine Beweggründe wohl nie erfahren …
Im Schadensfall mit dem Kunden wurde zwischenzeitlich eine für alle beteiligten Parteien tragbare und zufriedenstellende Lösung gefunden. Ein Rückruf wurde verhindert und die verbleibende Schadenssumme, die noch zur Diskussion stand, belief sich jetzt »nur« noch auf viereinhalb Millionen Euro.
Davon wurden rund zweieinhalb Millionen Euro von der Versicherung abgedeckt, und die restlichen zwei Millionen Euro wurden über eine eigens für solche Fälle gebildete Rückstellung der Winter AG gezahlt.
Die höhere Versicherungsprämie, die nun auf die Winter AG zukommen würde, konnte durch zwei neue Kundenaufträge kompensiert werden.
Ich konnte den Auftrag nun auch für mich erfolgreich abschließen und erhielt von Horst meine versprochene Prämie.
Vollkommen zufrieden freute ich mich nun auf meinen bevorstehenden und wohlverdienten Urlaub in der Provence.
URLAUB IM SÜDEN
Als ich am Abend von meinem wöchentlichen Kickbox-Training nach Hause kam, klingelte auch schon das Telefon. Es war mein Freund René. Dieses Mal wollte er sichergehen, dass ich auch wirklich zu ihm nach Frankreich kam.
Zu oft hatte ich ihn in den vergangenen Jahren schon vertröstet. Mehr als einmal musste ich ihm bereits kurz vor unserem geplanten Urlaub absagen. Immer kam bei mir ein neuer Auftrag dazwischen.
Mein Beruf als selbstständiger Berater gefiel mir zwar ganz gut, ich war unabhängig, hatte viel Abwechslung bei der Arbeit und lernte dabei noch die unterschiedlichsten Branchen kennen. Neue Leute, neue Länder und ja, die Bezahlung war auch nicht übel.
Aber wo viel Licht ist, da ist auch meist der Schatten nicht weit entfernt, und einer dieser Schatten war nun einmal der Tatsache geschuldet, dass, wenn ein Kunde anrief, man sehr schlecht Nein sagen konnte – zum Beispiel dann, wenn es Sonntag war oder ein bereits eingeplanter Urlaub vor der Tür stand. Einmal ein Nein, und der Kunde ist meist weg.
Ich bin in meinem Job zwar ganz gut und habe mir auch einen Namen gemacht. Aber ich bin nun einmal nicht alleine auf dem Markt, und ein Teil meiner Mitstreiter sind ebenfalls nicht schlecht in dem, was sie tun.
Die Millionenverträge erhielt ich sowieso nicht. Dieser Markt war von den wirklich großen Beratungsgesellschaften besetzt, und diese Aufträge wurden immer noch auf den Golfplätzen verteilt. Eine Jahresmitgliedschaft in einem dieser Clubs würde glatt schon einmal den Wert eines Sportwagens ausmachen. Ganz zu schweigen von den Kosten drum herum.
Der richtige Anzug musste her und bei Männern schaute »Mann« auch als Erstes auf die Schuhe und die Uhr. Und wenn diese dann aus einem Kaufhaus stammten, kam »Mann« erst gar nicht an dem Portier im Nobelclub vorbei.
Mit Grauen denke ich dabei noch an meine Zeit bei einer dieser großen Gesellschaften zurück – zu einer Zeit, als ich noch am Anfang meiner eigenen Karriere stand und für eine der weltweit größten Beratungsgesellschaften unterwegs war. Dieser Global Player unter den Beratungsgesellschaften hatte über Jahrzehnte hinweg ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut. Dessen Beziehungen reichten nahezu in alle großen Unternehmen.
Die Top-Berater akquirierten die Aufträge und hatten freien Zugang zu den Chefetagen. Anfänger in diesem Business wie ich damals, die frisch von der Uni kamen, mussten die eigentliche Arbeit leisten.
Die Strukturen dieser großen Gesellschaften sind nach dem Pyramidenprinzip aufgebaut. Ganz oben stand der »Big Boss«, der mit dem größten Verdienst und den geringsten Arbeitszeiten. Am untersten Ende standen die Berufsanfänger mit den geringsten Einkommen und den längsten Arbeitszeiten.
Damals war ich natürlich sehr froh und stolz darauf, einen Job bei diesem renommierten Unternehmen erhalten zu haben. Bereits vor Studienabschluss wurden die besten unseres Jahrgangs umworben und erhielten sofort einen Anstellungsvertrag.
Am Anfang – so naiv, wie wir nun einmal waren – fühlten wir uns wie die neuen Superhelden. Eine der größten Gesellschaften wollte uns haben! Diese Naivität verflog jedoch recht schnell. Rasch holte uns die Realität des Alltags ein.
Meine eigene persönliche Läuterung erhielt ich, als ich in Frankreich an der Restrukturierung eines größeren Industrieunternehmens, das Armaturen für Bäder herstellte, beteiligt war.
Wir hatten den Auftrag, die Prozesse zu optimieren und die Produktionskosten zu senken. Auf gut Deutsch: schlankere Prozesse entwickeln und Leute entlassen.
Eigentlich wollte ich bei diesem Auftrag gar nicht dabei sein. Jedoch machte mir mein damaliger Chef sehr deutlich, was dann passieren würde. Er ließ keinen Zweifel aufkommen.
Zwar hatte ich mittlerweile schon einige Aufträge erfolgreich abgeschlossen, hatte aber noch kein eigenes Netzwerk aufgebaut, um so als Einzelkämpfer am Beratermarkt zu agieren – und vor allem zu überleben.
Eine negative Beurteilung meines damaligen Arbeitgebers hätte meine weitere Zukunft in diesem Business schon früh beendet. Beendet, bevor sie überhaupt richtig angefangen hatte. Und auf Golf und Tennis hatte ich definitiv einfach keine Lust.
Als einer der wenigen, der fließend Französisch sprach, blieb mir damals nichts anderes übrig, als mit dem insgesamt sechsköpfigen Team mit nach Frankreich zu reisen.
Drei Monate lang analysierten und diskutierten wir. Nach unzähligen Überstunden stand nun fest, welche Prozesse geändert werden mussten, damit in diesem Unternehmen wieder Gewinne erwirtschaftet werden konnten. Auch stand jetzt fest, wer alles von der Entlassungswelle betroffen sein würde. Die Stimmung im gesamten Unternehmen war verständlicherweise nahe an der nächsten Eiszeit.
Als externe Berater und mit sämtlichen Vollmachten der Eigentümer ausgestattet, standen uns alle Türen im Unternehmen offen. Keine Dokumente, keine Abläufe blieben uns verborgen. Willkommen waren wir nicht … Dies war zwar verständlich, aber trotzdem war unser Ziel ja die Rettung dieses Unternehmens, um wenigstens den größten Teil der Arbeitsplätze zu erhalten.
Als ich eines Morgens, noch recht müde von der zuvor eingelegten Nachtschicht, die große Empfangshalle betrat, rief plötzlich jemand von der oberen Galerie aus ganz laut: »Ihr Verbrecher! Louise, ich liebe dich!«
Noch völlig in Gedanken versunken, drehte ich mich erschrocken um und sah, wie sich ein jüngerer Mann auf dem Geländer stehend von der fünften Etage aus in die Tiefe stürzte. Die Gespräche in der belebten Halle verstummten sofort und es herrschte eine bedrückende Stille. Binnen Sekunden schlug der Körper des Mannes, nicht einmal zwei Meter weit von mir entfernt, auf die weiß polierten Fliesen auf.
Die Frauen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Eingangshalle aufhielten, und die, die auf den oberen Etagen am Geländer standen, fingen sofort an zu schreien, und einige bekamen hysterische Heulkrämpfe. Den meisten anwesenden Männern stand, wie auch mir, das Entsetzen ins Gesicht geschrieben.
Ich erinnere mich noch genau, so als ob es gestern erst passiert wäre, wie ich zusammenzuckte und sich mein Magen bei dem Anblick des auf dem Boden liegenden verdrehten Körpers förmlich zusammenschnürte. Nie werde ich dieses Bild wieder aus meinem Kopf heraus bekommen. Ich sehe immer noch, wie das Blut und vermutlich die Gehirnmasse aus seinem durch den Sturz aufgeplatzten Kopf herausliefen. Dunkelrot verfärbten sich die weißen Fliesen. Wieder eins dieser Bilder, die mich wohl für den Rest meines Lebens verfolgen werden.
Wie ich später erfuhr, war es einer jener Angestellten aus der Verwaltung, der von der Kündigungswelle betroffen waren.
Er sah für sich wohl keinen anderen Ausweg mehr, als seinem Leben auf so spektakuläre Weise ein Ende zu setzen. Zwei Kinder mussten nun ohne Vater aufwachsen. Seine Frau musste nun stark sein und die Last der Schulden, die durch einen Hauskauf entstanden waren, alleine bewältigen.
Auf der einen Seite empfand ich natürlich Mitleid mit diesem Mann und seiner Familie. Jedoch mischte sich in mein Mitleid auch eine Art Verärgerung – ein Unverständnis darüber, dass er seine Frau und seine Kinder im Stich gelassen hatte.
Eine Entlassung war schlimm. Die finanziellen Folgen grausam. Aber das Ganze rechtfertigte es doch nicht, so einen Schritt zu gehen und sein Leben einfach wegzuwerfen. Ich konnte das nicht nachvollziehen! Wie konnte er nur aus diesem Grund seine Frau und seine Kinder alleine lassen?
Dieses Erlebnis bedeutete jedoch für mich, dass ich kündigte und mich endlich selbstständig machte. Solche Aufträge wollte ich definitiv nicht mehr übernehmen. Nach diesem Ereignis wollte mein damaliger Chef auch keinen Rechtsstreit mehr mit mir. Negative Presse hatte er durch den Vorfall schon reichlich erhalten.
So konnte ich mich dann doch ohne weitere Probleme von meinem damaligen Arbeitgeber trennen und erhielt zum Glück auch recht schnell einen ersten eigenen Auftrag.
Einen ersten Auftrag von Horst bei der Winter AG.
Als ich am Telefon, noch im Gespräch mit René, anfing zu jammern, dass mir noch alles vom Kickbox-Training schmerzte, fing René nur laut und herzhaft an zu lachen: »Du warst ja immer schon ein Weichei!« Er spielte damit immer gern auf den Tag an, als wir uns das erste Mal in Düsseldorf auf einem Kickbox-Turnier trafen und er mich im finalen Kampf glatt besiegte. Es machte René immer noch und jedes Mal aufs Neue viel Freude, mich daran zu erinnern.
Trotz meiner Niederlage haben wir uns von Anfang an gut verstanden und noch am gleichen Abend seinen Sieg in der Düsseldorfer Altstadt ausgiebig gefeiert.
Puh, was war das für ein Abend! Mir brummt heute noch der Kopf, wenn ich an den Morgen danach denke. Zu reichlich war das süffige Altbier in der gemütlichen Kneipe geflossen.
In der ganzen Zeit, in der wir uns kannten – und das waren mittlerweile acht Jahre – hatte er es auch nur dieses eine Mal geschafft, mich auf die »Bretter« zu schicken. Und das Ganze auch nur, weil ich für den Bruchteil einer Sekunde unaufmerksam war und seiner Schwester, die auch am Turnier teilnahm, schöne Augen machte. Blöd daran war nur, dass ich dies ausgerechnet mitten im Kampf tat und mich René daraufhin ausknockte. Seitdem werfe ich ihm natürlich vor, dass er seine Schwester bewusst als Ablenkung eingesetzt hätte. Darüber lacht er sich heute immer noch halb tot.
Frauen – irgendwann bringen die mich wirklich noch einmal um. Und dabei bin ich, wenn ich einmal verliebt bin, wirklich treu. Anders als Sabine, meine letzte Freundin.
Bloß jetzt nicht an Sabine denken, denn das würde mir dann doch noch den bevorstehenden Urlaub völlig vermiesen.





























