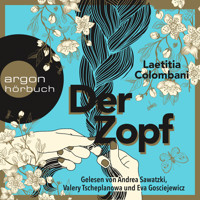8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Seine früheste Erinnerung ist der Duft von scharfem Curry. Als Hassan Haji über einem turbulenten Imbissladen in Bombay das Licht der Welt erblickt, ahnt niemand, welch großes Talent in ihm schlummert. Erst Tausende Kilometer entfernt, in einem verschlafenen französischen Dorf, entdeckt der Junge seine Leidenschaft für die hohe Kunst des Kochens – und gerät mitten hinein in eine handfeste Restaurant-Fehde: Seiner indischen Großfamilie und ihrem lebhaften Lokal schlägt die offene Verachtung der alteingesessenen Madame Mallory entgegen, die genau gegenüber einen sternedekorierten Gourmettempel führt. Bis sie Hassans Gabe erkennt und anbietet, ihn in die Geheimnisse der gehobenen Küche einzuführen. Doch nur wenn der Lehrling die Straßenseite wechselt und bei ihr einzieht – in die Höhle der Löwin…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Katy und Susan
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Monika Köpfer Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel The Hundred-Foot Journey bei Scribner, einem Imprint von Simon & Schuster, Inc., New York.
ISBN 978-3-492-95360-3 Juni 2015
© Richard C. Morais 2010 © der deutschsprachigen Ausgabe: Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2011 Umschlaggestaltung: Mediabureau Di Stefano, Berlin, unter Verwendung zweier Abbildungen von iStockphoto (Sawayasu Tsuji, Heidi Kalyani)
Bombay
Kapitel
Eins
Ich heiße Hassan Haji und wurde als zweites von sechs Kindern über dem Restaurant meines Großvaters in der Napean Sea Road geboren, in einer Gegend, die sich damals West Bombay nannte, lange bevor die Megacity ihren alten Namen Mumbai zurückerhielt. Vermutlich wurde mein Schicksal in jenem ersten Moment besiegelt, denn meine früheste Sinneswahrnehmung war der Duft von Machli ka Salan, eines scharfen Fischcurrys, der durch die Ritzen zwischen den Dielenbrettern vom Restaurant zu meinem Kinderbettchen im Zimmer meiner Eltern aufstieg. Noch heute meine ich die kühlen Gitterstäbe des Bettchens auf meinem Babygesicht zu spüren, wie damals, als ich die Nase zwischen den Stäben hinausreckte, um dieses aromatische Duftbündel aus Kardamom, Fischköpfen und Palmöl zu erschnuppern, das mich trotz meines zarten Alters gleichsam erahnen ließ, welch unergründlicher Erfahrungsschatz in der freien Welt jenseits meiner Stäbe darauf wartete, entdeckt oder besser gesagt gekostet zu werden.
Doch ich will von vorn beginnen. 1934 kehrte mein Großvater als junger Mann der Provinz Gujarat den Rücken und gelangte auf einem Waggondach der Dampfeisenbahn nach Bombay. Heutzutage entdecken in Indien zahlreiche aufstrebende Familien auf wundersame Weise edle Wurzeln, zum Beispiel Verwandte, die seinerzeit Seite an Seite mit dem jungen Mahatma Gandhi in Südafrika gearbeitet haben, doch mit derlei vornehmen Vorfahren kann ich nicht aufwarten. Wir waren arme Muslime, Kleinbauern aus dem staubigen Distrikt Bhavnagar, wo 1917 eine schlimme Braunfäule die Baumwollfelder zerstörte und meinem siebzehnjährigen Großvater keine andere Wahl ließ, als nach Bombay abzuwandern, in diese quirlige Metropole – seit jeher Anziehungspunkt für die kleinen Leute, die sich dort ein neues, besseres Leben erhofften.
Kurz und gut, die Weichen für mein späteres Berufsleben wurden also schon lange vor meiner Geburt mit der Hungersnot meines Großvaters gestellt. Und seine dreitägige Reise auf dem Dach der Dampfeisenbahn, an das er sich unter Lebensgefahr festklammerte, während die Dampflok unter der glühenden Sonne durch die indische Ebene tuckerte, war der nicht eben verheißungsvolle Beginn der langen Reise meiner Familie. Großvater sprach nie gern von seiner ersten Zeit in Bombay, doch ich weiß von Ammi, meiner Großmutter, dass er mehrere Jahre lang auf der Straße lebte und seinen kärglichen Lebensunterhalt durch das Ausliefern von Lunchpaketen an indische Angestellte verdiente, die damals in den Hinterzimmern der Verwaltung des Britischen Empire arbeiteten.
Um sich ein Bild von dem Bombay zu machen, das meine Geburtswiege war, sollte man sich während der Rushhour zum Victoria Terminus in Mumbai begeben. Dieser verkehrsreichste Bahnhof der Stadt spiegelt wie kein anderer Ort das Wesen indischen Lebens wider. Es gibt getrennte Abteile für Frauen und Männer, und Trauben von Pendlern hängen aus den Fenstern und Türen der Waggons, während die Züge ratternd auf den Gleisen in die Victoria und Churchgate Station einfahren. Die Waggons sind so überfüllt, dass nicht einmal mehr die Lunchpakete Platz finden, die dann in separaten Zügen außerhalb der Hauptverkehrszeit geliefert werden. Diese Lunchboxes – mehr als eine Million zerbeulte Blechdosen mit Deckel, die einen Geruch nach Daal, mit Ingwer gewürztem Kohl und Reis mit schwarzem Pfeffer verströmen und von treu sorgenden Ehefrauen auf den Weg gebracht wurden – finden, nachdem sie sortiert und auf Handkarren gestapelt wurden, mit äußerster Zuverlässigkeit ihren Weg zu sämtlichen Versicherungsangestellten und Bankkassierern in ganz Bombay.
Und genau das war die Aufgabe meines Großvaters. Er lieferte Lunchboxes aus.
Er war ein dabba-wallah. Nicht mehr. Und nicht weniger.
Großvater war ein ziemlich verdrießlicher Geselle. Wir nannten ihn Bapaji, und ich erinnere mich, wie er während des Ramadan kurz vor Sonnenuntergang auf der Straße vor dem Haus auf den Fersen kauerte, das Gesicht blass vor Hunger und Wut, und eine Bidi paffte, eine dieser indischen Zigaretten. Noch immer sehe ich ihn mit seiner dünnen Nase und den drahtigen Augenbrauen, seinem Käppi und seiner Kurta, beides fleckig, und seinem dünnen weißen Bart vor mir.
Nun, mürrisch hin oder her, er war für seine Familie ein verlässlicher Versorger. Mit dreiundzwanzig lieferte er täglich an die tausend Lunchboxes aus. Inzwischen arbeiteten vierzehn Boten für ihn, die – die wieselflinken Beine in einen Lungi gehüllt, den Männerrock armer Inder – mit ihren Karren durch die verstopften Straßen Bombays zuckelten und die Blechdosen zu den Verwaltungsgebäuden der Scottish Amicable und Eagle Star brachten, oder wie die Versicherungen und Banken alle hießen.
Es war 1938, wenn ich mich nicht irre, als er endlich Ammi nachkommen ließ. Die beiden waren schon mit vierzehn verheiratet worden, und so traf sie nach all den Jahren – eine winzige Kleinbäuerin mit öliger dunkler Haut und klimpernden, billigen Armreifen – mit dem Zug aus Gujarat ein. Auf den von einer Dampfwolke eingehüllten Gleisen kauerten die Gassenjungen rasch nieder, um ihr Geschäft zu verrichten, die Wasserträger priesen lauthals ihre Ware an und ein Strom müder Passagiere und Gepäckträger ergoss sich auf den Bahnsteig. Und ganz hinten, aus einem Waggon der dritten Klasse, stieg meine Ammi mit ihrem armseligen Bündel aus.
Großvater rief schroff ihren Namen und dann trotteten sie aus dem Bahnhofsgebäude hinaus, die brave Ehefrau vom Land in gebührendem Abstand zu ihrem Ehemann aus Bombay.
Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs bauten meine Großeltern im Slum hinter der Napean Sea Road ein kleines Schindelhaus. Bombay war das Hinterzimmer der Alliierten bei ihren Kriegsaktivitäten in Asien, und bald strömten Millionen von Soldaten aus aller Welt durch die Pforten der Stadt. Für viele Soldaten waren es die letzten friedlichen Tage, ehe sie sich in die heiß umkämpften Kriegsgebiete Burmas und der Philippinen begeben mussten. Ausgelassen tummelten sich die jungen Männer auf den Küstenstraßen Bombays, eine Zigarette im Mundwinkel, und beäugten neugierig die Prostituierten am Chowpatty-Strand.
Die Idee, den Männern kleine Mahlzeiten zu verkaufen, kam von meiner Großmutter Ammi, und mein Großvater willigte schließlich ein, neben dem Lunchbox-Lieferservice ein zweites Standbein zu errichten, eine mobile Imbiss-Kette in Form mehrerer Essensstände auf Fahrrädern. Und so hetzten diese Garküchenräder vom Juhu-Strand, wo sie die badenden Soldaten mit Snacks versorgt hatten, zur Churchgate Station, um sich dort in das allabendliche Gedränge zu mischen. Im Angebot hatten sie Zuckerwerk aus Honig und Nüssen, milchigen Tee und vor allem Bhelpuri, ein Gericht aus Puffreis, Chutney, Kartoffeln, Zwiebeln, Tomaten, Minze und Koriander, das in einer Zeitungstüte gereicht und üppig mit Gewürzen bestreut wurde.
Mmh, ein Gedicht, kann ich euch sagen, und es ist nicht weiter verwunderlich, dass diese Imbissstände auf Rädern ein kommerzieller Volltreffer wurden. Angespornt durch ihren Erfolg, rodeten meine Großeltern ein verlassenes Grundstück an der Napean Sea Road und eröffneten dort ein primitives Straßenrestaurant. Die Küche war mit einem US-Army-Zelt überdacht und bestand aus drei Tandori-Öfen und einer Reihe von Holzfeuern, über denen in eisernen Kadais Lamm-Masala schmorte. Im Schatten von Banyan-Bäumen stellten meine Großeltern Tische aus grob behauenem Holz auf und spannten ein paar Hängematten zwischen die Bäume. Großmutter engagierte Bappu, einen Koch aus einem Dorf in Kerala, und erweiterte so ihr nordindisches Repertoire durch Gerichte wie Zwiebel-Theal und scharfe, gegrillte Garnelen.
Soldaten, Seeleute und Flieger wuschen sich mit englischer Seife die Hände, in einem mit Wasser gefüllten Ölfass, und trockneten sie mit einem Handtuch ab, das man ihnen reichte, ehe sie es sich in einer Hängematte im Schatten eines Baumes bequem machten. Inzwischen waren einige Verwandte meiner Großeltern aus Gujarat zu den beiden gestoßen und verdingten sich als Kellner. Sie legten Holzbretter als behelfsmäßige Tische quer über die Hängematten und bestückten sie flink mit Schüsseln voller Hühnchenspieße, Basmatireis und Süßspeisen aus Butter und Honig. Wenn gerade mal wenig Betrieb herrschte, zeigte sich meine Großmutter in langem Hemd und Hose, der traditionellen Kleidung, die wir salwar kamiz nennen, und schlenderte zwischen den Hängematten umher, um mit den heimwehgeplagten Soldaten zu plaudern, die sich nach ihren Leibspeisen sehnten.
»Worauf haben Sie Lust?«, fragte sie. »Welches Gericht essen Sie am liebsten bei sich zu Hause?«
Die britischen Soldaten nannten die von ihnen so heißgeliebten Steaks mit Nierenpastete und schwärmten von dem heißen Dampf, der von der klumpigen Füllung aufstieg, sobald man die Teigkruste mit dem Messer zerteilte. Die Soldaten versuchten, einander in ihren Schwärmereien zu überbieten, und bald konnte man unter dem Zeltdach viele Ahs und Ohs vernehmen. Die Amerikaner, die den Briten in nichts nachstehen wollten, mühten sich redlich, die angemessenen Worte für ein Grillsteak zu finden, das von Rindern stammte, die auf den Sumpfweiden Floridas gegrast hatten.
Ausgerüstet mit diesem neuen Wissen, das sie auf ihren Rundgängen durch die Reihen der Gäste aufgeschnappt hatte, zog sich Ammi in die Küche zurück, um in ihren Tandori-Öfen Nachbildungen jener Gerichte zu kreieren, Interpretationen dessen, was sie vernommen hatte. Zum Beispiel ihre indische Variante eines Bread-and-Butter-Puddings, den sie mit frisch geriebener Muskatnuss bestäubte und der sich zum Schlager unter den britischen Soldaten mauserte. Die Amerikaner hingegen, fand sie heraus, waren sehr angetan von einer in ein Naan-Brot eingeschlagenen Füllung aus Erdnusssauce und Mango Chutney. Und so dauerte es nicht lang und die Kunde von unserem Restaurant verbreitete sich von den Gurkhas bis zu den britischen Soldaten und von den Kasernen bis zu den Kriegsschiffen. Den ganzen Tag lang hielten Jeeps vor dem Zelt an der Napean Sea Road.
Ammi war eine bemerkenswerte Person, und mein Werdegang ist zum großen Teil ihr Verdienst. Es gibt nichts Exquisiteres als ihren Pearlspot, einen einheimischen Fisch, den sie in einer Sweet-Chili-Gewürzmischung wendete, in ein Bananenblatt einschlug und mit einem Tropfen Kokosnussöl in einer Tawa-Pfanne briet. O ja, dieses im Grunde deftige, aber zugleich raffinierte Gericht ist für mich der Gipfel indischer Kultur und Kochkunst, und alles, was ich im Laufe meiner Karriere gekocht habe, musste sich an der Leibspeise meiner Großmutter messen lassen.
Auch besaß sie die erstaunliche Fähigkeit, über die jeder gute Chefkoch verfügen muss – sich gleichzeitig mehreren Aufgaben widmen zu können. Meine Kindheit verbrachte ich zum Gutteil damit zuzuschauen, wie dieses zarte Persönchen barfuß über den irdenen Küchenfußboden hin und her flitzte, schnell ein paar Auberginenscheiben in Kichererbsenmehl wendete und sie dann im Kadai briet, einer kleinen wokähnlichen Pfanne, während sie gleichzeitig einen Koch in die Seite knuffte, mir eine Mandelwaffel reichte und meine Tante wegen irgendeines Missgeschicks ausschalt.
Kurz und gut, Ammis Straßenzelt entpuppte sich bald als Goldesel und bescherte meinen Großeltern ein kleines Vermögen, angehäuft durch die harte Währung, die eine Million Soldaten und Matrosen und Flieger auf ihrer Zwischenstation bei uns in Bombay daließen.
Mit dem Erfolg kamen auch die Probleme. Bapaji war ein notorischer Geizhals. Die ganze Zeit schrie er uns wegen der geringsten Kleinigkeit an, etwa, wenn man zu viel Öl auf den Tawa-Grill träufelte. Das Geld war ihm sozusagen zu Kopf gestiegen. Misstrauisch gegenüber Nachbarn und unseren Verwandten aus Gujarat, versteckte Bapaji seine Ersparnisse in Kaffeedosen und fuhr jeden Sonntag zu einem geheimen Ort auf dem Land, wo er seinen schnöden Mammon in der Erde vergrub.
Doch der eigentliche Durchbruch meiner Großeltern ereignete sich 1942, als die britische Verwaltung in ihrem Bemühen, Geldmittel für den Krieg zu beschaffen, Grundstücke in Bombay versteigerte. Die meisten befanden sich auf Salsette, der großen Insel, auf der Bombay errichtet wurde. Doch auch schmale Landstreifen und Parzellen auf der im Süden gelegenen Halbinsel Colaba kamen unter den Hammer. Und darunter: das verlassene Grundstück an der Napean Sea Road, das sich meine Familie ohne Genehmigung angeeignet hatte.
Für Bapaji – im Innersten noch immer ein einfacher Bauer – war Land wertvoller als Papiergeld. Und so grub er eines schönen Tages all die Dosen wieder aus der Erde und begab sich mit einem Nachbarn an der Seite, der des Lesens und Schreibens kundig war, zur Standard Chartered Bank. Mit der Unterstützung der Bank ersteigerte Bapaji das 1,6 Hektar große Grundstück an der Napean Sea Road. Er bezahlte 1.016 englische Pfund, zehn Shilling und acht Pence für ein Stück Land zu Füßen des Malabar Hill, heute eine der beliebtesten Gegenden der Stadt.
Dann, und erst dann, stellte sich bei meinen Großeltern der Kindersegen ein. Dank der zupackenden Hilfe mehrerer Hebammen kam am Abend der berühmten Munitionsexplosion im Hafen von Bombay mein Vater, Abbas Haji, zur Welt. Riesige Feuerbälle schossen in den Abendhimmel, gewaltige Explosionen ließen in der ganzen Stadt die Fenster erbeben, als meine Großmutter plötzlich einen markerschütternden Schrei ausstieß und mein Vater aus ihrem Schoß plumpste und mit seinem Gebrüll den Explosionslärm und die Schreie seiner Mutter noch übertönte. Wann immer Ammi uns diese Anekdote in ihrer typischen Art erzählte, mussten wir herzlich lachen, denn jeder, der meinen Vater kannte, stimmte zu, dass er keine bessere Kulisse für seine Geburt hätte wählen können. Tantchen, die zwei Jahre später geboren wurde, sollte unter wesentlich ruhigeren Umständen das Licht der Welt erblicken.
Es folgten die Unabhängigkeit und Teilung Indiens. Das genaue Schicksal meiner Familie in jenen unrühmlichen Jahren ist und bleibt wahrscheinlich für immer ein Rätsel, denn auf keine der Fragen, die wir Papa später stellten, bekamen wir eine zufriedenstellende Antwort. »Ach, wisst ihr, es waren schlimme Zeiten damals«, sagte er zum Beispiel, wenn wir ihn wieder einmal bedrängten. »Aber wir haben uns durchgeschlagen. Und nun hört endlich auf mit eurem Polizeiverhör und bringt mir meine Zeitung.«
Wir wussten nur, dass die Familie meines Vaters, wie so viele andere auch, auseinandergerissen worden war. Die meisten unserer Verwandten flohen nach Pakistan, doch Bapaji blieb in Bombay, wo er seine Familie im Keller eines Warenlagers versteckte, das einem befreundeten Geschäftsmann, einem Hindu, gehörte. Ammi erzählte mir einmal, dass sie damals tagsüber schliefen, weil sie des Nachts von den Schreien und grausamen Straßenkämpfen wach gehalten wurden, bei denen die verfeindeten Hindus und Muslime einander die Kehle aufschlitzten.
Tatsächlich war das Indien, in dem Papa aufwuchs, ein ganz anderes als das, welches sein Vater gekannt hatte. Großvater war Analphabet, Papa besuchte die örtliche Hauptschule, die freilich alles andere als elitär war, doch immerhin schaffte er es später auf die Hotelfachschule, eine polytechnische Oberschule in Ahmedabad.
Im Zuge der Schulbildung wurden althergebrachte Stammessitten über Bord geworfen, und so lernte Papa in Ahmedabad Tahira kennen, ein hellhäutiges Mädchen, das eine Buchhaltungsausbildung absolvierte – meine Mutter. Papa erzählte, er habe sich zuerst in ihren Duft verliebt. Er war in ein Buch aus der Bücherei vertieft, als ihm ein höchst berauschendes Aroma in die Nase stieg, eine Mischung aus Chapati- und Rosenwasserduft.
»Und das«, sagte er, »war deine Mutter.«
Eine meiner frühesten Erinnerungen an Papa ist, wie wir auf der Mahatma Gandhi Road standen und er fest meine Hand drückte, während er zum »Hyderabad« starrte, einem damals äußerst beliebten Lokal. Gerade stiegen die steinreichen Banajis mit Freunden aus einem Mercedes aus, der von einem Chauffeur am Bordstein geparkt worden war. Die Frauen schnatterten mit schrillen Stimmen, gaben sich Küsschen und kommentierten gegenseitig ihre Gewichtsprobleme. Hinter ihnen stand ein Portier, ein Sikh, und riss schwungvoll die gläserne Restauranttür für die Ankommenden auf.
Das Hyderabad und sein Besitzer Uday Joshi, eine Art indischer Douglas Fairbanks junior, füllten regelmäßig die Klatschspalten der Bombay Times, und wann immer jener Name erwähnt wurde, fluchte mein Vater leise und raschelte aufgebracht mit der Zeitung. Obwohl unser eigenes Restaurant nicht in derselben Liga wie das Hyderabad spielte – unser Lokal war einfach und für jedermann, man bekam gutes Essen zu vernünftigen Preisen –, betrachtete Papa Uday Joshi als seinen größten Rivalen.
Und da stand mein Vater nun und sah zu, wie diese schicke Gesellschaft aus der Oberschicht in das Restaurant hineinschneite, um ein Mehndi zu zelebrieren, ein vorhochzeitliches Ritual, bei dem die Braut mit ihren Freundinnen auf Kissen thront und sich Hände und Füße kunstvoll mit Henna bemalen lässt. Bei dieser Gelegenheit gab es feines Essen, Live-Musik und reichlich gewürzten Tratsch. Und garantiert noch mehr Schlagzeilen für Joshi.
»Schau«, sagte Papa, »Gopan Kalam.«
Er kaute auf einer Schnurrbartspitze und knetete mit seiner feuchten Pranke meine Hand. Seinen Gesichtsausdruck werde ich nie vergessen. Es war, als hätten sich plötzlich die Wolken geteilt und als wäre ihm Allah persönlich erschienen. »Er ist Milliardär«, flüsterte Papa. »Sein Vermögen hat er mit Petrochemie und Telekommunikation gemacht. Da, sieh dir nur die Smaragde an, mit denen diese Frau behängt ist. Mein lieber Mann, sind das Klunker!«
Im selben Moment trat Uday Joshi durch die Glastür und mischte sich wie selbstverständlich unter die eleganten pfirsichfarbenen Saris und seidenen Nehru-Anzüge. Augenblicklich begannen die vier, fünf Zeitungsfotografen um seine Aufmerksamkeit zu buhlen, und von allen Seiten wurde er aufgefordert, hierhin und dorthin zu schauen. Joshi liebte bekanntermaßen alles Westliche, und so warf er sich in seinem schwarzen Pierre-Cardin-Anzug selbstbewusst vor den klickenden Kameras in Pose und ließ seine weißen Porzellankronen im Sonnenlicht aufblitzen.
Trotz meines zarten Alters zog mich der berühmte Gastronom in seinen Bann, als wäre er ein gefeierter Bollywood-Leinwanddarsteller. Ganz genau erinnere ich mich noch an das gelbe Seidenplastron, das er um den Hals trug, und seine luftig nach hinten toupierte silbrige Schmalzlocke, die zu fixieren wohl Unmengen von Haarspray gekostet hatte. Nie zuvor hatte ich eine elegantere Erscheinung gesehen.
»Schau ihn dir an«, zischte mir Papa zu, »nun schau dir bloß diesen kleinen aufgeplusterten Gockel an.«
Schließlich beschloss er, Joshis Anblick nicht eine Sekunde länger ertragen zu können. Er wandte sich abrupt um und zerrte mich hinter sich her, in Richtung des Suryodhaya-Supermarkts, um das Sonderangebot des Tages, ein Fünfzig-Liter-Fass mit Sonnenblumenöl, zu ergattern. Mit meinen acht Jahren hatte ich Mühe, mit seinem raschen Gang Schritt zu halten, während ihm die Kurta um die Beine flatterte.
»Hör mir gut zu«, brüllte er gegen den Verkehrslärm an. »Eines Tages wird der Name Haji in aller Munde sein und kein Hahn wird mehr nach diesem aufgeblasenen Schnösel krähen. Du wirst schon sehen. Frag dann die Leute, ob sie einen Uday Johsi kennen. ›Wer ist das?‹, werden sie antworten. ›Ich kenne nur die Hajis. Die Hajis‹, werden sie sagen, ›die sind eine vornehme, bedeutende Familie.‹«
Der langen Rede kurzer Sinn: Papa war ein Mensch mit großem Appetit. Mit seinen eins achtzig hatte er eine stolze Größe für einen Inder, war außerdem sehr beleibt, hatte pausbäckige Wangen, drahtiges Kraushaar und einen gewachsten Schnurrbart. Sein Lebtag lang trug er traditionelle indische Kleidung – Hose und darüber eine Kurta.
Aber ein kultivierter Mann war er nicht. Papa aß wie alle muslimischen Männer mit den Händen, mit der rechten Hand, um genau zu sein, während die linke im Schoß ruhte. Doch statt manierlich mit den Fingern das Essen zum Mund zu führen, beugte sich Papa tief über den Teller und schaufelte gierig fettes Lammfleisch und Reis in sich hinein, als wäre es seine erste Mahlzeit seit langem. Während er aß, geriet er heftig ins Schwitzen, und unter seinen Achseln breiteten sich tellergroße Schweißflecken aus. Und wenn er schließlich das Gesicht wieder hob, hatten seine Augen den glasigen Ausdruck eines Betrunkenen und Kinn und Wangen glänzten orange vor Fett.
Ich liebte ihn zwar sehr, doch kann ich nicht verhehlen, welch abschreckenden Anblick er in solchen Momenten bot. Nach dem Abendessen watschelte Papa zum Sofa und ließ sich schwer daraufplumpsen. Dann fächerte er sich eine halbe Stunde lang Luft zu, während er alle Anwesenden daran teilhaben ließ, wie er sich mit ausgiebigem Rülpsen und Furzen Erleichterung verschaffte. Meine Mutter, die aus einer geachteten Beamtenfamilie aus Delhi stammte, schloss angesichts dieses Verdauungsrituals angewidert die Augen. Und bei Tisch ermahnte sie ihn immerzu: »Iss langsam. Du wirst noch mal ersticken, wenn du dein Essen so hinunterschlingst. Gütiger Himmel, wir sind hier doch nicht im Schweinestall.«
Und doch musste man Papa bewundern für sein Charisma und die Entschlossenheit, mit der er seinen Weg ging. Als ich 1970 zur Welt kam, war das Familienrestaurant bereits fest in seinen Händen. Großvater, der unter einem Lungenemphysem litt, saß die meiste Zeit in einem Lehnstuhl im Hof, wo er – an guten Tagen – den Lunchbox-Lieferservice beaufsichtigte.
Ammis Zelt war durch einen grauen Gebäudekomplex aus Beton und Ziegeln ersetzt worden. Unsere Familie wohnte im ersten Stock über dem Restaurant im Haupthaus. Meine kinderlose Tante – wir nannten sie Tantchen – und ihr Mann hatten das Haus nebenan, und den Abschluss unserer kleinen Familienenklave bildeten zwei würfelartige zweigeschossige Bretterbuden, in denen Bappu, unser Koch aus Kerala, und die anderen Bediensteten auf dem Boden schliefen.
Das Herzstück des alten Familienbetriebs war indessen der Innenhof. An der hinteren Mauer lehnten die Lunchbox-Handkarren und Imbissstände auf Rädern, und im Schatten einer schlaffen Plane lagerten die großen Kessel mit Karpfenkopfsuppe, Stapel von Bananenblättern und frisch zubereitete Samosas auf Wachspapier. An der gegenüberliegenden Mauer standen große Blechfässer mit gesprenkeltem Reis, gewürzt mit Lorbeerblättern und Kardamom, und über allen Köstlichkeiten war das unaufhörliche Summen unzähliger Fliegen vernehmbar.
Für gewöhnlich saß ein Diener auf einem Segeltuchsack an der Hintertür der Küche und säuberte die Basmatikörner von schwarzen Verunreinigungen; eine Dienerin mit ölgetränktem Haar, den Sari zwischen den Beinen hochgerafft, um sich tief hinabbeugen zu können, kehrte mit einem kurzen Handbesen unermüdlich den Boden aus gestampfter Erde. Unser Hof war immer voller Leben, es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, sodass die Hühner den ganzen Tag aufgescheucht hin und her rannten. Noch heute meine ich, ihr nervöses Gackern zu hören.
Wenn ich in der größten Nachmittagshitze von der Schule zurückkam, traf ich dort Ammi an. Sie saß im Schatten des Dachvorsprungs, der einen Teil des Innenhofs überdeckte. Ich kletterte auf eine Kiste, um an ihrer scharfen Fischsuppe zu schnuppern, deren Dampf mir das Gesicht rötete. Sie fragte mich, wie es in der Schule gewesen sei, ehe sie mir den Kochlöffel reichte, damit ich weiter in dem Kessel rührte. Und noch immer sehe ich sie vor mir, wie sie grazil den Saum ihres Saris hielt und sich an die Mauer zurückzog, von wo aus sie mich im Auge hatte, während sie ihre eiserne Pfeife paffte, eine Angewohnheit, die sie sich aus ihrer Zeit im dörflichen Gujarat bewahrt hatte.
An all dies erinnere ich mich, als wäre es erst gestern gewesen: wie ich beim unaufhörlichen Rühren im Takt des Straßenlärms zum ersten Mal jenes Gefühl magischer Trance verspürte, das mich stets beim Kochen begleitet. Ein laues Lüftchen wehte über den Hof und trug das entfernte Kläffen der Hunde, das Rauschen des Verkehrs und den beißenden Abwassergeruch Bombays zu uns herüber. Währenddessen kauerte Ammi in ihrer schattigen Ecke, das winzige, runzlige Gesicht eingehüllt in eine Tabakwolke; und von oben hörte man die mädchenhaften Stimmen meiner Mutter und Tante, die auf der Veranda im ersten Stock Teigtaschen mit einer Füllung aus Kichererbsen und Chili formten. Doch am gegenwärtigsten von allem ist mir noch immer das rhythmische Kratzen meines eisernen Kochlöffels auf dem Boden des Kessels, der die verborgenen Schätze aus den Tiefen der Suppe emporförderte: knochige Fischköpfe mit weißen Augen, die auf rubinroten Strudeln an die Oberfläche trudelten.
Noch heute träume ich von jenem Ort. Kaum hatte man die Geborgenheit unseres Grundstücks hinter sich gelassen, fand man sich am Rand der berüchtigten Barackenstadt an der Napean Sea Road wieder. Das Elendsviertel war ein Meer aus zusammengeflickten Dächern über schiefen Schindelhütten, zwischen denen sich stinkende Rinnsale hindurchschlängelten. Aus den Behausungen stieg der beißende Geruch von Kohlefeuer und verrottetem Kohl auf, und in den Straßen hörte man das Krähen der Hähne, das Meckern der Ziegen und das dumpfe Klatschen von Wäschestücken auf Zementplatten. Ein Ort, an dem Kinder und auch Erwachsene ihre Notdurft auf den Straßen verrichteten.
Doch die gegenüberliegende Seite der Stadt kündete von einem anderen Indien. So wie ich wurde das Land groß. Auf dem Malabar Hill hinter uns wuchsen bald unzählige Kräne in den Himmel, mit denen zwischen den alten umzäumten Villen weiße Hochhäuser hochgezogen wurden, die auf »Miramar«, »Palm Beach« oder einen ähnlich verheißungsvollen Namen getauft wurden. Ich habe keine Ahnung, wo all die Wohlhabenden plötzlich herkamen, die gleich Göttern vom Himmel gefallen schienen. Ringsherum war nur noch die Rede von frischgebackenen Informatikern, Paschminaschal-Exporteuren oder Regenschirmherstellern und was es noch an neuen Berufszweigen gab – Millionären, die zunächst Hunderte zählten und schließlich Tausende.
Einmal im Monat besuchte Papa den Malabar Hill. Zu diesem Anlass zog er eine frische Kurta an, ehe er mich bei der Hand nahm und mit mir den Berg hinaufging, um den mächtigen Politikern »unsere Aufwartung« zu machen. Diskret wählten wir die Hintereingänge der vanillefarbenen Villen, und ein weiß behandschuhter Butler wies wortlos auf einen Terrakottatopf am Eingang. Dort hinein legte Papa seinen braunen Umschlag auf den Berg bereits vorhandener Kuverts, ehe die Tür ganz und gar unfeierlich vor unserer Nase wieder zugeschlagen wurde und wir unseren Weg mit den Umschlägen voller Rupien fortsetzten, zum nächsten Mitglied des Regionalkongresses von Bombay. Aber dabei gab es gewisse Regeln zu beachten. Niemals die Vordertür zu benutzen, lautete eine. Immer durch die Hintertür.
Danach kaufte uns Papa, ein Ghasel auf den Lippen, Mangosaft und gegrillte Maiskolben, und wir setzten uns auf eine Bank in den Hanging Gardens, dem öffentlichen Park auf dem Gipfel des Malabar Hill. Von unserem Aussichtsplatz unter Palmen und Bougainvillea konnten wir das Kommen und Gehen vor dem »Broadway« beobachten, einem funkelnagelneuen Apartmenthochhaus jenseits der brennend heißen Grünanlage: ein Geschäftsmann, der in seinen Mercedes stieg; die Kinder, die in ihren Schuluniformen herauskamen; die Ehefrauen auf ihrem Weg zum Tennis oder Nachmittagstee. Ein unaufhörlicher Strom wohlhabender Jains – seidene Gewänder, offene Hemden, die behaarte Männerbrüste entblößten, goldgefasste Brillen – zog an uns vorbei zum Jain Mandir, um in dem Tempel ihre Götzenbilder mit Sandelholzpaste zu waschen.
Papa senkte die Zähne in die Maiskörner und arbeitete sich nagend am Kolben entlang. Gelbe Körner blieben an seinem Schnurrbart, den Wangen und im Haar haften. »Geld wie Heu«, sagte er und leckte sich die Lippen, während er mit seinem abgenagten Kolben in Richtung der gegenüberliegenden Straßenseite fuchtelte. »Stinkreiche Leute.«
Ein Mädchen und ihre Nanny, offensichtlich auf dem Weg zu einem Kindergeburtstag, tauchten aus einem Apartmenthaus auf und hielten ein Taxi an.
»Das Mädchen dort drüben ist an meiner Schule. Ich sehe sie ab und zu auf dem Schulhof.«
Papa schleuderte seinen abgenagten Kolben in die Büsche und wischte sich mit dem Taschentuch übers Gesicht.
»So?«, sagte er. »Ist sie nett?«
»Nein. Sie glaubt, sie ist rattenscharf.«
Ich erinnere mich, wie in diesem Moment ein Lieferwagen vor dem Eingang des Apartmenthauses vorfuhr. Er gehörte unserem legendären Gastronom Uday Joshi, der sich einen neuen Geschäftszweig hatte einfallen lassen – Heimservice für die gutsituierten Bewohner, für jene beschwerlichen Tage, an denen das Hauspersonal frei hatte. Ein riesenhaftes Abbild eines winkenden Joshi starrte uns von der Wagenflanke an, und eine Sprechblase aus seinem Mund verkündete: Kein Schmutz. Kein Verdruss. Überlassen Sie’s uns.
Der Portier hielt die Tür auf, während der Catering-Lieferant in weißem Jackett aus dem hinteren Teil des Lieferwagens sprang, beladen mit mehreren Aluminiumbehältern und folienbedeckten Tabletts. Und noch heute höre ich Papa mit tiefer Stimme grollen:
»Was hat dieser Joshi denn jetzt wieder vor?«
Es war lange her, dass mein Vater das US-Army-Zelt durch ein Backsteingebäude und Plastiktische ersetzt hatte. Das Restaurant war ein einfacher, lang gezogener Saal, der vom Lärm widerhallte. Als ich zwölf war, beschloss Papa, eine weitere Stufe auf der gastronomischen Leiter zu erklimmen, etwas mehr in Richtung von Joshis Hyderabad. Und so verwandelte er unser altes Familienlokal in ein 365 Sitzplätze fassendes Restaurant und nannte es »Bollywood Nights«.
Ein steinerner Springbrunnen musste her. An die Deckenmitte des Speisesaals brachte Papa eine verspiegelte Diskokugel an, die über einer winzigen Tanzfläche rotierte. Die Wände hatte er golden streichen lassen, ehe er sie nach und nach mit signierten Fotos von Bollywoodstars bestückte – so hatte er es auf Abbildungen eines Hollywood-Restaurants gesehen. Er hatte Filmsternchen und ihre Ehemänner bestochen, damit sie dem Restaurant mehrmals im Monat einen Besuch abstatteten, und – welch ein Zufall – ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt war jedes Mal ein Fotoreporter des Hochglanzmagazins Hello Bombay! zugegen. Für die Wochenenden engagierte er zwei Sänger, die den äußerst populären Stars Alka Yagnik und Udit Narayan wie aus dem Gesicht geschnitten waren.
Das Restaurant schlug ein wie eine Bombe, sodass Papa nur wenige Jahre nach der Eröffnung von Bollywood Nights unserem Familienbetrieb ein Chinalokal hinzufügte. Und eine richtige Disko mit einer Rauchmaschine, die zu meinem Verdruss nur Umar, mein ältester Bruder, bedienen durfte. Inzwischen wurde unser gesamtes anderthalb Hektar umfassendes Gelände von Restaurants eingenommen, die 568 Sitzplätze boten, pulsierende Lokale, die von den Yuppies Bombays frequentiert wurden.
Die Räume hallten von stampfenden Diskorhythmen und ausgelassenem Gelächter wider. In der Luft hing der Geruch von Chili und gegrilltem Fisch, der sich mit dem feuchten Aroma von verschüttetem Kingfisher-Bier vermischte. Papa, den jeder nur Big Abbas rief, war für diese Arbeit wie geschaffen, und den lieben langen Tag watschelte er durch seine Restaurants wie ein Bollywood-Produzent über sein Filmgelände, während er Befehle bellte und gelegentlich einem nachlässigen Servierjungen eine Ohrfeige gab, und begrüßte die Gäste. Immer unter Strom. »Los, nun mach schon!«, rief er ständig. »Geht’s auch schneller, oder warum schleichst du rum wie ein altes Weib?«
Meine Mutter hingegen war der dringend benötigte Ruhepol, stets bereit, Papa mit ihrem gesunden Menschenverstand auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Ich erinnere mich, wie sie direkt über dem Eingang des Hauptrestaurants in einem käfigartigen Bau saß und in ihrem luftigen Hochsitz Zahlen in die Geschäftsbücher kritzelte.
Doch über allem kreisten die Geier, die sich von den Leichen im Turm des Schweigens nährten, der Begräbnisstätte der Parsen oben auf dem Malabar Hill.
An diese Geier erinnere ich mich ebenfalls.
Immerzu kreisten sie und kreisten und kreisten.
Kapitel
Zwei
Doch ich will lieber in schöneren Erinnerungen schwelgen. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich unsere alte Küche vor mir, rieche die Nelken und Lorbeerblätter und höre das Zischen des Öls im Kadai. Linkerhand befanden sich Bappus Gasherd und Tawa-Grills. Für gewöhnlich stand er davor und nippte an seinem milchigen Tee, während die vier verschiedenen Masalas, die die Basis der indischen Küche bilden, unter seinem wachsamen Auge vor sich hin blubberten. Auf seinem Kopf saß eine Toque, die hoch aufragende weiße Mütze des Chefkochs, auf die er so stolz war. Muntere Küchenschaben flitzten mit wackelnden Antennen über die bereitstehenden Tabletts mit rohen Meeresfrüchten und Seebrassen. Und stets hatte er jene kleinen Schüsseln zur Hand, die zu seinem Berufsstand gehören: gefüllt mit Knoblauchwasser, grünen Erbsen, einem cremigen Kokosnuss- und Cashew-Mus, Chili- und Ingwerpürees.
Wenn Bappu mich an der Tür erspähte, winkte er mich zu sich, damit ich zuschaute, wie er Lammhirn von einer Platte in den Kadai gleiten ließ, wo sich die rosa Masse mit brutzelnden Zwiebeln und heftig spuckendem Zitronengras vereinte. Neben Bappu stand ein zweihundert Liter fassendes Stahlfass mit Hüttenkäse und Bockshornklee, eine leise köchelnde milchige Suppe, in der zwei Küchenjungen gleichmütig mit Holzkochlöffeln rührten. Und auf der rechten Seite der Küche, in gebührendem Abstand, machten sich unsere Köche aus Uttar Pradesh zu schaffen.
Meine Großmutter hatte beschlossen, dass nur diese Nordländer das richtige Gespür für die Tandori hatten, die zylindrischen Holzkohleöfen, aus denen die Männer Grillspieße mit marinierten Auberginen und Hühnchenfleisch oder grüner Paprika mit Garnelen hervorzauberten. Und oben im ersten Stock arbeiteten die Lehrlinge, kaum älter als ich, unter einem gelben Blumenkranz, eingehüllt in Weihrauch.
Ihre Aufgabe war es, das restliche Tandori-Hühnchenfleisch von den Knochen zu lösen, Bohnen über einem Fass aufzubrechen und Ingwer zu schälen und zu raspeln. Diese Jungen, die in ihrer Freizeit in den Gassen Zigaretten rauchten und den Mädchen hinterherpfiffen, waren meine Idole. Einen beträchtlichen Teil meiner Jugend verbrachte ich damit, auf einem Schemel in der Kaltküche zu sitzen und mit ihnen zu plaudern. Aufmerksam schaute ich zu, wenn einer der Lehrlinge mit einem Messer fein säuberlich Okras zerteilte und mit der Fingerspitze grellrote Chilipaste auf die weißen Innenseiten der Gemüseschenkel strich. Es gibt wohl kaum eine anmutigere Erscheinung als einen kohlrabenschwarzen Jungen aus Kerala, der Koriander klein hackt: ein blitzschnelles Hantieren mit einem scharfen Messer und einem Wiegemesser – und in Sekundenschnelle werden widerborstige Blätter und Stängel zu einer feinen grünen Farce zerkleinert. Welch faszinierender Anblick.
Eine meiner liebsten Ferienbeschäftigungen war jedoch, Bappu frühmorgens zum Crawford Market in Bombay zu begleiten. Eigentlich ging ich mit, weil ich hoffte, bei dieser Gelegenheit meine geliebten Jalebis zu ergattern, in heißem Fett ausgebackene Spritzgebäckteilchen aus Daal und Mehl, die anschließend in Zuckersirup getränkt werden. Doch auch wenn ich am Ende in Sachen Jalebismeist leer ausging, bot sich mir eine viel wertvollere Gelegenheit: Ich erlernte die für einen guten Chefkoch so unerlässliche Fähigkeit, die frischesten Produkte auszuwählen.
Wir begannen unsere Tour bei den Obst- und Gemüseständen, wo sich in den schmalen Gängen die Körbe türmten. Die Obsthändler hatten aus Granatäpfeln kunstvolle Türme errichtet, zu deren Füßen ein fächerförmiges purpurrotes Gewebe in Form von Lotusblüten drapiert war. Körbe voller Kokosnüsse, Sternfrüchte und Bohnen stapelten sich zu mehreren Etagen und bildeten eine süßlich duftende Gruft. Stets waren die Korridore zwischen den Ständen sauber gefegt und die kostbaren handpolierten Früchte glänzten wächsern.
Ein Junge meines Alters kauerte hoch oben in einem Regal auf den Fersen, und als Bappu stehen blieb, um eine neue kernlose Traubensorte zu kosten, hoppelte der Kleine zu einer Messingschüssel mit Wasser, die ein paar Meter entfernt stand, wusch rasch drei, vier Trauben und reichte sie zu uns hinunter, damit wir sie kosteten. »Sie sind kernlos!«, rief uns der Standbesitzer aus dem Schatten seines Standes zu, wo er auf einem dreibeinigen Hocker saß. »Das Allerneuste. Kriegst ’n Sonderpreis, Bappu, wenn de ’n Kilo nimmst.« Manchmal kaufte Bappu die Ware und manchmal nicht, stets darauf bedacht, die Verkäufer gegeneinander auszuspielen.
Zum Fleischmarkt nahmen wir eine Abkürzung zwischen Ställen und Käfigen hindurch, in denen hechelnde Hasen und kreischende Papageien ihrem Schicksal entgegensahen. Die Hühner und Truthähne verströmten einen beißenden Geruch, ähnlich wie eine Dorflatrine. Aus den überfüllten Käfigen dröhnte ein ohrenbetäubendes Gackern, und immer wieder ragte zwischen dem Gefieder ein nackter Bürzel hervor, dem in dem Gedränge die Federn abhandengekommen waren. Der Geflügelmetzger stand, ein Liedchen auf den Lippen, in einem roten Blutregen hinter dem Hackblock, zu seinen Füßen ein Korb mit blutigen Hühnerköpfen und Kehllappen.
Dort lehrte mich Bappu, wie man die Haut eines Huhns begutachtet, wie man sich davon überzeugt, dass das Fleisch zart ist, und wie man das Alter eines Huhns ermittelt, indem man die Flügel spreizt und den Schnabel aufbiegt, um so die Elastizität zu überprüfen. Doch das untrüglichste Zeichen für ein schmackhaftes Huhn seien pummelige Knie, wie er mir erklärte.
Sobald wir die kalte Halle des Fleischmarktes betraten, bekam ich eine Gänsehaut, und meine Augen brauchten eine Weile, um sich an das schummrige Licht zu gewöhnen. Ein übler Geruch schlug einem entgegen. Und das Nächste, was ich wahrnahm, war ein Metzger, der mit einem riesigen Messer zähes, sehniges Fleisch zerkleinerte. Von rhythmischem Hacken begleitet gingen wir weiter, vorbei an Abflussrinnen rot vor Blut, während in der Luft der süßliche Geruch des Todes lag.
Am Stand des Halal-Metzgers Akbar hingen Schafe mit frisch aufgeschlitzter Kehle in Reih und Glied an Haken. Bappu schlängelte sich zwischen diesen wie seltsame Bäume anmutenden Wesen hindurch und betatschte das fellbedeckte Fleisch der Tiere. Wenn er schließlich eines fand, das seinen Ansprüchen genügte, feilschten Akbar und Bappu eine Weile miteinander, begleitet von den üblichen Ritualen wie Brüllen und gelegentlichem Ausspucken, bis sie sich schließlich handelseinig wurden, indem sie sich mit den Fingerspitzen berührten. Dann brauchte Akbar nur die Hand zu heben und einer seiner Gehilfen senkte eine Axtschneide in die Brust des ausgewählten Tiers. Ein roter Schwall ergoss sich auf unsere Sandalen und aus dem klaffenden Schnitt quollen die graublauen Schläuche der Eingeweide zu Boden.
Ich erinnere mich, wie ich den Kopf in den Nacken legte und zu den Raben blickte, die über uns auf den Dachsparren hockten und zu uns herabstarrten, während der Schlachter routiniert den Hammel häutete und zerlegte und die Läufe in Wachspapier wickelte. Die Vögel stießen ihr raues Krächzen aus und lüpften die Flügel, und an den Pfeilern zogen sich die weißen Spuren ihres Kots herab, der mitunter auf das Fleisch tropfte. Und wann immer ich heute in meinem Pariser Restaurant eine meiner aberwitzigen »künstlerischen« Kreationen ersinne, rufe ich mir dieses raue Krächzen der Raben im Crawford Market ins Gedächtnis, die mich warnen, doch besser mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben.
Mein bevorzugtes Ziel war jedoch der Fischmarkt. Bappu und ich suchten ihn stets erst zum Schluss auf. Beladen mit unseren morgendlichen Einkäufen, hüpften wir über die von Fischinnereien verstopften Abflussrinnen, die sich im Laufe des Morgens in öliggraue Seen verwandelten. Zielsicher steuerten wir den Stand des Fischhändlers Anwar im hinteren Teil des überdachten Markts an.
Die Hindus hatten die Betonsäulen, die das Dach des Fischmarktes trugen, mit gelben Girlanden geschmückt, und verbrannten Weihrauch unter den Abbildungen von Shirdi Sai Baba. Bottiche mit Fischen wurden hereingetragen – ein silbernes Gemisch aus großäugigen Pomfrets, Karimeen und Seebrassen –, und hie und da sah man einen Haufen schwefliger Bombay Ducks, dieser gesalzenen Shiner, die nicht aus der indischen Küche wegzudenken sind. Um neun Uhr morgens, wenn die Frühschicht Feierabend hatte, zogen sich die Arbeiter unter einem weiten Gewand um, wuschen sich über einem rostigen Eimer und schrubbten sich mit Kernseife die Schuppen von ihren Lungis. In dunklen Nischen glühten Kohlefeuer, die die Arbeiter durch behutsames Luftfächern am Leben hielten, um darüber ihr einfaches Reis- und Linsengericht zuzubereiten. Nach dem Essen legten sich die Männer, unempfindlich gegenüber dem Lärm, zu einem Nickerchen auf den Boden, ein Stück Pappe als Unterlage und den Kopf auf ihre Jutetasche gebettet.
Ach, welch herrliche Fische es hier gab! Wir passierten ölige Bonitos mit silbrigen Leibern und platten glasig-gelblich Köpfen. Ich konnte mich nicht sattsehen an den Tabletts voller Tintenfische mit ihrer lila schillernden Haut, glänzend wie eine Penisspitze, und an den Weidenkörben voller Seeigel, die aufgeschnitten dalagen, um ihre saftigen orangen Eier zur Schau zu stellen.
Und überall auf dem Zementboden türmten sich Berge von Eis auf, aus denen Fischköpfe und Flossen in merkwürdigen Winkeln herausragten. Es herrschte ein ohrenbetäubender Lärm. In das Rattern von Eisenketten, das krachende Geräusch der Eismühlen und das Krächzen der Raben oben in den Dachsparren mischten sich die monotonen Singsänge der Versteigerer. Eine Welt, die mich unweigerlich in ihren Bann zog.
Und schließlich, ganz am Ende des Crawford Market, betraten wir Anwars Reich. Der Fischhändler thronte ganz in Weiß im Schneidersitz auf einem Metallschreibtisch, inmitten brusthoher Eisberge mit Fisch. Neben ihm auf dem Schreibtisch standen drei Telefone, ein weißes, ein rotes und ein schwarzes. Als ich ihn zum ersten Mal sah, musste ich blinzeln, und ich brauchte eine Weile, bis ich erkannte, dass die Kreatur, die er in seinem Schoß streichelte, eine Katze war. Dann rührte sich noch etwas, und mit einem Mal wurde mir bewusst, dass der ganze Metallschreibtisch von etwa einem halben Dutzend zufriedener Katzen eingenommen wurde. Hin und wieder bewegten sie träge den Schwanz, leckten sich die Pfoten und hoben bei unserer Ankunft hochmütig den Kopf.
Und ob ihr’s glaubt oder nicht: Sowohl Anwar als auch seine Katzen kannten sich mit Fisch aus. Gemeinsam verfolgten sie wachsamen Auges das Hin- und Herschieben der Kisten auf dem Boden. Eine leichte Bewegung mit dem Kopf oder ein leises Schnalzen mit der Zunge genügte, und schon flitzte einer von Anwars Arbeitern herbei, um einen rosa Auftragszettel entgegenzunehmen, oder lief einem Koli-Fischer entgegen, einem Nachfahren der Ureinwohner Bombays, der mit seinem frischen Fang gerade die Halle betrat. Anwars Arbeiter stammten allesamt aus der benachbarten Mohammed Ali Road und waren ihm zutiefst ergeben. Den lieben langen Tag kauerten sie zu seinen Füßen und sortierten Hummer und Krebse, zerteilten fleischigen Thunfisch und entschuppten mit grimmigem Gesicht Brassen.
Fünf Mal am Tag rollte Anwar hinter einer Säule seinen Gebetsteppich aus, um seine Gebete zu sprechen. Doch ansonsten traf man ihn stets im Schneidersitz auf seinem zerbeulten Metallschreibtisch im hinteren Teil des Marktes an. Den ganzen Tag verbrachte er damit, seine nackten Füße mit den langen gelben, gebogenen Zehennägeln zu massieren.
»Hassan«, sagte er und zupfte an seinem großen Zeh, »du bist zu klein. Sag Großem Abbas, er soll dir mehr Fisch zu essen geben. Gerade ist guter Thunfisch aus Goa eingetroffen.«
»Was, das soll Fisch sein, guter Mann? Der taugt höchstens als Katzenfutter«, entgegnete ich.
Anwar ließ ein raues Husten und Krächzen vernehmen, was bedeutete, dass er sich köstlich über meine im Tonfall von Bappu geäußerte Replik amüsierte. An Tagen, an denen seine Telefone nicht stillstanden – wenn die Restaurants und Hotels von Bombay ihre Bestellungen durchgaben –, bot Anwar Bappu und mir höflich milchigen Tee an und fuhr dann fort, rosa Auftragszettel auszufüllen und mit strenger Miene aufmerksam seine Arbeiter beim Bestücken der Kisten zu überwachen. An Tagen, an denen wenig los war, nahm er mich beiseite und zeigte mir anhand einer frisch eingetroffenen Kiste, wie man die Qualität eines Fischs bestimmte.
»Das Auge muss klar sein, Junge, nicht wie das hier«, sagte er und deutete mit einem geschwärzten Fingernagel auf das trübe Auge eines Pomfrets. »Schau, dieser is’ frisch. Siehste den Unterschied? Klare Augen und weit offen.«
Er wandte sich einem anderen Korb zu. »Aha, ein alter Trick. Die obere Lage Fisch is’ fangfrisch. Aber was ham wir hier …« Er langte mit der Hand tief in die Kiste und zog einen zerdrückten Fisch an seinen Kiemen hervor. »Fühl mal. Das Fleisch is’ weich. Und die Kiemen, siehste? Die Kiemen sind nich’ rot wie bei dem frischen, sondern blass. Fast schon grau. Und wennde die Kiemen zurückziehst, sollten die sich steif anfühlen, nich’ so schlaff wie diese.« Anwar wedelte mit der Hand und der junge Fischer nahm seinen Korb wieder an sich. »Und schau dir diesen Thunfisch an. Schlechte Ware, Junge. Sehr schlechte Ware.«
»Zerquetscht und eingedrückt. Is’ einem Nichtsnutz von wallah wohl hinten vom Laster gerutscht«, konstatierte ich.
»Ha!«, sagte er kopfschüttelnd, zufrieden, dass ich meine Lektion gelernt hatte.
Eines Nachmittags im Monsun saßen Papa, Ammi und ich an einem Tisch im hinteren Teil des Restaurants. Die beiden brüteten über mehreren Stapeln aufgespießter Essensbons. Anhand der hingekritzelten Essensbestellungen wollten sie herausfinden, welche Gerichte in der vergangenen Woche am besten gegangen waren und welche weniger gut. Bappu hatte uns gegenüber in einem Lehnstuhl Platz genommen, wie ein Angeklagter vor Gericht, und strich sich nervös über seinen gezwirbelten Schnurrbart. Es handelte sich um ein allwöchentliches Ritual, das Bappu anspornen sollte, die alten Rezepte noch ein wenig zu verbessern. Genau darum ging es. Noch besser zu werden. Immer noch besser zu werden.
Der Stein des Anstoßes stand zwischen ihnen: eine Kupferschüssel mit Hühnchen. Ich streckte die Hand aus, tauchte die Fingerspitzen hinein und schob mir ein Stück purpurrotes Fleisch in den Mund. Das Masala rann mir die Kehle hinab, eine ölige Paste aus feinem roten Chili, gemildert durch eine Prise Kardamom und Zimt.
»Wurde nur drei Mal bestellt letzte Woche«, sagte Papa und blickte zwischen Großmutter und Bappu hin und her. Er nahm einen Schluck seines Lieblingsgetränks: Tee gewürzt mit einem Löffel Garam Masala. »Entweder wir kriegen das jetzt hin oder ich nehm’s von der Karte.«
Ammi griff nach dem Schöpflöffel und träufelte sich ein wenig auf den Handrücken, ehe sie konzentriert daran leckte und mit den Lippen schmatzte. Untermauert vom Klimpern ihrer Goldarmreifen, drohte sie Bappu mit dem Finger: »Was ist denn das? Soll ich dir das etwa beigebracht haben?«
»Wieso?«, fragte Bappu. »Neulich haben Sie mir gesagt, ich soll das Rezept ändern. Ich soll mehr Sternanis reintun. Und mehr Vanille. Immer heißt es: Mach dies, mach das. Und wenn ich es mache, ist es auch nicht recht! Wie kann ich etwas Anständiges kochen, wenn ich ständig die Rezeptur ändern soll? Sie treiben mich noch in den Wahnsinn mit diesem Hin und Her. Vielleicht sollte ich doch besser für Joshi arbeiten …«
»Aiiii…«, kreischte meine Großmutter, »du drohst mir? Wer hat dich zu dem gemacht, was du heute bist, hm? Und nun willst du zu diesem Kerl überlaufen? Geh nur, dann werfe ich auch den Rest deiner Familie auf die Straße …«
»So beruhige dich doch, Ammi!«, rief Papa. »Und du, Bappu, hör auf, dummes Zeug zu reden. Niemand wird hier beschuldigt. Es geht nur um dieses Gericht – könnte besser sein. Findest du nicht auch?«
Bappu rückte seine Chefkochmütze zurecht, als wollte er seine Würde wiederherstellen, und nippte seinerseits an seinem Tee.
»Hm«, sagte er.
»Mhm«, sagte meine Großmutter.
Alle starrten das Beweisstück an, das Gericht, das ihren Ansprüchen nicht genügen wollte.
»Es muss trockener sein«, sagte ich.
»Wie bitte? Soll ich jetzt vielleicht auch noch die Anweisungen von einem Kind befolgen?«
»So lass ihn halt auch was sagen.«
»Es ist zu ölig, Papa. Bappu brät das Fleisch in Butter und Öl und schöpft dann das Fett ab. Es wäre aber besser, wenn er es mit weniger Fett braten würde. Dann wird es knuspriger.«
»So, so, der Junge hat also etwas gegen das Abschöpfen. Na ja, er muss es ja wissen …«
»Jetzt halt doch mal die Klappe, Bappu!«, schrie Papa. »Warum musst du immer jammern wie ein altes Weib?«
Letztlich, nachdem Papa seine Standpauke gehalten hatte, befolgte Bappu meinen Vorschlag, und als sich das Gericht zu einem unserer gefragtesten mauserte, taufte es mein Vater um in »Hassan’s Dry Chicken« – der einzige Hinweis auf meine spätere Karriere.
»Komm, Hassan.«
Mami nahm mich bei der Hand und wir schlüpften durch die Hintertür hinaus zur Bushaltestelle, wo wir in die Nummer 37 stiegen.
»Wo fahren wir hin?«
Natürlich kannte ich die Antwort, aber wir machten jedes Mal ein Spiel daraus.
»Ach, ich weiß nicht. Vielleicht zu einem Einkaufsbummel? Ein bisschen Abwechslung vom Alltag kann schließlich nicht schaden.«
Meine Mutter, die gut mit Zahlen umgehen konnte, war zwar schüchtern, doch wenn mein Vater mal wieder von seinem Tatendrang überwältigt zu werden drohte, fuhr sie ihm in die Parade. Auf ihre stille Art war sie der tragende Pfeiler unserer Familie, und eben nicht mein Vater, der stets so viel Tamtam machte. Zum Beispiel sorgte sie dafür, dass wir Kinder immer ordentlich angezogen waren und unsere Hausaufgaben erledigten.
Was nicht bedeutete, dass Mami keine heimlichen Gelüste hatte.
Nach Schals etwa. Mami liebte ihre dupatta über alles.
Aus einem unerfindlichen Grund nahm mich Mami gelegentlich mit auf ihre heimlichen Streifzüge durch die Stadt, so als wäre ich der Einzige, der ihre verrückten Kaufrauschanfälle verstehen könnte. Im Grunde waren es ja harmlose Exkursionen. Ein, zwei Schals, hie und da mal ein Paar Schuhe und, eher selten, einen teuren Sari. Und für mich gab es ein Bilderbuch oder ein Comic-Heft und danach ein herrliches Essen.
Es war unser geheimes Band, ein Abenteuer, das nur uns beiden vorbehalten war. Vermutlich hoffte sie, damit zu verhindern, dass ich im Durcheinander des Restaurantbetriebs und angesichts der Ansprüche, die der übermächtige Papa und ihre restliche laute Kinderschar an sie stellten, zu stark vernachlässigt wurde. (Aber vielleicht irrte ich ja auch in meinem Glauben, bevorzugt behandelt zu werden, denn Jahre später sollte mir meine Schwester Mehtab erzählen, dass Mami sie heimlich ins Kino und Umar zum Go-Kart-Fahren mitgenommen hatte.)
Mir schien auch, dass es ihr gar nicht so sehr um den Kick des Kaufens ging, sondern dass es sich um eine andere Art Hunger handelte, etwas, das viel tiefer reichte. Bisweilen blieb sie unschlüssig vor einem Geschäft stehen, schürzte gedankenverloren die Lippen, ehe sie dann urplötzlich in eine ganz andere Richtung strebte, etwa zum Prince of Wales Museum, um kurz die Mogul-Miniaturen zu betrachten, oder zum Nehru-Planetarium, das auf mich wie eine Turbine wirkte, die man in die Erde gerammt hatte.
An jenem besonderen Tag stand wieder ein Einkaufsausflug in die Stadt an. Mami hatte zwei Wochen lang ununterbrochen gearbeitet – um die Restaurantbücher für den Steuerberater vorzubereiten, damit dieser ein weiteres profitables Jahr abschließen konnte – und wollte uns beide mit diesem Ausflug belohnen. Doch diesmal stiegen wir von der Buslinie 37 in einen anderen Bus um und wagten uns noch tiefer in das Gewimmel der Stadt hinein. In diesem Viertel Bombays waren die Boulevards so breit wie der Ganges und wurden von großen Geschäften mit Glasfronten gesäumt, deren Türsteher ebenso wie die Teakholzregale im Inneren mächtig herausgeputzt waren.
Das Sari-Geschäft, das wir betraten, hieß »Hite of Fashion«. Der Blick meiner Mutter glitt über die Stoffballen, die sich bis zur Decke türmten und deren Farbpalette von glänzenden Blautönen bis zu stumpfem Mausgrau reichte. Die Hände unter dem Kinn gefaltet, sah sie staunend zu, wie der Ladenbesitzer, ein Parse, von der Leiter herab seinem Assistenten Ballen glänzender Seidenstoffe reichte. Ihre Augen funkelten, wie geblendet von der schieren Schönheit der Stoffe, so als blickte sie geradewegs in die Sonne. Und als Krönung jenes Tages gab es für mich ein schickes Baumwolljackett, auf dessen Brust aus welchem Grund auch immer das goldene Emblem des Jacht-Clubs von Hongkong prangte.
In dem Laden mit Öl-Essenzen nebenan waren die Regale gefüllt mit bernsteinfarbenen und blauen Glasflakons, deren lange Hälse schwanengleich anmutig gebogen waren. Eine Frau in einem weißen Laborkittel träufelte Öltropfen mit den verschiedensten Aromen auf unsere Handgelenke – Sandelholz, Kaffee, Ylang Ylang, Honig, Jasmin und Rosenblätter –, bis uns ganz rauschhaft zumute, ja geradezu schwindlig wurde von all den Düften und wir rasch nach draußen mussten, um frische Luft zu schnappen.
Dann kamen die Schuhe an die Reihe. Wir saßen in einem piekfeinen Schuhpalast auf einem goldenen Sofa mit vergoldeten Armlehnen und Löwenfüßen. Die Schaufenster rahmte ein diamantenbesetztes Ome-ga ein, und das Schuhwerk auf den Glasregalen – hochhackige Pumps, Krokodilleder-Pumps und purpurrote Sandalen – wurde präsentiert, als handelte es sich um einzigartige Juwelen. Ich erinnere mich noch, wie der Schuhverkäufer zu Mamis Füßen kniete, als wäre sie die Königin von Saba, und meine Mutter kokett wie ein junges Mädchen die Füße hierhin und dorthin drehte, sodass ich die goldenen Sandalen von allen Seiten bewundern konnte, bis sie schließlich sagte: »Na, Hassan, was meinst du?«
Doch vor allem eines ist mir im Gedächtnis haften geblieben: wie wir auf dem Rückweg zur Bushaltestelle an einem Hochhaus vorbeikamen, in dessen Erdgeschoss sich eine Schneiderstube und ein Schreibwarenladen befanden, sowie ein merkwürdig anmutendes Restaurant mit dem Namen »La Fourchette«, an dessen Zementfassade schlaff die französische Flagge hing.
»Komm, Hassan«, sagte Mami, »lass uns hineingehen und das Restaurant ausprobieren.«
Ende der Leseprobe