
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
“Meine Schwester ist das gestohlene Meisterwerk. Ich bin nur die Fälschung.“
Mari ist drei, als ihre Schwester in einem Kaufhaus spurlos verschwindet. Seit Mari sich erinnern kann, schwebt der Schatten der verlorenen Tochter über der Familie und lässt die Verschwundene beinahe realer scheinen als sie selbst. Als Annika nach zwölf Jahren wie aus dem Nichts wieder auftaucht, sind alle überfordert von diesem Geistermädchen, das verschlossen, unzugänglich und geheimnisvoll ist. Während die Eltern krampfhaft heile Welt spielen, fühlt Mari sich mehr und mehr verdrängt. Bis ihr irgendwann nichts anderes übrig bleibt, als selbst zu verschwinden. Zusammen mit ihren Freunden Clementine und Ole macht sie sich auf einen irrwitzigen Trip nach Italien – um am Ende doch zurückzufinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Sina Flammang
Mädchen
aus
Papier
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage 2017
cbt Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Suse Kopp
Umschlagmotiv: Nina Masic/Trevillion Images
TP · Herstellung: ang
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-18796-5V001
www.cbt-buecher.de
Mehr zu cbt auf Instagram @hey_reader
1
Aufziehkind
Früher, als ich noch klein war, hatte ich Angst vor dem Spiegel. Für mich war er wie ein Fenster in eine andere Welt.
Eine Welt, in der Fische durch den Himmel fliegen und Vögel durchs Wasser tauchen. In der alles umgedreht ist. In der es Annika noch gibt, die mich durch die kalte Oberfläche hindurch anstarrt, als dürfte es mich in ihrem Spiegel nicht geben, als sei ich ein Fleck auf ihrer Seite, der sie irritiert.
Manchmal glaube ich, es gibt zwei Maris. Eine für den Tag und eine für die Nacht. Die Tag-Mari ist so, wie alle sie sich vorstellen. Eine Puppe aus Papier, die jemand mit einem Filzstift grob ausgemalt und auf Karton geklebt hat. Damit der Hals nicht so schnell knickt. Damit sie nicht so schnell kaputtgeht. Die Tag-Mari kämmt sich jeden Morgen alle Knoten aus dem Haar. Sie macht nicht einfach einen einzigen, großen Knoten aus all ihren Haaren, den sie dann ganz oben auf ihrem Kopf platziert wie ein Nest. Was einfacher wäre und irgendwie auch besser aussehen würde.
Tag-Mari ist nämlich ordentlich. Sie weiß, was von ihr erwartet wird. Wenn ihre Eltern Gäste haben, sitzt sie in der Ecke wie eine Aufziehpuppe aus Blech, und wenn jemand sie anspricht und damit den kleinen Schlüssel in ihrem Rücken dreht, dann klappert sie los, zieht die Mundwinkel nach unten und lässt ihre glatten Haare wie einen Vorhang über ihr Gesicht fallen. Ende der Vorstellung. Ein leichtes Kopfnicken, ein Ruck der Schultern nach vorne, und ich bin das perfekte traurige Mädchen, dem man die Hand auf die Schulter legen kann, oder besser noch: auf den Kopf. Ich bin das Mädchen, das jeden Tag daran erinnert wird, dass es noch da ist. Trotzdem habe ich das Gefühl, nicht wirklich da zu sein.
Es ist, als würden meine Eltern ein Bild von mir in der Tasche mit sich rumtragen. Wenn ich mich im Spiegel ansehe, wirkt mein Gesicht verschwommen, konturlos, als würde es sich in Wasser auflösen. Meine Mutter behauptet, ich bräuchte eine Brille, wie sie und mein Vater zum Autofahren. Aber ich weiß, dass es so nicht funktioniert. Man setzt sich nicht einfach eine Brille auf die Nase, und plötzlich ist die Welt so, wie sie sein sollte. Brillen verschleiern den Blick auf die Dinge, wie sie wirklich sind: unklar, verschwommen, nicht zu begreifen. Mir ist es lieber, wenn ich nichts sehe, wenn ich die Augen schließe und mich fallen lasse. In das weiche Kissen der Dunkelheit. Ich habe es immer schon geliebt, unterzugehen, zu verschwinden. Wie blasse Wasserfarbe, die sich zurück ins Papier saugt.
Erst in der Nacht fühle ich, wie ich deutlicher werde. Wie ich Gestalt annehme. Ich setze mich in meinem Bett auf, sobald ich meine Mutter durch die dünne Wand zwischen meinem und dem Zimmer meiner Eltern schnarchen und murmeln höre. Dann weiß ich, dass sie irgendwo ganz weit weg im Land der Träume vor sich hin sägt und dass mein Vater seine Ohren mit blauen Schaumstoffstöpseln versiegelt hat. Ich sehe mich im Spiegel an, der gegenüber meinem Bett auf der Kommode lehnt. Mein Gesicht schwebt darin wie ein weißer, verschwommener Klecks, hingetupft von einem Maler. Ich blinzle gegen die Dunkelheit an und sehe zu, wie Nacht-Mari vor mir langsam Gestalt annimmt. Ich lächle ihr zu und winke leicht mit der Hand, um zu überprüfen, ob wir ein und dieselbe sind. Dann schlüpfe ich aus meiner Decke, werfe sie ab wie den Kokon, in den sich Tag-Mari verpuppt hat, um mit dem Einbruch der Nacht zu etwas anderem zu werden. Zu etwas Richtigem, etwas, das man sehen kann. Es tut gut, das Gesicht zu einem breiten Grinsen zu verziehen, bis unter die Ohren. Die Haut wird zu einer Gummimaske, die sich über die Wangenknochen schiebt, als würde sie darüber schmelzen. Ich schlüpfe in meine Jeans, ziehe meinen Hoodie über und klettere durch das Fenster nach draußen in die Nacht. Meine Augen sind weit offen. Ich bin wieder ich.
2
Wunderbaum
Im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen fragt Niklas mich nicht, was mit Annika passiert ist. Vielleicht weiß er gar nichts davon. Für ihn bin ich einfach nur Mari. Nicht »die kleine Schwester«.
Wenn ich Nacht-Mari bin, fühle ich mich frei. Während alle anderen Menschen sich in ihren Häusern verkriechen und die Türen verrammeln, sich ihre Bettdecken über die Köpfe ziehen und die Augen verschließen vor den unheimlichen Schatten, die die Nacht in eine bizarre Theaterkulisse verwandeln, weiß ich, dass ich in Sicherheit bin. Die größten Gefahren dieser Welt gehen von anderen Menschen aus, und nachts sind kaum Menschen unterwegs. Es ist also viel sicherer als tagsüber. Tagsüber werden Leute überfahren. Tagsüber verschwinden Kleinkinder aus Kaufhäusern. In der Nacht kann man mitten auf der Straße auf dem weißen Streifen balancieren wie eine Seiltänzerin und keinen kümmert es.
Ich gehe auf Zehenspitzen, die Arme ausgebreitet, und stelle mir vor, dass die Straße links und rechts von mir ein tiefer Graben ist. Ein Fehltritt, und ich bin weg. Nicht mehr als ein kleiner Punkt, der in der Tiefe verschwindet. Meine Füße sind leicht, und der Wind spielt mit meinen Haaren, als wolle er mich beschnuppern. Es riecht nach Regen. Am Ende der Straße schwimmt eine Tankstelle in einem Heiligenschein aus weichem, gelbem Licht, wie aus der Welt gefallen. Der Himmel knurrt leise, er klingt hungrig, und ich ziehe den Kopf ein, als müsse jeden Moment eine große Schlabberzunge aus den Wolken schießen und mich von der Straße lecken.
Als ich den Kopf wieder hebe, sehe ich sie. Sie steht im Lichtkegel einer Straßenlaterne, in einem blauen Latzkleid mit langen Trägern. Ein Zipfel ihrer Bluse ist an der Seite rausgerutscht. Ihre Haare sind blond und zerzaust, wie ein Wust durchscheinender Watte sitzen sie auf ihrem runden Kopf. Sie ist vielleicht vier Jahre alt und ganz allein. Ich bleibe schwankend stehen, verliere die Balance und berühre mit einem Fuß die Straße. Abgestürzt. Mein Magen macht einen kleinen Satz.
In diesem Moment dreht das Mädchen ruckartig den Kopf, als hätte es jemand gerufen. Es dreht sich um und rennt, mit platschenden Füßen, wie ein kleiner Pinguin, aus dem Licht in die Dunkelheit, um Sekunden später im gelben Lichtsee der Tankstelle wieder aufzutauchen. Eine Frau breitet die Arme aus und das Mädchen springt hinein. Über die Schulter seiner Mutter wirft es mir einen letzten Blick zu, als es in seinen Kindersitz gehoben wird. Die Augen zwei kleine Punkte, die mich über eine wollene Schulter hinweg fixieren, als wollten sie mich festnageln, hier wo ich stehe.
Meine Hände sind warm und nass. Ich kann mich nicht bewegen. Ich schaue zu, wie die Mutter mit dem Mädchen vom Parkplatz rollt. In der Ausfahrt blinkt sie und wendet kurz den Kopf nach rechts, um zu sehen, ob die Straße frei ist. Erst als ihr Blick mich trifft und sie die Stirn runzelt, klappe ich meinen Mund zu und schaue weg. Ich muss aussehen wie eine Verrückte. Mitten auf der Straße, glotzäugig und starr. Ich drehe mich auf dem Absatz um und verschwinde im Schutz der Dunkelheit. Eine Maus huscht in ein Gebüsch. Von einem zerfetzten Plakat an einer Litfasssäule grinst ein Mädchen mit einer rötlichen Haarpalme auf dem Kopf. »Vermisst!« steht in dicken, schwarzen Buchstaben darunter. Ein hysterisches Lachen gluckert in meiner Kehle. Ich würge es runter, verschlucke mich daran und huste. Reiß dich zusammen, sage ich mir selbst von innen in die Ohren. In das einsame Rauschen in meinem Schädel, mit dem man allein ist, wenn man die Augen so fest zudrückt, dass es wehtut.
Ich stolpere den Mittelstreifen entlang, lege den Kopf zurück, schaue in den Himmel. Ich laufe einfach geradeaus, und dann ist es, als würde ich direkt in den Himmel hineinfallen, zwischen die Sterne. Es ist beinahe wie Fliegen. Ich habe das Gefühl, dass eine namenlose Kraft wie ein Magnet an meiner Schädeldecke zieht und mich nach oben hebt, ich werde leichter und leichter, wie ein Ballon, der sich langsam mit Stille füllt. Und dann reißt mich ein lautes Quietschen aus meinem Wachtraum.
Ich öffne meine Augen und starre in die eines Wesens, das sich direkt vor mir aus dem Boden gestampft hat. Seine hellen Augen flackern auf und erlöschen dann, als hätte das Wesen seine Lider darüber fallen lassen. Erst dann verstehe ich, dass ich vor einem Auto stehe.
Das Fenster wird heruntergekurbelt und ein Junge streckt den Kopf heraus. Ich kenne ihn. Er heißt Niklas Schiller, hat drei nervige Brüder und wohnt am Ende unserer Straße in einem schmutzig gelben Haus. Wenn sich in diesem Haus jemand streitet, was oft passiert, hören alle Nachbarn mit, ob sie wollen oder nicht. Deshalb weiß ich auch, dass der Junge Niklas heißt und seine Brüder Florian und Philip und Lukas. Ich weiß sogar, wie seine Eltern heißen, die sich ihre Namen am häufigsten an den Kopf werfen. Wie Steine. Jetzt streckt Niklas seinen Kopf aus dem Seitenfenster und fragt mich freundlich grinsend, ob ich noch ganz dicht sei. Er ist vielleicht ein Jahr älter als ich. Keine Chance, dass er schon einen Führerschein hat. Das sage ich ihm auch und er hebt unbeeindruckt die Schultern.
»Willst du mich verraten oder lieber ein Stück mitfahren?«, fragt er. Ich lege den Kopf schief und sehe ihn an. Der Mond wirft einen weißen Streifen auf das schwarze Autodach, es sieht beinahe aus wie hinlackiert.
»Okay«, sage ich.
Niklas und ich fahren Streife. Jedenfalls nennt er das so. Jede Nacht klaut er sich das Auto seiner Eltern und »cruist« durch die verwaisten Straßen, auf der Suche nach Verbrechern, die er zur Rechenschaft ziehen kann.
»Wie ein Superheld halt, nur ohne Kostüm. Das ist doch total dumm, oder? In einem roten Cape rumlaufen, damit deine Feinde dich schon von Weitem erkennen? Es ist doch viel schlauer, wenn du dich als ganz normaler Typ tarnst und dann, BAM!, mit deinen Superkräften zuschlägst, so aus dem Hinterhalt, weißt du?«
»Was für Superkräfte hast du denn?«, frage ich spöttisch. »Galaktischen Haarwuchs? Bist du als Kind in einem Labor eingesperrt worden und dann hat dich ein Yeti gebissen?« Niklas hat ziemlich viele Haare auf dem Kopf.
»Haha«, sagt er trocken. »Nee, ich mein doch nur. Wenn ich eine haben KÖNNTE, dann. Ich glaub, Fliegen wär schon gut … Und wenn mir alles zu doof wird, flieg ich einfach irgendwohin, wo’s gut ist. Nach Manhattan. Mein Bruder wohnt in Manhattan.«
»Sag mal, wie viele Brüder hast du?«, frage ich. Er zuckt mit den Schultern.
»Ein paar. Zu viele. Egal.«
»Und wie viele Verbrecher hast du schon gefangen, mit deinen krassen Superkräften?«
Niklas antwortet nicht. Er sieht nachdenklich aus. »Wer wärst du lieber: Magneto oder Doctor Manhattan?«
»Äh. Wer ist Doctor Manhattan?«
»What, spinnst du? Doctor Manhattan, von Watchmen? Hast du den einen Film nicht gesehen? Der kam neulich sogar im Fernsehen. Das ist dieser riesige, blaue Typ.«
»Wart’ mal, riesig und blau? Ist das nicht total auffällig und gefährlich, deiner These nach?«
»Mann, nein! Der kann sich auch normal groß machen.«
»Ach so, dann ist er normal groß – und blau. Das macht es natürlich viel weniger auffällig. Ich glaub, dann wär ich schon lieber Magneto …«
»Nee, jetzt wart mal. Doctor Manhattan kann total viel, so teleportieren und … solche Sachen. Ich find’s echt schwer zu entscheiden, so. Weil, Magneto hat schon krasse Power und so, aber Doctor Manhattan kann einfach Leute wegbeamen. Ist doch geil, so morgens in der U-Bahn? Paff!«
Ich nicke langsam. Einfach Leute wegbeamen, das hört sich gut an. Allein sein. In Ruhe gelassen werden.
»Ich bin, glaub ich, doch für diesen Manhattan«, sage ich.
»Doctor Manhattan«, sagt Niklas und grinst mich an.
Wir rollen im Schritttempo durch ein Wohngebiet mit Gartenzwergen und Windrädern in den Beeten, und ich erkläre Niklas, dass er hier keine Beute machen könne. Wenn er einen echten Verbrecher fangen wolle, dann müsse er in ganz andere Gegenden fahren. Hinter den Güterbahnhof oder ins Industriegebiet.
»Was glaubst du denn, wo ich gerade hinfahre?«, sagt er, beinahe eingeschnappt. Er trägt einen schwarzen Hoodie, wie ich. Es sieht fast so aus, als hätten wir uns zu einem Überfall verabredet. Niklas hat seine Kapuze auf, darunter lugen einzelne Strähnen seiner gewaltigen Matte hervor. In Niklas’ Familie haben alle gewaltige Matten, die sie meistens mit Mützen zu bändigen versuchen. Die Matte von Niklas’ Vater ist grau, aber keine Spur von Haarausfall, wie bei meinem Vater. Der behauptet immer, die Sorgen hätten ihm die Haare geraubt. Dabei dachte ich immer, von Sorgen werden die Haare bloß weiß. Sogar im Industriegebiet ist in dieser Nacht nichts los.
Niklas parkt das Auto vor einer hässlichen Baracke zwischen zwei großen Lagerhallen. Die Baracke hat eine Tür, neben der ein Klingelschild hängt, und Fenster mit Vorhängen davor.
»Wohnen da Menschen?«, frage ich und kann es kaum glauben. »Äh, jaaa?«, sagt Niklas, als wäre ich dumm.
Er holt was zum Rauchen raus und fängt an, daran herumzubasteln. Ich frage mich, ob wir nur zufällig hier stehen geblieben sind oder ob Niklas etwas Bestimmtes vorhat. Ich starre auf die Baracke. Hinter einem Fenster im ersten Stock geht ein Licht aus. Niklas erstarrt für einen Moment, alarmiert wie eine Katze, die eine Maus gesichtet hat. Dann fängt er meinen irritierten Seitenblick auf und räuspert sich kurz.
»Jo«, sagt er nur, was er, wie ich später herausfinden werde, immer sagt, wenn er nicht weiß, was er sonst sagen soll, und ihm die Stille einfach zu blöd wird. Ich sage lieber gar nichts und lasse die Zeit dahinrauschen, mit den Autos, die über die nahe Bundestraße zischen wie fliehende Tiere.
Eine einsame Plastiktüte von Media Markt weht unter einen geparkten Lastwagen, hinter dessen Steuer ein Trucker über seinem Lenkrad hängt und schnarcht. Man hört ihn durch das halb offene Fenster sägen. Von seinem Rückspiegel baumelt ein grüner Wunderbaum. Niklas und ich diskutieren kurz, ob das Wort baumeln von Wunderbaum kommt oder andersrum. Bevor wir uns einigen können, biegt plötzlich ein anderes Auto in die Straße ein, und Niklas reckt alarmiert den Hals.
»Pscht!«, macht er unnötig heftig und hebt eine Hand. Das fremde Auto hält vor der Baracke, dann steigt ein dürrer Mann mit müden Augen und der Aura eines Mehlwurmes aus. Mit lascher Geste wirft er die Autotür zu, klemmt sich eine Ledertasche unter den Arm und geht mit klimperndem Schlüsselbund auf die Haustür zu. Niklas folgt seiner konturlosen Gestalt mit lauerndem Blick, dann schnippt er den (ziemlich großen) Rest seiner Kippe aus dem Fenster und pikt mir seinen Zeigefinger in die Schulter.
»Aua!«, sage ich tonlos und empört zugleich, aber er ignoriert mich und befiehlt mir sitzen zu bleiben. Dann springt er so geschmeidig aus dem Auto, als hätte er sich das in irgendeinem Actionthriller abgeschaut, und geht mit großspurigen Schritten auf den Mann zu. Ich höre nicht, was sie sagen, für mich spielt sich die Szene stumm auf der schmutzigen Windschutzscheibe ab, wie ein Film, der nichts mit mir zu tun hat. Niklas nickt mechanisch mit dem Kopf, und der dürre Mann fährt herum, etwas Verlorenes, Resigniertes im Blick und die Ledertasche fest an die Brust gepresst, als habe er Angst, sie jeden Augenblick entrissen zu bekommen. Ich beuge mich vor. Niklas, der plötzlich wirkt wie ein anderer, baut sich vor dem Mehlwurm auf und redet auf ihn ein, mit leicht vorgeneigtem Kopf, das erschrockene Gesicht des Mannes schwebt über seiner Schulter, seine Augen zucken suchend hin und her, landen für einen Moment auf mir, und ich wende rasch den Kopf ab. Als ich wieder hinzusehen wage, kommt Niklas mit federnden Schritten und einem Grinsen auf dem Gesicht zum Auto zurückgejoggt, und der Mehlwurm verschwindet mit fliegendem Trenchcoat in seiner Baracke. Stirnrunzelnd sehe ich Niklas dabei zu, wie er sich hinsetzt und den Motor anlässt.
Ich runzle die Stirn so sehr, dass es ihm aus dem Augenwinkel auffallen muss, aber als er nicht reagiert, frage ich: »Was war das denn?«
»Kohle«, sagt er und reicht mir einen Fünfzigeuroschein. Ich starre auf den Schein, er verschwimmt vor meinen Augen, während das Auto mit wippender Motorhaube die löchrige Straße runterstolpert.
»Warum?«, frage ich, und Niklas zuckt bloß mit den Schultern. »Entschädigung«, sagt er und starrt blinzelnd geradeaus. »Der Typ da hat was mit meiner Mom.« Niklas gehört zu den Menschen, die nicht Mama sagen oder Mutter, sondern Mom.
»Echt?«, frage ich lahm, weil mir nichts anderes einfällt. Ich denke an Frau Schiller mit ihren krausen, blonden Locken und ihren weiten T-Shirts, die immer die Augen zukneift, als würde sie die ganze Zeit direkt in die Sonne gucken.
»Echt«, sagt Niklas und presst die Lippen zusammen. Er deutet auf den Schein in meinem Schoß, der dort liegt wie ein zusammengeknüllter Strafzettel.
»Der denkt, er kommt damit durch. Aber ich sehe alles. Doctor Manhattan. Deshalb: Entschädigung!« Niklas grinst. Ich grinse zurück, kann mir aber eine kleine, unsichere Grimasse aus dem Fenster nicht verkneifen. Im Seitenspiegel verschwindet die Baracke des Mehlwurms zwischen geparkten Trucks und Fabrikhallen, und bald deutet nichts mehr darauf hin, dass hier irgendwo ein Mensch wohnt. Ich lehne mich zurück.
»Aha«, sage ich.
»Jo«, sagt Niklas wieder, und diesmal klingt es, als wolle er sagen: Erledigt. Was auch immer er damit meint.
Später sitzen wir mit einem Sixpack Jever-Flaschen am Alten Spielplatz auf der Anhöhe über dem Stadtpark. Der Alte Spielplatz ist einer jener traurigen Orte, die man unwillkürlich mit dem Tod verbindet. Viele Legenden ranken sich um die morsche Röhrenrutsche, die Schaukeln und das Klettergerüst. Gerüchte von einem Kind, das abgestürzt sei. Nächtliche Satansmessen im Sandkasten. Junkiespritzen. Fuchsbandwurm. Seit sich hier letzten Sommer ein Exhibitionist vor einem kleinen Mädchen entblößt haben soll, bleiben die Familien ganz weg. Der Spielplatz gehört jetzt denen, die von Verbrechen und Abenteuer angezogen werden, die nachts ihre leeren Dosen in den Sand stecken und Feuerwerkskörper darin anzünden. Ich hangele mich an den Lederschlaufen unter dem Klettergerüst entlang und habe das Gefühl, mir selbst die Arme aus dem Körper zu reißen. Unter mir kauert die Stadt, eine flirrende Pfütze aus grellem Licht und der Dunkelheit dazwischen. Unser Wohnviertel liegt auf der anderen Seite des Hügels und ist nicht zu sehen. Niklas macht mit seinem Feuerzeug eine Flasche Bier für mich auf und reicht sie mir. Ich hasse Bier, seit ich als Siebenjährige bei einer Grillparty das Glas meines Vaters mit meinem Apfelsaft verwechselt habe, aber die Blöße kann ich mir jetzt nicht geben. Es gibt Regeln.
Ich nehme die Flasche und trinke und schlucke und tu so, als wäre das alles völlig normal. Ich spüre Niklas’ Blick auf meiner Wange und weiß genau, dass er mich nach verräterischen Anzeichen abscannt. Bloß nicht das Gesicht verziehen, es ist alles in Ordnung, flüstere ich mir selbst unter meiner Schädeldecke zu, und dann drehe ich meine Augäpfel nach rechts und hole Niklas in den Fokus, als würde ich ihn durch ein Fernglas betrachten. Die Luft ist kalt und frisch wie im Frühling, und ein heller Streifen liegt über dem Horizont, wie mit einem wässrigen Filzstift markiert. In den Bäumen um den Spielplatz zwitschern die ersten Vögel. Frühaufsteher. Ihr schriller, rhythmischer Gesang lässt mich an Sommer denken und an Kindheit, und plötzlich fühle ich mich, als würde jemand einen Ballon in mir aufblasen. Den Tränen nahe und glücklich und voller Sehnsucht. Im Sand, der nass und trocken zugleich ist, liegt eine vergessene hellblaue Kinderschaufel. Der Mülleimer quillt über, um den Sockel eine Schaumkrone aus Burger-King-Tüten, leeren Bierdosen und Coffee-to-go-Bechern.
Eine Zeitung klebt unter einer Bank und flattert, als wolle sie sich befreien. Wie eine Taube, deren Schwanz von einem Auto eingeklemmt wurde. Niklas und ich sitzen nebeneinander oben auf dem Klettergerüst und atmen Wolken in die Stille. In der dunkelblauen Ferne jenseits der bewaldeten Anhöhe gegenüber blinkt ein rotes Licht am Fernsehturm, über die Autobahnbrücke rauschen Autos, schnell und gleichmäßig, kleine Kugeln, die über eine Murmelbahn schießen. Das sanfte Rauschen lullt mich ein, es lässt mich an mein warmes Bett denken, an das leicht angelehnte Fenster, durch das der Nachtwind das immerwährende Rauschen der Stadt bis in meinen Schlaf trägt. Bett. Warm. Ich fröstle leicht, ziehe die Ärmel meines Hoodies lang und bündle den Stoff der Kapuze unter meinem Kinn.
»Kalt?«, fragt Niklas und rülpst leicht. »Ouu. Sorry?«
»Macht nichts? Vielleicht muss ich jetzt mal heim …«
»Nee. Trink mal noch ein Bier, das macht warm. Beer-Jacket.«
»Ich weiß …«, sage ich, aber das warme, fast volle Bier klebt in meiner unbeweglichen Hand wie ein Gewicht. Niklas hebt plötzlich seine Flasche hoch und lässt sie auf die Öffnung meiner Flasche krachen. Schaum schießt aus dem Hals und läuft über meine Hände. »Maaaann«, rufe ich und wische das Bier an meiner Hose ab. Niklas lacht bloß.
»Sorry!« Er streift sich seinen Hoodie über den strubbeligen Kopf, seine Haare stehen nach allen Seiten ab wie Strahlen, elektrisiert knisternd fällt der dunkle, muffige Stoff über mich und plötzlich sträuben sich meine eigenen Haare und schmiegen sich gleichzeitig unangenehm an, ein weißer Funke blitzt in der Dunkelheit im Inneren des Hoodies auf.
»Hey!«, rufe ich dumpf, etwas zu spät und nicht ganz überzeugend. Niklas zieht den Hoodie an mir herunter und betrachtet zufrieden sein Werk.
»So, wärmer?«, fragt er, sein Gesicht ist nun ganz nah vor meinem, und ich weiß nicht, in welches Auge ich zuerst sehen soll, links, rechts, links, beide, es ist, als würde mein Blick stottern, und ich starre auf seine Nasenwurzel, zwischen die Augen. Aber dann fällt mir ein, dass irgendwer mir mal erzählt hat, die Stasi habe das so gemacht, um ihre Gefangenen zu verwirren, also sehe ich ihm wieder in die Augen und treffe sie direkt. Niklas starrt zurück.
Die Stille fühlt sich an wie eine Flüssigkeit, die mir durch das Trommelfell sickert.
Ich muss etwas sagen. Ich muss.
Aber ehe ich etwas sagen kann, zieht Niklas plötzlich zu viel Luft durch die Nase, wie ein Kokser, und fragt mich, wann ich zuletzt geduscht hätte.
»Bitte?!«, frage ich, etwas zu schrill und empört, um noch würdevoll rüberzukommen. Er hebt abwehrend eine Hand.
»Deine Haare muffen«, sagt er und zuckt mit den Schultern. Ich starre ihn bloß an. Er merkt es und schiebt hinterher: »Beruhig dich mal. Es ist der gute Muff.«
Der gute Muff? Ich runzle demonstrativ die Stirn und starre ihn weiter an, den steifen Oberkörper frontal zu ihm gedreht, wie eine Puppe in einer Geisterbahn.
»Beruhig dich mal, Alter!«, sagt er und grinst mir zu. Ich setze die Kapuze seines Hoodies auf.
»Jetzt ist der gute Muff in deiner Kapuze«, stelle ich zufrieden fest, und er grinst und lacht, bevor er mir die Kapuze tief ins Gesicht zieht.
»Mir doch egal«, sagt er. Dann schauen wir wieder ins Tal, wo Rauch aus Fabriktürmen quillt wie fette Schlagsahne, und irgendwann fahren wir zurück in unser beschauliches Wohngebiet mit Deko in den Gartenbeeten und Lampen über den Türen. Mehr passiert nicht. Aber was soll auch schon passieren, mitten in der Nacht, wenn alle Menschen schlafen?
3
Puppenhaus
Pinocchio wollte immer ein richtiger Junge sein. Ich weiß, wie das ist, wenn man das Gefühl hat, aus Holz zu bestehen. Du bist hart und zerbrechlich zugleich. Keiner weiß, wer du wirklich bist. Nur, dass du jederzeit anfangen könntest zu brennen. Kein Wunder, dass die Menschen einen Bogen um dich machen. Feuer breitet sich schließlich aus.
Es ist Sonntag. Der schlimmste Tag der Woche. Die Uhr über dem Durchgang zur Küche scheint stehen geblieben zu sein und die Zeit dehnt sich wie Kaugummi. Sonntage durchschwimmt man wie einen dunklen See und das andere Ufer ist unendlich weit weg.
»Frühstück!«, ruft meine Mutter von unten.
»Ja«, knurre ich leise.
»Frühstüüück!«, ruft sie noch einmal, diesmal lauter.
»JA-HA!«, brülle ich, unfreundlicher, als ich eigentlich will. Ich wälze mich aus dem Bett, ziehe mir das neue T-Shirt mit Einhorn-Aufdruck über den Kopf, das Clementine mir zum Geburtstag geschenkt hat, und binde meine Haare zu einem lockeren Pferdeschwanz hoch. Er wird sich schnell auflösen, sodass ich ihn immer wieder neu knoten muss, und das ist auch gut so. Ich brauche etwas, womit meine Hände sich beschäftigen können.
Auf dem Tisch im Esszimmer steht eine kristallene Etagère mit Käse und Wurst. Meine Mutter hat auf jeden Teller ein Gesicht aus Trauben gelegt und die weich gekochten Eier tragen kleine Strickmützen mit Bommeln. Ich weiß nicht, warum die Blumen in der Vase mich traurig machen, aber sie tun es. Mein Vater liest die Zeitung, wie in diesem Abzählreim, den die kleinen Mädchen auf der Straße manchmal singen: »Vater liest die … Zeitung!« Ich habe das Gefühl, als würde er sich dahinter verstecken. Was er vermutlich auch tut. Wenn meine Eltern zusammen essen, ist es manchmal so, als hätte man zwei Fremde in einem Hotel an einen Tisch gesetzt. Vor allem, wenn ich dabei bin. Sie reden dann entweder nur mit mir oder sind so höflich zueinander, dass es wehtut. Wem wollen sie eigentlich was vormachen? Meine Mutter streicht Margarine auf ihren Toast und lächelt mich an. Wir essen nahezu wortlos, wie jeden Morgen. Ich stopfe mir die Backen voll wie ein Hamster, weil ich das Gefühl habe, dass es dann schneller geht.
»Hamsterbacke! Schluck doch erst mal runter, bevor du was isst!«, sagt meine Mutter, mit kehliger Stimme, weil gerade ein Stück Toast ihre Speiseröhre runterrutscht. Ich schaue sie nur an: »Schluck du runter, bevor du was SAGST!« Wir müssen lachen. Im selben Moment klingelt es an der Tür. Mein Vater lässt die Zeitung abrupt sinken. Wir wechseln Blicke, jeder mit einem Bissen im Mund. Ich sitze am nächsten an der Tür, also stehe ich auf. Träge und schwer, wie ein Sack Kartoffeln.
»Guck aber erst, wer’s ist!«, flüstert meine Mutter. »Vielleicht sind das wieder diese nervigen Typen mit den Feuermeldern.«
Ich schlurfe auf meinen Wollsocken in den Flur, spähe durch den Türspion und direkt in das breit gezogene Gesicht unserer Nachbarin, Frau Schiller. Niklas’ Mutter. Ich öffne die Tür, und Frau Schillers Gesicht wird noch breiter, weil es jetzt lächelt. Ihre Augen sind zusammengekniffen, als würde mein Anblick sie blenden. Sie sieht aus wie ein blinder Breitmaulfrosch. Ich verziehe mein Gesicht genauso, werde ihr Spiegel. Frau Schiller hält mir mit ausgestreckten Armen ein Päckchen hin. Ihr Gesicht ist fettig, als hätte sie sich gerade eingecremt.
»Hallo! Das wurde bei uns abgegeben, liegt schon ewig bei uns rum, wahrscheinlich hat der Postbote vergessen, euch ein Kärtchen zu hinterlegen …!« Sie verstummt, schaut auf die Fußmatte und ihr Hals läuft rot an. Fasziniert starre ich zuerst auf ihren Hals, dann auf die Fußmatte. Das Wochenblatt liegt halb geöffnet zu unseren Füßen, wie ein Monster, das uns in die Waden beißen will. Auf der Titelseite erkenne ich wieder das Mädchen mit der rötlichen Haarpalme, die seitlich aus ihrem Kopf wächst wie ein dünner Wasserstrahl. Sie trägt einen gelb-orangen Rollkragenpullover und hält eine Klarinette im Arm. Daneben die Schlagzeile: »Immer noch keine Spur von NELET. (8)«. Ich starre die weißen, fetten Buchstaben an, bis sie sich aus der Zeitung lösen und auf mich zuschweben. Mein Kopf ist schwer und wattig zugleich, meine Augen brennen. Ich bin plötzlich sehr müde. Frau Schiller schaut mich an, hektische Flecken nun auch im Gesicht, als wolle sie sich für etwas entschuldigen.
»Wer is’ es, Mari?«, ruft meine Mutter. Frau Schiller sieht aus, als würde sie am liebsten die Flucht ergreifen.
»Tut mir leid, dass es bei Ihnen rumlag!«, sage ich und drücke das Paket an mich. »Schönen Sonntag noch!«
Frau Schiller nickt erleichtert und ist im nächsten Augenblick schon durch das Gartentor und um die Hecke verschwunden. Ich hebe die Zeitung auf und stopfe sie in den Mülleimer neben der Tür, bevor ich reingehe und das Paket auf die Treppe stelle.
»Frau Schiller hat gestern ein Paket angenommen.«
»Was?« Meine Mutter lässt den Toast sinken, von dem sie eben abbeißen wollte. »Aber wir waren den ganzen Samstag hier. Also ihr beiden wart hier. Wieso habt ihr nicht aufgemacht?« Mein Vater und ich schauen uns an.
»Keine Ahnung!«, sage ich. Und er, gleichzeitig: »Ich hab den Rasen gemäht, also …« Meine Mutter fängt an, den Tisch abzuräumen, obwohl wir noch gar nicht richtig fertig sind. Ich stecke mir schnell eine Traube in den Mund, ehe sie mir den Teller wegzieht. Ich schaue zu ihr hoch und sehe, dass sie wieder ihren typischen Glasaugenblick hat. Der Blick, der einen anklagt, der einem Angst macht. Plötzlich bin ich nicht mehr die einzige automatische Puppe im Haus. Wir sind eine Puppenfamilie in einem Puppenhaus. Wir spielen Familie, frühstücken gemeinsam und tun so, als wäre alles normal. Wie Figuren in einem Diorama, das im Museum steht. Deshalb sind wir auch so irritiert, wenn jemand die unsichtbare Mauer, die uns von allem trennt, durchbricht und an unsere Tür klopft. Meine Mutter nimmt die Teller und schaut meinen Vater an, der noch tiefer hinter seine Zeitung abgetaucht ist.
»Piet? Wieso bist du nicht an die Tür, als das Paket kam?« Mein Vater seufzt müde, die Zeitung raschelt unter seinen Fingern. »Ich hab’s nicht gehört. Ich war im Garten«, murmelt er. Über den Rand der Zeitung sehe ich seine Haare flirren. Der Blick meiner Mutter wandert zwischen uns beiden hin und her. Um ihren Hals liegt die dünne, goldene Kette mit der Perle, die sie immer trägt. Wenn ich als Kind auf der Rückbank im Auto saß, konnte ich ihren Hals mit der Kette durch die Lücke zwischen Kopfstütze und Sitz sehen, und manchmal drehte ich die Perle zu mir hinter und rollte sie zwischen meinen Fingern. Dieses Gefühl war mir vertraut, es bedeutete, dass meine Mutter da war. Aber eines Tages im Winter, als wir gerade an einer roten Ampel standen, wurde alles anders. Ohne Vorwarnung machte meine Mutter einen Ruck nach vorne, riss mir die Perle aus der Hand und die Tür auf und rannte zwischen den wartenden Autos hindurch auf ein fremdes Mädchen zu, das an einer Bushaltestelle saß, einen Cellokasten neben sich, auf dem bunte Sticker klebten. Papa ließ eine Hand aufs Lenkrad fallen und seufzte, und ich erinnere mich, dass Empörung in mir aufstieg, und Angst. Ich starrte meiner Mutter nach. Noch bevor sie bei dem Mädchen ankam, hob es den Kopf und schaute stirnrunzelnd die seltsame Frau an, die mit offenem Mantel über die Straße gerannt kam wie eine Geisteskranke. Eine Frau mit Stirnband trat im selben Moment mit einer Tüte aus einem Bäcker, sie setzte sich neben das Mädchen und gab ihm einen Kuss auf den Kopf. Das Mädchen lächelte. In der Tüte waren Mohnschnecken. Mama, die zwischen zwei parkenden Autos stehen geblieben war, ließ die Arme hängen. Die Mutter des Mädchens hatte sie nicht bemerkt, aber das Mädchen starrte sie über den Rand ihrer Mohnschnecke hinweg neugierig an. Mama machte eine entschuldigende Geste, das Haar ungewohnt zerwühlt. Als die Ampel auf Grün schaltete und die anderen Autofahrer hinter uns zu hupen anfingen, bahnte sie sich ihren Weg zurück, um die dampfenden Motorhauben herum, die Arme so fest um den Körper gewickelt, als wolle sie sich selbst vor dem Zerfall bewahren. Ich spähte durch die gespreizten Finger zu ihr hinaus, zu dieser seltsamen, verrückten Frau, die nicht mehr meine Mutter war, und in diesem Moment wünschte ich mir beinahe, sie würde bei jemand anderem einsteigen. Sie war fremd, wie einer dieser Menschen auf der Straße, die keiner sehen will. Menschen, die vor sich hin murmeln und deren Augen wild umherhuschen, als wüssten sie nicht mehr, wo unten und wo oben ist. Als hätten sie sich verlaufen in ihrem eigenen Kopf. Wenn man solchen Menschen begegnet, macht man einen großen Bogen um sie, als seien ihre Probleme ansteckend wie ein Zombievirus. Seit dem Tag an der Ampel hat meine Mutter aufgehört, Annika in fremden Mädchen zu suchen, und wenn wir sie hin und wieder doch mal beim Starren erwischen, wendet sie schnell den Blick ab und tut so, als hätte sie einfach nur so in die Gegend geschaut oder ihr Gesicht in die Sonne gehalten.
»Mari? Hallo, Mari! Hörst du mich?«
»Was?«
»Hast du die Tür etwa auch nicht gehört?«
»Nein.«
»Wir müssen hingehen, wenn jemand klingelt!«, sagt meine Mutter, ein bisschen zu laut. Ich schaue schnell zu ihr hoch. Sie räuspert sich, dreht sich um und trägt die Teller zur Küche. »Wir können ja nicht die Pakete bei den Nachbarn rumliegen lassen!«, sagt sie, bemüht ruhig, über die Schulter, aber ich weiß, dass es ihr nicht um die Pakete geht, in denen sowieso nur irgendwelche Werbegeschenke sind, die sie von Kunden bekommt. Es geht darum, dass wir die Tür aufmachen, wenn es klingelt, weil vielleicht eines Tages jemand davorstehen wird, der aus unserer Puppenfamilie wieder eine richtige Familie macht. Die Küchentür klappt zu. Wie auf ein Signal, lässt mein Vater in diesem Moment die Zeitung auf seinen Teller sinken.
Wir sehen uns an, blinzeln ein bisschen und schauen gleich wieder weg. Irgendwo draußen gurrt eine Taube. Sie klingt wie jemand unter Wasser, der versucht, etwas zu sagen.
4
Fossilien
Am liebsten hätten meine Eltern wohl alles gerahmt, was noch von meiner Schwester übrig ist. Manchmal fühlt sich unser ganzes Haus an wie ein Museum. Annika ist das gestohlene Meisterwerk. Ich bin die Fälschung, die den grauen Schatten an der Wand vergeblich zu kaschieren versucht.
Annika war ein süßes Kind. Pummelig und pausbäckig wie ein kleiner Engel. Mit blonden Löckchen. Sie war erst fünf Jahre alt, als sie verschwand, aber sie war schon ein Genie. Sie konnte fast alles. Sogar Ballett. Sie war ein echtes Talent, wenn man meinen Eltern glauben darf. Sie wäre eine Primaballerina geworden oder Astronautin, weil sie die Klebesterne an ihrer Zimmerdecke so gerne mochte. Meine Eltern haben mir erzählt, dass Annika gerne »Erwachsene« spielte. Einmal im Bad, als gerade keiner hingeschaut hat, hatte sie sich den Rasierer von meinem Vater ausgeliehen. Sie hatte sich geschnitten, unterhalb der linken Schläfe, und meine Mutter klebte ein Pflaster drauf, mit Elefantenmuster. Ich stelle mir vor, wie sie gepustet und gesagt hat: »Alles wieder gut!«. Damals wusste sie noch nicht, dass genau dieses Pflaster nur wenig später Teil der Personenbeschreibung von Annika werden würde: ein kleines Mädchen mit einer Hasenohrmütze und einem Pflaster über dem linken Wangenknochen.
Annika hat auch ein Bild von mir gemalt, bevor ich überhaupt auf der Welt war. Ein Porträt. Mit Filzstiften. Es sieht aus wie ein blutiges Steak, das von einem lila Ameisenbären inhaliert wird. Meine Eltern haben es gerahmt und ins Treppenhaus gehängt. Wenn Besucher kommen, sagen sie immer, wie zur Entschuldigung: Das hat Annika gemalt. Dann gucken die Besucher ganz betreten und sagen: »Aha.« Ich weiß nicht, ob sie betreten sind, weil es um Annika geht oder weil sie nicht erkennen, was »es sein soll«. Meine Eltern erklären nie, dass ich das blutige Steak bin. Ich habe das einmal gemacht und dann nie wieder. Kam nicht gut an.
Neben meinem Porträt in Filzstift hängt das wichtigste Bild des Hauses. Es ist »das letzte Foto«. Annika, in einem blau-weiß karierten Kleid, steht vor einem frisch gepflanzten Bäumchen in unserem Garten. In einer Hand hält sie eine rote Kinderschaufel, die andere hat sie zur Faust geballt und in einem kindlichen Anfall von Scham gegen ihre rechte Wange gedrückt. Sie dreht sich leicht zur Seite, als würde sie jeden Moment auf ihren nackten Füßen davonlaufen. Das Elefanten-Pflaster unterhalb ihrer linken Schläfe ist auf dem Foto nicht zu sehen. Am Tag nach dieser Aufnahme sind meine Eltern mit Annika und mir zum Einkaufen gefahren.
Zurückgekommen sind sie nur mit mir.
Manchmal habe ich das Gefühl, als wäre ich die große Schwester und Annika die kleine. Weil sie immer ein Kind bleiben wird. Irgendwann wird meine Haut verschrumpeln wie ein alter Apfel, während ihre immer glatt und weich und – bis auf eine kleine Narbe über dem linken Wangenknochen – makellos bleiben wird, wie dieses kleinen Mädchens aus Sizilien, Rosalia Lombardo. Rosalia starb 1920 an der Spanischen Grippe. Ihr Vater hat ihre Leiche von einem Chemiker einbalsamieren lassen, und bis heute sieht Rosalia aus, als schlafe sie nur. Es gibt Fotos von ihr im Internet. Rosalia hat eine schmuddelige, weiße Schleife auf dem Kopf und liegt in einem gläsernen Sarg wie eine aus Wachs gegossene Puppe, ein morbides Spielzeug in einer kleinen Schachtel. Sie ist über 90 Jahre alt und wird doch immer eine Zweijährige bleiben. Das älteste Mädchen der Welt.
Wir wissen nicht, was mit Annika passiert ist, ob sie irgendwo noch am Leben ist. Aber für uns wird sie immer die Fünfjährige bleiben, die sich nicht gerne fotografieren lässt und vor dem Einschlafen in die Sterne an ihrer Zimmerdecke schaut.
5
Gruppe
Freunde sind eigentlich wie eine chronische Krankheit. Man bekommt sie, ohne sie zu wollen, und dann wird man sie so schnell nicht wieder los. Irgendwann hat man sich dann so an sie gewöhnt, dass man sich ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen kann. Und dann fühlt man sich plötzlich nicht mehr komisch, wenn sie da sind, sondern wenn sie weg sind.
Früher haben meine Eltern mich einmal die Woche bei Frau Dr. Schmalz abgeliefert, wo ich dann eine Stunde in einem Korbstuhl saß und gemeinsam mit ihr die Wand angeschwiegen habe.
Anfangs dachte ich noch, dass meine Eltern Frau Dr. Schmalz einen Gefallen schuldeten und sie – aus irgendeinem gruseligen Grund – die Gesellschaft eines stummen Kindes brauchte.
Irgendwann begriff ich dann, dass sie dazu da war, meine Seele zu heilen. Auf einem Glastischchen in der Mitte des Raumes standen trockene Bananenchips in einem Körbchen parat, die aussahen, als hätten sie schon immer da gestanden. Frau Dr. Schmalz und ich redeten fast nichts und das war auch gut so. Als sie mich dann eines Tages nötigte, einen Bananenchip zu essen, den sie mir mit ihrer nach Oma-Creme riechenden Hand reichte, war es für mich vorbei. Ich klammerte mich morgens am Treppengeländer fest und weigerte mich, ins Auto zu steigen. Meinem Vater wurde das irgendwann zu anstrengend. »Es wird sowieso zu viel geredet«, meinte er und drehte sich weg. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte ich nicht mehr hingehen müssen. Aber meine Mutter war hartnäckiger. Sie versuchte, mich mit Überraschungseiern zu bestechen oder mit Sachen, die ich im Fernsehen anschauen dufte. Aber am Ende gab auch sie auf und ich war frei. Bis sie eines Tages auf die Idee mit der Gruppe kam.
»Gruppe« bedeutet, mit einem Haufen anderer mehr oder weniger verstörter Kinder und Jugendlicher in einem muffigen Raum zu sitzen und sich selber leidzutun. Ich mag »Gruppe« nicht besonders. Aber ich allein bin schuld, dass ich dort gelandet bin.
Es ist keine lange Geschichte: Mit neun habe ich beschlossen, nicht mehr älter zu werden. Für mich war es das perfekte Alter. Neun waren die Olsen-Twins in meinem Lieblingsfilm. Neun waren Luise und Lotte aus »Das doppelte Lottchen«. Neun war Pippi Langstrumpf, und sie konnte machen, was sie wollte.
Leider hatten aber die Zeit und der Lauf der Dinge anderes mit mir vor und so wuchs ich einfach weiter. Meine Glieder wurden länger und meine Augen immer schlechter, aber das verriet ich keinem. Außerdem wurde ich immer dreister. Als ich zehn Jahre alt war, klaute ich mit meiner alten besten Freundin Lattischa (von der ich heute weiß, dass man sie »Laticia« schreibt) bei dm einen Lipgloss mit Glitzer und legte mir damit das größte Ei meines Lebens.
Meine Eltern »wussten« jetzt, dass Frau Dr. Schmalz und alles andere überhaupt nichts gebracht hatten. Das wussten sie einfach, wie allwissende Götter wissen, dass es sie gibt und dass es sich lohnt, an sie zu glauben. Deshalb flüsterten sie tagelang miteinander, meine Mutter kaufte bei Hugendubel zwielichtige Ratgeber über Kinder (als wären Kinder so was wie Wellensittiche) und hörte sich auch sonst »einfach mal um«. Am Ende erzählte sie mir dann stolz, dass sie sich »umgehört habe«, und meldete mich mehr oder weniger ungefragt bei einer Selbsthilfegruppe für die »Geschwister verlorener Kinder« an. Der wöchentliche Termin fiel genau auf meine geliebte Kinder-Hip-Hop-Stunde mit Lattischa.
Ich war stinksauer. Lattischa auch. Lattischa sogar so sehr, dass sie mir die Freundschaft kündigte. Erstens, weil ich ihr nicht gesagt hatte, dass ich schlecht sehe und TROTZDEM Schmiere stehen wollte. Und zweitens, weil sie nicht den »arme kleine verstörte Schwester«-Bonus ausspielen hatte können und zur Strafe wochenlang im Altersheim, wo ihre Eltern als Pfleger arbeiteten, Früchtetee und Würstchen mit Senf servieren musste. Als Vegetarierin. Das war natürlich überhaupt nicht meine Schuld, aber Lattischa war das egal.
Die Gruppe ist ein bisschen, wie ich mir Nachsitzen im Religionsunterricht vorstelle, nur ohne die »Zehn Gebote«. Die »Zehn Gebote« heißen hier »Drei Sätze« und lauten folgendermaßen:
1. Satz: Wir sind nicht allein.
2. Satz: Wir halten zusammen.
3. Satz: Am Ende ist alles gut, und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende.
Auf einem Tisch an der Seite des Raumes liegen, auf moosgrüne Servietten drapiert, trockene Kekse, Schokoriegel und Obst, und man kann sich Früchtetee aus einer großen Thermoskanne zapfen. Das mache ich meistens, aber eher aus Langweile, als dass ich wirklich Durst hätte. Clementine macht es immer ganz nervös, wenn ich neben ihr esse. Sie sagt, der bloße Anblick essender Menschen gebe ihr »ein dickes Gefühl«. Clementine muss wissen, was ein dickes Gefühl ist, denn sie war als Kind selber mal dick. Ich habe ihr das nie geglaubt, aber dann hat sie mir ein Foto von ihrer alten Grundschulklasse gezeigt, und ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Clementine war dick. Sehr dick. Monströs dick. Um nicht zu sagen: fett. In meiner Klasse gab es damals auch ein dickes Mädchen, und ich weiß genau, wie mit dicken Menschen in Grundschulen umgegangen wird. Unmenschlich. Schlimm. Man stelle sich ein ausgehungertes Wolfsrudel vor, das sich im sibirischen Winter über eine im Schnee steckende Elchkuh hermacht. So schlimm.
Clementine, die früher Pummeline genannt wurde, hat sich inzwischen selbst auf 45 Kilogramm heruntergehungert und sieht aus wie ein Fahnenmast, an dem jemand eine blonde Perücke gehisst hat. Sie ertränkt ihre Lippen in rosa Gloss und geht nie ungeschminkt aus dem Haus. Clementine wäre eigentlich die perfekte Tussi, die deutsche Entsprechung der Cheerleaderin aus einem amerikanischen Highschool-Film. Das einzige Problem: Clementine ist verrückt. Nicht »süß verrückt« oder »voll crazy«; Attribute, die sich viele ganz normale Mädchen nur zu gerne auf ihre Fahnen schreiben, sondern wirklich verrückt-verrückt. Clementine überspielt diesen Umstand mit einer doppelten Portion hyperaktiv guter Laune und strahlender Extrovertiertheit, was auf alle, die sie nur flüchtig kennen, charmant und anziehend wirkt. Alle, die sie näher kennen – einmal abgesehen von ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester Nessie –, haben auch ein kleines bisschen Angst vor ihr.
Ich mag Clementine trotzdem. Ich weiß, dass sie sich die Barbie nur übergezogen hat, wie einen pinken Ganzkörperanzug. Darunter ist die echte Clementine: voller verrückter Träume, seltsamer Ideen und immer da, wenn man sie braucht. Clementine ist ein kleiner Nerd. Das ist etwas, was nur ich von ihr weiß und was ich unter gar keinen Umständen irgendwem verraten darf. Sie hat schließlich einen Ruf zu verlieren. Ich halte daher den Mund und zocke mit ihr hinter vorgezogenen Vorhängen nerdige Playstation-Spiele, wie man das als Freundin eben macht. Man könnte beinahe sagen, dass Clementine meine beste Freundin ist. Wenn ich mir so was wie beste Freunde halten würde. Aber damit habe ich nach Lattischa eigentlich aufgehört. Man lernt ja schließlich aus seinen Fehlern. Vierter Satz.
Als sie noch dick war, sah Clementine aus wie ein Schweinchen. Jetzt sieht sie aus wie ein Rüsselspringer. Das sind Mäuse, die spitze kleine Schweinsnasen haben. Im Gegensatz zu ihr weiß ich noch ganz genau, wie wir uns kennengelernt haben.
Clementine leugnet es gerne, wahrscheinlich, weil es für sie eher peinlich war. Sie war gerade neu in die Gruppe gekommen und – im Gegensatz zu den meisten anderen Neuen – total gut drauf. Deshalb hatte sie sich auch sofort freiwillig gemeldet, als es darum ging, mit Heiko neue Vorräte für den Gruppenraum einkaufen zu gehen. Es müssen immer zwei Personen zu seinen wöchentlichen Hamstertouren mitkommen. Die andere, per Los entschieden, war damals ich.
Es war Sommer. Während andere am Baggersee lagen, klapperten wir in Heikos uraltem VW-Bus zu »Metro« und packten ihn bis oben hin voll mit Keksen, Gummibärchen und Fanta. Heiko brachte den Einkaufswagen zurück, und Clementine lümmelte mit einer riesigen Sonnenbrille auf der Nase vor mir auf dem Beifahrersitz und redete auf mich ein, ohne Luft zu holen. Sie fragte mich über alles aus, drückte ihre nackten Füße an die Heckscheibe, spreizte ihre Zehen, drehte singend am Radio herum und war eben einfach total gut drauf. Bis das Auto plötzlich einen kleinen Ruck nach vorne machte. Die Handbremse hatte sich gelockert, und der VW-Bus rollte, langsam und ruckartig, auf die Straße. Clementine bekam sofort einen Schreikrampf. Sie saß plötzlich stocksteif da, wie ein hysterischer, rosa gekleideter Baum, und es hätte mich nicht gewundert, wenn plötzlich ein Eichhörnchen aus ihrem weit geöffneten Mund geklettert wäre. Ich schnallte mich ab, zog die Handbremse wieder an und legte dann von hinten meine Arme um Clementine und ihren Sitz, um sie zusammenzudrücken. Mein Vater hat mir mal erzählt, dass eine Autistin in Amerika eine Art Presse entwickelt hat, in der autistische Menschen durch gleichmäßigen Druck vor Reizüberflutung bewahrt und damit beruhigt werden konnten. Mein Vater und ich haben uns daraufhin immer den Spaß gemacht, uns gegenseitig zu drücken, wenn einer sich aus irgendeinem Grund aufregte. Danach mussten wir dann immer lachen und waren wirklich wieder ganz ruhig.
Bei Clementine funktionierte die Presse auch, aber wohl eher, weil sie so überrascht war. Sie blinzelte, erkannte, dass der Bus sich nicht mehr bewegte, und starrte mich an, als hätte ich ihr das Leben gerettet. Von diesem Moment an waren Clementine und ich Freunde, saßen in der Gruppe nebeneinander und flüsterten die ganze Zeit, was die anderen ziemlich nervte. Vor allem Liza mit z, die damals noch Lisa mit s war und keine roten Haare hatte. So einfach ging das. Auch wenn Clementine bis heute behauptet, dass wir uns auf einer langweiligen »Fünf nerdige Jungs führen Privatgespräche über Pokémon und zwei Mädchen langweiligen sich«-Geburtstagsparty aus Solidarität am Punschtisch zusammengerottet hätten.
6
Little Sisters
In Fernsehkrimis lassen die Kommissare Fotos immer »vergrößern«. Aber das ist Science-Fiction. Im wahren Leben geht das nicht. Das ist völliger Quatsch. Was verpixelt ist, kann man nicht deutlicher machen. Man würde nur die Pixel vergrößern. Irgendwann wäre Annika ein einziger großer Pixel, ein einziges, großes Fragezeichen.
Nach der Gruppe hängen Clementine und ich noch ein bisschen zusammen ab. Wie meistens, bei ihr zu Hause, weil ich immer schon lieber bei fremden Leuten war als daheim. Auch als kleines Kind. Meine Mutter war beinahe beleidigt, wenn ich meinen Babysittern um den Hals fiel oder mit wehendem Haarschopf und ohne Proteste in den Kindergarten rannte. Über die kleinen Heulsusen, die morgens im Stuhlkreis noch nach ihren Müttern brüllten, wunderte ich mich bloß, mit dem mitleidlosen Interesse einer Insektenforscherin. Ich war emotional absolut selbstständig. Mich hätte man auch nie aus dem Småland abholen müssen, mal angenommen, ich wäre jemals dort gewesen. Aber wegen Annika haben meine Eltern mich im Ikea nie von der Leine gelassen. Wenn ich »Ikea« bloß denke, kribbelt sofort meine rechte Hand, wie bei einer Art Phantomschmerz oder eher Phantomgefühl. Ich fühle wieder, wie meine kleine Kinderhand schwitzig und heiß in der von Mama oder Papa klebt, während bunte Möbel und Lampen und Textilien an mir vorbeiziehen wie die Auswüchse eines fremden Planeten. Ich frage mich bis heute, ob der Schweiß, der unsere Hände zusammenhielt, einfach nur ganz normaler »Eine Hand umklammert zu lange eine andere Hand«-Schweiß war, dieser warme Schweiß, der entsteht, wenn man beim Anstehen am Kaffeeautomaten die Finger um seine Geldstücke ballt. Oder ob sie tatsächlich Angst hatten, sie könnten schon wieder ein Kind verlieren. Als säße unter der Decke jedes Kaufhauses ein finsterer, schlingender Gott, der Chronos des Konsums, der pro Besuch ein Kinderleben forderte und sofort zuschlagen würde, wenn man es wagte, seine Brut auch nur für eine Sekunde aus den Augen zu lassen.
![Meine übelst schlimme Geschichte!!! Tagebuch einer Vampirin [Band 2] - Sina Flammang - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/00c46ee11788270e0b85e043ac7e8b44/w200_u90.jpg)
![Meine schlimme Geschichte!!! Tagebuch einer Vampirin [Band 1] - Sina Flammang - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/815f8cfed804a8da70a0995d89636737/w200_u90.jpg)

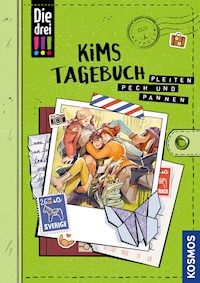
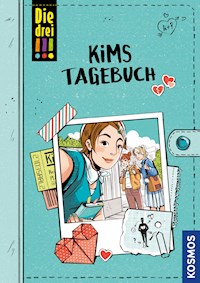














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









