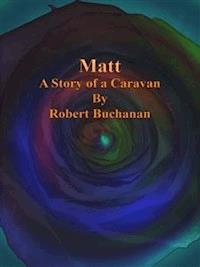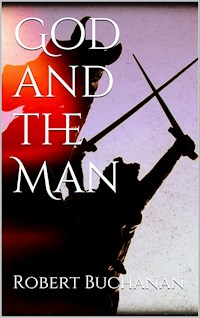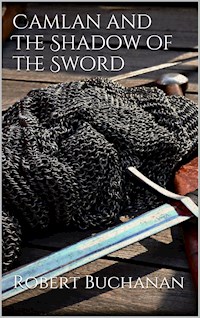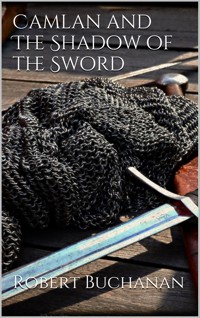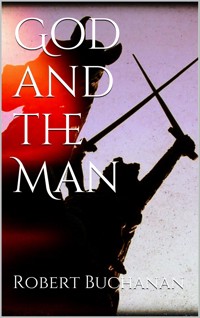Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Robert Buchanan läßt den Leser teilhaben am Schicksal Madelines, die in die Hände von skrupellosen Betrügern gerät.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Prolog in der Nacht
Kapitel I: Eine Tanzstunde unter Schwierigkeiten
Kapitel II: ‚Onkel’ Luke und ‚Onkel’ Mark
Kapitel III: Ostern, das Fest der Brethren
Kapitel IV: Onkel Marks Aufgaben auf dem Lastkahn
Kapitel V: Onkel Marks Schifffahrt auf dem glänzenden Fluss
Kapitel VI: Madeline kümmert sich ihren Traum zu verwirklichen
Kapitel VII: Charakteristik eines böhmischen Literaten
Kapitel VIII: Onkel Luke ist gebrochenen Herzens
Kapitel IX: Madeline findet neue Freunde
Kapitel X: Ein Blitztelegramm
Kapitel XI: Der Habicht und die Taube
Kapitel XII: Eingesperrt
Kapitel XIII: Madeline erwacht aus ihrem Traum
Kapitel XIV: Dunkle Tage
Kapitel XV: Belleisle spinnt sein Netz
Kapitel XVI: ‚Was tatest du aus Mitleid?’
Kapitel XVII: Der Bann ist gebrochen
Kapitel XVIII: Imogen
Kapitel XIX: Das ‚Harum – Scarum’
Kapitel XX: Das Modell des Malers
Kapitel XXI: Ein Spaziergang durch den Hydepark
Kapitel XXII: Blanco Serena
Kapitel XXIII: Im Club
Kapitel XXIV: White verabschiedet sich von der Boheme
Kapitel XXV: Madeline wechselt ihren Namen
Kapitel XXVI: Zögling der Unfehlbarkeit
Kapitel XXVII: Adele Lambert
Kapitel XXVIII: Bei der Gräfin Aurelia
Kapitel XXIX: Gavrolles
Kapitel XXX: In der Schlinge
Kapitel XXXI: Die Verspätung
Kapitel XXXII: Ehemann und Ehefrau
Kapitel XXXIII: Alter Journalismus und neuer
Kapitel XXXIV: Der selbsternannte Held
Kapitel XXXV: Madeline bereitet sich auf die Flucht vor
Kapitel XXXVI: Auf Wiedersehen!
Kapitel XXXVII: Die Suche
Kapitel XXXVIII: Ein weiteres Unglück
Kapitel XXXIX: Staub zu Staub
Kapitel XL: Ins Ungewisse
Kapitel XLI: Die Schwestern vom Berg Eden
Kapitel XLII: Gavrolles
Kapitel XLIII: Am Strand von Bologna
Kapitel XLIV: Jane Peartree
Kapitel XLV: Ein altes Bild
Kapitel XLVI: Madelines Wiederauferstehung
Epilog
Vorwort
In dieser Geschichte habe ich sehr vorsichtig und unzureichend eines der größten und traurigsten der humanistischen Probleme berührt – sicherlich so groß und traurig wie das Problem, welches das zentrale Thema in meinem Buch ‚Der Schatten des Schwertes’ ist.
Der Glaube an Frieden und der Glaube an Unschuld in der sozialen Gemeinschaft.
So lange wie sinnliche Befriedigung als ein männliches Vorrecht anerkannt ist, so lange wie persönliche Keuschheit als ein Hauptfaktor im Schicksal der Frauen angesehen wird und nichts als ein Zufall im Leben der Männer ist, so lange wie die teuflische Offenheit des körperlichen Sex verurteilt wird, wird sie zum Opfer eines schwachen Geschlechts. In einem Wort: So lange wie unsere Heime und unsere Straßen so bleiben wie sie sind – müssen der Glaube an die Unschuld wie auch der andere Glaube an Frieden als unglücklicher Traum übrig bleiben.
Ein Wort noch hinsichtlich meiner handelnden Personen. Keine von ihnen sind Abbilder wie eine Photographie oder gar lebender Individuen.
In einem Fall habe ich mich bemüht, aus einer Veröffentlichung eines Boulevardblattes eine amüsante Persönlichkeit zu verwenden, aber über den realen Verfasser weiß ich absolut nichts und ich will ihm nichts Schlechtes. Vieles, was ich an dem System des persönlichen Journalismus nicht mag, zeige ich. Alle anderen Charaktere sind fiktiv.
Gavrolles und sein Kreis werden als Vertreter der geheuchelten und nicht der eigentlichen Ästhetik, was etwas ganz anderes ist, akzeptiert.
R.B.
Prolog in der Nacht
Als die zwei Frauen beim Lampenlicht einander ansehen, eine stehend und nach unten schauend, die andere sitzend und aufschauend, könnte man meinen, es wären Zwillingsschwestern. Sie sehen sich so wunderbar ähnlich. Beide sind so schön, mit hellen Vergißmeinnicht-Augen. Es gibt auch keinen erwähnenswerten Unterschied in der Kleidung, die sie tragen. Diejenige, die aufrecht steht, ist dem Wind abgewendet, aber auf ihr Haupt fällt Regen. Ihre Haube und ihr Kleid sind aus schwarzen Stoff, ein Schal hüllt sie ein, der wertvoll und teuer erscheint, im schummrigen Licht aber gewöhnlich aussieht. Diejenige, die sitzt, mit ihren Ellenbogen auf den Knien und ihrem Gesicht auf ihren offenen Handflächen ruht, ist ebenfalls in einen Schal gehüllt und in ein einfarbiges Stoffkleid, das naß vom Regen ist. Ihrer Haube ist durchweicht und unbeachtet auf ihre Schulter zurückgefallen, nur gehalten von den ebenfalls durchweichten Bändern. Ein aufmerksamerer Betrachter würde aber eine ganze Reihe Unterschiede zwischen diesen beiden Frauen bemerken.
Die stehende Frau hat die Wildheit einer schmerzlich ungeduldigen Art, wie die eines wilden Tieres, jeder Blick, jede Gebärde ist selbstbeherrscht, bestimmt und voll hinreißender Besorgnis.
Die sitzende Frau ist ein in sich gekehrter, hautdurchnäßter, leidenschaftsloser, kraftloser, verlassener Mensch, mit nur den Mut eines gejagten, ausgestoßenen Hundes, der zubeißen kann, oder sich nutzlos davonschleicht.
Beide Frauen sind sehr jung, etwas über zwanzig Jahre alt.
„Diesen Weg! Über die Brücke!“ sagt die sitzende Frau in einer heiseren Stimme, dann setzt sie hinzu, als die andere weitergehen zu wollen schien: „Moment noch. Was würde dich am Gehen aufhalten?“
Die andere dreht sich schnell um und schaut wieder mit ihren Adleraugen herunter.
„Was willst du? – Geld?“ Die Stimme ist tief und deutlich, aber etwas zittrig wie es scheint.
„Ja, ich bin durstiger als ein Fisch. Leihe mir einen Schilling, wenn ich Glück habe werde ich ihn in ein paar Tagen zurückzahlen. Nur einen Schilling, das wird dich nicht umbringen.“
“Wenn ich dir das Geld gebe, was willst du damit anfangen?“
„Vertrinken“, war die knappe Antwort.
Etwas in der Antwort hat einen merkwürdigen Effekt auf die Zuhörerin. Sie beugt sich ein wenig herab und schaut ernst in das Gesicht der anderen Frau.
„Du wirst mich wieder erkennen, wenn du mich siehst? Sagst du mir deinen Namen?“
„Ellen, mehr nicht. ‚Nell’ als Kurzform.“
„Wo lebst du?“
„Nirgends.“
„Wie alt bist du?“
„Das weiß Gott. Zwanzig oder um zwanzig. Bist du hier, um die ganze gesegnete Nacht Fragen zu stellen? Ich möchte etwas trinken.“
Das stehende Mädchen beugt sich über die Sitzende und gibt ihr etwas in die Hand. Diese gibt einen unterdrückten Schrei von sich.
„Gold! Warum hast du mir einen Sovereign gegeben? Für was?“
„Ich habe nur den einen, sonst würde ich dir mehr geben. Entschuldige mich. Gute Nacht!“
„Halt! Geh’ nicht. Laß mich dich noch einmal anschauen.“
„Gut?“
„Was für ein Narr bin ich. Du bist eine Lady!“
Es ist nun eine andere Art zu lachen, ein schwaches, bitteres Lachen.
„Und du hast da einen echten ‚Ingy-Schal’, laß mich ihn einmal anfühlen. Und auch goldene Armbänder!“
„Gut, ich bin …“
Dieses halb Geflüsterte drückt gänzlich Überraschung aus.
„Ich weiß nicht wer du bist oder wohin du gehst, aber die Straßen sind für Personen wie dich nicht sicher. Du tätest gut daran nach Hause zu gehen, Lady!“
„Ich habe kein Zuhause.“
„Was!“
„Das Zuhause, was ich hatte, habe ich verlassen, ich kehre nie zurück. Ich habe London verlassen.“
„Wohin gehst du?“
„Irgendwohin.“
Nach einer kurzen Pause zeigt sie über den Fluß und über die Dächer und sagt:
„Da hinaus.“
„Ich vermute dort sind Freunde?“
„Keine Freunde.“
„Und nicht viel Geld. Aber gut, du hast die eleganten Armbänder; und den Schal, der auch eine Menge Wert hat.“
Es ist eine scheinbar arglose Bemerkung, man bemerkt, daß es einen großen Eindruck auf die Zuhörerin macht, die vor innerer Bewegung oder Ärger zittert. Mit einer schnellen ungestümen Bewegung zieht sie ihre Armbänder ab und gibt sie in den Schoß des Mädchens.
„Nimm sie – ich möchte sie nicht mehr! Und den Schal auch – nimm es und gib mir deinen Schal.“
„Nein, du machst einen Scherz!“
„Schnell!“
In einem Moment vollzieht sich der Tausch. Die Frauen stehen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Die bürgerliche und die ausgestoßene Kreatur scheinen gänzlich bestürzt durch das eben Geschehene. Plötzlich hebt die andere beide Hände hoch und sagt schnell:
„Der Fluß – ist er dort?“
Ein Licht scheint der Ausgestoßenen aufzugehen.
„Du willst dich doch nicht selbst ertränken?“
„Nein. Ich weiß nicht, vielleicht!“, sagt sie mit einem eigentümlichen Lächeln.
„Es ist nicht zu machen, dort sind zu viele Augen, die beobachten. Ich versuchte es selbst einmal, vom Deich aus, aber ich wurde wie ein nasser Sack herausgefischt. Sei nicht so eine Närrin! Du bist eine Lady und gehst am besten nach Hause.“
Ohne zu antworten beginnt die Lady sich schnell zu entfernen. Ergriffen von einem eigentümlichen Impuls ruft die Ausgestoßene ihr nach:
„Komm zurück – nimm deine Sachen, ich schäme mich sie anzunehmen. Nimm sie zurück.“
„Nein behalte sie. Auf Wiedersehen. Darf ich dich küssen?“
„Wenn du willst“, ist die benommene Antwort.
Die Lippen der beiden Frauen trafen sich und ihr Atem vermischt sich für einen Moment. Dann, während die eine gänzlich verwundert und wie versteinert dasteht beginnt die andere sich schnell und leise zu entfernen.
Kapitel I
Eine Tanzstunde unter Schwierigkeiten
Zwölf Jahre bevor die im Prolog beschriebenen Ereignisse stattfanden, war eine merkwürdige Gruppe in einer stillen Ecke des Grayfleet Friedhofs versammelt. Grayfleet ist ein feuchtes, krankhaftes, fast verödetes Dorf, am Rande der großen Essex-Marschen. Seine alte Kirche schaut mit Fenstern wie ein Totenschädel mit zwei traurigen, leeren und leblosen Augen auf die Marschen zum tiefliegenden Nebel, der sich mit der See vermischt, herab.
Die Gruppe, von der ich spreche, besteht aus sechs Mädchen und einem kleinen Jungen. Die Mädchen sind verschiedenen Alters, von sechs bis sechzehn und alle sind mehr oder weniger elegant gekleidet, denn es ist Karfreitag. Sie stehen im Kreis um einen flachen Grabstein, der schon verwittert und grün von feuchtem Moos ist. Auf diesem Grabstein steht ein hübsches Mädchen von acht Jahren, mit zerzaustem Haar und geröteten Wangen und probiert erste Schritte eines Tanzes. Ihre ‚Lehrerin’ ist die Älteste unter ihnen, ein blasses, rothaariges Mädchen von sechzehn, welches sie mit scharfen kritischen Blicken beobachtet, manchmal nach vorn geht, deren Platz auf dem Grabstein einnimmt und ihr zeigt, wie sie die Füße setzen muß.
„Erste Position – Ferse und Zehen – kreuzen und zur Seite.“
„Schau her, Mawther!“, ruft eines der Mädchen zu einem Vorübergehenden. „Komm und sieh, Polly Lowther lehrt Mark Peartrees Tochter das Tanzen.“
Ein weiteres Mädchen kommt auf den Friedhof gerannt und gesellt sich zu der Gruppe.
„Das ist der Stil“, ruft Polly Lowther aus, „du wirst es bald lernen, wenn du es nur versuchst. Schau zu mir Madlin, beobachte meine Füße.“
„Erste Position – Ferse und Zehen – kreuzen und zur Seite.“ Die Mädchen klatschen begeistert, ihre Lehrerin bestaunend, in die Hände und der kleine Junge, der rittlings auf einem grünen Grab sitzt, grinst beifällig.
Angefeuert durch den Applaus, der ihrer Lehrerin gezollt wird, beginnt das kleine hübsche Mädchen, die Madlin genannt wird, die Schritte heftig auszuführen.
Erste Position – Fersen und Zehen – kreuzen und zur Seite.
Plötzlich sind da ein Schrei und eine Unruhe. Die Gruppe Mädchen zerstreut sich nach allen Seiten und verschwindet. Der kleine Junge schreit auf und rennt los. Nur Madlin bleibt, so von ihrem Tanz in Anspruch genommen, daß sie im Moment keine Notiz davon nimmt, daß sie allein gelassen worden war und daß eine große Gestalt in Schwarz mit weißem Halstuch mürrisch neben ihr steht. Im nächsten Moment wird ihr ihre mißliche Lage bewußt. Aufgescheucht und keuchend steht sie und starrt und erkennt zu ihrem Schrecken den Pfarrer des Kirchspiels. Sie blickt in die Runde und bemerkt, daß sie völlig verlassen ist und keine Spur ihrer Gefährten zu sehen ist. Sie wird ängstlich und springt von dem Stein.
„Kleines Mädchen“, sagt der Pfarrer in einer furchtbaren Stimme, „ich kenne dich nicht, wie heißt du?“
Sie läßt unbeholfen ihren Kopf hängen und antwortet nicht.
„Verstehst du mich? Wie heißt du?“
Das kleine Mädchen hebt ihren Kopf und schaut den Pfarrer an und antwortet mit einer klaren Stimme:
„Wenn sie gestatten, Sir, ich bin Madlin, Mark Peartree’s Mädchen.“
Die Augenbrauen des Pfarrers ziehen sich noch mehr zusammen.
„Mark Peartree, ich denke, ich kenne den Mann – er lebt unten an der Fähre und segelt eine Barke. Ist er dein Vater?“
Das Mädchen, das einen einfachen Strohhut auf hat und an dessen Seidenband nagt, antwortet kurz:
„Nein, ist er nicht.“
„Was ist er dann?“ fragt der Pfarrer, „hat er einen Verwandtschaftsgrad?“
„Nein, “ ist die sofortige Antwort, „ich rufe ihn ‚Onkel’, aber er ist nicht mein wirklicher Onkel und Onkel Luke auch nicht. Ich bin ein Findling – Tante Jane fand mich dort draußen.“
Und mit einer ausladenden Handbewegung weist das kleine Mädchen über dir großen Marschen, die in der untergehenden Sonne dampfen und sich rot färben.
„Und wer immer du bist, weißt du nicht“, sagt der Pfarrer, „daß du ein sehr gottloses kleines Mädchen bist? An diesem heiligen Tag aller Tage des Jahres finde ich dich hier bei einem verderbten Zeitvertreib auf Gottes eigenem Acker! Auf einem Grabstein! Kleines Mädchen, weißt du nicht, daß dort ein Toter unter dir liegt und daß du seinen Ruheplatz entweihst?“
Das Mädchen schreckt auf und wirft einen Schreckensblick nach unten, als ob sie den Toten auferstehen erwartet und er vor ihr steht. Dann, halb unbewußt, verläßt sie den Grabstein und steht knöcheltief im langen Friedhofsgras.
„Ich bin besorgt“, sagt der Pfarrer und droht ihr mit seinem erhobenen Zeigefinger, „ich bin wirklich sehr besorgt, daß du etwas sehr schlechtes getan hast. Sag mir, hast du jemals das Wort Gottes gehört? Gehst du immer in die Kirche?“
Die Antwort ist prompt und deutlich:
„Nein, niemals.“
„Ah, das dachte ich mir. Ein schlimmer Fall. Und dein Vater – ich meine deinen Adopotivvater – schämt er sich nicht, dich in Unglaube und Sünde zu bringen?“
Das kleine Mädchen errötet, keucht und öffnet ihre großen, blauen Augen, schaut den Gottesdiener an und erklärt:
„Onkel Mark schämt sich seiner nicht, genau so wenig wie Onkel Luke! Sie gehen zu ihren Versammlungen und ich gehe auch mit. Sie sind bei den ‚United Brethren’ (1) und wenn ich groß bin, möchte ich auch zu den Brethren gehören.“
„Brethren!“
Dies sagt er in einem Ton, der deutlich zu verstehen gibt, daß das Faß der moralischen Verfehlung in den Augen des Pfarrers voll und übergelaufen ist. Der gute Pastor kann eine Familie, welche den Ruf der Christenheit gänzlich untergräbt, und jede Form einer anderen Meinung, nicht ertragen. Dann noch diese verderbte Gotteslästerung.
Es ist ungewiß, welche Wendung das Gespräch genommen hätte, wenn nicht in diesem Moment eine unerwartete Ablenkung eintrat. Eine dünne schrille Stimme, zweifellos von einem der kleinen Mädchen aus der Schar, erschallt plötzlich aus einer mysteriösen Ecke, wo es sich verborgen hält.
„Sieh, Madlin! Hier ist Dein Onkel Luke gekommen.“
Madeline schaut überrascht, dann wird ihr Gesicht hell und lebhaft. Der Pastor scheint verwirrt und unsicher was als nun zu sagen sei. Jetzt öffnet sich die Friedhofspforte und ein kleiner Mann mit zu kurzen Hosen und einen sehr großen Kopf schaut herein, sieht Madeline und tritt ein.
„Onkel! Onkel Luke!“
Der kleine Mann nickt ihr zu und lächelt. Als er den Pastor sieht, nimmt er seinen Hut ab und grinst. Es ist eine Eigenheit des kleinen Mannes, alle Gedanken und Stimmungen durch ein unbekümmertes Lächeln, das sich manchmal zu einem Grinsen erweitert, auszudrücken. Er hat große wäßrige Augen und einen großen Mund. Seine Erscheinung ist schlicht und extrem unbeholfen. Nun ist Madeline an seiner Seite, hält seine Hand und schaut zu seinem Gesicht hoch. Der Pastor steht gespreizt auf dem Friedhof.
„Ich habe nur dieses Kind gewarnt, nicht auf dem Grabstein zu tanzen. Ich habe ihr gesagt, daß sie ein sehr gottloses Kind ist. Sie hat mir erzählt, daß ihre Eltern methodistischer Überzeugung seien. Mag es sein wie es sei, sie werden zweifellos mit mir übereinstimmen, daß ihr Verhalten heute extrem gotteslästerlich war.“
Der kleine Mann, der noch immer seinen Hut in der Hand hält, schaut zum Pastor, dann schaut er auf Madeline, dann lächelt er blödsinnig. Sein Lächeln wirkt und er versucht finster auszusehen, mit dem Erfolg, daß er seine Miene zu einem Grinsen verzerrt. Dann plötzlich beugt er sich nach unten zum Ohr des kleinen Mädchens und flüstert krächzend:
„Was ist Madlin? Was ist los?“
„Polly Lowther lehrte mir Tanzschritte“, sagt das Mädchen laut und blickt den Pfarrer furchtlos an, „und Parson kam und fand uns und alle anderen rannten fort. Ich weiß tanzen ist sündhaft, weil Onkel Mark es sagte, aber ich konnte nicht widerstehen. Parson sagte, Onkel Mark sollte sich schämen, aber ich sagte Parson, daß es nicht wahr ist!“
Diese Erklärung scheint für den kleinen Mann zu konfus zu sein. Er kratzt sich den Kopf und schaut mit einem verstohlenen Grinsen zum Pfarrer.
„Tanzen ist tüchtig sündhaft“, sagt er, „kein Zweifel daran.“
„Es ist nicht lächerlich“, ruft der Pfarrer entrüstet, irritiert von dem sonderbaren Gesichtsausdruck des kleinen Mannes.
„Seien sie so gut und verlassen sie das Gelände der Kirche. Das Kind ist ein schlechtes Kind und es ist schlecht erzogen. Nun halten sie ihre Zunge im Zaum – ich wünsche keine weiteren Erklärungen. Nur erinnere ich daran, wenn das Kind den Friedhof wieder entweiht, werde ich verschiedene Maßnahmen ergreifen.“
Dies sagend, winkt er das Paar vom Friedhof und schließt laut das Tor hinter ihnen und stakt zurück zur Pfarrei, mit der Brust voller heiliger Gefühle und christlichem Zorn.
Der kleine Mann steht einige Minuten auf der offenen Straße, verwirrt glotzend und der sich zurückziehenden Gestalt nachschauend. Dann faßt er sich mit der einen Hand an den Kopf und mit der anderen die Hand des Mädchens, nicht wissend, was zu sagen oder zu tun sei. Zuletzt zerschlägt er den gordischen Knoten seiner Verwirrung durch ein von Ohr zu Ohr reichendes Grinsen.
„Parson ist sehr zornig“, sagt er, „aber Tanzen ist eben sündhaft, das ist Fakt.“ Und er setzt mit einem überraschten Blick hinzu, als sage er es zu sich selbst: „Was soll ich deinem Onkel Mark sagen?“
Madeline scheint einen Moment nachzudenken und, als ob sie plötzlich eine Inspiration hat, erklärt sie:
„Komm weiter, Onkel Luke, laß uns heimgehen.“
Der kleine Mann lacht zufrieden, als finde er in dem Vorschlag eine Lösung aller Schwierigkeiten und die kleinen Füße laufen los. Hand in Hand eilen die beiden den Hang hinunter, der von der Kirche zum Dorf führt. Während sie laufen schaut Madeline ganz verstohlen von Zeit zu Zeit zu ihrem Begleiter, als ob sie seine Gedanken zu erraten versucht. Dann preßt sie fest seine Hand und sagt in gut zuredender Stimme: „Onkel Luke!“ „Ja, Madlin.“
„Du wirst Onkel Mark nichts über das Tanzen erzählen.“
„Ich weiß nicht, gerade Tanzen ist sündhaft.“
„Ich kann mir nicht helfen, Polly Lowther bot sich an es mir zu lehren und alle anderen Mädchen können schon etwas tanzen. Wenn du kein Wort Onkel Mark sagen würdest, werde ich dich meine Sparbüchse, die ich von Onkel Mark bekam, öffnen lassen und der Inhalt ist dein.“
Dieser außergewöhnliche Vorschlag schien, um die Gunst Onkel Lukes zu finden, unverantwortlich. Seine Augen blitzten und sein Mund verbreiterte sich von Ohr zu Ohr, aber er täuscht die Mißbilligung der Bestechung vor und bewegt seinen Kopf von einer Seite zur anderen. Madeline beobachtet ihn aufmerksam und als er unschlüssig erscheint, hebt sie seine große braune Hand an ihren Mund und küßt sie leidenschaftlich. Dies scheint Onkel Luke gänzlich zu verwirren und er murmelt schnell:
„In Ordnung Madlin, ich werde nichts erzählen.“
Und Madeline weiß gut, daß ein Versprechen dieser Art von Onkel Luke wie ein Schwur ist. Sie beschleunigen ihren Schritt und sie fährt fort, mit seiner Hand zu spielen und sie zu streicheln und hin und wieder an ihre Lippen zu halten. Vertrauensbeweise dieser Art sind dem kleinen Mann am liebsten von allen Dingen auf der Welt. Das Lächeln in seinem Gesicht ist hell, breit und zufrieden.
Kapitel II
‚Onkel’ Luke und ‚Onkel’ Mark
Während die untergehende Sonne auf Greenfleet, seine finstere Kirche und seine roten Dächer der Wohnhäuser strahlt, nimmt Onkel Luke den Fußweg, der durch die Marschen führt. Um sie herum ist die Landschaft flach und eben, mit keiner oder wenig Vegetation. Über die dunklen, niedrigen Senken war die See davongekrochen, um erneut wieder zu kommen. Hier und da schwebt eine Möwe im geringen Abstand zum Salzwasser, die Marsch nach Beute absuchend. Einmal, als sie eine flache Stelle im blutroten Licht passiert, erhebt sich ein Fischreiher mit grellem Schrei und fliegt langsam davon.
Eine halbe Meile durch die Marsch bringt sie ans Flußufer und sie haben den Blick auf eine Art Gegenstück zum Oberdorf, auf den Umriß winziger rot bedachter Katen, die dicht am Damm stehen. Hier und dort ist ein Fährhaus mit der Lizenz ‚Ale und Tabak‘ zu verkaufen. Als sie auf den Uferweg einbiegen, kreuzt gerade langsam eine Fähre, deren Fracht aus Landmädchen besteht, die auf dem Heimweg von Grayfleet sind. Onkel Luke trottet heiter den Weg entlang, noch die Hand des Mädchens haltend. Ihr Blick ist nun auf den glitzernden Fluß und das driftende Fährboot gerichtet und sie hatten nahezu die Szene mit dem Pfarrer vergessen. Sie sind ein kurioses Paar. Das Mädchen ist ein schlankes hageres Ding, wild wie manch am Wegesrand stehende Unkraut. Ihr Gesicht mit großen leidenschaftlichen Augen, die sehr gedankenvoll und etwas betrübt dreinschauen. Sie trägt eine gewöhnliche Baumwollkutte, ähnlich der Mönchskutten, und grobe Landschuhe und Strümpfe, obgleich ihre Gliedmaßen noch etwas lang und unförmig sind, steht ihr alles gut zu Gesicht. Und, obwohl das Mädchen nicht feenhaft ist, könnte Onkel Luke sicher für einen Zwerg gehalten werden oder eher noch für einen dieser wunderlichen Trolle, deren Aufgabe nach der skandinavischen Legende ist, geschäftig im Bauch der Erde zu arbeiten. Die ganze Woche lang arbeitet Onkel Luke auf der schwarzen Flußbarke als Maat, sein Bruder ist Kapitän. Von Montag bis Sonnabend ist seine Gestalt in blauen Jersey, eine rote Kappe und Ölzeughosen gekleidet und er hilft, daß die Barke auf ihrer kurzen Reise auf und ab des Stromes arbeitet. Aber bei der gegenwärtigen Gelegenheit, es ist ein Feiertag, ist seine Kleidung feierlich: Ein hoher Zylinderhut mit sehr breitem Rand, groß genug von den Ohren gehalten zu werden, eine blaue Lotsenjacke, eine weiße Weste und ein farbiges baumwollenes Hemd, blaue Marinehosen und Schnürschuhe. Onkel Luke liebt die Pracht und nichts gefällt ihm mehr, als in den Augen seiner Mitmenschen prächtig zu scheinen, obschon Onkel Mark, sein älterer Bruder, der streng fromm ist, all diese eitlen Nichtigkeiten tadelt.
Onkel Luke, obgleich körperlich voll tauglich, geistig aber etwas zurückgeblieben, ist in der Achtung vieler ehrbarer und kluger Menschen einfach ein Narr oder in der lokalen Redeweise, ein klein wenig besser als ein Schwachsinniger. Seine Unzulänglichkeiten sind ihm durch äußeren Anschein nicht anzumerken und es würde eines sehr klugen Mannes bedürfen, ihn auf Anhieb zu verstehen. Er ist harmlos, fleißig und in mancher Beziehung sogar klug. Er weiß so gut wie die meisten Männer wieviel Pence einen Schilling ausmachen und wieviel Schilling ein Pfund. Er hat ein scharfes intuitives Wahrnehmungsvermögen der menschlichen Charaktere. All das ist über die Maßen einfach und seine Fähigkeit zu urteilen ist äußerst gering. Sehr ausgeprägt ist seine gute Natur. Er verübelt jede Beschuldigung über seine Klugheit sehr. Sein Bruder Mark sichert ihm Arbeit mit sehr niedrigem Lohn, in dem Verständnis, daß er schwach ist und leicht ermüdet. Und dort auf der Barke, unter den Augen seines Bruders, arbeitet er frohsinnig, außer, wenn jemand grausam genug war, ihm seine Überlegenheit zu nehmen oder ihn wegen seiner Schwachheit zu verhöhnen. In solchen Fällen bekommt er einen wütenden, leidenschaftlichen Anfall. Wenn dieser vorüber ist, verkriecht er sich in seine Kabine, schreit wie ein Kind und manchmal bleibt er für Tage in seiner Hängematte.
Aber heute sieht er glücklich aus, teils aus Stolz wegen des glücklichen Entkommens vom Pfarrer und teils, weil Madeline ihm etwas versprochen hatte. Das unvergleichliche Versprechen des Öffnens ihrer neuen Sparbüchse. Das ist eine Versuchung, der er niemals widerstehen könnte.
Wenn er eine Uhr besäße, so würde er sie in ihre Einzelteile zerlegen, um zu sehen wie sie funktioniert. Und tagelang zerbricht er sich den Kopf, vor Wißbegierde schmachtend, wie es die meisten Kinder tun, um zu erfahren, was wohl im Innern der Sparbüchse ist, auf deren Vorderseite ein Rathaus abgebildet ist und sich ganz oben ein Schlitz für einen übrigen Pence befindet.
Als sie in Sichtweite der Fähre kommen, laufen die beiden schneller. Die Sonne wirft ihren goldenen Schein auf sie und unter ihren Füßen wirbeln Staubwolken auf. Niemand spricht. Madeline fährt fort, gelegentlich einen Kuß auf die Hand zu pressen, welche sie noch in ihrer hält, und zu jeder dieser Gefühlsbezeugungen antwortet ihr Begleiter mit einem breiten Grinsen. Plötzlich gibt er einen Aufschrei von sich. Sie schaut zu ihrem geröteten und staubigen Begleiter. Er sagt ganz schnell:
„Ich sage, Madlin, am besten du setzt deinen Sonntagshut auf, denn Onkel Mark lehnt an der Gartentür!“
Ohne ein Wort gehorcht Madeline. Sie nimmt den Hut, welcher der Kühlung und des Komforts wegen an ihrem Arm hängt und setzt ihn vorsorglich auf. Dann nimmt sie wieder Besitz von der Hand ihres Onkels. Sie laufen schicklich hinauf zu einer der kleinen grünen Pforten, an der tatsächlich Onkel Mark lehnt.
Obgleich Luke und Mark Brüder sind, sind sie verschieden wie nur zwei Männer sein können. Mark Peartree ist sechs Fuß groß, er ist sehr mager und seine Schultern sind leicht gebeugt, sein Haar ist grau, sein Gesicht rot wie ein Ripston Pippinapfel, seine Wangen sind eingesunken, vielleicht durch den Verlust einiger Zähne.
Die Kate ist eine aus der Reihe der roten Ziegelhäuser, deren Vorderfront mit Kletterpflanzen bewachsen ist, eine schmale Gartenparzelle zum Fluß hin besitzt und von Bäumen eingerahmt ist und als Begrenzung ein grünes Tor besitzt. Auf dem Tor nun lehnt Onkel Mark, auch im Sonntagsstaat gekleidet, aber mit viel weniger schmückendem Beiwerk als Luke. Wie man seinem Gesichtsausdruck ansieht, schaut er mit Ungeduld auf die Straße.
„Da seid ihr ja endlich“, sagt er, als das wandernde Paar ankommt, „warum, verflixt, könnt ihr nicht zur Essenszeit zu Hause sein? Die Mutter ist sehr ärgerlich. Bruder Brown war am Nachmittag hier und er wird wiederkommen!“
Bei dieser Rede verschwindet das Lächeln auf Lukes Gesicht und bevor er eine Antwort hat, ertönt eine andere Stimme aus dem Inneren des Hauses, offenbar die einer Frau:
„Ich bin sicher, Vater, es ist wie dir Bruder Brown sagte, als er mit den Brethrenbrüdern hier war, daß wir genug zu tun hätten, wie an jedem Tag des Jahres. Wie auch immer, sie sind jetzt da, aber es wird wohl nichts zu Essen geben…“
Die Sprecherin steht in der Haustür, die roten Ziegel und die grünen Ranken umrahmen sie. Eine stattlich aussehende Frau. Gekleidet in ein sauberes baumwollenes Kleid mit einer weißen einfachen Schürze, die um ihre Hüfte gebunden ist. Sie ist klein und beleibt, mit einem gebräunten gutmütig-humorvollen Gesicht und glänzenden schwarzen Haaren. Sie trägt eine Haube, deren lange Enden über ihre Schultern fallen und hinten gebunden sind. Ihre Ärmel sind fast bis zu den Ellenbogen aufgekrempelt. Ihre Hände und Arme sind braun und rot gesprenkelt durch das ständige Arbeiten in Seife und Wasser.
Beim Anblick dieser Gestalt, die wirklich die Frau von Mark Peartree ist, oder wie Madeline sie ruft, Tante Jane, erscheint das gutmütige Grinsen auf Onkel Lukes Gesicht. Sie gehen durch das kleine Tor, das als Eingang dient und betreten schließlich das Haus, während Madeline ihre Aufmerksamkeit auf Onkel Mark richtet:
„Es war nicht die Schuld von Onkel Luke“, sagt sie in das Schlechtwettergesicht schauend, „wirklich, Onkel Mark, alle Schuld liegt bei mir, daß wir zu spät gekommen sind – ich war unten mit Polly Lowther die Gräber ansehen.“
Ihr Eifer, ihren Schützling zu verteidigen offenbarte nicht das gefürchtete Geheimnis des Tanzens und Onkel Mark ordert das Dinner, das er einnehmen will, nimmt dann ihre Hand und sagt:
„Es ist alles in Ordnung, mein Mädchen“, behält ihre Hand in seiner schwieligen Faust und zieht sie weiter ins Haus.
Es ist ein sehr kleines Haus. Ein langer, schmaler Gang führt von der Eingangstür nach hinten und in der Mitte des Gangs ist eine Treppenflucht mit schmalen nackten Stufen. Auf der rechten Seite gehen zwei Räume ab – eine Küche und ein sogenanntes Wohnzimmer. In der Woche, während die Männer zur Arbeit auf dem Fluß sind, wird das Wohnzimmer sorgfältig verschlossen. Darin wird niemals Feuer gemacht – die Möbel sind dunkel, gut poliert und elegant mit ein wenig rauem Wollstoff als Teppich unterlegt. Ein chinesischer Hirte und eine Schäferin sowie verschiedene Muscheln zieren die Kamineinfassung. An den Wänden hängen zwei hell beleuchtete Bilder, eines zeigt den ‚verlorenen Sohn’, das andere ‚Susanne und die Greise’. Und in der Mitte des Kaminsimses steht die Krönung des Appartements: Ein kleines Wetterhäuschen, aus Holz geschnitzt, in Form eines überdachten Schuppens und im Innern zwei Figuren, eine ist ein ‚Darby’, die andere ist ‚Joan’, die an jeder Seite des aufgehängten Thermometers stehen. Wenn das Wetter schön ist, so kommt Joan hervor mit ihrem Korb am Arm, als ginge sie zum Markt und ‚Darby bleibt unsichtbar. Wenn es regnet verschwindet Joan und ‚Darby’ erscheint mit den Attributen eines Mannes. Dieses Wetterhäuschen ist in Madelines Augen ein Wunder der Kunst und geschätzt bei allen Bewohnern des Hauses. Wahrlich ist das Wohnzimmer alles in allem etwas Heiliges, voll von frommer Verschwiegenheit und Dunkelheit und sogar Mrs. Peartree betritt es nie ohne eine gewisse Ehrfurcht, zurückhaltend im Sinne von großer Achtung. Von Wochenende zu Wochenende bleibt sie in der rot gefliesten Küche, während am Sonntagabend und an besonderen festlichen Anlässen das Wohnzimmer zur familiären Nutzung aufgeschlossen wird.
Kapitel III
Ostern, das Fest der Brethren
Es ist in der gepflasterten Küche, wo sich die Gesellschaft versammelt und ihre Plätze um den viereckigen Tisch einnimmt, welcher mit einem sauberen Tischtuch bedeckt ist und das Essen beginnt. Es gibt gekochtes Schweinefleisch und Kartoffeln.
Ihre kleinen Füße schwingen hin und her und ihre großen blauen nachdenklichen Augen schweifen wehmütig durch den Raum. Madeline sitzt am Tisch und ißt ihre Portion zufrieden auf. Die Sonne strahlt durch das hintere Fenster und liebkost ihre hellen Wangen und ihr goldenes Haar. Madeline läßt ihre Gedanken zu den glücklichen Strahlen wandern, die sie nur eine kurze Zeit berührten, als sie auf dem Grabstein Tanzen lernte. Plötzlich scheint sie ein neuer Gedanke zu erfüllen.
„Onkel Mark“, sagt sie, während Onkel Luke seine Gabel und sein Messer verwundert senkt, „können tote Leute fühlen?“
„Nein, mein Mädchen“, erwidert Onkel Mark, mit ein wenig überraschten sanften blauen Augen, „ein toter Mensch ist tot wie ein Nagel es ist – er kann nichts fühlen. Wie bist du darauf gekommen?“
Aber Madeline antwortet nicht; nach dieser kurzen Versicherung macht sich ein Gefühl großer Befriedigung in ihr breit. Mit einem bedeutungsvollen Blick zu Onkel Luke, sagt sie zu sich selbst, daß zum ersten Mal in ihrem Leben der Pfarrer etwas Falsches sagte.
Das Essen geht vorüber und alle sind allgemein bewegt, eine große Ehrfurcht ergreift die Familie bei der Unterhaltung, die in der Küche entfacht worden war. Onkel Mark und Luke gehen ehrfurchtsvoll in das Wohnzimmer und schließen die Tür, Madeline räumt auf und macht sauber und folgt ihnen danach, während Tante Jane, die eine unerklärbare Reizbarkeit ergriffen zu haben scheint, fortfährt, die Küche zu säubern. Im Wohnzimmer schleicht sich Madeline zum Fenster und starrt mit nachdenklich verträumten Augen in den kleinen Garten vor dem großen stillen Fluß, welcher glitzernd in der Sonne dahinfließt. Onkel Mark, der auf einem sehr abgenutzten und ekligen Pferdehaarsofa sitzt, ist tief in die Seiten der Familienbibel versunken, während Onkel Luke mit einem Gesicht schwerwiegender Entscheidungen, leise die Worte eines Osterliedes wiederholt. Alles ist in der düsteren Kammer ruhig und still, aber man kann durch die geschlossene Tür das Rasseln des Geschirrs, das Klappern der Töpfe und Pfannen aus der Küche hören. Das Rasseln und Klappern klingt nun ab und gleichzeitig klopft es an der Haustür. Die Zimmertür wird geöffnet und eine Anzahl Besucher kommen nacheinander herein. Da ist ein hagerer dünner Mann, bekleidet in glänzendem Schwarz, mit einem langen schmalen Gesicht, breiter hervorstehender Stirn und einer Glatze, gefolgt von verschiedenen, sehr roh aussehenden Gestalten mit hohen Hüften und einfachem Sonntagsstaat. Jeder der hereintritt, nimmt seinen Hut ab und mit einem feierlichen Nicken begrüßen sie Onkel Mark und Luke. Der hager4e Mann bleibt in der Mitte des Raumes stehen und atmet schwer, während Onkel Mark, der ihn offensichtlich erwartet hat, aufsteht und begrüßt. Der hagere Mann in Schwarz, ein pensionierter Kaufmann, bekannt in der Nachbarschaft als ‚Bruder Brown’, ist der Führer der Sekte der ‚United Brethren’, in der Onkel Mark und Luke bescheidene Mitglieder sind. Bruder Brown ist eine Person von äußerster Wichtigkeit und großem Eigentum und ohne ein großes Feld für Heldentaten der Frömmigkeit zu haben, ist er mit sich zufrieden. Jeden Sonntag besucht er eine Reihe von Landhäusern, um in dem einen oder anderen Haus seine Anhänger zu versammeln, um ihnen vom Licht und Schatten einer anderen Welt zu predigen.
Nach einem scharfen Blick in den Raum gibt Bruder Brown nur die Fingerspitzen, nickt grimmig zu Madeline und sinkt auf das Sofa. Er bedeckt sein Gesicht mit seinen großen roten Händen und sinkt in tiefe Stille. Diesem Manöver folgen alle anderen stellt Madeline fest. Jeder bedeckt sein Gesicht mit den Händen und nimmt sozusagen den frommen Anführer in sich auf. Wenn wir die Metapher weiterführen, bleiben alle für einige Minuten unter Wasser. Der Effekt ist Ehrfurcht und Inspiration. Zuletzt nimmt Bruder Brown seine Hände herunter und steht erfrischt auf und einer nach dem anderen erhebt sich.
„Bruder Peartree“, sagt er zu Onkel Mark, „sind alle da?“
„Ja, Sir“, antwortet Onkel Mark, während seine blauen Augen über die Gruppe wandern.
„Hier sind Bruder Strangeways, Bruder Smith, Bruder Hornblower, Bruder Billy Hornblower, Bruder Luke Peartree und ich selbst. Nicht zu sprechen von der kleinen Madlin – sie wollte mit herein und ein Kind kann nicht früh genug beginnen.“
Bruder Brown hustet heftig und schaut zur Küchentür durch welche in Abständen die Geräusche von Töpfen und Pfannen kommen.
„Dann nehme ich an“, sagt er, „Schwester Peartree ist noch verstockt. Sie wird nicht an unserer kleinen Versammlung teilnehmen, um die Worte der Heilung zu hören?“
Onkel Mark wird rot und schaut sehr beunruhigt. „Nun, die Frau hat sich die ganze Woche abgeplagt und ich denke, sie ist nicht sauber genug angezogen, um in die gute Stube zu kommen.“
Bruder Browns Augenbrauen verdunkeln sich noch mehr.
„Sechs Tage sollst du arbeiten“, sagt er, „gut Bruder, du bist der Hausherr und ich lasse unsere sündige Schwester tun. Laßt uns nun beten.“
Darauf knien alle, Madeline inbegriffen, nieder, während Bruder Brown, unter Seufzern und Ausrufen seiner Begleiter, seinem Geist in einer langen Predigt über Veränderungen und Erklärungen des Mitgefühls freien Lauf läßt.
Auf ein Zeichen Bruder Browns erheben sich alle wieder und er bittet Bruder Billy Hornblower, ein langer und schmächtiger junger Schiffer von zwanzig Jahren, ein schlichtes Kirchenlied anzustimmen, in das alle mürrisch einstimmen:
Führe das Boot zur Stadt Jesus,
stromaufwärts, durch die Gefahren des Meeres,
neben dem Strom liegt die Stadt Jesus,
dunkel ist die Nacht, aber gut wird das Boot geführt.
Führe das Boot, Maat! Führe das Boot!
Hört, Wind kommt auf – es ist Gefahr auf See-
Mut! Zur Stadt de Jesus,
standhaft, sicher wird das Boot geführt…
Als der Gesang lauter wird, vergrößert sich das Geklapper in der Küche, zum augenscheinlichen Ärgernis Bruder Marks. Das Lied endet und Bruder Brown trägt eine kurze Predigt vor, die auf dem Text basiert ‚Denen, die hinunter gehen zur See in Schiffen’, welche besonders geeignet ist für die, die zu ihren Kähnen zum Fluß gehen.
Danach erhebt sich Bruder Mark und in ein paar kurzen Worten fügt er frei biblische Zitate an, die an die Brethren gerichtet sind und nimmt als Thema den heiligen Charakter dieses Tages und verwirrt die Seele der kleinen Madeline durch düstere Ehrerbietung der Toten in ihren Gräbern.
Mit einem kurzen Hinweis von Bruder Strangeways, ein Seemann mit einem sehr wettergezeichneten Gesicht und ein anderes Lied von Bruder Billy Hornblower, ist der Dienst beendet. Dann schütteln sich zum feierlichen Abschluss alle die Hände und die Unterhaltung wird plötzlich weltlich.
„Gehst du am Morgen mit der Flut hinunter, Maat?“ fragt Bruder Strangeways, „so gegen vier wird Flut sein und werden wir wieder so beladen sein wie vorgestern?“
„Wo denn, Maat?“ fragt Onkel Mark.
„Nicht weit von Southam“, war die Antwort.
„Gut Maat, ich bin noch angebunden bis Montag aber dann geht’s ab mit der ersten Flut zum Crewsham Becken.“
Das Gespräch zwischen beiden wird nun geschäftlich. In der Zwischenzeit nimmt Bruder Brown verschiedene lose Blätter oder Traktate aus seiner Tasche, die als eine Art Torpedos, die er ungefragt in seiner Ordenstracht auf die widerspenstigen Verwirrten und reuelosen Sünder verschießt. Drei von den Traktaten sortiert er aus, jedes von ihnen hat einen besonderen Inhalt als verzweifelte Hoffnung zur geistlichen Verfassung einer Person des anderen Geschlechts. Er entscheidet sich, die Blätter an die Wohnzimmerwand zu heften, eines über die Hirtin am Kamin, das zweite unter das Bild des verlorenen Sohnes und das dritte unter das der Susanna. Als das getan ist, gibt er Onkel Mark die Hand, ignoriert Onkel Luke und verläßt das Haus. Darauf folgen die anderen Männer, jeder mit einem ‚Gute Nacht’ für jeden der beiden Peartrees.
Nicht schnell genug schließt Mrs. Peartree die Haustür und geht mit bis zu den Ellenbogen hochgekrempelten Kleiderärmeln in ihr Wohnzimmer. Als ihr Blick auf die Wohnzimmerwand fällt, verwandelt sich ihre Verachtung in Zorn.
„Bruder Brown hat sie wieder an die Wand gepinnt“, schreit sie, „ich wundere mich über dich, Mark Peartree, das du still dabeisitzt und ihn gewähren läßt, oh, ich könnte ihn zur Strecke bringen.“
Während sie spricht, macht sie ein Schlag auf jedes Stück Papier und reißt es ärgerlich herunter.
„Mein Mädchen“, sagt Onkel Mark mürrisch, „lese sie, sie sind dagelassen zu deiner Erbauung.“ „Papier und Unsinn!“
„Seelenheil ist kein Unsinn, Mutter…und laß es dir sagen, dies ist mein Fräulein, sie bekommt nicht viel von dir, um ihr die Augen zu öffnen. Warum hörten wir dich wie einen Lastkahn, der seinen Anker hebt, so mit dem Geschirr klappern, während wir sangen? Meinem Mädchen bekommt das nicht und es ist kein gutes Beispiel für die kleine Madlin, die nach und nach ein Wessel wird.“
„Niemals, wenn ich es verhindern kann“ antwortet die Frau, „wir haben mit dir und Luke genug Wessels in unserer Familie. Schau auf die Spuren der schmutzigen schlammigen Füße auf dem sauberen Teppich. Ich wünsche, daß ihr euch draußen trefft oder in einem anderen Haus als in meinem.“
„Und ich wünschte, du würdest zu uns gehören – das würde dir Kraft für das Gute geben.“
Mrs. Peartrees einzige Antwort ist, ihren Kopf zurückzuwerfen und in die Küche zurückzugehen. Onkel Luke folgt niedergeschlagen und traurig über die häuslichen Unstimmigkeiten, währen Onkel Mark im Wohnzimmer bleibt und Madeline die Bilder in Fox’s Buch der Märtyrer zeigt, dieses kolossale antiquarische Frühwerk. Das Kind schauderte, als es auf jeder Seite sieht, wie Feuer die Menschen vernichtet, die die Wahrheit bezeugen in gottloser Zeit.
„Onkel Mark“, sagt sie „verbrennen sie jetzt immer noch Leute?“
„Nicht hier, in der jetzigen Welt, nur in anderen Ländern. Und dann auch nur die Allerschlechtesten – solche, die ihre Nachbarn hassen und nicht im Guten, ohne zu brennen, sich einigen können!“
Madeline antwortet nicht, aber sie denkt an Tante Jane, die im Innersten eine milde und gute Natur ist, die aber äußerst unverbesserlich in ihrem heftigen Haß gegen Bruder Brown ist.
Kapitel IV
Onkel Marks Aufgaben auf dem Lastkahn
Als Madeline am Dienstag nach Ostermontag aus ihrem Bett schlüpft, die Kattunvorhänge von ihrem kleinen Fenster zurückzieht und hinausschaut, ist sie erstaunt, daß der Sonnenschein der vorangegangenen Tage von nebligem Regen gefolgt wird. Der Fluß sieht schwarz und sehr festlich aus wie er zwischen seinen Sandbänken dahinfließt. Die Marschen bekommen ein weißes Gesicht zum finsteren Himmel und scheinen im fallenden Regen traurig wie trunken. Die roten Ziegel auf den Häusern von Grayfleet sind durch den unaufhörlichen Regen roter als sonst.
Sie hatte tief und fest geschlafen, ist aber noch nicht gänzlich wieder bei Bewußtsein, durch die Niedergeschlagenheit der Predigten in den letzten paar Tagen und von so mancher Stunde im Heiligtum des besten Zimmers. Sie zieht sich eilig an, rennt die Treppe hinunter und schaut in das Wohnzimmer zum Wetterhäuschen. Oh weh! Joan ist unter dem Dach und Darby ist draußen. So wird es wirklich ein nasser Tag werden! Im Haus ist es still. Die Haustür steht offen und eine feuchtkalte Brise weht in den Flur und küßt ihre Wangen. Das Wohnzimmer ist von Tante Janes fleißigen Händen vor einer Stunde gereinigt und für den nächsten Sonntag hergerichtet worden. Ein helles Feuer brennt in der Küche und wirft sein Licht auf den hellen gefliesten Flur und auf die stramme Gestalt der Tante Jane selbst, die am Tisch steht und das Frühstück vorbereitet.
„He, wie kannst du mich erschrecken!“ ruft sie aus, als Madeline ihren Kopf vom Flur hereinsteckt, „komm, Mädchen, und frühstücke. Es ist schon höchste Zeit, daß du zur Schule mußt.“
Nachdem sie einen herzlichen Kuß auf Mrs. Peartrees sonnengebräunte Wange geschenkt hat, setzt sie sich auf ihren Platz an den Tisch. Plötzlich schaut sie sich um und fragt:
„Tante Jane, wo ist Onkel Luke?“
„Mit Onkel Mark für zwei Stunden oder länger ausgegangen. Sie segelten mit der Flut hinaus, schon vor einer Stunde, bevor du aufgestanden bist.“
„Sie fahren nach London, ohne mich?“ sagt Madeline und ihre großen Augen füllen sich mit Tränen.
„Onkel Luke hatte versprochen, mich diesmal mitzunehmen!“
„Gut, gut, höre auf mit dem Geschrei, sei ein gutes Mädchen!“ sagt Tante Jane beruhigend, „dein Onkel Luke wollte dich nicht mitnehmen, aber auch ich wußte nichts von dieser Reise. An so einem trüben Morgen wollte dich niemand aus dem Bett holen, es regnete und ein starker Wind blies, da würdest du dir den Tod geholt haben. Aber wenn du ein gutes Mädchen bist und gut lernst, wirst du das nächste Mal mitgenommen. Sie wollen den Kahn morgen hinunter bringen und am Donnerstag zurückbringen. Dann wirst du mitfahren.“
Durch diese Versicherung wird Madeline froh und gefaßt. Sie war schon ein oder zweimal auf dem Kahn gewesen, als er gegenüber der Fähre im Grayfleet-Becken lag. Seine großen roten Segel waren gesetzt und sie hatte es im Fahrwasser des Flusses gleiten sehen, bis es nur noch als schwarzer Punkt zu sehen war und langsam, die Marschen passierend, hinter dem grauen Nebel, der ständig wie eine graue Wolke über ihm lag, verschwand. Ihre kindliche Vorstellungskraft hat ihr oft Bilder fremder Szenen heraufbeschworen, von dort, wohin der schwarze Schwan driftet. London ist für sie die große Welt, eine mysteriöse Stadt, so ganz anders als der dunkle schlammige Fluß und die höher gelegenen Marschen von Grayfleet. Seit sie sich erinnern kann, ist das magische Wort ‚London’ immer eins gewesen, das sie zu guten Taten antrieb, mit dem Ziel, einmal dorthin zu kommen. Wann immer sie böse war, vergaß Tante Jane nie das Ehrfurcht einflößende Wort zu wiederholen:
„Madlin, wenn du nicht ein besseres Mädchen wirst, so wirst du nie mit mir und Onkel Mark nach London kommen…“
Wenn es ihr außergewöhnlich gut gegangen ist und sie alles zur Zufriedenheit erledigte, mangelte es nie das ständige Versprechen zu hören:
„Du bist außerordentlich fleißig gewesen! Du wirst mit mir nach London kommen und wirst die großen Wachsfiguren der Könige und Königinnen sehen, die schlafenden Schönheiten, als würden sie leben.“
Wann diese märchenhafte Reise stattfinden sollte, schien unbestimmt. Daß Tante Jane streng dagegen ist, mag von der Tatsache herrühren, daß sie in ihrer sechsundzwanzigjährigen Ehe nur zwei Tage von zu Hause fort war.
Aber Madeline ist mit der Hoffnung zufrieden. Zu hoffen und zu warten und von manchen Dingen zu träumen, bis irgendwann dieser glückliche Tag kommt.
Nun, kurz vor Ostern ging sie einmal in überschwänglicher Dankbarkeit zu Onkel Luke, gerade als seine Wißbegierde ihn veranlaßte, eine billige Ziehharmonika auseinander zu nehmen, um zu sehen, woher die Musik kommt.
Er fühlte sich ertappt und versprach ihr sogleich, sie mit auf das Boot zu nehmen und ihr selbst die wunderbaren Sehenswürdigkeiten der großen Stadt zu zeigen.
Es ist nun für Madeline ein harter Schlag zu erkennen, daß ihre Onkel zu diesem märchenhaften Ort ohne sie gestartet waren. In der Zwischenzeit hat sie ihr Frühstück beendet und ihre Niedergeschlagenheit von dieser Enttäuschung hatte sich gelegt. Sie schenkt einen weiteren Kuß auf Tante Janes braune Wange, nimmt ihre Bücher unter den Arm und trottet fröhlich durch den Regen zur großen rotgeziegelten öffentlichen Schule. Den ganzen Tag ist sie leichten Herzens und als der Abend kommt, verweigert sie entschlossen Polly Lowthers Einladung zu einer weiteren Tanzstunde und trottet nach Hause zu Tante Jane. Sie findet die Küche freundlich und sauber wie gewöhnlich, das blitzende Geschirr auf der Anrichte, die Schüsseln lächeln von den Wänden und in ihrer Mitte sitzt Mrs. Peartrees mit einem Wollschal um ihren Nacken und ihre geschäftigen Finger stopfen Onkel Marks Wolljacke. Als Madeline kommt, legt sie ihre Arbeit beiseite und holt den Tee. Beide setzen sich hin.
„Madeline, warum um alles in der Welt, freust du dich so?“ fragt Tante Jane jetzt, erstaunt über die ständigen Ausbrüche und halb unterdrückten Lacher des Kindes. Doch Madeline weiß nur, daß sie eine fremde, hysterische Art von Freude fühlt, die nicht unterdrückt werden kann. Alles bringt sie zum Lachen, das glänzende Geschirr, das leuchtende Licht des Feuers, die schnurrende Katze am Herd, Tante Janes sonnengebräuntes Gesicht und eben so ihre erstaunten Blicke und ihre vorwurfsvolle Stirn.
Mrs. Peartree schaut kummervoll, für sie ist das abergläubisch.
„Dieses Lachen und dein Denken ist falsch. Ich weiß noch, an dem Tag, als mein armer Bruder Jim ertrank, lachte ich wie ein verrücktes Ding, als ich die Nachricht erhielt. Ich denke: Wer am Morgen lacht, wird weinen bevor die Nacht kommt.“
Diese ernsthafte Warnung gebot Madelines Heiterkeit plötzlich Einhalt, die aber bald wieder mit erneuter Vehemenz hervorplatzte.
„Es ist nicht wegen schlechter Nachrichten, Tante Jane“, sagt sie „es ist, weil ich schon bald mit Onkel Mark nach London fahre.“
Das hat Tante Jane nicht überzeugt. Sie schüttelt ernst ihren Kopf und ein paar Stunden später, als sie das Kind zu Bett bringt, sagt sie:
„Nun, Madeline, versuche zu schlafen und höre auf zu kichern, es ist verderbt für ein Kind, so zu lachen, es nimmt mir jeden Schlaf, wenn ich an meinen armen lieben Bruder denke, der in den Himmel gegangen ist.“
Madeline verspricht unbedingten Gehorsam und schmiegt ihren dunklen kleinen Kopf in das schneeweiße Kopfkissen. Als sie allein ist, schlüpft sie aus dem Bett, schiebt die Gardine beiseite und schaut hinaus, um durch den dunstigen Nebel des Regens wie ein Gespenst in Erwartung, das große dunkle Segel des Kahns zu sehen. Aber diese Vision tritt nicht ein, die matten Strahlen des Halbmondes zeigen ihr nur den still schlafenden Fluss durch die silbernen Fäden des Regens, die still aus dem dunklen Himmel fallen.
„Onkel Mark, Onkel Luke, beeilt euch und kommt heim, ich will auch versuchen, niemals wieder zu lachen“, sagt Madeline leise.
Zur selben Zeit gleitet etwa zehn Meilen entfernt der Kahn von Onkel Mark und Luke langsam auf dem Fluß. Der Wind ist den ganzen Tag gut und der Lastkahn kommt schnell voran, aber als es Nacht wird und der Regen stärker fällt ist absolute Windstille. Der Kahn liegt unbeweglich mit den großen lautlosen, schlapp hängenden Segeln auf dem Fluß. Sie haben die Seitenlichter aufgezogen und hin und wieder antwortet ihnen durch die schier undurchdringliche Finsternis ein schwaches Licht als einziges Zeichen menschlichen Lebens, welches zu ihnen dringt.
Onkel Luke steht am Ruder, mit seinen kleinen scharfen grauen Augen in die Finsternis spähend. Onkel Mark ist unter Deck und ißt Abendbrot. Dann schaut sein Kopf mit seiner roten Nachtmütze aus der Schiffsluke und ein heller Schein umgibt ihn, dann erscheint sein ganzer starker Körper und er schlendert zu Luke.
„Gut gemacht“, sagt er „es scheint immer noch kein Wind zu sein und ich fürchte es ist auch nicht viel zu erwarten, gehe du jetzt nach unten und ruhe dich aus.“
Aber Onkel Luke schüttelt entschieden seinen Kopf.
„Nein, nein, Mark“, antwortet er, „du bist länger wach als ich. Gehe noch eine Weile bei dieser Stille und wenn Wind aufkommt, werde ich dich wecken.“
Nach einer weiteren kleinen Diskussion, wer nun zuerst schlafen gehen soll, entscheidet sich Onkel Mark für die Kajüte und Luke bleibt allein zurück.
Oben ist es sehr langweilig, sehr dunkel und naß, aber Onkel Luke, der immer glücklich ist, scheint ganz kämpferisch. Er faßt das Ruder fester und härter mit seinen schwieligen Händen und richtet seinen scharfen Blick auf die sich rund um ihn bewegenden Lichter. Es ist kaum ein Luftzug zu spüren und der Kahn liegt wie ein Brett. Immer mal wieder wird der Kahn durch eine aufkommende leichte Brise angehoben, während das große Segel hoch oben lautlos schlägt und die Positionslichter wie glimmende Sterne in der Dunkelheit erscheinen und ihr Schein sich in den dunklen Himmel oben verliert. Ungefähr eine Stunde vergeht so, dann hört der Regen langsam, der schwarze Himmel verzieht sich, ein kalter, leichter Wind bläht die Segel, schiebt die schwere Takelage des Leesegels zur Seite und läßt den Kahn langsam vorangleiten. Onkel Luke hält das Ruder noch fester, klopft heftig mit seinen genagelten Schuhen auf das Deck und in kurzer Zeit kommt Onkel Mark frisch und lebhaft aus der Kajütenluke.
„Ah, wir haben ein wenig Wind bekommen, bevor es Tag ist“, sagt er, als er das Ruder übernimmt, „mach die Segel klar, Luke, wir wollen keine Zeit verlieren, denn der alte Kahn ist nicht mehr sehr flink und es wird etwas mehr Verkehr sein.“
Onkel Luke trottet gehorsam nach Achtern.
Als nun Mark ihn von allen Aufgaben entbunden hat, beschäftigt ihn ein großes Problem, an welches er denkt, seit sie von zu Hause losfuhren: Entweder will er ein Geschenk aus der großen Stadt mitbringen oder sie sollte sich selbst etwas kaufen, wenn sie wieder zurück sind.
Während er darüber nachdenkt, prüfen seine verträumten Augen die Szenerie um ihn herum, seine Hände sind geschäftig und holen die Taue ein. Die Brise verstärkt sich in kürzester Zeit mehr und mehr. Als die Nacht vorüber ist und der Tag zu dämmern beginnt, wird sie noch stärker und breitet sich auf der Wasseroberfläche aus, peitscht sie zu kleinen Wellen auf, die Schaum auf ihrer Krone haben. Die dicken schwarzen Wolken sind westwärts abgezogen und in östlicher Richtung sind viele scharlachrote und graue Wolken zu sehen. Die Landschaft ist noch düster und das Licht ist von einer silbern leuchtenden Art, welche bereits vom Tageslicht oder noch vom Mondlicht herrührt.
Sie haben bereits die tiefer gelegenen Marschen von Essex weit hinter sich gelassen und können bereits in der trüben Entfernung eine schwer lastende Wolke über einer Bergspitze sehen. Es ist der Smog, welcher immer über der großen Stadt emporsteigt. Der Verkehr auf dem Fluß scheint sich zu beleben. Lastkähne, meist beladen bis zur Wassergrenze, schlagen sich vorwärts, andere fahren hinunter, Dampfschlepper und Ozeandampfer, die die Luft mit Rauch schwärzen, alles gleicht sich, dahinschwindend und ankommend wie in einem Irrgarten.
Onkel Mark hält noch das Ruder, mit großer Geschicklichkeit meistert er seine schwierige Aufgabe. Die Krümmungen des Flusses sind unzählig, oft kommt der Wind direkt von vorn. Der Lastkahn ist schon immer ein schwerfälliger Segler und ist überladen. Ein oder zweimal schätzt Onkel Mark beim aneinander Vorbeifahren die Lage falsch ein und bringt den Kahn in Gefahr. Er entgeht knapp einer Kollision. Dann wird es auf dem Fluß klarer und der Wind kommt geradewegs auf das Oberteil des Schiffes. Sie eilen vergnügt vorwärts und das Wasser um sie ist weiß von Schaum.
„Schau hin, Mark, schau hin!“ schreit Onkel Luke plötzlich und Onkel Mark beugt sich, um unter das rote Hauptsegel zu sehen und sieht einen Dampfschlepper geschwind dampfend auf ihrer Route entgegenkommen.
„Er ist gerade vor uns und geht nicht aus dem Weg“, kreischt Onkel Luke in das Heulen des Windes, er ist wie taub.
Mark verringert die Geschwindigkeit des Kahns, dann schätzt er die Entfernung zwischen beiden Schiffen.
„Alles in Ordnung, Maat“, schreit er, „wir schaffen das.“
Der Kahn fährt seine Geschwindigkeit weiter, der Schlepper kommt schnell entgegen. Onkel Mark beobachtet zunächst unbekümmert, dann besorgt. Der Schlepper ist bereits empfindlich nahe. Durch leichtes Ausweichen von ihrem Kurs könnten sie mit dem Heck passieren, bei Beibehaltung scheint es, würden sie in der Mitte bersten. Onkel Mark rechnet damit, daß der Schlepper sie sicher trifft. Der Schlepper, so scheint es, rechnet damit, daß der Lastkahn ausweichen müsse, denn er kommt gerade auf sie zu. Eine Kollision scheint unvermeidlich. Onkel Mark schreit plötzlich:
„Hol das Hauptsegel ein!“ und mit diesem Schrei reißt er das Ruder herum, als einzige Chance zu entkommen. Der Kahn gleitet herum, aber der brüllende Wind drückt das Bugspriet einige Inches in die Schlepperseite. Durch und durch bebend, mit einem donnernden Zusammenstoß, legt er sich auf die Seite, reißt den Mast heraus. Dann gibt es noch einen Zusammenstoß wie eine berstende Kanone, es gibt einen großen Plumps ins Wasser und vom Schlepper ertönt ein Schrei. Onkel Luke, der mit dem Gesicht auf dem Boden liegt, kriecht auf allen Vieren um an das verlassene Ruder zu gelangen. Der große Baum ist in zwei Teile geborsten, der Mast wie Schilfrohr geknickt und Onkel Mark ist weg! Vom Steuermann verlassen schaukelt der Kahn im Wind mit seinen großen Segeln, die nutzlos flattern, die ganzen Aufbauten sind entzwei und er sieht aus wie ein driftendes Wrack.
Verwirrt durch den Unfall und die donnernden Wanten und Segel kann Onkel Luke jetzt seine Gedanken nicht sammeln, um schnell zu handeln und starrt für einige Momente in entsetzter Verzweiflung vor sich hin. Dann sieht er, daß der Schlepper ihren Motor umgestoßen hatte, daß ein Boot geschwind herausrudert zu einer Gestalt, die offensichtlich leblos auf den Wellen treibt, es ist die Gestalt Onkel Marks. Tot? Es scheint so, der Körper ist bewegungslos, das Gesicht bleich und er treibt ohne Kampf. Plötzlich wird Onkel Luke gewahr, daß das Deck des Kahns unter seinen Füßen schwindet. Der heftige Schlag des Mastes hatte die Wanten durchschlagen. Das Wasser ergießt sich wie ein reißender Strom, der Kahn sinkt schnell. Er springt in den angehängten Kahn, schneidet mit seinem Messer das Bootstau durch und rudert, ohne auf irgendetwas zu achten schnell zu der Stelle, wo Onkel Mark der Hilfe bedarf.
Er holt ihn jetzt ins Boot und legt ihn ins Heck, seine Wangen sind aschgrau, seine Lippen blutig, seine Augen halb geschlossen. Mit einem wilden Schrei klettert Luke in das Boot und ohne an sich zu denken, faßt er die kalte nasse Hand, streicht ihm das tropfende Haar zurück und beginnt zu weinen und zu stöhnen
„Mark, Gefährte, öffne deine Augen“, schreit er, „was fehlt dir? Kennst du nicht Luke – deinen Bruder Luke?“
Aber Mark antwortet weder mit einer Geste, noch mit einem Wort. Ein abgesplittertes Stück des Baumes machte ihn besinnungslos und beinahe wäre er durch den Schlag getötet worden.
„Wir werden ihn am besten an Bord nehmen“, sagt einer der Männer, „seht, der Kahn sinkt schnell.“
Während er dies sagt, sinkt der Kahn und verschwindet bis auf die Spitze des Topmastes, die nun noch über den Wellen zu sehen ist.
Der arme Luke denkt nicht an das Schiff, seine Gedanken drehen sich nur um den verletzten Mann.
„Woher seid ihr, Maat?“ fragt einer der Seeleute von dem Schlepper.
„Wir sind aus Grayfleet, Meister“, antwortet Luke schluchzend und immer noch versucht er die schlappe, kalte Hand warm zu reiben.
„Nehmt ihn bitte an Bord und bringt ihn schnell nach Hause, dann wird er an der schweren Verletzung nicht sterben.“
Der Mann ist einverstanden, die beiden Männer an Bord zu nehmen, weil auch ihre Route Grayfleet streift. Aber als sie in Onkel Marks Gesicht sehen, glauben sie unverändert, daß sie in das Gesicht eines Leichnams schauen. Nachdem sie ihn an Bord des Schleppers geholt und ihn von seinen nassen Kleidern befreit und ihm ein Mittel zur Wiederbelebung verabreicht hatten, stößt er einen kleinen Seufzer aus und öffnet seine Augen.
„Luke, Gefährte“, sagt er, seinen Bruder erkennend, „versuche für mich zu beten. Ich zweifle nicht daran, ein toter Mann zu sein.“
Kapitel V
Onkel Marks Schifffahrt auf dem glänzenden Fluss
In dieser Nacht schläft Madeline friedlich und hatte schöne Träume: Ihr kleinen Füße trippelten durch die geschäftigen Straßen der ‚Goldenen Stadt’; ihre bewundernden Blicke ergötzten sich an all den bunten Sehenswürdigkeiten, ihre Ohren an all den lebhaften Geräuschen, welche der wunderbare Weg bot.
Als sie am Morgen erwacht, ist sie ein bißchen enttäuscht und verwundert, sich zu Hause in ihrem kleinen Zimmer zu befinden.
Es ist schon heller Tag und Madeline denkt, es sei schon spät. Mrs. Peartrees steht am Fenster und schaut träumend hinaus. Eine Weile liegt Madeline und beobachtet sie, dann sagt sie plötzlich:
„Nach was schaust du, Tante Jane?“
Beim Klang der Stimme wendet sich die Frau um und küßt sie wie gewöhnlich auf die glatten kleinen Wangen auf dem Kopfkissen.
„Steh’ auf Madlin“, sagt sie, „es ist gleich acht Uhr, sonst kommst du zu spät zur Schule.“
„Nach was hast du ausgeschaut?“ wiederholt Madeline, nachdem sie die Liebkosung erwidert hatte.
„Nichts, Mädchen, nichts – es ist nur einer der kleinen Dampfschlepper, welcher bei der Fähre gestoppt hat und ein Boot an Land ging – aber nun ist das Boot wieder zurück und der Schlepper dampft davon.“
„Warum hat er gestoppt“, fragt Madeline und erhebt sich aus den Kissen.
„Liebes Mädchen, wie kann ich das wissen? Stehe nun schnell auf, ich habe Brot und Butter.“
Während sie das sagt, verläßt sie das Zimmer und Madeline schlüpft aus dem Bett und beginnt sich anzuziehen. Als sie fast fertig ist und ihre Arme hebt, um ihren Rock über ihren Kopf zu ziehen, erreicht sie von unten Stimmengewirr. Sie horcht und erkennt die Stimme von Onkel Luke. Ihr Herz klopft, ihre Wangen röten sich und eine Minute später fliegt sie förmlich die Treppe hinunter, steckt ihre Arme in die falschen Ärmel und kommt strahlend keuchend und halb angezogen in den Küchenflur.
Sicher, es ist Onkel Luke, aber wie fremd er aussieht! Seine wettergebräunten Wangen sind geisterhaft – seine nervösen Finger arbeiten an einem großen Loch in seiner wollenen Jacke. Er starrt verwirrt vor sich hin, aber als Madeline ankommt, setzt er sich schnell hin und bricht in Tränen aus.
„Es war kein Fehler von mir, Mutter“, er schluchzt, „denke das nicht! Er war es selbst, er legte den alten Kahn selbst um und daß alles so gekommen ist.“
Mrs. Peartree schaut entsetzt und wird ebenfalls ganz bleich.
„Gott sei uns gnädig, Luke, kannst du nicht sagen, was mit Mark passiert ist? Ist er verwundet? … ist er … tot?“
Während sie spricht schnürt es sie vor Furcht das Herz zusammen und sie wendet sich den schweren Schritten zu, die sich nähern. Nun steht sie Angesicht zu Angesicht ihrem Mann gegenüber. Er liegt auf einer Trage, bedeckt mit einer groben Decke, getragen von zwei Brethren, die am Karfreitag mit in der Wohnstube versammelt waren.
Marks Gesicht ist totenbleich, aber seine Augen wandern ruhelos umher. Als er seiner Frau gewahr wird, strahlen sie. Er lächelt schwach und streckt ihr seine zitternde Hand entgegen.
„Weine nicht, Mutter“, sagt er mit zitternden Lippen, weil er ihre Augen feucht sieht. Dann sieht er Madeline im Hintergrund, bereit, zu ihm zu stürzen. Er setzt schwach hinzu:
„Komm mir nicht zu nahe, kleine Madlin, ich bin zu erschöpft.“
Mrs. Peartree ist eine Frau mit großen Emotionen, aber sie hat eine wunderbare Kraft der Selbstkontrolle. Entschlossen unterdrückt sie den aufkommenden Wunsch zu schreien und in Hysterie zu verfallen – und legt ihre gebräunte Hand auf die kalten nassen Brauen ihres Mannes und sagt:
„Warum, Mark, Mark – was ist zu tun? Ich hätte nie gedacht, daß ich meinen Mann so sehen muß wie er mir nun gebracht wurde.“