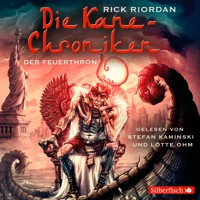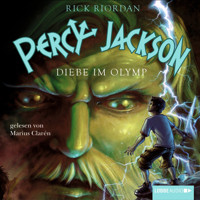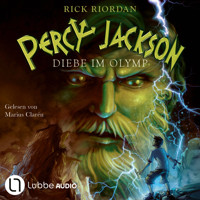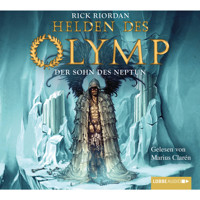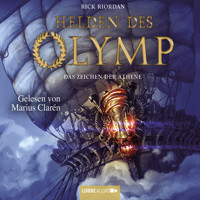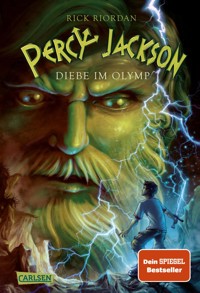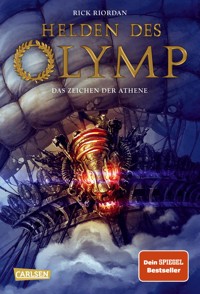9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nordische Mythen, Heldenmut und grandioser Humor Magnus schlägt sich nach dem Tod seiner Mutter allein auf der Straße durch, denn seinen Vater hat er nie gekannt. Als ihn eines Tages sein Onkel aufspürt, erfährt er Unglaubliches: Magnus stammt von einem der nordischen Götter Asgards ab! Leider rüsten diese Götter gerade zum Krieg, auch Trolle, Riesen und andere Monster machen sich bereit. Ausgerechnet Magnus soll den Weltuntergang Ragnarök verhindern. Dafür muss er ein magisches Schwert finden, das seit 1000 Jahren verschollen ist. Kein Problem! Magnus muss ja nur zahlreiche Abenteuer bestehen, Kämpfe gegen gefährliche Kreaturen führen, mit Göttern und Riesen verhandeln, seine göttlichen Fähigkeiten trainieren – und lernen, Freundschaften zu schließen. Aus dem Universum von "Percy Jackson" und "Die Kane-Chroniken": Magnus Chase Der 16-jährige Magnus Chase lebt seit dem mysteriösen Tod seiner Mutter auf der Straße. Mit Diebstählen hält er sich über Wasser – bis er eines Tages von seinem besonderen Erbe erfährt: Magnus ist der Sohn des nordischen Gottes Frey und soll die Welt vor dem Untergang retten. In der Fantasy-Trilogie überführt Rick Riordan alte Sagen und Legenden in moderne Geschichten und schafft es, Leser*innen überall auf der Welt für die nordische Mythologie zu begeistern. ***Feuerriesen, Walküren und nordische Götter - packende Fantasy für Leser*innen ab 12 Jahren und für alle Fans der nordischen Mythologie***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Rick Riordan:
Magnus Chase – Das Schwert des Sommers
Aus dem Englischen von Gabriele Haefs
Magnus schlägt sich nach dem Tod seiner Mutter allein auf der Straße durch, denn seinen Vater hat er nie gekannt. Bis er eines Tages etwas Unglaubliches erfährt: Er stammt von einem der nordischen Götter Asgards ab! Leider rüsten diese Götter gerade zum Krieg; auch Trolle, Riesen und andere Monster machen sich bereit. Ausgerechnet Magnus soll den Weltuntergang Ragnarök verhindern. Dafür muss er ein magisches Schwert finden, das seit 1000 Jahren verschollen ist. Noch hat er keine Ahnung, was für Abenteuer auf ihn warten!
Alle Bände der »Magnus Chase«-Serie: Magnus Chase − Das Schwert des Sommers (Band 1) Magnus Chase − Der Hammer des Thor (Band 2) Magnus Chase − Das Schiff der Toten (Band 3)
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Glossar
Die Neun Welten
Runen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
Leseprobe
Guten Morgen!Gleich wirst du sterben
1Klar, ich weiß. Ihr lest gleich, wie ich unter furchtbaren Qualen gestorben bin, und dann sagt ihr: »Wow! Magnus, das klingt super. Kann ich auch mal unter furchtbaren Qualen sterben?«
Nein. Könnt ihr eben nicht.
Springt nicht von irgendeinem Dach. Rennt nicht auf die Autobahn, zündet euch nicht an. So läuft das nicht. Ihr landet dann trotzdem nicht da, wo ich gelandet bin.
Außerdem hättet ihr garantiert keine Lust, in meiner Situation zu sein. Falls ihr nicht das irre Verlangen hegt, untote Krieger, die sich gegenseitig in Stücke hauen, Schwerter, die Riesen in die Nase fliegen, und Dunkelalben in feschen Klamotten zu sehen, dann solltet ihr nicht mal daran denken, euch auf die Suche nach den Türen mit den Wolfsköpfen zu machen.
Ich heiße Magnus Chase. Ich bin sechzehn Jahre alt. Ich erzähle jetzt die Geschichte, wie mein Leben den Bach runterging, nachdem ich umgebracht worden war.
Mein Tag fing ziemlich normal an. Ich schlief auf dem Gehweg unter einer Brücke im Park, als mich ein Typ mit Tritten weckte und sagte: »Sie sind hinter dir her.«
Ach, übrigens, ich war seit zwei Jahren obdachlos.
Einige von euch denken jetzt vielleicht: Oh, wie traurig. Andere denken, ha, ha, Versager! Aber wenn ihr mich auf der Straße sehen könntet, würden neunundneunzig Prozent von euch an mir vorbeilaufen, als ob ich unsichtbar wäre. Ihr würdet beten, mach, dass er mich nicht um Geld anhaut. Ihr würdet euch fragen, ob ich älter bin, als ich aussehe, denn ein Teenager kann doch wohl nicht mitten im Bostoner Winter in einem stinkenden alten Schlafsack unter freiem Himmel pennen. Irgendwer muss diesem armen Jungen doch helfen!
Und dann würdet ihr weitergehen.
Aber egal, ich brauche euer Mitleid nicht. Ich bin daran gewöhnt, verspottet zu werden. Vor allem bin ich daran gewöhnt, ignoriert zu werden. Also, weiter im Text.
Der Penner, der mich geweckt hatte, war ein Typ namens Blitz. Wie immer sah er aus, als ob er mitten durch einen Wirbelsturm gerannt wäre. In seinen drahtigen schwarzen Haaren hingen überall Papierfetzen und kleine Zweige. Sein Gesicht hatte die Farbe von Sattelleder und war mit Eis gesprenkelt. Sein Bart lockte sich in alle Richtungen. Unter dem Trenchcoat, der um seine Füße schlackerte (Blitz ist so ungefähr eins fünfzig groß), klebte Schnee, und seine Pupillen waren so erweitert, dass seine Iris kaum zu sehen war. Mit seiner ewig besorgten Miene sah er aus, als ob er jeden Moment losschreien könnte.
Ich blinzelte mir den Schlaf aus den Augen. Mein Mund schmeckte wie ein Hamburger vom Vortag. Mein Schlafsack war warm und ich wollte ihn auf keinen Fall verlassen.
»Wer ist hinter mir her?«
»Weiß nicht genau.« Blitz rieb sich die Nase, die so oft gebrochen gewesen war, dass sie wie ein Blitzstrahl im Zickzack verlief. »Da werden Flyer mit deinem Namen und deinem Bild verteilt.«
Ich fluchte. Mit irgendwelchen Polizisten und Parkwächtern wurde ich fertig. Inspektoren, die auf Schulschwänzer Jagd machten, freiwillige Sozialarbeiter, betrunkene Collegestudenten, Junkies, die Lust hatten, einen Schwächeren zusammenzufalten – die machten mir nach dem Aufwachen auch nicht mehr Probleme als Pfannkuchen und O-Saft.
Aber wenn jemand meinen Namen und mein Gesicht kannte – das war übel. Das bedeutete, dass genau ich gesucht wurde und sonst keiner. Vielleicht waren die Leute aus dem Obdachlosenheim sauer auf mich, weil ich ihnen die Stereo-Anlage ruiniert hatte (diese Weihnachtslieder hatten mich wahnsinnig gemacht!). Vielleicht hatte mich eine Überwachungskamera bei meinem kleinen Einsatz als Taschendieb im Theater District erwischt (aber ich brauchte doch Geld für eine Pizza!). Oder, so unwahrscheinlich mir das auch vorkam, die Polizei suchte mich noch immer und hatte Fragen zum Mord an meiner Mutter …
Ich packte meinen Kram zusammen, was ungefähr drei Sekunden dauerte. Der Schlafsack ließ sich ganz fest aufrollen und passte dann mit meiner Zahnpasta und einem Satz Unterwäsche in meinen Rucksack. Und abgesehen von den Klamotten, die ich anhatte, war das alles, was ich besaß. Wenn ich mir die Kapuze tief ins Gesicht zog, fiel ich zwischen den vielen Fußgängern kaum auf. In Boston wimmelte es nur so von Leuten, die aufs College gingen. Einige sahen sogar noch heruntergekommener und jünger aus als ich.
Ich drehte mich zu Blitz um. »Wo hast du die Leute mit den Flyern gesehen?«
»Beacon Street. Die sind unterwegs hierher. Weißer Typ mittleren Alters und ein junges Mädchen, vermutlich seine Tochter.«
Ich runzelte die Stirn. »Das verstehe ich nicht. Wer …«
»Weiß ich nicht, Kleiner, aber ich muss los.« Blitz schaute aus zusammengekniffenen Augen in den Sonnenaufgang, der die Fenster der Wolkenkratzer orange färbte. Aus Gründen, die ich nie so richtig kapiert hatte, hasste Blitz das Tageslicht. Vielleicht, weil er der kleinste, fetteste obdachlose Vampir aller Zeiten war. »Sprich doch mal mit Hearth. Der hängt am Copley Square rum.«
Ich versuchte, mich nicht zu ärgern. Die Leute hier auf der Straße nannten Hearth und Blitz im Scherz meine Mom und meinen Dad, weil immer einer von beiden in meiner Nähe herumzulungern schien.
»Das weiß ich zu schätzen«, sagte ich. »Aber ich komme schon zurecht.«
Blitz nagte an seinem Daumennagel. »Weiß nicht, Kleiner. Heute nicht. Du musst ganz besonders vorsichtig sein.«
»Warum?«
Er schaute über meine Schulter. »Da kommen sie.«
Ich sah niemanden. Als ich mich wieder umdrehte, war Blitz verschwunden.
Ich fand es schrecklich, wenn er das machte. Einfach so – puff. Der Typ war wie ein Ninja. Ein obdachloser Ninjavampir.
Jetzt hatte ich die Wahl: Entweder zum Copley Square gehen und mit Hearth herumhängen oder die Beacon Street ansteuern und versuchen, die Leute mit den Flyern zu entdecken.
Blitz’ Beschreibung hatte mich neugierig gemacht. Ein weißer Typ mittleren Alters und ein junges Mädchen, die mich an einem bitterkalten Morgen bei Sonnenaufgang suchten. Warum? Wer konnte das sein?
Ich schlich am Rand des Weihers entlang. Fast niemand benutzte den tiefer gelegenen Weg unter der Brücke. Ich konnte also auf dieser Seite des Hügels bleiben und alle sehen, die den höher gelegenen Weg entlangkamen, ohne von ihnen entdeckt zu werden.
Der Boden war von Schnee bedeckt. Der Himmel war so weiß, dass es in den Augen wehtat. Die kahlen Zweige der Bäume sahen aus wie in Glas getunkt. Der Wind durchdrang alle Schichten meiner Kleidung, aber die Kälte machte mir nichts aus. Meine Mom hatte immer gescherzt, ich sei ein halber Eisbär.
Verdammt, Magnus, wies ich mich selbst zurecht.
Auch nach zwei Jahren waren meine Erinnerungen an sie noch immer vermintes Gelände. Kaum stolperte ich über eine, brach meine Selbstbeherrschung in tausend Stücke.
Ich versuchte, mich zu konzentrieren.
Der Mann und das Mädchen kamen in meine Richtung. Dem Mann fielen seine sandfarbenen Haare fast bis auf den Kragen – nicht, als ob er das so wollte, sondern, als ob er sich einfach nicht die Mühe machte, sie schneiden zu lassen. Seine verdutzte Miene erinnerte mich an einen Vertretungslehrer: Ich weiß, dass mich ein Speichelklumpen getroffen hat, aber ich habe keine Vorstellung, wo der herkam. Seine eleganten Schuhe waren überhaupt nicht geeignet für den Bostoner Winter. Seine Socken hatten unterschiedliche Brauntöne. Sein Schlips sah aus, als ob er sich beim Binden in totaler Finsternis um sich selbst gedreht hätte.
Das Mädchen war auf jeden Fall seine Tochter. Ihre Haare waren so dicht und wellig wie seine, allerdings blond. Sie war vernünftiger gekleidet, mit Winterstiefeln, Jeans und einem Parka, aus dem oben ein oranges T-Shirt herauslugte. Ihre Miene war entschlossener als seine, fast wütend. Sie umklammerte einen Stapel Flyer wie Aufsätze, für die sie eine ungerechte Note erhalten hatte.
Wenn sie nach mir suchte, dann wollte ich nicht gefunden werden. Sie machte mir Angst.
Ich erkannte weder sie noch ihren Dad, aber irgendwas rumorte ganz hinten in meinem Hinterkopf … als wollte ein Magnet eine uralte Erinnerung hervorziehen.
Vater und Tochter blieben an der Weggabelung stehen. Sie schauten sich um, als ob ihnen jetzt erst aufging, dass sie sich in aller Herrgottsfrühe im kältesten Winter mitten in einem verlassenen Park befanden.
»Unglaublich«, sagte das Mädchen. »Ich könnte ihn erwürgen.«
In der Annahme, dass sie mich meinte, kauerte ich mich noch ein bisschen mehr zusammen.
Ihr Dad seufzte. »Wir sollten ihn vielleicht trotzdem am Leben lassen. Er ist ja schließlich dein Onkel.«
»Aber zwei Jahre?«, fragte das Mädchen. »Dad, wie hat er es über sich gebracht, uns zwei Jahre lang nichts zu sagen?«
»Ich kann Randolphs Verhalten nicht erklären. Das habe ich noch nie gekonnt, Annabeth.«
Ich schnappte so heftig nach Luft, dass ich fürchtete, sie hätten mich gehört. Eine Kruste wurde von meinem Gehirn gerissen und Erinnerungen an die Zeit, als ich sechs Jahre alt gewesen war, wurden freigelegt.
Annabeth … Das bedeutete, der Mann mit den sandfarbenen Haaren war … Onkel Frederick?
Ich dachte zurück an das letzte Thanksgiving, das wir mit der ganzen Familie verbracht hatten; Annabeth und ich hatten uns in Onkel Randolphs Haus hier in Boston in der Bibliothek versteckt und mit Dominosteinen gespielt, während die Erwachsenen sich unten anbrüllten.
Du hast so ein Glück, dass du bei deiner Mom wohnen kannst. Annabeth legte einen weiteren Dominostein auf das Dach ihres winzigen Gebäudes. Es war ihr überraschend gut gelungen, mit Säulen wie ein Tempel. Ich werde weglaufen.
Ich bezweifelte nicht, dass sie das ernst meinte. Ich bewunderte ihr Selbstvertrauen.
Dann tauchte Onkel Frederick in der Tür auf. Er hatte die Fäuste geballt. Seine wütende Miene passte nicht zu dem lächelnden Rentier auf seinem Pullover. Annabeth, wir brechen auf.
Annabeth sah mich an. Ihre grauen Augen waren ein wenig zu durchdringend für ein Mädchen in der ersten Klasse. Pass auf dich auf, Magnus.
Mit einer Fingerbewegung brachte sie ihren Tempel zum Einstürzen.
Das war unsere letzte Begegnung.
Danach hatte meine Mom sich nicht mehr erweichen lassen: Ich will mit deinen Onkeln nichts mehr zu tun haben. Schon gar nicht mit Randolph. Der kriegt von mir nicht, was er will. Nie im Leben.
Sie wollte mir nicht sagen, was Randolph wollte oder worüber sie sich mit Frederick und Randolph gestritten hatte.
Du musst Vertrauen zu mir haben, Magnus. In deren Nähe ist es zu gefährlich.
Ich hatte Vertrauen zu meiner Mom. Auch nach ihrem Tod hatte ich keinen Kontakt zu meiner Verwandtschaft aufgenommen.
Aber jetzt suchten sie mich plötzlich.
Randolph wohnte in Boston, aber meines Wissens lebten Frederick und Annabeth noch immer in Virginia. Jetzt waren sie allerdings hier und verteilten Flyer mit meinem Namen und meinem Foto. Woher hatten sie überhaupt ein Foto von mir?
In meinem Kopf war alles dermaßen durcheinander, dass ich einen Teil ihres Gesprächs verpasst hatte.
»… Magnus finden«, sagte Onkel Frederick gerade. Er sah auf sein Smartphone. »Randolph ist in dem Obdachlosenheim am South End. Er sagt, da ist er nicht. Wir sollten es im Heim für jugendliche Obdachlose auf der anderen Seite des Parks versuchen.«
»Woher wissen wir überhaupt, dass Magnus noch lebt?«, fragte Annabeth unglücklich. »Er ist seit zwei Jahren vermisst! Da kann er doch irgendwo im Straßengraben erfroren sein!«
Ein Teil von mir war versucht, aus meinen Versteck hervorzuspringen und zu brüllen: Denkste!
Obwohl ich Annabeth seit zehn Jahren nicht gesehen hatte, wollte ich nicht, dass sie sich Sorgen machte. Doch das Leben auf der Straße hatte mich gelehrt, Situationen zu meiden, die ich nicht einschätzen konnte.
»Randolph ist sicher, dass Magnus noch lebt«, sagte Onkel Frederick. »Er ist irgendwo in Boston. Und wenn er wirklich in Lebensgefahr schwebt …«
Sie gingen weiter in Richtung Charles Street und ihre Stimmen wurden vom Wind weggerissen.
Ich zitterte jetzt, aber nicht vor Kälte. Ich wollte hinter Frederick herrennen, ihn zur Rede stellen und in Erfahrung bringen, was hier los war. Wieso wusste Randolph, dass ich noch immer in Boston war? Warum suchten sie mich? Wieso schwebte ich heute plötzlich in größerer Lebensgefahr als sonst?
Aber ich lief nicht hinter ihnen her.
Ich dachte an das Letzte, was meine Mom mir je gesagt hatte. Ich hatte die Feuerleiter nicht benutzen wollen, hatte Mom nicht verlassen wollen, aber sie hatte meine Arme gepackt und mich gezwungen, sie anzusehen. Lauf, Magnus, versteck dich. Vertrau niemandem. Ich werde dich finden. Und was immer du tust, du darfst niemals Randolph um Hilfe bitten.
Noch ehe ich das Fenster erreicht hatte, war unsere Wohnungstür zersplittert. Zwei Paar leuchtende blaue Augen waren aus der Dunkelheit aufgetaucht …
Ich schüttelte die Erinnerung ab und sah Onkel Frederick und Annabeth hinterher, die jetzt nach Osten zur großen Wiese abbogen.
Onkel Randolph … aus irgendeinem Grund hatte er sich an Frederick und Annabeth gewandt. Er hatte sie nach Boston kommen lassen. Frederick und Annabeth hatten die ganze Zeit nicht gewusst, dass meine Mom tot und ich verschwunden war. Es schien mir kaum möglich, aber wenn es stimmte, warum sollte Randolph es ihnen jetzt plötzlich erzählen?
Es gab nur eine Möglichkeit, es herauszufinden, ohne ihn direkt zur Rede zu stellen. Er wohnte in Back Bay, das war nicht weit von hier. Wenn Frederick Recht hatte, war Randolph jetzt nicht zu Hause, sondern trieb sich auf der Suche nach mir irgendwo im South End herum.
Und da es keinen besseren Auftakt für einen Tag gibt als einen kleinen Einbruch, beschloss ich, mal in Randolphs Haus vorbeizuschauen.
Der Mann mit dem Metall-BH
2Die Familienvilla war zum Kotzen.
Na ja, ihr würdet das sicher nicht so sehen. Ihr würdet das gewaltige sechsstöckige Klinkerhaus mit Wasserspeiern an den Ecken des Daches, bunten Bleiglasfenstern, marmorner Vortreppe und den ganzen anderen Hier-wohnt-ein-reicher-Mann-Details sehen und euch fragen, warum ich auf der Straße hause.
Die Antwort: Onkel Randolph.
Es war sein Haus. Als ältester Sohn hatte er es von meinen Großeltern geerbt, die schon vor meiner Geburt gestorben waren. Ich wusste nicht viel über die Familien-Soap, aber zwischen den drei Kindern, Randolph, Frederick und meiner Mom, hatte es ganz schön viel böses Blut gegeben. Nach dem großen Thanksgiving-Streit hatten wir das Haus unserer Ahnen niemals wieder aufgesucht. Unsere Wohnung lag nicht mal einen Kilometer entfernt, aber Randolph hätte genauso gut auf dem Mars leben können.
Meine Mom erwähnte ihn nur, wenn wir zufällig an seinem Haus vorbeikamen. Dann zeigte sie darauf, wie auf eine gefährliche Klippe. Siehst du, da hinten? Das ist es. Geh da ja nicht zu nah ran!
Als ich dann auf der Straße lebte, ging ich manchmal nachts dort vorbei. Ich schaute in die Fenster und konnte Vitrinen mit uralten Schwertern und Äxten sehen, unheimliche Helme mit Gesichtsschutz, die mich von den Wänden her anstarrten, und Statuen, deren Silhouetten sich hinter den Fenstern oben im Haus abzeichneten wie versteinerte Gespenster.
Ich hatte schon häufiger mit dem Gedanken gespielt, einzubrechen und mich da drinnen mal umzusehen, aber ich hatte nie Lust gehabt, an die Tür zu klopfen. Bitte, Onkel Randolph, ich weiß, du hast meine Mutter verabscheut und mich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen; ich weiß, deine rostige alte Sammlung ist dir wichtiger als deine Familie, aber dürfte ich wohl in deinem schönen Haus leben und mich von deinen übrig gebliebenen Brotkrusten ernähren?
Nein, danke. Da bleibe ich doch lieber auf der Straße und esse im Busbahnhof Falafel von gestern.
Aber trotzdem … ich stellte es mir ziemlich einfach vor, einzubrechen, mich umzuschauen und vielleicht Antworten auf die Frage zu finden, was hier eigentlich los war. Und wenn ich schon mal da war, könnte ich vielleicht irgendwelchen Kram einsacken und später ins Pfandhaus bringen.
Tut mir leid, wenn das euer Rechtsempfinden verletzt.
Moment mal. Nein. Tut mir nicht leid.
Ich bestehle nicht wahllos alle, die mir über den Weg laufen. Ich suche mir miese Widerlinge aus, die ohnehin zu viel haben. Wenn ihr einen neuen BMW fahrt und den auf einem Behindertenparkplatz abstellt, ohne einen Behindertenausweis vorlegen zu können, dann habe ich kein Problem damit, ein Wagenfenster aufzustemmen und aus eurem Becherhalter eine Handvoll Kleingeld zu stehlen. Wenn ihr mit einer Tasche voller Seidentaschentücher aus dem Kaufhaus Barneys kommt und so sehr damit beschäftigt seid, zu telefonieren und Leute aus dem Weg zu stoßen, dass ihr gar nichts mehr merkt, dann bin ich für euch da und nehme gern eure Brieftasche an mich. Wenn ihr fünftausend Dollar ausgeben könnt, um euch die Nase zu putzen, dann könnt ihr es euch auch leisten, mir ein Essen zu spendieren.
Ich bin Richter, Jury und Dieb. Und was miese Widerlinge angeht, da könnte ich wohl kaum einen mieseren finden als Onkel Randolph.
Das Haus lag in der Commonwealth Avenue. Ich ging auf die Rückseite in die Gasse mit dem poetischen Namen Public Alley 429. Randolphs Parkplatz war leer. Eine Treppe führte zum Kellereingang hinunter. Wenn es ein Alarmsystem gab, konnte ich es jedenfalls nicht entdecken. Die Tür hatte ein einfaches Schnappschloss und nicht einmal einen Riegel. Also echt, Randolph! Mach es doch wenigstens ein bisschen spannend.
Zwei Minuten später war ich drinnen.
In der Küche nahm ich mir eine Portion Truthahnbraten in Scheiben, Cracker und Milch aus dem Karton. Keine Falafel. Ich war richtig in Stimmung für Falafel, aber ich fand einen Schokoriegel und steckte ihn für später in meine Jackentasche. (Schokolade muss man genießen, nicht reinstopfen.) Dann lief ich nach oben in ein Mausoleum voller Mahagonimöbel, Perserteppiche, Ölgemälde, Marmorböden und Kristallleuchter … Es war einfach nur peinlich. Was für Leute leben denn so?
Mit sechs Jahren hatte ich nicht einschätzen können, wie teuer dieser ganze Kram war, aber mein erster Eindruck von der Villa war derselbe gewesen: bedrückend, unheimlich, düster. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass meine Mom hier aufgewachsen war. Ich konnte gut verstehen, warum sie sich später am liebsten unter freiem Himmel aufgehalten hatte.
Unsere Wohnung über dem koreanischen Imbiss in Allston war wirklich gemütlich gewesen, aber Mom hielt sich nie gern im Haus auf. Sie sagte immer, ihr wahres Zuhause seien die Blue Hills. Wir gingen dort bei jedem Wetter wandern und zelten – frische Luft, keine Wände um uns herum, keine Gesellschaft außer Enten, Gänsen und Eichhörnchen.
Dieses Klinkerhaus dagegen kam mir vor wie ein Gefängnis. Wie ich allein da in der Eingangshalle stand, schienen unsichtbare Käfer über meine Haut zu krabbeln.
Ich stieg die Treppe zum zweiten Stock hoch. Die Bibliothek roch nach Möbelpolitur und Leder, genau wie in meiner Erinnerung. An einer Wand stand eine erleuchtete Vitrine mit Randolphs verrosteten Wikingerhelmen und zerfressenen Axtschneiden. Meine Mom hatte mir einmal erzählt, dass Randolph in Harvard Geschichte unterrichtet hatte. Sie wollte nicht ins Detail gehen, aber nach irgendeinem furchtbaren Patzer war er gefeuert worden. Der Typ stand offenbar immer noch total auf alte Fundstücke.
Du bist intelligenter als deine beiden Onkel, Magnus, hatte meine Mom mir einmal gesagt. Bei deinen Noten kriegst du mit Leichtigkeit einen Studienplatz in Harvard.
Das war damals gewesen, als sie noch lebte, als ich noch zur Schule ging und als ich vielleicht eine Zukunft hatte, die weiter reichte als bis zu meiner nächsten Mahlzeit.
In der einen Ecke von Randolphs Arbeitszimmer stand ein riesiger Felsquader wie ein Grabstein; die Vorderseite wies komplizierte verschlungene Muster auf, die gemalt oder in den Stein eingemeißelt waren. In der Mitte gab es eine grobe Zeichnung eines zähnebleckenden wilden Tieres – vielleicht ein Löwe oder ein Wolf.
Mir schauderte. An Wölfe wollte ich lieber nicht denken.
Ich trat an Randolphs Schreibtisch. Ich hatte auf einen Computer gehofft, oder auf einen Notizblock mit nützlichen Informationen – auf irgendetwas, das mir erklären könnte, warum sie mich suchten. Stattdessen waren Pergamentfetzen auf dem Schreibtisch verstreut, die dünn und gelb waren wie Zwiebelschalen. Sie sahen aus wie Landkarten, die ein Schulkind irgendwann im Mittelalter für den Erdkundeunterricht angefertigt hatte, vage Skizzen eines Küstenverlaufes, mehrere Punkte, bezeichnet in einem mir unbekannten Alphabet. Darauf, wie ein Briefbeschwerer, lag ein Lederbeutel.
Mir stockte der Atem. Diesen Beutel kannte ich. Ich zog die Schnur auf und fischte einen Dominostein heraus … nur war es kein Dominostein. Mit sechs Jahren hatte ich angenommen, dass Annabeth und ich mit Dominosteinen spielten, und im Laufe der Jahre hatte sich diese Erinnerung gefestigt. Aber an Stelle von Punkten wiesen diese Steine rote Symbole auf.
Das in meiner Hand war geformt wie ein Zweig oder ein missratenes F:
Mein Herz hämmerte. Ich weiß nicht, warum. Ich fragte mich, ob es wirklich so eine gute Idee gewesen war, herzukommen. Die Wände schienen langsam auf mich zuzurücken. Die Tierzeichnung auf dem Steinquader in der Ecke schien mich höhnisch anzugrinsen und ihre roten Umrisse leuchteten wie frisches Blut.
Ich ging zum Fenster. Ich dachte, ein Blick nach draußen würde helfen. An der Ecke der Avenue zog sich die Commonwealth Mall dahin – ein Streifen verschneites Parkgelände. Die kahlen Bäume waren mit Weihnachtslichtern versehen. Am Ende des Blocks, innerhalb einer schmiedeeisernen Umzäunung, stand die Bronzestatue von Leif Eriksson auf ihrem Sockel. Leif hielt sich die Hand über die Augen. Er starrte die Charlesgate-Brücke an, als wolle er sagen: Sieh an, ich habe einen Highway entdeckt!
Meine Mom und ich hatten oft Witze über Leif gerissen. Seine Rüstung war nicht gerade üppig: ein Minirock und ein Brustpanzer, der aussah wie ein Wikinger-BH.
Ich hatte keine Ahnung, warum diese Statue mitten in Boston stand, aber ich ging davon aus, dass Onkel Randolph nicht aus purem Zufall zum Wikingerforscher geworden war. Er hatte sein ganzes Leben hier verbracht. Er sah sich Leif vermutlich jeden Tag durchs Fenster an. Vielleicht hatte Randolph als Kind gedacht: Eines Tages will ich über Wikinger forschen. Männer mit Metall-BHs sind spitze!
Meine Augen wanderten an der Statue nach unten. Da stand jemand … und schaute zu mir nach oben.
Ihr wisst bestimmt, wie das ist, wenn ihr jemanden in einer Umgebung seht, in die er gar nicht gehört, und wenn ihr dann eine Sekunde braucht, um ihn zu erkennen. In Leif Erikssons Schatten stand ein bleicher, hochgewachsener Mann in einer schwarzen Lederjacke, schwarzer Motorradhose und spitzen Stiefeln. Seine kurzen Stachelhaare waren so blond, dass sie fast schon weiß aussahen. Der einzige Farbtupfer war ein rot-weiß gestreifter Schal, den er sich um den Hals gewickelt hatte und der sich von seinen Schultern herabschlängelte wie eine geschmolzene Zuckerstange.
Wenn ich ihn nicht gekannt hätte, hätte ich angenommen, dass er in einem Rollenspiel irgendeine Comicgestalt darstellen wollte. Aber ich kannte ihn sehr wohl. Es war Hearth, ein weiterer Obdachloser und meine »Ersatzmom«.
Ich erschrak und war gleichzeitig ein bisschen beleidigt. Hatte er mich auf der Straße gesehen und dann verfolgt? Ich brauchte wirklich keine gute Fee, die sich aus Sorge um mich aufs Stalken verlegte.
Ich hob fragend die Hände: Was machst du denn hier?
Hearth machte eine Handbewegung, als ob er etwas aus seiner hohlen Hand fischte und dann wegwarf. Nach zwei Jahren in seiner Nähe konnte ich seine Gebärdensprache ziemlich gut lesen.
Er sagte: RAUS DA!
Er sah nicht beunruhigt aus, aber bei Hearth war das immer schwer zu sagen. Er zeigte nie besonders viele Gefühle. Wenn wir zusammen waren, starrte er mich meistens nur mit seinen blassen grauen Augen an, als warte er darauf, dass ich explodierte.
Ich verlor kostbare Sekunden bei dem Versuch, zu begreifen, was er meinte, warum er hier stand, statt auf dem Copley Square abzuhängen.
Er machte eine neue Geste: zwei Hände, die mit je einem Finger nach vorn zeigten und sich zweimal auf und ab bewegten: Beeil dich.
»Warum?«, fragte ich laut.
Hinter mir sagte eine tiefe Stimme: »Hallo, Magnus.«
Ich zuckte zusammen. In der Tür der Bibliothek stand ein Mann mit einem gewaltigen Brustkasten, einem kurzen weißen Bart und grauen Haaren. Er trug einen beigen Kaschmirmantel über einem dunklen Wollanzug. Seine behandschuhte Hand umschloss den Griff eines polierten Holzstockes mit eiserner Spitze. Als ich ihn zuletzt gesehen hatte, waren seine Haare schwarz gewesen, aber diese Stimme kannte ich.
»Randolph.«
Er neigte den Kopf einen Millimeter. »Was für eine angenehme Überraschung. Ich freue mich, dass du hier bist.« Er hörte sich weder überrascht noch freudig an. »Wir haben nicht viel Zeit.«
Essen und Milch fingen an, in meinem Magen zu rotieren. »V-viel Zeit … ehe was passiert?«
Er runzelte die Stirn und rümpfte die Nase, als ob er einen leicht unangenehmen Geruch entdeckt hätte. »Du wirst doch heute sechzehn, oder? Dann kommen sie, um dich umzubringen.«
Lass dich bloß nicht von fremden Verwandten mitnehmen
3NA DANN, HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, MAGNUS!
War denn schon der 13. Januar? Ehrlich, ich hatte keine Ahnung. Die Zeit fliegt nur so dahin, wenn man unter Brücken schläft und sich aus Abfallcontainern ernährt.
Ich war also ganz offiziell sechzehn. Und mein Geschenk bestand darin, von Onkel Freakig in die Ecke gedrängt zu werden, nachdem er mir mitgeteilt hatte, dass meine Ermordung unmittelbar bevorstand.
»Wer …«, fing ich an. »Weißt du, was? Ist mir egal. Nett, dich zu sehen, Randolph. Ich muss jetzt los.«
Randolph blieb in der Tür stehen und versperrte mir damit den Ausgang. Er zeigte mit der Eisenspitze seines Stocks auf mich. Ich schwöre, ich konnte quer durch das Zimmer spüren, wie sie gegen mein Brustbein drückte.
»Magnus, wir müssen reden. Ich will nicht, dass sie dich erwischen. Nicht danach, was deiner Mutter passiert ist …«
Ein Schlag ins Gesicht hätte nicht so wehgetan.
Erinnerungen an jene Nacht wirbelten durch meinen Kopf wie ein Übelkeit erregendes Kaleidoskop: unsere Wohnung, die bebte, ein Schrei aus dem Stockwerk unter unserem, meine Mutter, die den ganzen Tag schon angespannt und fast hysterisch gewesen war und die mich zur Feuerleiter zog und sagte, ich sollte machen, dass ich wegkam. Aus dem Treppenhaus tauchten zwei riesige Biester auf, ihr Fell hatte die Farbe von schmutzigem Schnee und ihre Augen leuchteten blau. Meine Finger rutschten vom Rand der Feuerleiter ab und ich fiel nach unten und landete in der Gasse hinter dem Haus auf einem Haufen von Müllsäcken. Gleich darauf platzten die Fensterscheiben in unserer Wohnung und spuckten Feuer.
Meine Mom hatte gesagt, ich sollte losrennen. Das tat ich. Sie hatte versprochen, hinterherzukommen. Das tat sie nicht. Später hörte ich in den Nachrichten, dass ihr Leichnam in der ausgebrannten Wohnung gefunden worden war. Ich wurde von der Polizei gesucht. Es gab viele offene Fragen: Hinweise auf Brandstiftung, meine Probleme mit der Schuldisziplin, Nachbarn, die von lautem Geschrei und einem Knall aus unserer Wohnung unmittelbar vor der Explosion berichteten, die Tatsache, dass ich vom Tatort verschwunden war. Niemand hatte die riesigen Wölfe mit den leuchtenden Augen erwähnt.
Seit jener Nacht war ich untergetaucht, ich lebte unterhalb des Radars, und ich war zu sehr mit Überleben beschäftigt, um wirklich um meine Mom zu trauern. Ich fragte mich, ob ich mir diese Biester nur eingebildet hatte … Aber ich wusste, dass das nicht der Fall war.
Und jetzt, nach so langer Zeit, wollte Onkel Randolph mir helfen.
Ich umklammerte den kleinen Dominostein so fest, dass er in meine Handfläche schnitt. »Du weißt gar nicht, was mit meiner Mom passiert ist. Du hast dich doch nie für uns interessiert.«
Randolph ließ seinen Stock sinken. Er stützte sich darauf und starrte den Teppich an. Man hätte fast glauben können, dass ich seine Gefühle verletzt hatte.
»Ich habe deine Mutter angefleht«, sagte er. »Ich wollte, dass sie mit dir herkommt – um hier zu leben, wo ich dich beschützen könnte. Sie wollte nicht. Nach ihrem Tod …« Er schüttelte den Kopf. »Magnus, du hast keine Ahnung, wie lange ich nach dir gesucht habe und in welcher Gefahr du schwebst.«
»Mir geht’s gut«, fauchte ich, obwohl mein Herz gegen meine Rippen hämmerte. »Ich konnte bis jetzt sehr gut auf mich selbst aufpassen.«
»Das kann schon sein, aber damit hat es jetzt ein Ende.« Die Gewissheit in Randolphs Stimme ließ mir kalte Schauer über den Rücken laufen. »Du bist jetzt sechzehn, und damit ein Mann. Du bist ihnen einmal entkommen, in der Nacht, als deine Mutter gestorben ist. Sie werden dich nicht noch einmal entkommen lassen. Das hier ist unsere letzte Chance. Lass mich dir helfen, oder du wirst diesen Tag nicht überleben.«
Das trübe Winterlicht wanderte vor den Bleiglasfenstern weiter und überzog Randolphs Gesicht mit wechselnden Farben, wie bei einem Chamäleon.
Ich hätte nicht herkommen sollen. Blöd, blöd, blöd. Immer wieder hatte meine Mom es mir eingeschärft: Geh ja nicht zu Randolph. Und wo war ich?
Je länger ich ihm zuhörte, desto größer wurde meine Angst, und desto verzweifelter wollte ich hören, was er zu sagen hatte.
»Ich brauche deine Hilfe nicht.« Ich stellte den seltsamen kleinen Dominostein auf den Schreibtisch. »Ich will nicht …«
»Ich weiß von den Wölfen.«
Das ließ mich verstummen.
»Ich weiß, was du gesehen hast«, sagte Randolph, »ich weiß, wer diese Kreaturen geschickt hat. Egal, was die Polizei denkt, ich weiß, wie deine Mutter wirklich gestorben ist.«
»Woher …«
»Magnus, es gibt so viel, was ich dir über deine Eltern erzählen muss, über dein Erbe … Über deinen Vater.«
Ein eiskalter Draht bohrte sich in mein Rückgrat. »Du hast meinen Vater gekannt?«
Ich wollte Randolph nicht entgegenkommen. Das Leben auf der Straße hatte mir klargemacht, wie gefährlich das sein konnte. Aber ich hing am Haken. Ich musste einfach hören, was er zu sagen hatte. Und das befriedigte Funkeln seiner Augen zeigte deutlich, dass er das wusste.
»Ja, Magnus. Die Identität deines Vaters, der Mord an deiner Mutter, der Grund, warum sie meine Hilfe abgelehnt hat … das hängt alles zusammen.« Er zeigte auf seine Ausstellung von Wikingerschätzen. »Mein ganzes Leben lang arbeite ich schon auf dieses eine Ziel hin. Ich versuche, ein historisches Rätsel zu lösen. Bis vor kurzem konnte ich den größeren Zusammenhang nicht erkennen. Jetzt kann ich das. Und alles hat zu diesem einen Tag hingeführt, zu deinem sechzehnten Geburtstag.«
Ich wich zum Fenster zurück, so weit weg von Onkel Randolph wie überhaupt nur möglich. »Hör mal, neunzig Prozent davon, was du sagst, kapiere ich nicht, aber wenn du mir etwas über meinen Dad erzählen kannst …«
Das Haus zitterte, als ob in der Ferne eine Salve von Kanonenschüssen abgegeben worden wäre – ein so tiefes Grollen, dass ich es in meinen Zähnen spürte.
»Sie werden bald hier sein«, sagte Randolph warnend. »Wir haben nicht mehr viel Zeit.«
»Wer sind sie?«
Randolph humpelte auf mich zu und stützte sich dabei auf seinen Stock. »Ich verlange viel, Magnus. Du hast keinen Grund, mir zu vertrauen. Aber du musst jetzt sofort mit mir kommen. Ich weiß, wo dein Geburtsrecht liegt.« Er zeigte auf die alten Landkarten auf seinem Schreibtisch. »Zusammen können wir zurückholen, was dir gehört. Es ist das Einzige, was dich vielleicht beschützen kann.«
Ich schaute über meine Schulter hinweg aus dem Fenster. Hearth war verschwunden. Ich hätte dasselbe tun sollen. Als ich Onkel Randolph ansah, versuchte ich, irgendeine Ähnlichkeit mit meiner Mutter zu finden, irgendetwas, das mir Vertrauen einflößen könnte. Ich fand nichts. Sein beeindruckender Umfang, seine bohrenden dunklen Augen, sein humorloses Gesicht und sein steifes Verhalten … Er war das genaue Gegenteil meiner Mom.
»Mein Auto steht hinter dem Haus«, sagte er.
»V-vielleicht sollten wir auf Annabeth und Onkel Frederick warten.«
Randolph schnitt eine Grimasse. »Die glauben mir nicht. Die haben mir noch nie geglaubt. Vor lauter Verzweiflung, als letzten Versuch, habe ich sie nach Boston geholt, um mir bei der Suche nach dir zu helfen, aber da du jetzt hier bist …«
Wieder bebte das Haus. Diesmal kam mir das Dröhnen näher und stärker vor. Ich wollte glauben, es stammte von einer Baustelle in der Nähe oder einer militärischen Zeremonie oder sonst etwas, das sich leicht erklären ließ. Aber mein Bauchgefühl sagte mir etwas anderes. Der Lärm klang wie das Stampfen eines riesigen Fußes – wie der Lärm, der zwei Jahre zuvor unsere Wohnung zum Beben gebracht hatte.
»Bitte, Magnus!« Randolphs Stimme zitterte. »Ich habe schon meine eigene Familie durch diese Monster verloren. Ich habe meine Frau verloren, meine Töchter.«
»Du – du hattest eine Familie? Meine Mom hat nie etwas davon gesagt …«
»Nein, das kann ich mir denken. Aber deine Mutter … Natalie war meine einzige Schwester. Ich habe sie geliebt. Dein Vater hat etwas hinterlassen, das du finden solltest – etwas, das die Welten verändern wird.«
In meinem Gehirn drängten sich zu viele Fragen. Das irre Leuchten in Randolphs Augen gefiel mir nicht. Wie er »Welten« sagte, im Plural, gefiel mir nicht. Und ich glaubte nicht, dass er nach dem Tod meiner Mom versucht hatte, mich zu finden. Ich hatte immer meine Antennen ausgefahren. Wenn Randolph nach mir gefragt und dabei meinen Namen genannt hätte, hätte irgendeiner von meinen Freunden von der Straße mir Bescheid gesagt, wie Blitz es an diesem Morgen mit Annabeth und Frederick gemacht hatte.
Etwas hatte sich geändert – etwas, das Randolph zu der Überzeugung gebracht hatte, die Suche nach mir würde sich lohnen.
»Und wenn ich einfach weglaufe?«, fragte ich. »Versuchst du dann, mich aufzuhalten?«
»Wenn du wegläufst, werden sie dich finden. Und dann bringen sie dich um.«
Mein Hals fühlte sich an wie voller Wattekugeln. Ich vertraute Randolph nicht, aber leider glaubte ich ihm das mit den Leuten, die mich umbringen wollten. Seine Stimme klang einfach nach Wahrheit.
»Na dann«, sagte ich. »Dann lass uns mal losfahren.«
Der Typ kann echt nicht Auto fahren
4Habt ihr schon mal die Witze über die unmöglichen Fahrer aus Boston gehört? So einer ist mein Onkel Randolph.
Der Dussel ließ seinen BMW 5281 aufheulen (er musste natürlich einen BMW haben) und schoss die Commonwealth Avenue hinab, ohne auf die Ampeln zu achten, hupte drohend andere Autos an und wechselte ohne erkennbaren Grund von einer Spur auf die andere.
»Du hast eine Fußgängerin verfehlt«, sagte ich. »Willst du nicht wenden und es noch mal versuchen?«
Randolph war zu abgelenkt, um zu antworten. Er schaute immer wieder zum Himmel hoch, als ob er auf Gewitterwolken wartete. »Also«, sagte ich. »Wohin fahren wir eigentlich?«
»Zur Brücke.«
Das erklärte natürlich alles. In Boston gab es nur so ungefähr zwanzig Brücken.
Ich ließ meine Hand über den angewärmten Ledersitz fahren. Ich hatte vor etwa sechs Monaten zuletzt in einem Auto gesessen, und zwar im Toyota eines Sozialarbeiters. Davor in einem Streifenwagen der Polizei. Beide Male hatte ich einen falschen Namen genannt, und beide Male war ich entkommen, aber in den vergangenen beiden Jahren hatte ich trotzdem gelernt, Autos mit Arrestzellen zu verbinden. Ich war nicht sicher, ob ich heute mehr Glück haben würde.
Ich wartete darauf, dass Randolph eine meiner bohrenden kleinen Fragen beantworten würde, zum Beispiel: Wer ist mein Dad? Wer hat meine Mom umgebracht? Auf welche Weise hast du deine Frau und deine Kinder verloren? Musst du wirklich dieses Deo mit dem Nelkengeruch benutzen?
Aber er war zu sehr darauf konzentriert, ein Verkehrschaos zu produzieren.
Um überhaupt etwas zu sagen, fragte ich schließlich: »Aber wer will mich denn nun eigentlich umbringen?«
Auf der Arlington Street bog er nach rechts ab. Wir schlitterten am Park entlang, vorbei am Reiterstandbild von George Washington, an den Reihen von Gaslaternen und verschneiten Hecken. Ich spielte mit dem Gedanken, aus dem Wagen zu springen, zum Schwanenteich zurückzurennen und mich in meinem Schlafsack zu verstecken.
»Magnus«, sagte Randolph. »Ich habe es zu meiner Lebensaufgabe gemacht, die nordischen Expeditionen nach Nordamerika zu erforschen.«
»Super, danke«, sagte ich. »Damit ist meine Frage dann ja beantwortet.«
Plötzlich erinnerte Randolph mich doch an meine Mom. Er sah mich ebenso entnervt an wie sie, über den Brillenrand hinweg, als wolle er sagen, Bitte, Junge, erspar uns den Sarkasmus. Wegen dieser Ähnlichkeit tat mir das Herz weh.
»Schön«, sagte ich. »Weil du’s bist. Nordische Expeditionen. Du meinst die Wikinger.«
Randolph wand sich verlegen auf seinem Sitz. »Na ja … die Wikinger werden häufig mit Plünderern gleichgesetzt, die Bezeichnung klingt ja schon fast wie eine Arbeitsplatzbeschreibung. Aber nicht alle Menschen aus den nordischen Ländern waren Wikinger. Trotzdem, ja, doch, die meine ich.«
»Die Statue von Leif Eriksson … bedeutet das, dass die Wikinger … äh, die Leute aus dem Norden Boston entdeckt haben? Ich dachte, das waren die Pilgerväter.«
»Ich könnte dir allein über dieses Thema einen dreistündigen Vortrag halten.«
»Bitte nicht.«
»Es reicht zu wissen, dass die Skandinavier Nordamerika um das Jahr 1000 entdeckt und sogar Siedlungen gebaut haben – an die fünfhundert Jahre ehe Christoph Columbus hier eintraf. So weit sind sich die Gelehrten einig.«
»Wie beruhigend. Ich finde es furchtbar, wenn die Gelehrten sich nicht einig sind.«
»Aber niemand weiß, wie weit sie nach Süden vorgedrungen sind. Haben sie die heutigen USA erreicht? Die Statue von Leif Eriksson … das war das Lieblingsprojekt eines Wunschdenkers im 19. Jahrhundert, ein Mann namens Eben Horsford. Er war davon überzeugt, dass Boston die verschollene nordische Siedlung Norumbega war, der südlichste Punkt, den sie überhaupt erreicht hatten. Er hatte so einen Instinkt, ein Bauchgefühl, aber keinen echten Beweis. Die meisten Historiker haben ihn als Spinner abgetan.«
Er sah mich vielsagend an.
»Lass mich raten … du hältst ihn nicht für einen Spinner.« Ich konnte dem Drang widerstehen, hinzuzufügen: Nur ein Spinner glaubt einem anderen Spinner.
»Diese Landkarten auf meinem Schreibtisch«, fuhr Randolph fort, »die sind der Beweis. Meine Kollegen bezeichnen sie als Fälschungen, aber das sind sie nicht. Ich habe meinen guten Ruf dafür riskiert.«
Und deshalb bist du in Harvard gefeuert worden, dachte ich.
»Die nordischen Eroberer sind bis hier gekommen«, sagte er jetzt. »Sie haben etwas gesucht … und sie haben es hier gefunden. Eins ihrer Schiffe ist hier in der Nähe untergegangen. Ich habe jahrelang geglaubt, der Schiffbruch sei in der Massachusetts Bay passiert. Ich habe alles geopfert, um die Stelle zu finden. Ich habe mir ein Boot gekauft und bin mit meiner Frau und meinen Kindern auf Forschungsfahrt gegangen. Beim letzten Mal …« Seine Stimme versagte. »Der Sturm war ganz plötzlich da, das Feuer …«
Er wollte offenbar nicht unbedingt noch mehr erzählen, aber ich hatte schon begriffen: Er hatte seine Familie auf See verloren. Er hatte wirklich alles für seine verrückte Theorie über Wikinger in Boston aufs Spiel gesetzt.
Der Typ tat mir schon leid. Aber sein nächstes Opfer wollte ich trotzdem nicht werden.
Wir hielten an der Ecke Boylston und Charles Street.
»Vielleicht sollte ich hier einfach aussteigen«, sagte ich und griff nach dem Türöffner. Die Tür war verriegelt.
»Magnus, hör mir zu. Es ist kein Zufall, dass du in Boston geboren worden bist. Dein Vater wollte, dass du das findest, was er vor zweitausend Jahren verloren hat.«
Meine Füße wurden nervös. »Hast du gerade … zweitausend Jahre gesagt?«
»Mehr oder weniger.«
Ich überlegte, ob ich losschreien und gegen das Fenster hämmern sollte. Würde mir dann irgendwer helfen? Wenn ich aus dem Auto springen würde, könnte ich vielleicht irgendwo Onkel Frederick und Annabeth finden, vorausgesetzt, die waren nicht ganz so wahnsinnig wie Randolph.
Wir bogen auf die Charles Street ab und fuhren zwischen dem botanischen Garten und dem Park nach Norden. Randolph könnte jetzt mit mir überallhin unterwegs sein – nach Cambridge, zum North End oder zu irgendeiner abgelegenen Leichenentsorgungsstelle.
Ich versuchte, ganz ruhig zu bleiben. »Zweitausend Jahre … das ist nicht gerade die Lebenserwartung eines Durchschnitts-Dad.«
Randolphs Gesicht erinnerte mich an den Mann im Mond in alten Schwarz-Weiß-Comics: bleich und rund, voller Flecken und Narben, mit einem geheimnisvollen Lächeln, das nicht gerade freundlich war. »Magnus, was weißt du über nordische Mythologie?«
Das wird ja immer besser, dachte ich.
»Äh, nicht viel. Meine Mom hatte ein Bilderbuch, das ich als Kind lesen durfte. Und gab es nicht ein paar Filme über Thor?«
Randolph schüttelte angeekelt den Kopf. »Diese Filme … lächerlich unkorrekt. Die echten Götter von Asgard – Thor, Loki, Odin und die anderen – sind viel mächtiger, viel beängstigender als alles, was Hollywood sich aus den Fingern saugen könnte.«
»Aber … das sind doch Mythen. Die gibt es gar nicht.«
Randolph warf mir einen irgendwie mitleidigen Blick zu. »Mythen sind nichts anderes als Geschichten über Wahrheiten, die wir vergessen haben.«
»Du, hör mal, mir fällt gerade ein, ich hab hier um die Ecke eine Verabredung …«
»Vor tausend Jahren kamen nordische Entdeckungsreisende in dieses Land.« Randolph fuhr vorbei an der Cheers Bar in der Beacon Street, wo sich die Touristen rudelweise vor dem Namensschild gegenseitig fotografierten. Ich sah einen zerknüllten Flyer über den Bürgersteig flattern, darauf waren das Wort »VERMISST« und ein altes Foto von mir zu sehen. Ein Tourist trat darauf.
»Der Anführer dieser Entdecker«, sagte nun Randolph, »war ein Sohn des Gottes Skirnir.«
»Ein Sohn eines Gottes. Wirklich, es ist egal, wo du mich rauslässt. Ich kann den Rest zu Fuß gehen.«
»Der Mann hatte einen ganz besonderen Gegenstand bei sich«, sagte Randolph. »Etwas, das früher einmal deinem Vater gehört hatte. Als sein Schiff im Sturm unterging, verschwand dieser Gegenstand mit ihm. Aber du – du besitzt die Fähigkeit, ihn zu finden.«
Ich versuchte abermals, die Tür zu öffnen. Noch immer verriegelt.
Und das Schlimmste an der ganzen Sache war, je länger Randolph redete, umso weniger konnte ich mich davon überzeugen, dass er verrückt war. Seine Geschichte stieß etwas in mir an – Stürme, Wölfe, Götter, Asgard. Die Wörter fanden ihren Platz, wie Stücke in einem Puzzle, das ich niemals beendet hatte, weil mir der Mut fehlte. Ich fing an, ihm zu glauben, und das machte mich vor Angst erst recht fertig.
Randolph jagte durch die Zufahrtstraße zum Sorrow Drive. Er hielt vor einer Parkuhr in der Cambridge Street. Im Norden, hinter den erhöhten Schienen der Bahnstation, ragten die steinernen Türme der Longfellow Bridge auf.
»Hier wollten wir also hin?«, fragte ich.
Randolph fischte in seinem Tassenhalter nach Münzen. »All die Jahre war es viel näher, als mir klar war. Ich brauchte eben nur dich.«
»Wie schön, so geliebt zu werden.«
»Du wirst heute sechzehn.« Randolphs Augen zuckten vor Aufregung. »Das ist für dich der perfekte Tag, um dein Geburtsrecht geltend zu machen. Aber genau darauf haben deine Feinde gewartet. Wir müssen es vor ihnen finden.«
»Aber …«
»Hab noch ein bisschen länger Vertrauen zu mir, Magnus. Wenn wir erst die Waffe haben …«
»Die Waffe? Mein Geburtsrecht ist eine Waffe?«
»Wenn du sie erst mal in deinem Besitz hast, wirst du viel sicherer sein. Ich kann dir alles erklären. Ich kann dir auch helfen, für all das zu trainieren, was dir bevorsteht.«
Er öffnete die Autotür. Ehe er aussteigen konnte, packte ich sein Handgelenk.
Eigentlich vermeide ich es immer, andere zu berühren. Physischer Kontakt macht mich fertig. Aber ich brauchte seine volle Aufmerksamkeit.
»Gib mir eine Antwort«, sagte ich. »Eine einzige klare Antwort, ohne lange Abschweifungen und ohne Geschichtsunterricht. Du hast gesagt, du hast meinen Dad gekannt. Wer ist es?«
Randolph legte seine Hand auf meine, und ich zuckte zusammen. Seine Handfläche war zu rau und schwielig für einen Geschichtsprofessor. »Bei meinem Leben, Magnus, ich schwöre, dein Vater ist ein nordischer Gott. Und jetzt beeil dich. Wir haben zwanzig Minuten Parkzeit.«
Ich wollte immer schon mal eine Brücke in die Luft jagen
5Du kannst doch nicht so eine Bombe hochgehen lassen und dann einfach weglaufen«, schrie ich, als Randolph wegrannte.
Trotz seines Gehstocks und des steifen Beins war der Kerl total beweglich. Er hätte glatt die olympische Goldmedaille im Schnellhumpeln holen können. Er jagte einfach weiter und kletterte auf das Geländer der Longfellow Bridge, während ich hinterherrannte und der Wind in meinen Ohren heulte.
Die Morgenpendler aus Cambridge stauten sich. Eine lange Autoschlange stand auf der Brücke und schien sich kaum zu bewegen. Man sollte annehmen, dass mein Onkel und ich bei diesem unterirdischen Wetter die Einzigen waren, die zu Fuß die Brücke überquerten, aber wir waren in Boston, deshalb lief ein halbes Dutzend Jogger vor mir her, und alle sahen in ihren Lycra-Anzügen aus wie abgemagerte Seehunde. Eine Frau mit zwei Kindern in einer Karre war auf der entgegengesetzten Seite unterwegs. Ihre Kinder sahen ungefähr so glücklich aus, wie ich mich fühlte.
Mein Onkel war noch immer drei Meter vor mir.
»Randolph«, rief ich. »Ich rede mit dir!«
»Die Strömung des Flusses«, murmelte er. »Die Ablagerungen am Ufer … und wenn wir ein Jahrtausend mit veränderten Gezeitenmustern bedenken …«
»Warte!« Ich packte ihn am Ärmel seines Kaschmirmantels. »Spul mal zu der Stelle über den nordischen Gott zurück, der mein Dad ist.«
Randolph sah sich um. Wir standen jetzt vor einem der Haupttürme der Brücke – ein Granitkegel, der sich mehr als sechzehn Meter über uns erhob. Die Türme sehen angeblich aus wie riesige Salz- und Pfefferstreuer, aber mich erinnerten sie immer an die Daleks aus Doctor Who. (Gut, dann bin ich eben ein Nerd. Macht, was ihr wollt. Und ja, sogar obdachlose Jugendliche sehen manchmal fern – in den Aufenthaltsräumen von Herbergen, per Computer in öffentlichen Bibliotheken … Wir haben da unsere Methoden.)
Mehr als dreißig Meter unter uns glitzerte der Charles River stahlgrau, seine Oberfläche war gefleckt mit Schnee- und Eisresten, wie die Haut einer riesigen Pythonschlange.
Randolph beugte sich so weit über die Brüstung, dass ich ganz nervös wurde.
»Diese Ironie!«, murmelte er. »Ausgerechnet hier …«
»Also«, sagte ich, »was meinen Vater betrifft …«
Randolph packte meine Schulter. »Schau mal nach unten, Magnus. Was siehst du da?«
Vorsichtig lugte ich über die Brüstung. »Wasser.«
»Nein, die eingemeißelten Verzierungen, gleich unter uns.«
Ich schaute noch einmal nach. Ungefähr auf halber Höhe der Brücke ragte ein spitz zulaufendes Granitsims aus dem Wasser, wie eine Loge im Theater. »Sieht aus wie eine Nase.«
»Nein, das ist … na ja, von hier aus sieht es wirklich ein bisschen aus wie eine Nase. Aber es ist der Bug eines wikingischen Langschiffes. Der Dichter Longfellow, nach dem die Brücke benannt ist, war von der nordischen Kultur fasziniert. Hat über ihre Götter geschrieben. So wie Eben Horsford. Longfellow glaubte, dass die Wikinger in Boston gewesen waren. Deshalb die Verzierungen auf der Brücke.«
»Du solltest Führungen machen«, sagte ich. »Alle flammenden Longfellow-Fans würden dicke Summen hinblättern.«
»Verstehst du nicht?« Randolphs Hand lag noch immer auf meiner Schulter, was meine Nervosität nicht gerade milderte. »So viele Menschen im Laufe der Jahrhunderte haben es gewusst. Sie haben es instinktiv gespürt, auch wenn sie keine Beweise hatten. Diese Gegend wurde von den Wikingern nicht nur bereist! Sie war ihnen heilig! Gleich unter uns – irgendwo in der Nähe dieser steinernen Langschiffe – liegt das Wrack eines echten Langschiffes, mit einer Ladung von unschätzbarem Wert.«
»Ich sehe noch immer nur Wasser. Und ich möchte noch immer mehr über meinen Dad erfahren.«
»Magnus, die nordischen Entdecker haben hier die Achse der Welt gesucht, den Stamm des Baumes! Und sie fanden …«
Ein dumpfes Bumm hallte über dem Fluss wider. Die Brücke bebte. Ungefähr einen Kilometer weiter, im Dickicht der Schornsteine und Türme von Black Bay, stieg ein ölig schwarzer Rauchpilz auf.
Ich hielt mich am Geländer fest. »Äh, war das nicht ziemlich nah bei deinem Haus?«
Randolphs Miene verhärtete sich. Sein stoppeliger Bart glitzerte silbrig im Sonnenlicht.
»Wir haben keine Zeit mehr. Magnus, streck deine Hand über das Wasser aus. Das Schwert ist dort unten. Ruf es. Konzentrier dich darauf, als sei es das Allerwichtigste auf der Welt – das, was du dir am dringendsten wünschst.«
»Ein Schwert? Ich – hör mal, Randolph, mir ist schon klar, dass das hier ein harter Tag für dich ist, aber …«
»MACH SCHON!«
Die Entschlossenheit in seiner Stimme ließ mich zusammenfahren. Randolph musste einfach wahnsinnig sein, mit seinem Gerede über Götter und Schwerter und uralte Wracks. Aber die Rauchsäule über Black Bay war sehr real. Sirenen heulten in der Ferne. Auf der Brücke steckten die Fahrer ihre Köpfe aus den Fenstern, um zu glotzen, sie hielten ihre Smartphones hoch und machten Bilder.
Und so gern ich auch das Gegenteil behauptet hätte, Randolphs Worte hallten irgendwie in mir wider. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass mein Körper in der richtigen Frequenz summte, als ob ich endlich die richtige Tonlage für den miesen Soundtrack zu meinem Leben gefunden hätte.
Ich streckte meine Hand über dem Fluss aus.
Nichts passierte.
Natürlich passiert nichts, rief ich mich zur Ordnung. Was hattest du denn erwartet?
Die Brücke bebte noch heftiger. Ein Jogger stolperte auf dem Gehweg. Hinter mir hörte ich den Knall von zwei zusammenstoßenden Autos. Hupen plärrten.
Über den Dächern von Black Bay erhob sich jetzt eine weitere Rauchsäule. Asche und orange Funken stoben auf, wie bei einer Vulkanexplosion.
»Das – das war schon viel näher«, ging mir auf. »Als ob etwas auf uns zuhält.«
Ich hoffte inständig, dass Randolph sagen würde: Quatsch, natürlich nicht. Sei nicht so blöd!
Er schien vor meinen Augen älter zu werden. Seine Runzeln wurden dunkler. Seine Schultern sackten nach unten. Er stützte sich schwer auf seinen Stock. »Bitte, nicht schon wieder«, murmelte er vor sich hin. »Nicht wie beim letzten Mal.«
»Beim letzten Mal?« Dann fiel mir ein, wie er seine Frau und seine Kinder verloren hatte – in einem ganz plötzlich aufgetauchten Sturm, im Feuer.
Randolph hielt meinen Blick fest. »Mach noch einen Versuch, Magnus. Bitte.«
Ich streckte meine Hand über den Fluss aus. Ich stellte mir vor, dass ich versuchte, meine Mom zu erreichen, um sie aus der Vergangenheit zu ziehen, um sie vor den Wölfen und der brennenden Wohnung zu retten. Ich suchte nach Antworten, die erklären konnten, warum ich sie verloren hatte, warum mein ganzes Leben seither eine Abwärtsspirale in Richtung mies gewesen war.
Direkt unter mir fing die Wasseroberfläche an zu dampfen. Eis schmolz. Schnee verdunstete und hinterließ ein Loch von der Form einer Hand – meiner Hand, zwanzigmal größer.
Ich wusste nicht, was ich da überhaupt tat. Ich hatte dasselbe Gefühl wie damals, als meine Mom mir Radfahren beigebracht hatte. Denk nicht darüber nach, was du tust, Magnus. Nicht zögern, sonst stürzt du. Einfach weitermachen.
Ich bewegte meine Hand hin und her. Mehr als dreißig Meter tiefer spiegelte die dampfende Hand meine Bewegungen und befreite die Oberfläche des Flusses vom Schnee. Plötzlich hielt ich inne. Ein Nadelstich aus Wärme traf mich mitten in der Handfläche, als ob ich einen Sonnenstrahl eingefangen hätte.
Etwas war da unten … eine Wärmequelle, tief vergraben im eiskalten Schlamm auf dem Flussboden. Ich ballte die Faust und zog.
Eine Kuppel aus Wasser erhob sich und barst wie eine Blase aus Trockeneis. Ein Gegenstand, der aussah wie ein Bleirohr, schoss aufwärts und landete in meiner Hand.
Das Ding sah überhaupt nicht aus wie ein Schwert. Ich hielt es an einem Ende, aber es hatte keinen Griff. Wenn es jemals eine Spitze oder eine scharfe Kante gehabt hatte, dann war das lange vorbei. Es hatte genau die richtige Größe für eine Schwertklinge, aber es war so angerostet und zerfressen, so von Muscheln verkrustet und glänzte so vor Schlamm und Schleim, dass ich nicht mal sicher war, ob es aus Metall bestand. Mit anderen Worten, es war das traurigste, widerlichste Stück Schrott, das ich jemals auf magische Weise aus einem Fluss gezogen hatte.
»Endlich!« Randolph hob die Augen gen Himmel. Ich hatte das Gefühl, wenn er sein steifes Knie nicht gehabt hätte, dann wäre er jetzt auf dem Gehweg in die Knie gesunken, um ein Gebet zu den nicht existierenden nordischen Göttern zu sprechen.
»Allerdings.« Ich packte mein Fundstück fester. »Ich fühle mich schon viel sicherer.«
»Du kannst es wiederherstellen«, sagte Randolph. »Versuch es doch mal.«
Ich drehte die Klinge um und staunte darüber, dass sie in meiner Hand noch nicht zerfallen war.
»Ich weiß nicht, Randolph. So, wie das Teil aussieht, kann es nicht mehr wiederhergestellt werden. Ich bin nicht mal sicher, ob es recyclingfähig ist.«
Wenn das jetzt nicht gerade beeindruckt oder dankbar klingt, dann versteht das bitte nicht falsch. Wie ich das Schwert aus dem Fluss gefischt hatte, das war so cool gewesen, dass es mich einfach fertigmachte. Ich hatte mir immer schon eine Superkraft gewünscht. Ich hatte nur nicht damit gerechnet, dass meine in der Fähigkeit bestehen würde, Müll vom Grund der Flüsse zu holen. Die freiwilligen Helfer bei der Stadtreinigung würden mich lieben.
»Konzentrier dich, Magnus«, sagte Randolph. »Schnell, ehe …«
Etwa zwanzig Meter weiter ging die Mitte der Brücke in Flammen auf. Die Druckwelle presste mich gegen das Geländer. Die rechte Seite meines Gesichts fühlte sich nach Sonnenbrand an. Fußgänger schrien auf. Autos kamen von der Fahrspur ab und knallten gegeneinander.
Aus irgendeinem blöden Grund rannte ich auf die Explosion zu. Es war so, als könnte ich gar nicht anders. Randolph humpelte hinter mir her, rief meinen Namen, aber seine Stimme kam mir weit weg vor, unwichtig.
Feuer tanzte über die Wagendächer. Fenster platzten in der Hitze und übersäten die Straße mit Glassplittern. Autofahrer sprangen aus ihren Fahrzeugen und rannten um ihr Leben.
Es sah aus, als ob ein Meteor die Brücke getroffen hätte. Ein Kreis auf dem Asphalt von mehr als drei Metern Durchmesser war versengt und rauchte. Mitten in diesem Kreis stand eine Gestalt von Menschengröße: ein dunkler Mann in einem dunklen Anzug.
Wenn ich dunkel sage, dann meine ich damit, dass seine Haut das reinste, schönste Schwarz zeigte, das ich jemals gesehen hatte. Tintenfischtinte um Mitternacht wäre nicht so schwarz gewesen. Seine Kleidung war entsprechend: ein gut geschnittenes Jackett mit passender Hose, ein gestärktes Hemd und ein Schlips – allesamt aus dem Stoff eines Neutronensterns zugeschnitten. Sein Gesicht war unmenschlich schön, wie polierter Obsidian. Er hatte seine langen Haare zu einer makellos glatten, öligen Frisur zurückgekämmt. Seine Augen leuchteten wie winzige Lavaringe.
Ich dachte, wenn es Satan gäbe, würde er aussehen wie dieser Typ.
Dann dachte ich, nein, Satan würde neben diesem Typen aussehen wie ein Penner. Dieser Typ wäre Satans Modeberater oder so was.
Die roten Augen bohrten sich in meine.
»Magnus Chase.« Seine Stimme war tief und klangvoll, sein Akzent irgendwie deutsch oder skandinavisch. »Du hast ein Geschenk für mich.«
Zwischen uns stand ein verlassener Toyota Corolla. Satans Modeberater schritt mitten hindurch und schmolz sich eine Schneise durch die Karosserie, wie ein Lötkolben durch Wachs.
Die zischenden Hälften des Corolla brachen hinter ihm in sich zusammen, die Räder zerliefen zu Pfützen.
»Ich werde dir auch ein Geschenk machen.« Der dunkle Mann streckte die Hand aus. Rauch kräuselte sich über seinem Ärmel und seinen ebenholzschwarzen Fingern. »Gib mir das Schwert, dann verschone ich dein Leben.«
Macht Platz für die Entlein, oder die hauen dir voll auf den Kopf
6Ich hatte in meinem Leben schon allerlei ausgeflippten Kram erlebt.
Ich hatte einmal eine Menge von Leuten gesehen, die nichts als winzige Badehosen und Nikolausmützen trugen und die mitten im Winter die Boylston Street runtergelaufen waren. Mir war ein Typ begegnet, der mit der Nase Mundharmonika spielte, ein Schlagzeug mit den Füßen, eine Gitarre mit den Händen und ein Xylofon mit dem Hintern, und das alles gleichzeitig. Ich kannte eine Frau, die einen Einkaufswagen adoptiert und Clarence getauft hatte. Und dann gab es da noch diesen Dussel, der behauptete, von Alpha Centauri zu stammen, und der mit Kanadagänsen philosophische Gespräche führte.
Also, ein elegantes, männliches satanisches Model, das Autos zum Schmelzen bringen konnte … warum nicht? Mein Gehirn erweiterte sich einfach irgendwie, um Platz für diese Seltsamkeiten zu schaffen.
Der dunkle Mann wartete mit ausgestreckter Hand. Die Luft um ihn flirrte vor Hitze.
Etwa fünfunddreißig Meter weiter kam ein Pendlerzug mit knirschenden Bremsen zum Stehen. Die Schaffnerin glotzte das Chaos um sie herum an. Zwei Jogger versuchten, einen Mann aus einem halb zerquetschten Prius zu ziehen. Die Frau mit der Zwillingskarre öffnete die Sicherheitsgurte ihrer schreienden Kinder, während die Räder der Karre schon zu ovalen Gebilden zerlaufen waren. Neben ihr hielt ein Trottel sein Smartphone hoch, statt ihr zu helfen, und versuchte, die Zerstörung zu filmen. Seine Hand zitterte so heftig, dass bestimmt keine besonders guten Bilder dabei herauskommen würden.
Randolph stand jetzt neben mir und sagte: »Das Schwert, Magnus! Benutz es!«
Ich hatte das unangenehme Gefühl, dass mein großer, kräftiger Onkel versuchte, sich hinter mir zu verstecken.
Der dunkle Mann kicherte. »Professor Chase … ich bewundere Ihre Ausdauer. Ich hatte gedacht, dass unsere letzte Begegnung Ihnen allen Mut genommen hätte. Aber hier stehen Sie, bereit, ein weiteres Familienmitglied zu opfern.«
»Klappe, Surt!« Randolphs Stimme war schrill. »Magnus hat das Schwert. Geh zurück in die Feuer, von wannen du gekommen bist.«
Surt schien das nicht zu beeindrucken, während ich persönlich den Ausdruck »von wannen« überaus beängstigend fand.
Der Feuerheini betrachtete mich, als ob ich genauso muschelverkrustet wäre wie das Schwert. »Gib es schon her, Junge, sonst zeige ich dir die Macht von Muspellsheim und äschere diese Brücke ein, mit allen, die sich darauf befinden.«
Surt hob die Arme. Feuer sickerte zwischen seinen Fingern hindurch. Zu seinen Füßen blubberte der Asphalt. Die Bahngleise stöhnten. Die Schaffnerin schrie voller Panik in ihr Walkie-Talkie. Der Mann mit dem Smartphone fiel in Ohnmacht. Die Mutter brach über der Karre zusammen, und die Kinder saßen noch immer darin und weinten. Randolph grunzte und taumelte rückwärts.
Ich wurde von Surts Hitze nicht ohnmächtig. Sie machte mich nur wütend. Ich wusste nicht, wer dieser feurige Mistkerl war, aber einen Fiesling erkannte ich auf den ersten Blick. Erste Straßenregel: Lass so einen niemals deine Sachen klauen.
Ich richtete mein Möglicherweise-irgendwann-mal-gewesenes-Schwert auf Surt. »Komm mal wieder runter, Mann. Ich habe hier ein zerfressenes Metallstück, und das werde ich auch benutzen.«
Surt grinste spöttisch. »Du bist kein Kämpfer, so wenig wie dein Vater.«
Ich biss die Zähne aufeinander. Okay, dachte ich, wird Zeit, dem Typen sein Outfit zu ruinieren.
Aber ehe ich etwas unternehmen konnte, schwirrte etwas an meinem Ohr vorbei und traf Surt auf der Stirn.
Wenn es ein echter Pfeil gewesen wäre, hätte Surt jetzt Probleme gehabt. Zu seinem Glück war es ein Plastikspielzeuggeschoss mit einem rosa Herzen als Spitze – für den Valentinstag, nahm ich an. Es traf Surt mit einem fröhlichen Quietsch zwischen den Augen, fiel auf seine Füße und schmolz.
Surt blinzelte. Er sah so verwirrt aus, wie ich mich fühlte.
Hinter mir rief eine vertraute Stimme: »Weg da, Kleiner!«
Meine Kumpel Blitz und Hearth kamen über die Brücke gestürmt. Na ja … ich sage »gestürmt«, und das klingt irgendwie beeindruckend. War es aber nicht. Aus irgendeinem Grund hatte Blitz einen breitkrempigen Hut aufgesetzt und trug eine Sonnenbrille zu seinem schwarzen Trenchcoat, deshalb sah er aus wie ein schmieriger und sehr kleiner italienischer Priester. In seinen behandschuhten Händen schwenkte er einen furchterregenden Holzpflock mit einem knallgelben Verkehrsschild: MACHT PLATZ FÜR DIE ENTLEIN.
Hearths rot-weiß gestreifter Schal schleifte hinter ihm her wie schlaffe Flügel. Er legte einen weiteren Plastikpfeil an seinen knallrosa Spielzeugbogen und feuerte ihn auf Surt ab.
Wie ungeheuer lieb und blöd sie doch waren. Mir ging auf, woher sie ihre albernen Waffen hatten: aus dem Spielwarenladen in der Charles Street. Ich bettelte manchmal vor dem Laden und die hatten solchen Kram im Schaufenster. Aus irgendeinem Grund waren Blitz und Hearth mir offenbar dorthin gefolgt. In ihrer Eile hatten sie sich einfach die nächstbesten tödlichen Gegenstände geschnappt, ohne genauer hinzusehen. Und, typisch für verrückte Obdachlose, sie hatten keine besonders gute Wahl getroffen.
Blöd und sinnlos, ja. Aber mir wurde trotzdem warm ums Herz, weil sie sich um mich kümmerten.
»Wir decken dich!« Blitz stürmte an mir vorbei. »Lauf!«
Surt hatte keinen Angriff von schlecht bewaffneten Pennern erwartet. Er stand einfach da, während Blitz ihm das MACHT PLATZ FÜR DIE ENTLEIN-Schild vor die Birne knallte. Hearths nächster quietschender Pfeil ging daneben und traf meinen Hintern.
»He!«, rief ich empört.
Da Hearth taub war, konnte er mich nicht hören. Er rannte an mir vorbei, stürzte sich in die Schlacht und schlug Surt seinen Plastikbogen vor die Brust.
Onkel Randolph packte meinen Arm. Er röchelte grauenvoll. »Magnus, wir müssen weg hier. SOFORT!«
Vielleicht hätte ich losrennen sollen, aber ich stand wie angewachsen da und sah zu, wie meine beiden einzigen Freunde den finsteren Herrn des Feuers mit billigem Plastikspielzeug angriffen.
Endlich hatte Surt dieses Spiel satt. Er verpasste Hearth einen Schlag, der ihn über den Asphalt wirbeln ließ. Blitz trat er so heftig gegen die Brust, dass der kleine Wicht rückwärts taumelte und vor mir auf dem Hintern landete.
»Das reicht.« Surt streckte die Hand aus. Von seiner Handfläche züngelte Feuer empor und dehnte sich immer mehr aus, bis er ein geschwungenes Schwert aus nichts als weißen Flammen in der Hand hielt. »Jetzt bin ich verärgert. Ihr werdet alle sterben.«
»Bei den Galoschen der Götter!«, stammelte Blitz. »Das ist nicht irgendein Feuerriese. Das ist der Schwarze!«
Und nicht etwa der Gelbe?, hätte ich gern gefragt, aber der Anblick des flammenden Schwertes würgte meine Lust auf Witze irgendwie ab.