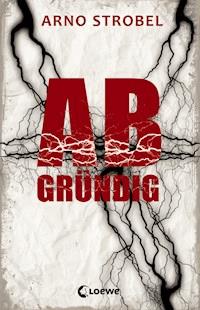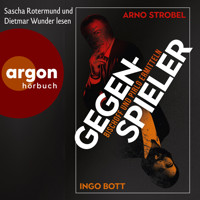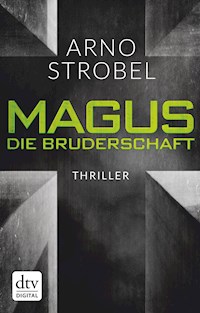
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Vatikan-Thriller von Bestsellerautor Arno Strobel Als der neu gewählte Papst die Loggia über dem Petersplatz betritt, fällt ein Schuss − er ist tödlich! Schnell wird der Attentäter gefasst, der jedoch jegliche Aussage verweigert. Stattdessen spielt er Bischof Corsetti eine mysteriöse Kiste zu. Die Kiste ist schwer und randvoll mit Tagebüchern, die ein noch schwerer wiegendes Geheimnis bergen: Sie führen Corsetti auf die Spur einer Bruderschaft, die ein Komplott gegen die katholische Kirche schmiedet. Der größenwahnsinnige Führer der Bruderschaft, der »Magus«, schreckt dabei auch vor brutaler Gewalt nicht zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über das Buch
»Habemus Papam!« Jubel aus Tausenden von Kehlen. Wenig später erscheint das neue Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche auf der Loggia über dem Petersplatz. Im selben Augenblick fällt ein Schuss. Tödlich getroffen sinkt der Papst zu Boden. Der Scharfschütze ist schnell festgenommen, doch weigert er sich auszusagen und verlangt stattdessen Bischof Corsetti zu sprechen.
Tags darauf betritt der Bischof ein kleines Lebensmittelgeschäft, um dort eine vom Attentäter für ihn deponierte Kiste abzuholen. Die Kiste ist schwer – und sie birgt ein noch schwerer wiegendes Geheimnis: das »Projekt Simon«. Die mysteriösen Tagebücher führen Corsetti auf die Spur einer mächtigen Bruderschaft, die ein gefährliches Komplott gegen die katholische Kirche schmiedet …
Der Inhalt dieses Buches ist reine Fiktion.
Organisationen, Namen und Charaktere sind entweder frei erfunden oder wurden auf fiktionale Weise verändert. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen oder Ereignissen sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig.
FürHeikeLauraChristineund Alexander
September 2001
Vatikan
Als er sah, wie der Kardinaldiakon die Loggia der Vatikanischen Basilika betrat, bildeten sich fast augenblicklich kleine Schweißperlen auf seiner Stirn. Seit Stunden lag er bäuchlings auf dem Dach der Kolonnaden, doch plötzlich erschien ihm der leichte Septemberwind um einige Grade kühler. Er atmete schnaubend aus und schloss für einen Moment die Augen.
Bitte, Gott, lass nicht zu, dass er es ist! Jeder, nur nicht er!
Seine Lider hoben sich wieder und schoben die wohltuende Dunkelheit wie einen Vorhang von ihm weg. Ein, zwei Sekunden lang bot sich ihm ein Bild aus Grau- und Weißtönen, dann war sein Blick wieder klar. Tränen suchten sich einen Weg über die Wangen, doch die feuchten Spuren in seinem Gesicht nahm er kaum wahr. Noch einmal stieß er kräftig den Atem aus, dann griff er entschlossen nach der Präzisionswaffe.
Wie ein drohender Zeigefinger senkte sich der Lauf über das Zweibein nach unten, als er den Schaft hob und fest gegen seine Schulter presste.
Eine Glocke aus bleierner Ruhe umgab ihn jetzt. Das Gemurmel, ein Wortbrei aus Tausenden von Stimmen unter ihm, an das er sich in den Stunden des Ausharrens längst gewöhnt hatte, war plötzlich verstummt. Er wusste nicht, ob die Masse wirklich schwieg oder ob das Stimmengewirr einfach nicht mehr zu ihm durchdringen konnte, aber es war ihm auch egal.
Der Abstand zwischen Schulter und Auflage, um die sich die Waffe in der Angel dreht, ist die Richtlänge. Der Richtwinkelfehler ergibt sich aus Schützenschulterbewegung je Richtlänge … Es ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, ganz wie deine Lakaien es mir wieder und wieder eingebläut haben. Du wärest stolz auf mich!
Das Fadenkreuz leuchtete weiß vor einem stark vergrößerten Ausschnitt der Außenmauer. Überdeutlich konnte er die Risse sehen, von denen die Wand der Basilika durchzogen war. Ganz langsam schwenkte er das Gewehr nach rechts. Dann hatte er die Gestalt im Visier. Das Bild zitterte noch einmal kurz und stand schließlich ruhig. Seine Armmuskeln entspannten sich. Die Waffe bewegte sich dabei keinen Millimeter.
Eine schreckliche Sekunde lang hatte er das Gefühl, die Augen in dem lächelnden Gesicht des Kardinals blickten ihn direkt an. Als Seine Eminenz einen Schritt auf das Mikrofon zuging, schob sich der Kopf wieder aus dem Fadenkreuz heraus. Sofort korrigierte er nach.
Als wäre durch die Bewegung die schützende Glocke über ihm weggerissen worden, hörte er die Stimme des alten Mannes, die von allen Seiten über den Petersplatz zu schallen schien.
»Annuntio vobis gaudium magnum – Habemus Papam! Ich verkünde Euch eine große Freude: Wir haben einen neuen Papst.«
»Den Namen! Sag endlich seinen Namen«, flüsterte er gegen den tosenden Beifall der Menge.
Wie die Waggons eines langen Zuges rauschten Worte an ihm vorbei, bis endlich diese eine, über alles entscheidende Information in sein Bewusstsein drang.
Der Name des neuen Papstes.
Alles in ihm bäumte sich auf. Er wollte aufspringen und über den Petersplatz schreien: »Ihr Wahnsinnigen! Ihr ahnt ja nicht, was ihr getan habt!«
Aber es hätte nichts geändert. Er würde nichts damit erreichen. Genauso wenig, wie er in der Vergangenheit etwas erreicht hatte.
Jetzt sitzt du zu Hause vor dem Fernseher und siehst dich fast am Ziel deiner Träume. Eurer Träume. Noch nicht im Ziel, aber ganz kurz davor. Aber ich …
Doch er hatte keine Zeit mehr für solche Gedanken. Das Gesicht, das er so gut kannte, tauchte nun neben dem Kardinaldiakon auf. Der Jubel der Menschenmenge wurde immer frenetischer.
Keine Zeit mehr für irgendwelche Gedanken. Der Moment war gekommen. Mit einer imaginären Handbewegung befreite er seine Sinne von allen unwichtigen Eindrücken. Der neu gewählte Papst trat würdevoll lächelnd an das Mikrofon, um dem Volk den apostolischen Segen zu erteilen.
Das Fadenkreuz pendelte sich genau auf der furchigen Stirn ein. Sein Zeigefinger krümmte sich, fand den kaum spürbaren Druckpunkt. Er hielt den Atem an.
Ein Leben gegen das von Millionen. O Gott, vergib mir!
Kurz zuckte der erwartete Ruck durch seine rechte Schulter, als der Rückstoß den Schaft dagegenpresste. Der weißgekleidete Mann auf der Loggia sackte in sich zusammen wie eine Marionette, der man die Fäden durchschnitten hatte. Es folgte eine schier endlose Sekunde der Stille. Dann fuhr ein Aufschrei des Entsetzens durch die Menschenmenge auf dem Petersplatz.
Er hatte getroffen. Und er zweifelte keinen Augenblick daran, dass er ihn tödlich getroffen hatte. Seine Waffe achtlos beiseiteschiebend, robbte er zu einem der steinernen Pfosten und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Langsam fiel die Anspannung von ihm ab. Er legte seinen Kopf in die Armbeuge. Sein Körper wurde von einem heftigen Weinkrampf geschüttelt.
Endlich kamen sie. Mit fast übermenschlicher Anstrengung schob er den Schmerz über seine Tat beiseite. Als sie über das Dach der Kolonnade mit erhobenen Maschinenpistolen auf ihn zugerannt kamen, hob er beide Arme. Sie durften ihn nicht erschießen. Es war von großer Bedeutung, dass er am Leben blieb.
In einem Abstand von etwa drei Metern bauten sie sich vor ihm auf. Er blickte in die Mündungen von mindestens zehn Waffen. Die Männer trugen schlichte Uniformen ohne Rangabzeichen. La Vigilanza, der vatikanische Polizeikorps, soufflierte ihm sein Gedächtnis.
Einer der Männer machte eine herrische Handbewegung und sagte in scharfem Tonfall etwas auf Italienisch. Er war ein kleiner, drahtiger Kerl mit eisblauen Augen. Dick traten die Adern seiner Unterarme unter den hochgekrempelten Hemdsärmeln hervor.
Er hob die Schultern und schüttelte den Kopf zum Zeichen, dass er ihn nicht verstand.
Mit dem Lauf der Waffe deutete der Polizist deshalb auf eine Stelle am Boden direkt neben ihm. Endlich begriff er und legte sich lang auf den Bauch, die Arme weit über den Kopf gestreckt. Mehrere Hände tasteten ihm grob über den Körper. Er hatte die Augen wieder fest geschlossen.
Nur nicht schießen. Sie dürfen mich nur nicht erschießen.
Schnell näher kommende Schritte deuteten darauf hin, dass noch mehr Männer sein Versteck gefunden hatten, das eigentlich kein Versteck war. Schmerzhaft wurde er von kräftigen Händen gepackt und auf die Beine gestellt. Aus den Gesichtern um ihn herum schlug ihm der pure Hass entgegen.
Ihr hasst mich und ahnt dabei nicht, wovor ich euch bewahrt habe. Aber wie solltet ihr auch.
Der Polizist, der scheinbar der Boss war, schnauzte ihn wieder an, obwohl er wusste, dass er keines seiner Worte verstand. Darauf nahmen ihn zwei Männer in ihre Mitte und zogen ihn brutal mit sich.
»Wie ist Ihr Name? Warum haben Sie das getan? Reden Sie endlich!«
Er saß, an Händen und Füßen mit Kunststoffseilen gefesselt, auf einem Stuhl. Ein weiterer primitiver Holzstuhl hinter einem wackligen Schreibtisch und ein niedriges, braunes Blechregal an der Wand neben der Tür bildeten das einzige Inventar des Büros. Durch das winzige Fenster drang nur wenig Tageslicht herein. Die Neonröhre an der Decke tauchte den Raum in kalte, abweisende Helligkeit.
Erst war das Büro voll mit aufgeregt durcheinander redenden Männern gewesen, die meisten in Uniformen der italienischen Polizei. Unzählige Hände hatten ihn geschubst und geschlagen. Jetzt befanden sich außer ihm nur noch vier Carabinieri und ein Mann in mausgrauem Anzug mit einer schwarz-rot karierten Krawatte in dem Büro. Der Mann sprach sehr gut Deutsch, mit einem leichten italienischen Akzent. Er hatte gehört, wie einer der Polizisten den Mann Rossi nannte.
Rossi mochte um die Fünfzig sein. Das kantige Gesicht unter den pechschwarzen, lockigen Haaren strahlte Härte und Erbarmungslosigkeit aus. Er beugte sich nun so weit zu ihm herunter, dass ihre Gesichter nur noch Zentimeter voneinander entfernt waren. Sein Atem roch nach kaltem Zigarettenrauch.
»Machen Sie verdammt noch mal endlich den Mund auf!«
Er durfte sich nicht aus der Ruhe bringen lassen.
»Ich muss zuerst mit Bischof Leonardo Corsetti sprechen. Danach werde ich alles erzählen, was Sie wissen wollen.«
Zum zweiten Mal bekam er einen schmerzhaften Schlag ins Gesicht. Der Hieb ließ seine Unterlippe aufplatzen. Wütend wandte sich Rossi ab und sagte etwas zu einem der Carabinieri, dessen Uniformjacke sich über dem gewaltigen Bauch spannte. Augenblicklich verließ dieser den Raum. Wieder trat Rossi zu ihm.
»Ich würde Sie am liebsten über den Petersplatz treiben«, zischte Rossi ihn an. »Haben Sie eine Vorstellung davon, was die Gläubigen da draußen mit Ihnen machen würden? Ist Ihr krankes Hirn in der Lage, auch nur im Entferntesten zu ahnen, was Sie diesen Menschen, was Sie uns allen angetan haben, Sie Irrer?«
»Ist er tot?«
Wieder ein Schlag mitten ins Gesicht, nun aber mit der Faust und mit solcher Wucht ausgeführt, dass er mitsamt dem Stuhl nach hinten kippte. Noch im Fallen dachte er, dass der Kerl ihm das Nasenbein gebrochen hatte. Dann knallte sein Hinterkopf auf die Holzdielen des Fußbodens. Sogleich packte ihn jemand an den Haaren und zog seinen Kopf ein Stück nach oben. Wieder waren Rossis schwarze Augen dicht vor ihm.
»Ja, Papst Gregor XVII. ist tot!« Rossis Gesicht war zu einer zornigen Fratze verzerrt. »Gemeuchelt von einem Wahnsinnigen nach nicht einmal einstündigem Pontifikat.«
Plötzlich war sein Kopf wieder frei und schlug noch einmal hart auf dem Boden auf. Für Sekunden tanzten schwarze Punkte vor seinen Augen einen wilden Reigen. Jetzt bloß nicht bewusstlos werden, beschwor er sich selbst. Er versuchte, sich auf einen Punkt an der weißgetünchten Decke zu konzentrieren, um nicht in die Finsternis einer Ohnmacht abzugleiten, doch das grelle Neonlicht zwang ihn, die Augen zu schließen.
Die Welt stand am Abgrund und ahnte nichts davon. Er wusste nicht, ob seine Tat ausreichte, das Unheil abzuwenden, aber er hatte sein Möglichstes getan. Er fühlte sich von einer unendlichen Last befreit.
Unbeweglich lag er da; vielleicht ließ so der stechende Schmerz unter der Schädeldecke nach. Sie ließen ihn in Ruhe, bis sich die Tür wieder öffnete und jemand den Raum betrat. Blut war ihm aus der gebrochenen Nase in die Ohren gelaufen, weshalb er nur undeutliches Stimmengemurmel vernahm. Sein Stuhl wurde von zwei Männern mit einem Ruck aufgerichtet. Der dicke Carabiniere war zurückgekommen und redete leise auf Rossi ein. Sein Peiniger schüttelte gerade den Kopf, als könne er nicht glauben, was er hörte. Dann drehte er sich um und beugte sich wieder angewidert über ihn.
»Seine Exzellenz Bischof Corsetti hat sich bereit erklärt, mit Ihnen zu sprechen«, sagte er. »Er wird in einigen Minuten hier sein. Wenn es nach mir ginge …«
»Ich muss ihn allein sprechen.«
Der Arm, der sich erneut zum Schlag erhob, wurde von hinten von einem jungen Polizisten festgehalten. Rossi wirbelte mit einer wilden Bewegung herum und starrte den Mann wütend an. Der Carabiniere erblasste. An seinem jugendlichen Gesicht konnte man ablesen, dass er wusste, wie viel Ärger ihm sein Eingreifen bereiten würde. Trotzdem hielt er Rossis Blick stand und schüttelte leicht den Kopf. Rossi schnaubte und ließ den Arm sinken.
Er warf dem jungen Uniformierten einen dankbaren Blick zu, worauf dieser brüsk in eine andere Richtung sah. Augenscheinlich wollte er keine Dankbarkeit von einem Menschen, der gerade den neugewählten Papst ermordet hatte.
Die folgenden Minuten verstrichen, ohne dass Rossi sich noch einmal an ihn wandte. Er hatte sich mit dem Rücken zu ihm auf den Schreibtisch gesetzt und starrte auf die gegenüberliegende Wand. In unregelmäßigen Abständen stieg der blaue Rauch einer Zigarette über seinem Kopf auf.
Die Carabinieri wurden abgelöst. Auch in den neuen Gesichtern konnte er die Mischung aus Unverständnis, blankem Entsetzen und Hass erkennen, wenn sie ihn ansahen. Ein älterer Uniformierter mit Halbglatze kam, kaum hatte er den Raum betreten, geradewegs auf ihn zu und spuckte vor ihm aus. Dazu zischte er einige Worte auf Italienisch, die er nicht verstand. Es klang, als hätte der Mann ihn verflucht.
Plötzlich wurden vor der Tür hektische Schritte hörbar, und kurz darauf betrat Bischof Corsetti den Raum. Als der hohe Geistliche ihn auf dem Stuhl erblickte, blieb er wie angewurzelt stehen. Seine Augen weiteten sich für einen kurzen Moment. Dann wandte er sich an Rossi, der aufgesprungen war, und sagte tadelnd in deutscher Sprache: »Sie haben ihn misshandelt. Seien Sie bitte so freundlich, ihm das Gesicht zu säubern.«
Minuten später wischte ihm der Polizist mit der Halbglatze mit einem nassen Lappen grob das Blut vom Gesicht, wobei er es nicht versäumte, ihm die gebrochene Nase mit festem Druck besonders gründlich abzureiben. Ein höllischer Schmerz durchzuckte ihn, aber er ließ es stumm über sich ergehen, den Blick starr auf den geistlichen Würdenträger gerichtet.
Man hatte für den Bischof ein Kissen auf den zweiten Stuhl gelegt und ihn so hingestellt, dass sie sich in einem Abstand von etwa zwei Metern gegenübersaßen.
»Mein verlorener Sohn, du wolltest mit mir sprechen«, sagte der Geistliche sanft. »Warum ausgerechnet mit mir?«
Das leichte Zittern in seiner Stimme ließ ahnen, was es für ihn bedeutete, dem Mörder des Papstes gegenüberzusitzen.
»Eure Exzellenz, ich muss Sie allein sprechen. Es ist wirklich wichtig. Lebenswichtig.«
»Auf gar keinen Fall!«, polterte Rossi.
Der Bischof hob beschwichtigend die Hand und sah ihn dann mit Augen an, die trotz der großen Trauer ehrliche Güte ausstrahlten. »Welchen Grund gibt es, dass du mich allein sprechen willst?«
»Ich möchte beichten.«
Bischof Corsetti nickte. »Das soll dir nicht verwehrt werden.«
»Exzellenz, das kann ich nicht zulassen!«, brauste Rossi auf. Er lief wie ein gereizter Tiger im Käfig hin und her. »Sie begeben sich in Lebensgefahr. Dieser Mann ist wahnsinnig. Er hat den Heiligen Vater umgebracht!«
Der Geistliche erhob sich. »Auch er ist ein Kind Gottes, und wenn er seine Seele retten möchte, so ist es meine Pflicht, ihm dabei zu helfen. Das kann mir kein weltliches Gericht untersagen. Also lassen Sie uns bitte allein.«
Rossi presste die Lippen kurz fest aufeinander und schluckte. Dann drehte er sich zu einem der Carabinieri um und erteilte ihm einen scharfen Befehl, worauf dieser weitere Kunststoffseile aus einer Innentasche seiner Uniformjacke zog und begann, den Gefangenen noch fester an den Stuhl zu binden. Die Fesseln schnitten ihm ins Fleisch, sie würden ihm das Blut abschnüren. Aber spielte das noch eine Rolle?
Als sichergestellt war, dass er sich nicht mehr bewegen konnte, verließen die Uniformierten das Büro. Bevor Rossi hinausging, sah er ihm noch einmal mit einem langen, finsteren Blick drohend in die Augen und wandte sich dann an den Bischof, der ans Fenster getreten war und hinunter auf den Petersplatz blickte, den gewaltige Polizeieinheiten inzwischen vollkommen abgesperrt hatten.
»Wenn Sie Hilfe brauchen, Exzellenz, ich stehe vor der Tür!«
Dann war auch er verschwunden. Kaum hatte sich die Tür geschlossen, sprudelte es aus ihm heraus.
»Exzellenz, schauen Sie mich bitte an«, sagte er beschwörend. »Erinnern Sie sich an mich? Sie kennen mich!«
Der Bischof hatte sich zu ihm umgedreht und musterte ihn angestrengt. Plötzlich wich alle Farbe aus seinem Gesicht. Er legte die Hand auf den Mund und starrte ihn entsetzt an.
»Gütiger Gott! Du bist …« Mit vor Schreck geweiteten Augen ließ sich der Geistliche auf den Stuhl sinken. »Wie …?«
Er schüttelte jedoch vehement den Kopf, woraufhin ihn erneut ein stechender Schmerz durchzuckte. »Bitte, stellen Sie jetzt keine Fragen!«, flehte er verzweifelt. »Dazu bleibt keine Zeit. Hören Sie mir einfach nur zu. Kennen Sie die Via del Falco ganz hier in der Nähe des Petersplatzes?«
Der Bischof nickte stumm.
»Gut! An der Kreuzung Via del Falco mit Borgo Vittorio gibt es ein kleines Lebensmittelgeschäft. Es gehört einem alten Herrn, Signore Lazetti. Dort habe ich eine Kiste für Sie deponiert.« Er sprach schnell, denn er befürchtete, dass Rossi jeden Moment wieder auftauchte. »Ich habe dem Mann eine fürstliche Belohnung versprochen, wenn er sie sorgsam für Sie aufbewahrt. Die Kiste ist sehr schwer. Und beeilen Sie sich. Nach dem, was geschehen ist, wird man ihr Fehlen bald bemerken und vor nichts zurückschrecken, um sie wiederzubekommen. Glauben Sie mir, es ist von allerhöchster Wichtigkeit!«
Der Bischof sah ihm lange mit einem nicht zu deutenden Blick in die Augen.
»Warum nur hast du etwas so unsagbar Schreckliches getan?«
»Nehmen Sie die Kiste an sich, dann wird Ihnen diese Frage beantwortet. Sehen Sie sich ihren Inhalt an. Allein. Sie entscheiden, was damit zu geschehen hat. Werden Sie es tun, Exzellenz?«
Wieder dieser seltsame Blick. »Du wolltest doch beichten, mein Sohn.«
Als Bischof Corsetti, angekündigt vom einsamen Bimmeln eines Glöckchens, den kleinen Laden betrat, mussten sich seine Augen erst an das schummrige Licht gewöhnen, das sich dünn wie Rinnsale durch die Ritzen der geschlossenen Holzläden in den Raum zwängte. Erst auf den zweiten Blick entdeckte er Giuseppe Lazetti, der dösend hinter der Theke saß.
Umständlich richtete sich der Alte auf und sah dem schlanken Geistlichen mit dem vollen, grauen Haar misstrauisch entgegen. Die hohen Herren des Vatikans verirrten sich sonst nie in sein kleines Lebensmittelgeschäft. Hatte der Besuch etwas mit dem gestrigen Attentat auf den Papst zu tun? Was konnte er dazu schon sagen? Er hatte mit der Kirche nichts am Hut. Sein letzter Besuch in einem Gotteshaus musste über zwanzig Jahre her sein. Sein Unwille schlug jedoch sofort in geschäftigen Eifer um, als der Bischof das Attentat überhaupt nicht erwähnte, sondern nach einer Kiste fragte, die jemand für ihn abgegeben habe. In Erwartung der versprochenen Belohnung rieb sich Lazetti, untertänig nickend, die Hände. Er quetschte sich an den Regalen hinter seinem Tresen vorbei und verschwand durch eine niedrige Tür im Hinterzimmer.
Während polternde Geräusche ein Umstapeln mehrerer Kisten vermuten ließen, blickte Corsetti sich um. Die alten, mit Waschmitteln, Konserven und sonstigen Dingen für den täglichen Gebrauch überladenen Holzregale, auf denen an manchen Stellen die abblätternde weiße Farbe die Konturen einer Landkarte angenommen hatte, vermittelten ihm das Gefühl, eine Reise in die Vergangenheit unternommen zu haben. Mit einem Anflug von Wehmut dachte er an seine Zeit als junger Priester in einem kleinen sizilianischen Dorf zurück, als eine seiner größten Sorgen war, dass die unverheiratete Giulietta Corrina den Vater ihres Kindes nicht nennen wollte. Oder wie er Paolo Veretto davon überzeugen konnte, dass es im Streit mit der Ehefrau bessere Argumente gab, als ihr ein blaues Auge zu schlagen. Was waren das damals noch für sorglose Zeiten gewesen. Nun, viele Jahre später und nur einen Tag nach der Ermordung des frischgewählten Heiligen Vaters, stand er, Bischof Corsetti, hier und wartete auf den Schlüssel, der ihm die Gründe für ein furchtbares Attentat liefern sollte, das die ganze Welt erschüttert hatte.
Das Ächzen des alten Mannes riss ihn aus seinen Gedanken. Lazetti zog, gebückt rückwärtsgehend, einen Karton von der Größe eines Koffers in den Laden.
»Hier ist die Kiste, Eure Exzellenz. Genau so, wie sie mir der junge Deutsche vorgestern übergeben hat. Ich habe sie wie meinen Augapfel gehütet.«
Bischof Corsetti betrachtete den mit einem breiten schwarzen Klebeband mehrfach umwickelten Pappkarton mit gemischten Gefühlen. Würde er darin wirklich die Antwort finden? Womöglich sogar auf Fragen, die er sich schon vor Jahren gestellt hatte?
»Vielen Dank für Ihre Mühe. Kann ich die Kiste allein tragen?«
»Sicher, Eure Exzellenz. Nur für einen alten kranken Mann wie mich ist sie zu schwer. Das Rheuma, Eure Exzellenz, das ist wie die Pestilenz. Ich habe kein Geld, um die teuren Medikamente zu bezahlen. Hat man Ihnen etwas gesagt von einer … ähm …«, er wand sich wie ein Wurm, »von einer kleinen … Anerkennung für meine Verdienste?«
Corsetti nickte und dachte dabei: Gerade erst ist der Heilige Vater, der Stellvertreter Christi auf Erden, ermordet worden und diesen einfachen Mann kümmern nur seine kleinen Sorgen. Er drückte dem Alten einige Scheine in die Hand, die dieser sogleich eingehend begutachtete. Er strahlte den Bischof an.
»Oh, Eure Exzellenz, der Herr sei mit Ihnen. Ich werde Sie in mein Abendgebet einschließen … Und den verstorbenen Heiligen Vater natürlich auch, Gott hab ihn selig«, beeilte sich Lazetti hinzuzufügen und bekreuzigte sich gleich zweimal. Dann zwängte er sich mehrfach verbeugend an dem Kirchenmann vorbei und öffnete ihm unter Glöckchengebimmel die Tür.
Der Karton war schwer, aber für das kurze Stück bis zu dem wartenden Taxi würde es gehen. Als Bischof Corsetti mit seiner Last hinaus in die strahlende Mittagssonne trat, schloss er für einen Moment geblendet die Augen.
Im Vatikan mussten eigentlich die Vorbereitungen für die Trauerfeierlichkeiten beginnen, aber die Mitglieder der Kurie waren vor Entsetzen noch wie gelähmt. In jüngster Vergangenheit waren ungewöhnliche Dinge geschehen. Der Mord an dem eben erst gewählten Papst war wie ein Donnerschlag aus den schwarzen Wolken über sie gekommen, die sich über dem Vatikan zusammengezogen hatten. Gott schien seine Kirche einer harten Prüfung unterziehen zu wollen.
Hunderte von Trauerbekundungen aus aller Welt waren seit dem Attentat im Vatikan eingegangen. Aber es wurden auch immer mehr neugierige Fragen nach den Hintergründen der Tat gestellt. Die internationale Presse überschlug sich mit Meldungen aus »gut unterrichteten Kreisen« und Spekulationen der Redakteure. Gab es einen Zusammenhang zwischen dem Mord an dem Kirchenoberhaupt und den geheimnisvollen Geschehnissen um seinen Vorgänger? Gehörte der deutsche Attentäter einer fanatischen Vereinigung an? Ein großes Skandalblatt glaubte zu wissen, dass der Mörder zum Islam konvertiert war, der zum finalen Schlag gegen die »Ungläubigen« ausgeholt hatte. Der deutsche Bundeskanzler hatte einen Krisenstab gebildet, dessen Sprecher verkündete, dass man ein Sondereinsatzkommando aus Angehörigen des Bundeskriminalamts nach Rom senden würde, um der italienischen Polizei bei der Aufklärung des Verbrechens behilflich zu sein.
Grübelnd schritt Bischof Corsetti durch die engen Straßen der Vatikanstadt, vorbei an Grüppchen von Geistlichen, die leise und mit ernsten Gesichtern miteinander debattierten und ihn verhalten grüßten. Hin und wieder blieb er stehen, sah hinauf in den Himmel, an dem dicke Wolken aufgezogen waren, und ließ dann seinen Blick über die gelblich-braunen Mauern der alten Gebäude schweifen. Im trüben Licht wirkten sie so trostlos, als wollten sie die Verzweiflung und Trauer nach außen tragen, die sich der Menschen bemächtigt hatte. Das Leben im Vatikan schien stillzustehen angesichts der Unfassbarkeit des Geschehens.
Eine Viertelstunde später schloss er die Tür seiner kleinen Wohnung hinter sich und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Nur das unverhältnismäßig laut erscheinende Geräusch seines Atems unterbrach die Stille. Die Kiste stand in der Mitte des Wohnzimmers, so wie er sie eine Stunde vorher dort abgestellt hatte, bevor ihn das dringende Bedürfnis überkam, erst einmal frische Luft zu schöpfen. Ein beklemmendes Gefühl hatte ihm gesagt, dass der Inhalt dieser Kiste ihm nicht nur die Hintergründe für die Ermordung des Papstes liefern würde. Er spürte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte, als er sich von der Tür löste und zu seinem schweren Schreibtisch ging. Mit einem silbernen Brieföffner in der Hand machte er zwei entschlossene Schritte auf die Kiste zu, zögerte noch einmal kurz und schlitzte dann das Klebeband auf.
Langsam klappte er die beiden Pappdeckel zurück und warf einen ersten Blick ins Innere. Soweit er erkennen konnte, enthielt der Karton mehrere große, in roten Samt eingeschlagene Bücher. Sie hatten das Format eines herkömmlichen Fotoalbums, waren aber um einiges dicker. Mit leicht zitternder Hand nahm er den obersten Band heraus. Auf den Umschlag war in goldenen Lettern »Projekt S.« geprägt. Corsetti schlug die erste Seite auf. »Projekt Simon III 74–87«. Die Zahl 87 war mit einem anderen Stift geschrieben worden. Projekt Simon? Nachdenklich blätterte er um und erblickte eine lange Kolonne von etwa hundert Zahlen. In einer separaten Spalte daneben war jeweils eine weitere Zahl eingefügt. Es handelte sich dabei ausschließlich um Zahlen zwischen eins und fünf, wobei die Zwei und die Drei am häufigsten vorzukommen schienen. Die Überschrift lautete »74/aktiv«. Er blätterte weiter. Auch die nächste Seite zeigte eine senkrechte Reihe untereinandergeschriebener Zahlen, allerdings ohne die zweite Spalte, und darüber stand »74/X«.
Corsetti schlug nun eine Stelle in der Mitte des Buches auf. Sie war eng von Hand beschrieben. In unregelmäßigen Abständen war am Zeilenanfang ein Datum eingefügt. Es schien sich hier um eine Art Tagebuch zu handeln. Gespannt überflog er die ersten Zeilen.
2. Oktober1979
ALLGEMEIN – Gespräch mit Oberst K. / Voraussetzungen für Neuakquisition in seiner Kompanie gut. Habe K. geraten, vorsichtig vorzugehen. Fall Helge S. ist noch zu frisch.
SIMON – Erfolg für Weimann. Soll zum Bischof geweiht werden. Problem mit Kinzler spitzt sich weiter zu.Nicht mehr tragbar. Antrag auf X in der morgigen Sitzung.
Simonische Steuer September:645345,65 DM.
20. Oktober1979
ALLGEMEIN – k. b. V.
SIMON – Antrag auf X betreffend Kinzler mit einer Gegenstimme angenommen. Auftrag erteilt!
S6 verliert den Blick für das Ziel.
Corsetti klappte das Buch zu und hielt einen Moment nachdenklich inne. Er konnte sich auf das Gelesene keinen Reim machen. Aber vielleicht fand er in einem anderen Band die Erklärung dafür? Er legte das Buch auf dem schweren Schreibtisch ab und entnahm dem Karton vorsichtig drei weitere Bücher mit rotem Samteinband. Als er sich ein letztes Mal über die Kiste beugte, stockte ihm der Atem: Aus bronzefarbenem Metall glänzte ihm vom schwarzen Lederdeckel des letzten Buches ein Hakenkreuz entgegen. Langsam streckte er seine Hand danach aus. Ebenso langsam richtete er sich dann, das Buch in der Hand, wieder auf. Er konnte den Blick nicht von dem metallisch glänzenden Symbol abwenden, in dem sich das Licht der Deckenlampe spiegelte. Etwas war seltsam daran. Als er seine Augen die Linien entlangwandern ließ, dämmerte es ihm: An den Eckpunkten, dort, wo die Balken um neunzig Grad abknickten, waren schwarze Kreise aufgesetzt. Dies erweckte den Eindruck, als gehörten die seitlichen Flügel nicht mehr dazu.
Den Blick noch immer auf den Buchdeckel geheftet, ging Bischof Corsetti langsam die drei Schritte bis zu seinem bequemen Sessel in der Ecke neben der Stehlampe. Die verschiedensten Gedanken rasten ihm durch den Kopf, als er sich in die Polster sinken ließ. Er legte das Buch auf seine Oberschenkel und lehnte den Kopf mit geschlossenen Augen zurück.
Himmlischer Vater, was bürdest du mir da auf? Was immer ich hier finden werde, gib mir die Weisheit und die Kraft, es zu verstehen und zu deinem Wohle einzusetzen!
Er holte tief Luft, öffnete die Augen und schlug das Buch auf. Wie auch schon bei dem in rotem Samt eingeschlagenen Buch zeigte die erste Seite den Titel »Projekt Simon«, allerdings ohne sonstige Zusätze. Auch die Zahlenreihen auf den folgenden Seiten fehlten. Stattdessen erblickte Corsetti einen ersten, mit Datum versehenen Eintrag.
Montag, 24. Januar 1949
Kimberley
Die südafrikanische Sonne kannte kein Mitleid mit Mensch und Tier. Als wäre sie fest gewillt, in diesem Sommer diesen Teil der Erde bis zum letzten Tropfen auszutrocknen, demonstrierte sie seit Tagen erbarmungslos ihre ganze Kraft. Sie schien geradezu auf das kleinste Anzeichen von Wasserdampf zu lauern, um es sofort zu zerstören, bevor sich daraus eine lebensspendende Regenwolke bilden konnte.
An diesem Vormittag saßen fünfzig Jungen schwitzend in einem großen Raum, an dessen Decke vier Ventilatoren die heiße Luft gemächlich wie einen Kuchenteig durchwalkten. Die einfachen Holzstühle waren zu zwei Blöcken mit jeweils fünf Stühlen in fünf Reihen hintereinander aufgestellt worden. Dazwischen hatte man einen etwa einen Meter breiten Gang frei gelassen.
Gespannt warteten die Jungen auf den Mann, der ihnen etwas über ihre glänzende Zukunft erzählen wollte. Von ihren Eltern wussten sie nur, dass ihnen in Südafrika eine große Ehre zuteil werden sollte, hier würden sie eine hervorragende Ausbildung erhalten, die den Grundstein zu einem unglaublich erfolgreichen Leben bildete. Und obwohl es für die meisten von ihnen nicht einfach gewesen war, Familie und Freunde in Deutschland zurückzulassen, hatte sie die Aussicht auf Abenteuer in dieses ferne, fremde Land gelockt.
Die Blicke der Männer, die sich mit hinter dem Rücken verschränkten Armen entlang der weißen Wände aufgestellt hatten, glitten gleichmäßig über die Jugendlichen und mahnten zur Ruhe. Der Erfolg war nur mäßig. Überall wurde aufgeregt getuschelt und gekichert.
Immer wieder betrachteten die Jungen das etwa zwei Meter hohe Metallgebilde an der mit hellen Holzbrettern verkleideten Stirnseite der Aula. Flüsternd stellten sie Mutmaßungen darüber an, was die Kreise an den Eckpunkten des schwarzen Hakenkreuzes wohl zu bedeuten hatten, bis die zweiflügelige Tür geöffnet wurde und ein etwa fünfzigjähriger Mann in weißem Leinenanzug den Raum betrat. Schlagartig verstummte das Gemurmel. Verfolgt von fünfzig jungen Augenpaaren, ging der Mann mit zügigen Schritten durch den Mittelgang zur Stirnwand, wo er von allen gesehen werden konnte. Sekundenlang betrachtete er die vor ihm sitzenden Jungen, während die Ventilatoren an der Decke mit einem surrenden Geräusch ihre sinnlose Arbeit verrichteten. Es war ein deutlich anderer Blick als der der restlichen Männer. Abschätzend und neugierig, autoritär und doch nicht unangenehm. Dann nickte er. Was er gesehen hatte, schien ihm zu gefallen.
»Guten Morgen, meine Herren«, sagte er mit lauter, fester Stimme. »Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise. Ich begrüße Sie auf meinem Anwesen und denke, dass Sie sich trotz der Hitze hier wohlfühlen werden.«
Die förmliche Anrede ließ den einen oder anderen verlegen lächeln. Der Mann behandelte sie wie vollwertige Erwachsene.
»In Ihren Blicken erkenne ich die wachsende Ungeduld. Ich werde Sie auch nicht länger auf die Folter spannen.« Sein Lächeln drückte Verständnis aus. »Mein Name ist Hermann von Settler. Mehr zu meiner Person erfahren Sie – hoffentlich alle – zu einem späteren Zeitpunkt. Sie möchten endlich wissen, warum Sie hier sind. Zuerst einmal kann ich Ihnen sagen, dass Sie sorgsam aus Tausenden jungen Männern ausgesucht worden sind, denn wir können nur die Besten gebrauchen. Sie alle sind junge, katholische, deutsche Männer im Alter von dreizehn und vierzehn Jahren, stammen aus einem tadellosen Elternhaus und sind durch besondere Charakterzüge und überdurchschnittliche Intelligenz aufgefallen. Und Sie haben nicht gezögert, die vertraute Umgebung aufzugeben, um einer ungewissen Zukunft entgegenzugehen.«
Von Settlers Gesichtsausdruck hatte sich verändert. Das freundliche Lächeln war daraus verschwunden und hatte einer nicht strengen, aber doch bestimmten Ernsthaftigkeit Platz gemacht.
»In den nächsten zwei Tagen werde ich mit jedem Einzelnen von Ihnen ein Gespräch führen. Wenn Sie währenddessen zu der Erkenntnis gelangen, Sie seien für die bedeutungsvolle Aufgabe, für die wir Sie ausgesucht haben, nicht geeignet, können Sie sofort wieder abreisen und alles vergessen. Sollten Sie sich jedoch für unsere Sache entscheiden, ist dies absolut bindend und nicht mehr rückgängig zu machen. Stellen Sie es sich wie das ewige Gelübde vor, das ein Ordensbruder ablegt.«
Er tauschte, nun wieder lächelnd, Blicke mit den vor den Wänden stehenden Männern, räusperte sich und versenkte die Hände tief in den Taschen der Leinenhose.
»Als Gegenleistung erhalten Sie eine einzigartige Ausbildung, um die enorm verantwortungsvolle Aufgabe bewältigen zu können, die auf Sie wartet, sowie eine beachtliche finanzielle Unterstützung. Und Sie werden die Gewissheit erlangen, der ganzen Welt einen großen Dienst zu erweisen. Gibt es zum jetzigen Zeitpunkt jemanden unter Ihnen, der bereits den Saal verlassen möchte?«
Plötzlich schienen sich die meisten der Jungen brennend für ihre Schuhe zu interessieren. Verstohlen blickte mancher sich um, ob jemand die Hand hob. Hermann von Settler lächelte zufrieden.
»Gut! Dann sagen Sie jetzt bitte alle laut: Ich bin bereit!«
Als ein undeutliches Gemurmel folgte, zog er erstaunt die Augenbrauen hoch.
»Ich habe eine Antwort von fünfzig jungen Männern erwartet. Was ich stattdessen höre, ist das Gesäusel aus dem Klassenzimmer eines Mädchenpensionats. Meine Herren, stehen Sie auf!«
Seine Stimme klang plötzlich schneidend, und sofort erfüllte das Geräusch geschobener Stühle den Raum.
»Und jetzt möchte ich es noch einmal aus fünfzig Männerkehlen hören!«
»Ich bin bereit!«, schallte ihm darauf zwar nicht synchron, aber immerhin sehr laut entgegen.
»Na also … Bitte setzen Sie sich wieder.«
Auf von Settlers Gesicht zeigte sich nun wieder ein Lächeln. Kaum hatte sich die Unruhe gelegt, fuhr er mit seiner Ansprache fort.
»Sie werden sich sicher fragen, was unsere Sache ist, von der ich vorhin sprach. Nun, zusammen mit einigen einflussreichen und bedeutenden Männern habe ich vor etwa einem Jahr die Bruderschaft der Simoner gegründet. Der Begriff der Simonie geht zurück auf den Zauberer Simon Magus, der von Petrus die göttliche Gabe der Geistmitteilung kaufen wollte, und bezeichnet den Erwerb eines heiligen Amtes, einer Zeremonie oder eines geweihten Gegenstandes für Geld. Und wie der Name der Bruderschaft erinnert auch mein Titel und der aller künftigen Führer der Simoner an den biblischen Zauberer – Magus!«
Er machte eine Pause, um das Gesagte wirken zu lassen.
»Hinter mir an der Wand sehen Sie unser Symbol. Es erinnert in seiner Grundform an das Hakenkreuz. Die Grundgedanken des Mannes, der unwiderruflich mit diesem Symbol verbunden ist, sind auch in unserer Ideologie enthalten …«
Interessiert beobachtete er einige Sekunden lang die Reaktionen in den Gesichtern der Jungen nach der Erwähnung Adolf Hitlers, bevor er weiterredete.
»Wenn Sie jedoch genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass die Balken unterbrochen sind und dadurch das Symbol in seiner Gesamtheit ein anderes ist. Genau so, meine Herren, ist unser Weg ein anderer als der Adolf Hitlers, und auch das Ergebnis wird ein anderes sein. Unser Ziel ist es, alle Menschen dieser Welt, ob schwarz, gelb oder weiß, ob arm oder reich, unter einer Führung zu vereinen, weil dies die einzige Möglichkeit ist, dauerhaft in Frieden miteinander zu leben.«
Die Jungen blickten sich irritiert an. Unter einer Führung? War nicht gerade dieser Versuch vor Kurzem erst kläglich gescheitert? Sollte es schon wieder Krieg geben? Tod und Elend? Nächte in engen, dunklen Bunkern, umgeben von betenden Frauen und weinenden Geschwistern, in denen man sich vor Angst in die Hose machte, nicht wissend, ob man in wenigen Minuten noch am Leben war? Nächte, während denen sich die vertraute Welt jedes Mal furchtbar verändert hatte?
Hermann von Settler schien zu ahnen, was in den Jungen vorging. Beschwichtigend hob er beide Arme und sprach ruhig weiter.
»Lassen Sie mich ein wenig ausholen, damit Sie verstehen, worum es geht. Sie alle haben die Schrecken des Krieges und die schmähliche Niederlage erlebt, die er uns gebracht hat. Ich selbst habe in diesem Krieg gedient, ich habe als Hauptsturmführer der Waffen-SS für das Vaterland gekämpft. Als der größte Teil unserer ›alten Garde‹ an der Ostfront fiel, ging man dazu über, die bis dahin sehr hohen Anforderungen für die Aufnahme in diese deutsche Eliteeinheit herunterzuschrauben. Und so waren wir 1944 schließlich 600 000 Mann stark. Aber beachten Sie bitte die Zusammensetzung.« Er zog einen Zettel aus der Tasche. »In der Waffen-SS dienten Niederländer, Briten, Schweizer, Norweger, Dänen, Finnen, Schweden, Franzosen, Letten, Esten, Ukrainer, Kroaten, Flamen, Wallonen, Bosniaken, Italiener, Albaner, Turko-Tataren, Aserbeidschaner, Rumänen, Bulgaren, Kaukasier, Russen, Ungarn und sogar einige Inder. Nur die oberste Führung war und blieb stets deutsch.«
Der Zettel verschwand wieder in den weiten Falten seiner Hosentasche.
»Was möchte ich Ihnen damit sagen? Nun, für intelligente Wesen, und dazu zähle ich Sie alle, lässt sich daraus einiges ableiten. Erstens: Es ist durchaus möglich, unzählige Nationen, vielleicht sogar alle Nationen dieser Welt, unter einer Führung zusammenzufassen. Und zweitens, und das ist ganz wichtig: Ein Krieg ist die denkbar schlechteste Möglichkeit, dies zu realisieren.«
Die Erleichterung der Jungen nach dieser Aussage von Settlers war fast greifbar.
»Meine Herren, die ursprünglichen Gedanken Adolf Hitlers waren genial, aber er war letztendlich doch nur ein kleingeistiger Krawallbruder. Er hatte ein großes Ziel, aber er rückte mit der Brechstange an und hatte leider nicht die Intelligenz, zu erkennen, dass der kürzeste Weg in den seltensten Fällen der beste ist. Es gibt einen anderen Weg, der jedoch nicht innerhalb weniger Jahre zu realisieren ist. Dafür aber ist er umso Erfolg versprechender.«
Von Settler drehte sich um und betrachtete das Symbol. Sekundenlang wandte er den Jungen den Rücken zu, reglos, als würde er das hakenkreuzähnliche Gebilde anbeten. Stille erfüllte den großen Raum. Als er sich plötzlich wieder zu den Jungen umdrehte und noch in der Bewegung mit lauter Stimme weitersprach, fuhren einige erschrocken zusammen.
»An dieser Stelle kommt die Kirche ins Spiel. Wieso die Kirche, werden Sie sich fragen. Nun, ich will es Ihnen erklären. Churchill, Hitler und wie sie alle heißen – alles große Namen. Eine Zeit lang reden sie mit, lenken vielleicht sogar die Geschicke ihres Landes, doch ehe sie sich versehen, sind sie mitsamt ihren politischen Ideen in der Versenkung verschwunden und vergessen. Die Männer der Römischen Kurie hingegen, sie bleiben jahrzehntelang dieselben. Sie werden nicht abgewählt, nicht entmachtet. Kein Staatsstreich kann ihnen gefährlich werden. Erst wenn sie aus dem Leben geschieden sind oder ein geradezu biblisches Alter erreicht haben, werden sie durch jüngere abgelöst, die zudem aus den eigenen Reihen kommen und die seit Jahrhunderten gleiche Politik fortführen. Sie regieren über 360 Millionen Gläubige in allen Ländern dieser Erde und ihr über die ganze Welt verteilter Besitz hat unbeschreibliche Ausmaße.
Meine Herren, die Vergangenheit hat eindeutig bewiesen, dass das Buch der Geschichte nur vordergründig mit Kriegen, Geld und Wirtschaftsgesetzen geschrieben wird. Die eigentliche Triebfeder ist jedoch der Glaube. Die wahrhaft mächtigen Männer dieser Welt sind nicht die Marionetten, die sich Staatspräsidenten nennen oder Regierungschefs. Nein, die wirkliche Macht halten alte Männer in Händen, die in feinste Seide gekleidet sind. Sie tragen goldene Brustkreuze und Edelsteine, und wo immer sie auftauchen, kniet das Volk in wahrer Demut vor ihnen nieder. Es bittet um Vergebung seiner kleinen Sünden und erhält – große Politik.«
Wieder machte er eine kurze Pause, in der sein Blick über die Jungen glitt, die mit weit aufgerissenen Augen bewegungslos auf ihren Stühlen saßen.
»Wenn Sie sich uns anschließen, werden Sie ab der nächsten Woche ein eigens für Sie gegründetes deutsches Internat besuchen. Dort wird man Sie zu einem herausragenden Abitur führen. Anschließend werden sich Ihre Wege zwar trennen, aber Ihr Ziel wird das gleiche bleiben. Sie werden an verschiedenen Universitäten Theologie studieren und sich in einem Priesterseminar auf die Rolle vorbereiten, die Sie anschließend nach außen hin verkörpern sollen.
Während der gesamten Ausbildung werden Sie immer jemanden in Ihrer Nähe haben, der Tag und Nacht für Sie da ist und an den Sie sich mit allen Fragen und Problemen wenden können. So gerüstet und unterstützt wird Ihrer glänzenden Karriere in der kirchlichen Organisation nichts mehr im Wege stehen. Mit unserer Hilfe werden einige von Ihnen bis in die höchsten Ebenen der Römischen Kurie vordringen. Sie sind auserkoren, diese unglaubliche, ›gottgegebene‹ Macht einmal in Händen zu halten, die Sie dann dazu benutzen werden, die Kirche in unserem Sinne zu reformieren. Mit der Macht und dem Geld der katholischen Kirche werden wir die Gläubigen dieser Welt zu einer einzigen Nation zusammenführen.«
Pause.
»Mit Ihnen an der Spitze.«
Lange Pause. Als er weitersprach, wurde seine Stimme leise. Geradezu ehrfürchtig.
»Sie, meine Herren, werden dann die Welt beherrschen!«
Als hätten sie ihr Stichwort bekommen, ging die Tür auf und eine nicht enden wollende Reihe Männer in kurzen Khakihosen betrat den Raum.
»Jeder von Ihnen wird nun einen ›Begleiter‹ bekommen, der mit Ihnen nach draußen geht und Sie in den folgenden Stunden davor bewahren wird, mit jemandem reden zu müssen.« Von Settlers Stimme war wieder lauter geworden. »Der Grund dafür ist schnell erklärt. Ich möchte in den anschließenden Einzelgesprächen einzig Ihre unverfälschte Meinung hören, nicht das Resultat einer Gruppendiskussion. Ihre persönliche Entscheidung ist zu wichtig, als dass sie durch andere beeinflusst werden darf. Wer ein Bier trinken oder eine Zigarette rauchen möchte, wendet sich an seinen ›Begleiter‹. Er wird Sie damit versorgen.«
Die Jungen sahen sich mit großen Augen an. Bier? Zigaretten? Wenn ihre Mutter sie zu Hause mit einem von beiden erwischt hätte …
Wenig später stieg von dem großen sandigen Platz, der von dem Haupthaus, dem neuen Gebäude mit der großen Aula und den Räumlichkeiten für das Dienstpersonal u-förmig eingerahmt wurde, in unzähligen kleinen Wölkchen blauer Zigarettenqualm auf.
Die Gespräche liefen alle nach dem gleichen Muster ab. Nachdem er den Jungen nach dem Namen gefragt hatte, stellte von Settler allgemeine Fragen nach Freizeitbeschäftigungen, bisherigem Berufswunsch und dem Verhältnis zu den Eltern. Dann wollte er wissen, wie man über den letzten Krieg, den Nationalsozialismus und dessen Führer und über die Kirche dachte. Während der Gespräche machte von Settler sich Notizen in ein kleines, braunes Buch. Nach etwa zwanzig Minuten stellte er dann die alles entscheidende Frage.
»Peter Federspiel, sind Sie bereit, sich uns anzuschließen und sich unwiderruflich in den Dienst unserer Sache zu stellen?«
»Ja!«
»Dann stehen Sie bitte auf. Heben Sie die rechte Hand und sprechen Sie mir nach: Ich, Peter Federspiel, schwöre den heiligen Eid, dass ich der Sache der Simoner allzeit treu und redlich dienen werde und bereit bin, für die Bruderschaft jederzeit mein Leben einzusetzen.«
Nachdem der Eid geleistet war, musste der Junge eine vorbereitete Urkunde mit ähnlichem Wortlaut unterschreiben, worauf sein Betreuer den Raum betrat und das neueste Mitglied der Bruderschaft hinüber in die Unterkunft geleitete.
Alle Gespräche liefen exakt nach dem aufgestellten Zeitplan ab, bis am späten Nachmittag ein blonder Junge in von Settlers Büro Platz nahm. Er sollte der vorletzte des ersten Tages sein.
Wie jedes Mal davor lehnte sich von Settler erst einmal zurück und musterte sein Gegenüber für einige Sekunden. Die meisten der Jungen blickten dabei verlegen zu Boden oder betrachteten mit hochrotem Kopf scheinbar interessiert das Mobiliar des gemütlich eingerichteten Raumes. Dieser war jedoch anders. Trotzig hielt er dem prüfenden Blick der eisgrauen Augen stand.
»Wie ist Ihr Name, junger Mann?«, fragte von Settler.
Der Junge warf einen schnellen Blick auf den Schreibtisch, wo eine gelbe Aktenmappe lag. Auf dem Deckel stand sein Name geschrieben. Er deutete mit dem Kopf zu der Akte hin.
»Den haben Sie doch schon gelesen. Mein Name ist Friedrich von Keipen.«
Von Settler überging die kleine Provokation.
»Von Keipen, richtig. Ihr Vater ist ein beachtlicher Mann.«
»Er ist alt«, erwiderte Friedrich und zuckte mit den Schultern.
Von Settlers Augen verengten sich zu Schlitzen.
»Was meinen Sie damit?«
»Er lebt noch immer in seiner Welt aus Naziparolen und will nicht wahrhaben, dass das Dritte Reich längst Vergangenheit ist.«
»Das sind harte Worte. Hassen Sie Ihren Vater?«
»Nein, ich liebe ihn, denn er ist mein Vater. Aber ich respektiere ihn nicht.«
»Wie müsste er denn sein, um Ihren Respekt zu verdienen?«
»Haben Sie einen Sohn?«
Überrascht hob von Settler die Brauen.
»Nein. Ich habe keine Kinder«, antwortete er. »Für eine Ehe hatte ich nie die Zeit. Die Kriege und das Unternehmen haben meine ganze Aufmerksamkeit gefordert. Aber was hat das mit meiner Frage zu tun, von Keipen?«
»Sie würde ich bestimmt respektieren.«
»Das ist ja interessant. Und was genau an mir ist es, das Sie nach so kurzer Zeit zu dieser Auffassung gelangen lässt?«
»Ich traue Ihnen zu, dass Sie Ihr Ziel erreichen.«
»Bedeutet das, dass Sie sich unserer Sache anschließen werden?«
»Ja, das werde ich.« Friedrichs Antwort klang bestimmt, ohne den Anflug eines Zweifels.
»Welche Gründe haben Sie noch für diesen Schritt, der Ihr Leben endgültig verändern wird?«, wollte von Settler wissen.
»Mein Leben hat sich schon endgültig verändert, als ich hier angekommen bin.«
»Hm. Was meinen Sie damit?«
»Ich möchte am Leben bleiben«, erwiderte Friedrich ruhig.
Von Settler lachte überrascht auf.
»Ha! Was soll das denn heißen?«
Nun schlug der Junge doch die Augen nieder. Nur ganz kurz, dann sah er seinem Gegenüber wieder tief in die Augen. Seine Stimme klang absolut sachlich, als er antwortete: »Was Sie uns heute Vormittag erzählt haben, kann nur funktionieren, wenn kein Wort davon nach außen dringt. Wenn es Ihnen ernst ist mit Ihrer Sache, können Sie das Risiko nicht eingehen, einen Vierzehnjährigen mit diesem Wissen einfach so nach Hause gehen zu lassen.«
Sekundenlang sahen sie sich schweigend an, als wollten sie testen, wer dem Blick des anderen länger standhielt. Dann lächelte von Settler.
»Von Keipen, Sie sind ein bemerkenswerter junger Mann … Was natürlich nicht heißen soll, dass Sie recht haben mit Ihren Theorien. Wir sind schließlich keine Bande von Kindermördern.«
Er griff nach Friedrichs Akte und schlug sie auf. Beim Durchblättern hielt er sie so, dass der Junge den Inhalt nicht sehen konnte.
»Sie werden von Ihren Lehrern in Deutschland als außergewöhnlich intelligent beschrieben. Weiter lese ich hier aber, dass Sie ein sehr schwieriger junger Mann sein sollen. Ein verschlossener Einzelgänger, der keinerlei Freunde hat. Sind Sie sicher, dass Sie bei uns zurechtkommen werden?«
Der Junge nickte, ohne eine Miene zu verziehen.
»Ich werde mitmachen. Wo muss ich unterschreiben?«
Von Settler musterte ihn einige Sekunden nachdenklich und warf dann die Akte wieder auf den Schreibtisch. »Heben Sie die rechte Hand und sprechen Sie mir nach …«
Als Friedrichs »Begleiter« wenig später den Raum betrat, sagte von Settler: »Keine weiteren Gespräche mehr heute. Wir machen morgen früh um acht Uhr weiter.«
Nachdem sich die Tür hinter den beiden geschlossen hatte, schlug er eine neue Seite in seinem braunen Büchlein auf und schrieb in großen Buchstaben »Friedrich von Keipen« auf die Mitte der Seite. Dahinter setzte er drei dicke Ausrufezeichen. Dann klappte er das Buch zu, lehnte sich zurück und starrte auf den Schreibtisch.
Du bist es, Friedrich von Keipen. Ich spüre es genau!
Mit einem zufriedenen Lächeln stand er auf und verließ den Raum.
Nur einer der Jungen, mit denen er sich am nächsten Tag unterhielt, wollte lieber wieder nach Hause zu seinen Eltern und später Tierarzt werden. Von Settler zeigte sich verständnisvoll und versprach, sich sofort um seine Heimreise zu kümmern.
Am Abend erhielt Oberst a. D. Johannes Gerber in seiner von den Bombenangriffen verschont gebliebenen Villa am Stadtrand von Köln einen Anruf aus Südafrika, in dem ihm mit großem Bedauern mitgeteilt wurde, dass sein Sohn bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen sei.
Den Mittwochmorgen verbrachten die Jungen damit, sich das riesige Anwesen anzusehen.
Von seinem »Begleiter« erfuhr Friedrich, dass die Familie von Settler durch den Diamantenhandel zu Vermögen gekommen war. Hermann von Settlers Großvater war mit Frau und Kind – Hermanns Vater war damals vier Jahre alt – 1872 aus Deutschland nach Kimberley gekommen, nachdem dort die ersten Diamanten gefunden worden waren. So wie Tausende Glücksritter aus allen Teilen der Welt wollte Wilhelm von Settler ein Stück von dem wertvollen Kuchen erhaschen. Anders jedoch als die meisten der Abenteurer wühlte er nicht in dem staubigen Boden. Er baute sein Zelt auf und wartete. Entdeckte jemand ein paar der kostbaren Steine, war er sofort zur Stelle und kaufte sie ihm ab. Die meisten der abgerissenen Gestalten hatten keine Vorstellung davon, was ihr Fund wirklich wert war. So kaufte er die Diamanten anfangs zu unglaublich günstigen Preisen und verkaufte sie teuer weiter. Schon nach wenigen Monaten hatte er mehr verdient als jeder der Männer, die sechzehn Stunden am Tag die Erde abtrugen. Damit hatte er den Grundstock zu dem Reichtum gelegt, den er und sein einziger Sohn, Hermanns Vater, danach ständig vergrößert hatten.
Letzterer heiratete in jungen Jahren ein deutsches Mädchen aus preußischem Hause. Doch die Ehe sollte nicht lange währen. Nachdem die junge Frau zunächst eine Tochter zur Welt gebracht hatte, war sie nach Hermanns Geburt im Wochenbett gestorben, und die älteren der überwiegend schwarzen Angestellten glaubten zu wissen, dass Hermanns Vater den Jungen insgeheim dafür verantwortlich gemacht hatte. Nach einer Kindheit ohne Liebe und Geborgenheit war Hermann 1909 zu seinem Onkel mütterlicherseits nach Deutschland geschickt worden, wo er bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Alter von siebzehn Jahren sein Abitur machte und dann in die Armee eintrat. Im Dienstgrad eines Hauptmanns kehrte er nach Kriegsende 1918 in den Zivilstand zurück und begann mit dem Studium an der Humboldt-Universität in Berlin. Was genau er studiert hatte, wusste niemand, aber es hatte wohl »irgendetwas mit Politik« zu tun.
1922 starb sein Vater, erst 54-jährig, an einem Herzanfall. Hermann kehrte nach Südafrika zurück und übernahm die Leitung des Familienunternehmens. Er regierte die Firma mit harter Hand und war bei den Angestellten gefürchtet. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise 1929 und aufgrund weiterer Diamantenfunde in Australien, Indien und Kanada fiel der Preis der Rohdiamanten auf dem Weltmarkt zwar immer mehr, dennoch wuchs das Vermögen, das der Familienpatriarch von Settler angehäuft hatte, trotz verringerter Gewinnspannen immer weiter an. Als in den Dreißigern der Nationalsozialismus in Deutschland triumphierte, übergab Hermann von Settler die Führung des Unternehmens seiner zwei Jahre älteren Schwester Hedwig und trat in Deutschland der NSDAP bei.
1945, unmittelbar nach Kriegsende, tauchte er, begleitet von acht zwielichtigen Gestalten, plötzlich wieder in Kimberley auf. Seine Schwester war wenige Wochen zuvor in einem Internierungslager in der Nähe von Pretoria an einer Lungenentzündung gestorben. Dorthin hatte man sie zusammen mit vielen anderen Deutschen gebracht, nachdem sich das südafrikanische Parlament 1939 mit knapper Mehrheit gegen die Neutralität des Landes und für die Kriegsteilnahme auf der Seite Großbritanniens entschieden hatte. Das von Settler’sche Anwesen hatte zwar inzwischen etwas an Glanz eingebüßt, aber dank der guten Beziehungen der Familie zu den höchsten wirtschaftlichen und politischen Stellen Südafrikas waren sie nicht enteignet worden, sodass Hermann das Unternehmen unbesorgt weiterführen konnte.
Ein paar Monate später rekrutierte er etwa dreißig junge Männer, alle deutscher Abstammung. Niemand erfuhr, welche Aufgaben sie hatten. Sie trugen khakifarbene Uniformen und waren tagsüber meist verschwunden. Wenn sie gegen Abend wieder auf dem Anwesen auftauchten, waren sie schmutzig und sahen müde aus. Mit der Zeit gewöhnten sich die anderen Angestellten an die schattenhaften Gestalten, deren Anzahl stetig wuchs. Einige Monate, bevor die fünfzig Jungen aus Deutschland kamen, waren die Männer plötzlich auch tagsüber auf dem Anwesen, richteten in dem Haus für die Bediensteten zusätzliche Zimmer ein und zogen neben dem Haupthaus ein neues Gebäude hoch, das aus einem einzigen großen Saal bestand. In diesem Saal hatten die Jungen Hermann von Settlers Ansprache gelauscht.
In den folgenden Tagen lernten die Jungen sich ein wenig kennen. Schnell bildeten sich einzelne Gruppen, deren Mitglieder viel Zeit miteinander verbrachten. Zu diesen Gruppen gehörten automatisch auch die ständigen »Begleiter« der Jungen. Die Männer waren allgegenwärtig, gaben sich betont locker und hatten immer Zugang zu allem, was ein jugendliches Herz begehrte. Bereitwillig besorgten und verteilten sie die begehrten Zigaretten. Bei Fragen über die Bruderschaft zeigten sie sich allerdings verschlossen. Die stereotype Antwort war stets dieselbe: »Bald werdet ihr von euren Lehrern alles erfahren, was ihr wissen müsst.« Was die Jungen nicht wissen mussten: Gelegentlich verschwand einer der Männer unbemerkt und saß Minuten später Hermann von Settler gegenüber, um ihm Bericht zu erstatten.
Friedrich gehörte als Einziger keiner dieser Gruppen an. Nicht, dass ihn niemand dabeihaben wollte. Ganz im Gegenteil: Er war von fast allen angesprochen worden, doch dieses oder jenes mit ihnen zu unternehmen. Er lehnte jedoch jedes Mal freundlich, aber bestimmt ab, sodass er schon nach drei Tagen den Ruf eines geheimnisvollen Einzelgängers hatte.
Friedrich verbrachte seine Zeit größtenteils mit Hans, dem ihm zugeteilten Uniformierten. Der Mann hatte, wie die meisten seiner Kollegen, im Krieg unter Hermann von Settler gedient. Oft saßen sie stundenlang im Schatten eines Baumes und unterhielten sich über Deutschland und den vergangenen Krieg, wobei dem Vierzehnjährigen schon nach relativ kurzer Zeit klar war, dass er Hans geistig überlegen war. Friedrich verstand es während dieser Gespräche immer wieder, dem Mann durch geschickte indirekte Fragen wichtige Informationen zu entlocken.
So auch in den frühen Abendstunden des Freitags, als sie mit einem Glas hausgemachter Orangenlimonade auf den Treppenstufen des Haupthauses saßen.
»Wenn mir vor ein paar Tagen jemand erzählt hätte, ich würde später Theologie studieren, hätte ich ihn bestimmt für verrückt erklärt. Aber es ist ebenso verrückt zu denken, eine Handvoll junger Männer mit gutem Abitur und vielleicht auch einem guten Theologiestudium würden genügen, um das Machtgefüge innerhalb der katholischen Kirche umzugestalten.«
Hans lächelte wissend. »Wer sagt denn, dass es bei einer Handvoll junger Männer bleibt? Ihr seid fünfzig, halt, neunundvierzig, und in einem halben Jahr werden die nächsten fünfzig kommen und wieder ein halbes Jahr später …« Er verstummte abrupt und blickte in das grinsende Gesicht des Vierzehnjährigen. »Das hast du nicht gehört«, sagte er scharf. »Wenn Herr von Settler wüsste, dass ich …«
Friedrich klopfte ihm beruhigend auf die Schulter. »Schon gut, Hans. Ich werde den anderen bestimmt nichts verraten … Wir werden also eine ganze Armee sein.«
»Ganz recht, Sie neugieriger junger Mann. Sie werden Teil einer ganzen Armee sein. Der Armee der Simoner.«
Friedrich wusste sofort, wem die Stimme hinter ihnen gehörte. Hans sprang erschrocken auf.
»Herr von Settler, ich wollte nicht, ich meine …«
»Ist schon gut, Hans. Ich denke, ich werde mich etwas mit Herrn von Keipen unterhalten. Vielleicht kann ich seinen Wissensdurst ja ein wenig befriedigen.«
»Jawoll, Herr von Settler!«
Hans grüßte in strammer Haltung, drehte sich mit Schwung um und marschierte in Richtung der Unterkünfte davon.
Von Settler setzte sich neben Friedrich, der ruhig einen Schluck aus seinem Glas trank, und ließ seinen Blick über das weite, freie Gelände schweifen, das etwa fünfzig Meter hinter den Unterkünften begann. Die Sonne ging so schnell unter, dass man die Bewegung zu sehen glaubte. Es schien, als ergieße sie sich in einem Wasserfall über den Horizont und überziehe ihn mit einem gleichmäßigen, orangeroten Dunst.
Ohne den Blick von dem Schauspiel abzuwenden, sagte von Settler: »Meine Kindheit ist schon so lange her. Hat man als junger Mensch schon ein Gefühl für die Schönheit der Natur?«
Friedrich sah ihn ernst an. »Meine Kindheit ist auch schon lange her, Herr von Settler.«
Der Blick des Älteren riss sich vom Horizont los. Lange sahen sie sich stumm an, dann nickte von Settler.
»Friedrich – du erlaubst doch, dass ich dich so nenne?« Der Junge nickte gleichgültig. »Das ist gut. Ich habe das Gefühl, dass wir noch viel Zeit miteinander verbringen und gute Freunde werden.« Wenn er auf eine Reaktion gehofft hatte, sah er sich getäuscht. Friedrich blickte ihn weiter mit unbewegter Miene an. »Morgen werdet ihr eure Lehrer kennenlernen. Es sind Männer und Frauen, denen es genau wie mir unmöglich ist, in einem besiegten und vom Wohlwollen der Alliierten und der Sowjets abhängigen Deutschland zu leben. Sie werden euch zu einem anständigen Abitur führen und gleichzeitig mit unseren Idealen vertraut machen. Durch sie werdet ihr den tieferen Sinn dessen erkennen, was wir hier tun. Wie Hans dir schon erzählt hat, werden wir im Abstand von sechs Monaten neue Klassen einrichten. Unser Ziel ist es, in den nächsten fünf Jahren die Anzahl unserer Schüler auf dreihundert zu erhöhen.«
Friedrich runzelte die Stirn. Diese Zahlen passten nicht zusammen.
»Fünfzig pro Halbjahr. Das wären aber in fünf Jahren fünfhundert«, widersprach er, sichtlich irritiert.
Von Settler schüttelte bekümmert den Kopf. »Davon können wir leider nicht ausgehen. Jetzt, so kurz nach Kriegsende, ist die Zahl derer, die ihre Söhne zu uns schicken, noch groß. Das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Die alten Ideale und die Schmach des verlorenen Krieges werden in Vergessenheit geraten. Wenn wir in drei, vier Jahren noch zwanzig neue Schüler pro Halbjahr dazubekommen, können wir zufrieden sein.«
Friedrich betrachtete nachdenklich das Glas, das er mit beiden Händen umschlossen hielt, und blickte den Älteren dann interessiert an.
»Die neue Schule, die Lehrer, die ganzen Angestellten – das kostet doch ein Vermögen. Haben Sie so viel Geld?«
Nun war es an von Settler, kurz innezuhalten.
Wie viel kann ich dir jetzt schon verraten, mein Junge?