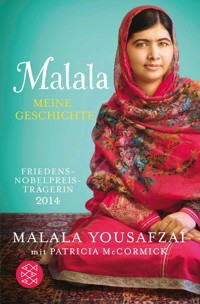
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Malalas Schicksal bewegt die Welt Malala war fünfzehn, als ihr Terroristen auf dem Schulweg in den Kopf schossen. Sie überlebte den Anschlag schwer verletzt, doch aufgegeben hat sie nicht. Sie setzt ihren Kampf für Bildung unermüdlich fort und ist damit zum Vorbild vieler Jugendlicher auf der ganzen Welt geworden. In einer einzigartigen Zusammenarbeit mit Bestsellerautorin Patricia McCormick gelingt es Malala auf höchst bewegende Weise und anhand vieler persönlicher Fotos und Dokumente, ihren jungen Lesern ein authentisches Bild von ihrem Leben und den Ereignissen in Pakistan zu vermitteln. Sie erzählt von ihrer Schulzeit und ihren Freundinnen, davon, wie die Anfeindungen der Extremisten täglich zunahmen, wie sie Widerstand leistete und ihr Leben dadurch eine tragische Wendung nahm. Für ihren Mut und Einsatz erhielt Malala den Friedensnobelpreis. Malalas Geschichte von ihr selbst für junge Leser erzählt – mit vielen Fotos, Karten, Glossar und einer Zeittafel Mit einem zusätzlichen Epilog - Die Besten 7 Bücher für junge Leser (Dezember 2014) - Nominiert für den Children's Choice Book Award 2015 (Kategorie: Teen Book of the Year)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Malala Yousafzai | Patricia McCormick
Malala. Meine Geschichte
Über dieses Buch
»Ich bin Malala – und dies ist meine Geschichte«
Als die Taliban die Macht in Pakistan übernahmen, sollten Mädchen nicht mehr zur Schule gehen. Doch Malala ließ sich nicht einschüchtern und kämpfte für ihr Recht auf Bildung.
Am 9. Oktober 2012 schossen ihr Terroristen in den Kopf, als sie auf dem Weg von der Schule nach Hause war. Sie überlebte den Anschlag schwer verletzt, doch aufgegeben hat
sie nicht – im Gegenteil: Sie ist zu einer Symbolfigur für den Frieden und zum Vorbild vieler Jugendlicher auf der ganzen Welt geworden.
Zusammen mit Bestsellerautorin Patricia McCormick erzählt Malala von den Ereignissen in Pakistan – von Schulzeit, Freundinnen und zunehmenden Anfeindungen der Extremisten,
von ihrem Widerstand und wie ihr Leben dadurch eine tragische Wendung nahm.
Mit vielen persönlichen Fotos, Landkarten, Glossar und einer Zeittafel
»Das Wichtigste jedoch: Die Leser – egal welchen Alters – sehen die schönen und schrecklichen Ereignisse im Leben Malalas immer auf Augenhöhe der jungen Erzählerin.«
Süddeutsche Zeitung
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch
Biografie
((keine Vita vorne, da hinten Teil des Buches, stattdessen im Print auf Seite 2 der Vermerk zum Unterrichtsmaterial sowie folgende Zitate:))
Für die Verwendung in der Schule ist unter
https://www.fischerverlage.de/verlag/kita-und-schule/unterrichtsmaterialien
ein Unterrichtsmodell zu diesem Buch kostenlos abrufbar.
»Ein gelungener Einstieg, um sich mit der Biografie eines der bewundernswerten, mutigen Mädchen zu beschäftigen.«
Eselsohr, November 2014
»Unbedingt lesen!«
Mädchen, Oktober 2014
»Diese Biographie ein Muss für jeden, ob alt oder jung.«
Literatwo, 29.10.2014
Inhalt
Widmung
Karte
PROLOG
TEIL EINS
1 Frei wie ein Vogel
2 Träume
3 Ein magischer Bleistift
4 Eine Warnung Gottes
5 Die erste direkte Drohung
TEIL ZWEI
6 Der Radio-Mullah
7 Die Taliban im Swat-Tal
8 Niemand ist sicher
9 Bonbons vom Himmel
10 2008: Wie der Terrorismus sich anfühlt
TEIL DREI
11 Die Chance zu sprechen
12 Das Tagebuch einer Schülerin
13 Der letzte Schultag
14 Die geheime Schule
15 Frieden?
16 Vertrieben
17 Wieder zu Hause
18 Eine bescheidene Bitte und ein seltsamer Frieden
19 Endlich gute Nachrichten
TEIL VIER
20 Eine Morddrohung
21 Das Versprechen des Frühlings
22 Vorzeichen
23 Ein Tag wie jeder andere
TEIL FÜNF
24 Ein Ort namens Birmingham
25 Probleme, Lösungen
26 Hundert Fragen
27 Die Zeit vertreiben
28 Wieder zusammen
29 Die Leerstellen füllen sich
30 Nachrichten aus aller Welt
31 Ein bittersüßer Tag
32 Wunder
33 Der neue Ort
34 Was wir alle wissen
35 Jahrestag
36 Ein Mädchen von vielen
Bildteil
Epilog Oktober 2015
DANKSAGUNG
FOTONACHWEISE
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
GLOSSAR
WICHTIGE EREIGNISSE IN PAKISTAN UND IM SWAT-TAL
DIE MALALA-STIFTUNG
ÜBER DIE AUTORINNEN
Für alle Kinder auf der ganzen Welt, die nicht in die Schule gehen können. Für alle Lehrer, die trotz großer Widerstände den Mut haben, zu unterrichten. Und für alle, die für ihre Menschenrechte und ihr Recht auf Bildung kämpfen.
Karte: © by John Gilkes
PROLOG
Wenn ich die Augen schließe, sehe ich mein Zimmer. Das Bett ist noch nicht gemacht, meine weiche Decke zu einem unordentlichen Haufen aufgetürmt, weil ich mich beeilen musste, um nicht zu spät zur Schule zu kommen. Wir schreiben eine Klassenarbeit. Mein Terminkalender liegt aufgeschlagen auf dem Schreibtisch und zeigt den 9. Oktober 2012. Und an einem Haken an der Wand hängen der weiße Shalwar und der blaue Kamiz, meine Schuluniform, die auf mich wartet.
Ich höre die Nachbarskinder, die in der Gasse hinter unserem Haus Kricket spielen. Ich höre die gedämpften Geräusche des Basars, der ganz in der Nähe ist. Und wenn ich aufmerksam lausche, kann ich Safina hören, meine Freundin nebenan, die gegen die Wand zwischen unseren Zimmern klopft, um mir ein Geheimnis zu verraten.
Ich rieche den Reis, den meine Mutter in der Küche zubereitet. Ich höre, wie sich meine kleinen Brüder um die Fernbedienung streiten – der Fernseher springt mehrmals zwischen einer Wrestling-Show und einer Zeichentricksendung hin und her. Bald schon werde ich die tiefe Stimme meines Vaters hören, der mich bei meinem Kosenamen ruft.
»Jani«, wird er sagen, das persische Wort für »Liebes«, »wie läuft es in der Schule?«
Er fragt mich nach der Khushal-Schule, die er gegründet hat und leitet, und deren Schülerin ich bin. Ich mache mir immer einen Spaß daraus, die Frage wörtlich zu nehmen.
»Aba«, scherze ich, »es läuft nicht, es geht!« Das ist meine Art, ihm zu sagen, dass man noch einige Dinge verbessern könnte.
Eines Morgens verließ ich dieses geliebte Zuhause in Pakistan, mit dem Plan, wieder unter die Decke zu schlüpfen, sobald die Schule aus sein würde – und landete am anderen Ende der Welt.
Einige Leute sagen, dass es zu gefährlich für mich ist, zurückzukehren. Sie sagen, dass ich nie wieder heimkehren kann. Und deshalb fliege ich von Zeit zu Zeit in Gedanken dorthin.
Jetzt lebt in unserem Zuhause eine andere Familie, ein anderes Mädchen schläft in meinem Bett. Und ich bin Tausende Kilometer entfernt. Die meisten Dinge in meinem früheren Zimmer sind mir egal, aber um die Schulpokale auf meinem Bücherregal mache ich mir Sorgen. Manchmal träume ich sogar von ihnen. Da ist zum Beispiel der Pokal für den zweiten Platz in meinem allerersten Redewettbewerb. Und da sind die über vierzig Goldmedaillen und Pokale dafür, dass ich die Klassenbeste gewesen war oder den ersten Preis in Debatten und Wettbewerben gewonnen hatte. Jemand anderem mögen sie wie Plastikbecher vorkommen. Für jemand anderen sind sie nichts weiter als Belohnungen für gute Noten. Aber für mich sind sie Erinnerungen an das Leben, das ich liebte, und an das Mädchen, das ich war, bevor ich an jenem schicksalhaften Tag das Haus verließ.
Wenn ich die Augen öffne, sehe ich mein neues Zimmer. Es befindet sich in einem klotzigen Backsteinhaus hinter einem Tor in einer feuchten und kalten Stadt namens Birmingham in England. Hier gibt es fließendes Wasser aus einem Wasserhahn, heiß und kalt, ganz nach Belieben. Es ist nicht nötig, Gasflaschen auf dem Basar zu kaufen und nach Hause zu tragen, um Wasser zu kochen. Hier gibt es große Räume mit glänzenden Holzböden, in denen wuchtige Möbel und ein großer Fernseher stehen.
In dieser stillen, grünen Gegend hört man kaum einen Laut. Keine Kinder, die lachen oder schreien. Keine Frauen, die in der Küche im Erdgeschoss sitzen, Gemüse schnippeln und mit meiner Mutter schwatzen. Keine Männer, die Zigaretten rauchen und über Politik reden. Aber manchmal höre ich trotz der dicken Mauern zwischen den Zimmern, wie jemand aus meiner Familie vor Heimweh weint. Doch dann stürmt mein Vater durch die Haustür und ruft mit lauter Stimme: »Jani! Wie war es in der Schule?«
Jetzt gibt es bei dieser Frage kein Wortspiel mehr. Er fragt nicht mehr nach der Schule, die er leitet. Und in seiner Stimme liegt Sorge, als ob er Angst hat, ich könnte nicht da sein, um ihm zu antworten. Denn es ist noch gar nicht lange her, da wäre ich beinahe getötet worden – nur weil ich mein Recht einforderte, in die Schule zu gehen.
Es war ein ganz gewöhnlicher Tag. Ich war 15 Jahre alt, ging in die neunte Klasse, und am Abend zuvor war ich viel zu lange aufgeblieben, um für meine Klassenarbeit zu lernen.
Ich hatte den Hahn krähen gehört, der die Morgendämmerung ankündigte, doch dann war ich wieder eingeschlafen. Ich hatte gehört, wie von der nahe gelegenen Moschee zum Morgengebet gerufen wurde, und hatte mir die Decke über den Kopf gezogen. Und dann hatte ich so getan, als ob ich meinen Vater nicht hören würde, der in mein Zimmer gekommen war, um mich zu wecken.
Schließlich kam meine Mutter und rüttelte mich sanft an der Schulter.
»Wach auf, Pisho«, sagte sie. Das war ihr Kosename für mich, er bedeutet »Kätzchen« auf Paschtu, der Sprache der Paschtunen. »Es ist halb acht. Du kommst noch zu spät zur Schule!«
Heute war die Klassenarbeit in Urdu, der Amtssprache in Pakistan. Ich sprach rasch ein Gebet zu Gott.
»Wenn es dein Wille ist, darf ich dann bitte Erste sein?«, flüsterte ich. »Oh, und danke, dass ich bislang so erfolgreich war.«
Ich schlang einige Bissen Rührei und Chapati hinunter und spülte mit Tee nach. Mein zehnjähriger Bruder Atal war an diesem Morgen besonders frech und beklagte sich über die ganze Aufmerksamkeit, die mir die Medien wegen meiner Rede über das Recht von Mädchen auf Bildung widmeten. Mein Vater neckte ihn während des Frühstücks.
»Wenn Malala eines Tages Premierministerin ist, kannst du ihr Sekretär sein«, sagte er.
Atal, unser kleiner Familienclown, tat so, als sei er wütend.
»Nein!«, schrie er. »Sie wird meine Sekretärin!«
All die Scherze sorgten dafür, dass ich spät dran war, und ich stürmte zur Tür hinaus. Mein halb aufgegessenes Frühstück stand immer noch auf dem Tisch. Ich rannte die Gasse hinunter und sah den Schulbus, in dem sich die anderen Mädchen drängten, die ebenfalls zur Schule wollten. Ich sprang hinein und schaute nicht zurück.
Der Weg zur Schule war kurz, nur fünf Minuten die Straße hinauf und eine kurze Strecke am Fluss entlang. Ich kam pünktlich, und der Tag der Klassenarbeit verlief wie jeder andere auch. Der Lärm der Stadt, das Hupkonzert und die Geräusche aus den Fabriken von Mingora umgaben uns, während wir uns still und konzentriert über unsere Arbeitsblätter beugten. Am Ende des Tages war ich müde, aber glücklich. Ich wusste, dass ich eine gute Leistung abgeliefert hatte.
»Lass uns den späteren Bus nehmen, ja?«, sagte Moniba, meine beste Freundin. »Dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten.« Wir ließen uns nach der Schule gerne noch Zeit.
Schon seit Tagen hatte ich eine merkwürdige, nagende Ahnung, dass etwas Schlimmes passieren würde. Eines Abends hatte ich über den Tod nachgedacht. Ich wollte wissen, wie es ist, tot zu sein. Ich war allein in meinem Zimmer, also wandte ich mich gen Mekka und fragte Gott.
»Was passiert, wenn man stirbt?«, fragte ich. »Wie fühlt es sich an?«
Wenn ich sterben sollte, würde ich den Menschen gerne beschreiben können, wie es sich anfühlt.
»Malala, du Dummkopf«, sagte ich zu mir selbst. »Du wärst ja tot und könntest nicht erzählen, wie es ist.«
Bevor ich ins Bett ging, richtete ich eine weitere Bitte an Gott. »Kann ich ein bisschen sterben und zurückkommen, um den anderen zu sagen, wie es ist?«
Aber der nächste Tag war hell und sonnig, ebenso der danach. Und jetzt hatte ich eine gute Arbeit geschrieben. Die Wolke, die über mir gehangen hatte, war fort. Deshalb taten Moniba und ich das, was wir immer taten: Wir schwatzten. Wir sprachen darüber, welche Gesichtscreme sie benutzte und ob einer unserer Lehrer wohl ein Mittel gegen Haarausfall verwendete. Und jetzt, da die Klassenarbeit vorbei war, fragten wir uns, wie schwierig die nächste sein würde.
Als unser Bus kam, rannten wir die Treppe hinunter. Wie üblich bedeckten die anderen Mädchen ihre Köpfe und Gesichter, ehe sie aus dem Tor traten und in den wartenden Dyna einstiegen, den weißen Pick-up, der unser »Schulbus« war. Und wie üblich zeigte uns der Busfahrer einen Zaubertrick. An diesem Tag ließ er einen Kieselstein verschwinden. So sehr wir uns auch bemühten, wir kamen nicht dahinter, wie er es angestellt hatte.
Im Bus war es brechend voll. Zwanzig Mädchen und zwei Lehrerinnen drängten sich in dem Wagen, in dem es ganze drei Sitzreihen gab. Es war heiß und stickig, und es gab keine Fenster, bloß gelbe Plastikplanen, die gegen die Seitenwände klatschten, während der Bus über die vom Feierabendverkehr überfüllten Straßen von Mingora holperte.
In der Haji-Baba-Straße herrschte ein Gewimmel aus bunten Rikschas, Frauen in wehenden Gewändern und Männern auf Motorrollern, die sich hupend und im Zickzack einen Weg durch den Verkehr bahnten. Wir kamen an einem Metzger vorbei, der Hühner schlachtete, an einem Jungen auf einem Fahrrad, der Eistüten verkaufte. An einer Werbetafel für Dr. Humayuns Institut für Haartransplantation. Moniba und ich waren ins Gespräch vertieft. Ich hatte viele Freunde, aber sie war meine beste Freundin, meine Seelenverwandte, der ich alle Geheimnisse anvertraute. Wir spekulierten gerade darüber, wer von uns in diesem Halbjahr die besten Noten bekommen würde, als eins der Mädchen ein Lied anstimmte. Wir anderen fielen ein.
Als wir an der »Little Giant’s«-Süßigkeitenfabrik an der Kreuzung vorbeigekommen waren, nur drei Minuten von meinem Zuhause entfernt, wurde es auf der Straße seltsam still. Der Bus hielt an.
»Es ist so ruhig heute«, sagte ich zu Moniba. »Wo sind die ganzen Leute?«
Ich erinnere mich nicht, was dann passierte. Aber so wurde es mir erzählt: Zwei Männer in weißen Gewändern traten vor unseren Bus.
»Ist das der Schulbus der Khushal-Schule?«, fragte einer der beiden.
Der Fahrer lachte. Der Name der Schule stand in großen schwarzen Buchstaben auf der Seite des Wagens.
Der andere junge Mann sprang hinten auf die Ladeklappe und beugte sich in den Bus.
»Wer ist Malala?«, fragte er.
Niemand sagte ein Wort, doch einige Mädchen sahen in meine Richtung. Er hob den Arm und zeigte auf mich. Ein paar Mädchen schrien. Ich drückte Monibas Hand.
Wer ist Malala? Ich bin Malala, und dies ist meine Geschichte.
TEIL EINS
Vor den Taliban
1 Frei wie ein Vogel
Ich bin Malala, ein Mädchen wie jedes andere – obwohl ich einige besondere Fähigkeiten habe.
Ich bin sehr gelenkig und kann meine Finger- und Zehenknöchel nach Belieben knacken lassen. (Und ich liebe es, wenn die Leute bei dem Geräusch das Gesicht verziehen.) Ich kann jemanden, der doppelt so alt ist wie ich, beim Armdrücken besiegen. Ich mag Cupcakes, aber keine Bonbons. Und ich finde, dunkle Schokolade hat die Bezeichnung »Schokolade« eigentlich gar nicht verdient. Ich hasse Auberginen und grüne Paprika, aber ich liebe Pizza. Ich finde, Bella aus der Twilight-Saga weiß nicht, was sie will, und ich verstehe nicht, was sie an diesem Langweiler Edward findet. Er ist nicht der Typ, der ein Mädchen auf Händen trägt, wie wir in Pakistan sagen würden.
Ich mache mir nicht viel aus Make-up und Schmuck, und ich bin kein Girlie. Aber meine Lieblingsfarbe ist rosa, und ich muss zugeben, dass ich früher viel Zeit vor dem Spiegel verbracht habe und mit meinen Haaren spielte. Und als ich jünger war, versuchte ich, meine Haut mit Honig, Rosenwasser und Büffelmilch aufzuhellen. (Wenn man sich Milch ins Gesicht schmiert, riecht das nicht gerade angenehm.)
Ich sage, wenn du in den Rucksack eines Jungen schaust, wirst du immer Chaos vorfinden. Und wenn du seine Schuluniform ansiehst, wirst du immer Schmutzflecken entdecken. Das ist kein Vorurteil. Das ist eine Tatsache.
Ich gehöre zu den Paschtunen, einem stolzen Volk, das in Afghanistan und Pakistan beheimatet ist. Mein Vater, Ziauddin, und meine Mutter, Toor Pekai, stammen aus Bergdörfern. Nach ihrer Hochzeit zogen sie nach Mingora, die größte Stadt im Swat-Tal im Nordwesten Pakistans, wo ich geboren wurde. Das Tal ist für seine Schönheit bekannt. Früher kamen Touristen von überallher, um die hohen Berge, die saftigen grünen Hügel und die kristallklaren Flüsse zu sehen.
Ich bin nach einer großen Heldin der Paschtunen benannt, nach der jungen Malalai, die ihre Landsleute mit ihrem Mut beeindruckte.
Aber ich glaube nicht ans Kämpfen – auch wenn mir mein vierzehnjähriger Bruder Khushal manchmal unglaublich auf die Nerven geht. Ich kämpfe nicht gegen ihn. Aber er gegen mich. Ich stimme Isaac Newton zu: Jeder Aktion folgt eine Reaktion. Also könnte man sagen, dass ich auf Khushal nur angemessen reagiere, wenn er mit mir streitet. Wir streiten uns wegen der Fernbedienung. Wegen unserer Aufgaben im Haushalt. Darüber, wer von uns beiden besser in der Schule ist. Wer die letzten Käseflips aufgegessen hat. Wegen allem, was man sich vorstellen kann.
Mein zehnjähriger Bruder Atal geht mir bei weitem nicht so auf die Nerven wie Khushal. Außerdem holt er immer den Kricketball, wenn wir ihn aus dem Spielfeld schlagen. Aber manchmal erfindet er seine eigenen Regeln.
Als ich kleiner war und diese Brüder auf der Bildfläche erschienen, habe ich ein Wörtchen mit Gott geredet.
»Gott«, sagte ich, »du hast dich nicht mit mir abgesprochen, bevor du mir diese beiden geschickt hast. Du hast nicht gefragt, was ich davon halte. Sie können ganz schön lästig sein.«
Wenn ich lernen will, machen sie einen fürchterlichen Krach. Und wenn ich mir morgens die Zähne putze, hämmern sie gegen die Badezimmertür. Aber ich habe meinen Frieden mit diesen Brüdern gemacht. Wenigstens können wir zu dritt Kricket spielen.
Zu Hause in Pakistan lebten wir wie wilde Kaninchen: Wir rannten hin und her durch die Gassen rings um unser Haus. Wir spielten Fangen und ein Spiel, das »Mango, Mango« heißt, dann noch eine Art »Himmel-und-Hölle«-Spiel, das wir Chindakh nennen, was »Frosch« bedeutet, und »Räuber und Gendarm«. Aber am liebsten spielten wir Kricket. Tag und Nacht spielten wir Kricket in der Gasse hinter unserem Haus oder auf unserem Dach, das flach war. Wenn wir uns keinen richtigen Kricketball leisten konnten, bastelten wir uns selbst einen: Wir stopften eine alte Socke mit allerlei Müll aus. Und die Krickettore malten wir mit Kreide an die Wand. Weil Atal der Jüngste war, musste er den Ball holen, wenn er vom Dach flog. Manchmal schnappte er sich nicht nur unseren, sondern auch gleich den der Nachbarskinder. Dann grinste er schelmisch und zuckte mit den Schultern.
»Was denn?«, sagte er. »Gestern haben sie unseren Ball genommen!«
So sind Jungs eben. Die meisten sind nicht so zivilisiert wie Mädchen. Wenn ich nicht in Stimmung für ihre Jungenspiele war, ging ich nach unten und klopfte an die Wand, die unser Haus von Safinas Haus trennte. Zweimal klopfen, das war unser Zeichen. Dann klopfte sie zurück, und ich schob den Stein beiseite, der ein Loch zwischen den beiden Häusern verbarg, und wir flüsterten miteinander. Manchmal trafen wir uns bei ihr oder bei mir und schauten unsere Lieblingssendung – Shaka Laka Boom Boom – über einen Jungen mit einem magischen Bleistift. Oder wir bastelten kleine Puppen aus Streichhölzern und Stoffresten.
Safina war meine Freundin, seit ich acht war. Sie ist zwei Jahre jünger als ich, aber wir verstanden uns trotzdem sehr gut. Manchmal machten wir uns gegenseitig nach, aber eines Tages fand ich, dass sie zu weit gegangen war. Mein liebstes Spielzeug – mein einziges –, ein rosafarbenes Handy, das mir mein Vater geschenkt hatte, war verschwunden.
Als ich an diesem Tag zum Spielen zu Safina ging, hatte sie das gleiche Handy! Sie sagte, es gehöre ihr, sie habe es auf dem Basar gekauft. Ich glaubte ihr nicht, und ich war zu wütend, um klar denken zu können. Als sie gerade nicht hinschaute, steckte ich ein Paar ihrer Ohrringe ein. Am nächsten Tag eine Halskette. Ich mochte diese Schmuckstücke nicht einmal, aber ich konnte einfach nicht anders.
Als ich ein paar Tage später nach Hause kam, war meine Mutter so wütend auf mich, dass sie mich nicht einmal anschauen konnte. Sie hatte den gestohlenen Schmuck in meinem Schrank gefunden und ihn zurückgegeben.
»Safina hat mich zuerst bestohlen!«, rief ich. Aber meine Mutter ließ das kalt. »Du bist die Ältere, Malala. Du hättest ihr ein Vorbild sein sollen.«
Voller Scham verzog ich mich in mein Zimmer. Aber am schlimmsten war das Warten auf meinen Vater. Er war mein Held, er war tapfer und hatte feste Prinzipien. Und ich war seine Jani. Er war bestimmt schrecklich enttäuscht von mir.
Doch als er kam, schrie er mich nicht an und er tadelte mich auch nicht. Er wusste, dass ich mir selbst die größten Vorwürfe machte, und sah keinen Grund mehr, mich auszuschimpfen. Stattdessen tröstete er mich, indem er mir erzählte, welche Fehler seine Helden gemacht hatten, als sie Kinder gewesen waren. Helden wie Mahatma Gandhi, der große Pazifist, und Mohammed Ali Jinnah, der Gründer Pakistans. Er zitierte einen Satz aus einer Geschichte, die ihm sein Vater immer erzählt hatte: »Ein Kind ist ein Kind, sogar wenn es ein Prophet ist.«
Ich dachte an den Paschtunwali, die Sammlung von Gesetzen, die das Leben von uns Paschtunen regeln. Ein Teil dieser Gesetze nennt sich Badal – eine Rache-Tradition, bei der eine Kränkung mit einer anderen beantwortet werden und ein Tod auf einen anderen folgen muss, und immer so weiter.
Ich hatte den Geschmack von Rache gekostet. Und er war bitter. Ich schwor mir, dass ich niemals den Badal anwenden würde.
Ich entschuldigte mich bei Safina und ihren Eltern. Ich hoffte, dass auch Safina sich entschuldigen und mir mein Handy zurückgeben würde. Aber sie sagte nichts. Und so schwer es mir auch fiel, meinen Schwur zu halten, so erwähnte ich mein verschwundenes Handy mit keinem Wort.
Es dauerte nicht lange, da hatten Safina und ich uns wieder vertragen und spielten mit den anderen Nachbarskindern unsere Spiele. Wir wohnten zu der Zeit am Rande der Stadt, weit entfernt von der geschäftigen Innenstadt. Hinter unserem Haus lag ein Feld mit geheimnisvollen Ruinen – Statuen von kauernden Löwen, zerbrochene Säulen eines längst zerfallenen Stupa und Hunderte von mächtigen Steinbrocken, die aussahen wie Regenschirme von Riesen. Dort spielten wir im Sommer Parpatuni, ein Versteckspiel. Im Winter bauten wir Schneemänner, bis unsere Mütter uns ins Haus riefen und uns heißen Tee mit Milch und Kardamom zu trinken gaben.
So lange ich denken kann, war unser Haus immer voller Menschen gewesen: Nachbarn, Verwandte und Freunde meines Vaters – und ein nie versiegender Strom von Cousins und Cousinen. Sie kamen aus den Bergen, wo meine Eltern aufgewachsen waren, oder aus der benachbarten Stadt. Auch als wir aus unserem winzigen ersten Haus auszogen und ich mein »eigenes« Zimmer bekam, gehörte es nur selten mir allein. Fast immer schlief die eine oder andere Cousine auf dem Boden. Der wichtigste Teil des Paschtunwali ist die Gastfreundschaft. Ein Paschtune öffnet jedem Gast seine Tür.
Meine Mutter und die anderen Frauen versammelten sich auf der Veranda hinter dem Haus, um zu kochen, zu lachen und über Kleider, Schmuck und die Frauen aus der Nachbarschaft zu reden, während mein Vater mit den Männern im Gästezimmer saß, Tee trank und über Politik redete.
Ich kehrte den Kinderspielen oft den Rücken, schlich mich auf Zehenspitzen durch den Frauenbereich und ging zu den Männern. Was dort geschah, dachte ich, war aufregend und wichtig. Ich wusste nicht, was genau es war, und von Politik verstand ich nichts, aber die gewichtige Männerwelt zog mich an. Ich setzte mich zu Füßen meines Vaters und saugte die Gespräche in mich auf. Ich liebte es, den Männern bei ihren Diskussionen über Politik zuzuhören. Aber am meisten liebte ich es, mich von den Gesprächen über die große Welt jenseits unseres Tals verzaubern zu lassen.
Irgendwann verließ ich das Zimmer wieder und blieb eine Weile bei den Frauen. Ihre Welt sah anders aus und hatte einen anderen Klang. Es waren leise, vertrauliche Gespräche. Manchmal klingendes Glöckchen-Lachen. Manchmal raues, brüllendes Gelächter. Aber das Erstaunlichste war, dass die Frauen ihre Kopftücher und Schleier abgelegt hatten. Ihre langen dunklen Haare und die hübschen Gesichter – geschminkt mit Lippenstift und Henna – waren wunderschön anzuschauen.
Ich kannte diese Frauen schon mein Leben lang, hatte gesehen, wie sie jeden Tag das muslimische Gesetz der Parda befolgten, das besagte, dass Frauen Gesicht und Kopf in der Öffentlichkeit verbergen müssen. Manche, wie meine Mutter, legten sich einfach Tücher über das Gesicht, die man Niqab nennt. Aber andere trugen Burkas, schwarze Gewänder, die den Körper von Kopf bis Fuß verhüllen und nicht einmal die Augen zeigen. Manche trugen sogar schwarze Handschuhe und Socken, damit kein Stückchen Haut zu sehen war. Ich hatte miterlebt, dass von Ehefrauen verlangt wurde, ein paar Schritte hinter ihren Männern zu gehen. Ich hatte gesehen, wie Frauen den Blick senken mussten, wenn sie einem Mann begegneten. Und die älteren Mädchen, die früher unsere Spielkameradinnen gewesen waren, verschwanden hinter Schleiern, sobald sie Teenager wurden.
Aber zu sehen, wie Frauen unbeschwert und ausgelassen miteinander lachten und scherzten – die Gesichter strahlend vor Freiheit –, war eine ganz neue Welt.
Ich bin bei der Küchenarbeit nicht zu gebrauchen; um ehrlich zu sein, versuche ich jedes Mal, mich vor dem Gemüseschnippeln oder dem Abwasch zu drücken. Deshalb blieb ich dort nie besonders lange. Aber wenn ich mich davonmachte, fragte ich mich immer unwillkürlich, wie sich ein Leben im Verborgenen anfühlte.
Unter all diesen Stoffbahnen zu leben kam mir so ungerecht vor – und so unbequem. Deshalb machte ich meinen Eltern schon sehr früh klar, dass – egal, was andere Mädchen taten – ich mich niemals so verhüllen würde. Mein Gesicht war meine Identität. Meine Mutter, die sehr gläubig und traditionell ist, war schockiert. Unsere Verwandten hielten mich für frech. (Einige auch für unhöflich.) Aber mein Vater meinte, ich könne tun, was ich wolle. »Malala darf so frei leben wie ein Vogel«, sagte er zu jedermann.
Und so kehrte ich zu den Kindern zurück. Besonders wenn die Zeit der Drachenflüge kam und die Jungen versuchten, die Schnüre der Flugdrachen der Konkurrenten zu durchschneiden. Es war ein aufregendes Spiel, voller unerwarteter Siege und Niederlagen. Es war wunderschön, aber auch ein bisschen traurig, die hübschen Drachen zu Boden trudeln zu sehen.
Vielleicht lag es daran, dass ich eine Zukunft vor mir sah, in der ich niedergeworfen werden würde wie diese Drachen. Nur weil ich ein Mädchen war. Denn trotz allem, was mein Vater sagte, war mir klar, dass von Safina und mir irgendwann erwartet werden würde, für unsere Brüder zu kochen und zu putzen. Wir durften Ärztinnen werden, denn es wurden weibliche Ärzte gebraucht, die sich um die weiblichen Patienten kümmerten. Aber wir konnten keine Anwältinnen werden, keine Ingenieurinnen, keine Modedesignerinnen oder Künstlerinnen. Nichts von dem, was wir uns erträumten. Und wir würden das Haus nur noch in Begleitung eines männlichen Verwandten verlassen dürfen.
Wenn ich meinen Brüdern zusah, wie sie auf das Dach liefen und ihre Drachen in die Luft warfen, fragte ich mich, wie frei ich sein konnte.
Aber schon damals wusste ich, dass ich der Augenstern meines Vaters war. Eine Seltenheit für ein pakistanisches Mädchen.
Wenn in Pakistan ein Junge geboren wird, ist das ein Grund zum Feiern. Freudenschüsse werden in die Luft abgefeuert. Geschenke werden in die Wiege gelegt. Und der Name des Jungen wird in den Stammbaum eingetragen. Aber wenn ein Mädchen geboren wird, kommt niemand, um zu gratulieren, und die anderen Frauen bedauern die Mutter.
Mein Vater kümmerte sich nicht um diese Gepflogenheiten. Ich habe meinen Namen in strahlend blauer Tinte inmitten der Liste unserer männlichen Verwandten stehen sehen. Es war der erste weibliche Name seit dreihundert Jahren.
Während meiner Kindheit sang er mir immer wieder das Lied über meine berühmte paschtunische Namensgeberin vor. »Oh, Malalai von Maiwand«, sang er. »Erhebe dich und lehre die Paschtunen das Lied der Ehre. Deine liebreizenden Worte lassen die Welt erstrahlen. Ich flehe dich an, erhebe dich.«
Als ich klein war, wusste ich noch nicht, was diese Worte bedeuteten. Als ich älter wurde, verstand ich, dass Malalai eine Heldin und ein Vorbild war. Ich wollte etwas von ihr lernen.
Als ich im Alter von fünf Jahren lesen lernte, prahlte mein Vater vor seinen Freunden. »Schaut euch dieses Mädchen an«, sagte er. »Der Himmel steht ihr offen!« Ich tat so, als machten mich seine Worte verlegen, aber das Lob meines Vaters war mir das Wertvollste auf der Welt.
Auch in anderen Dingen hatte ich es viel besser getroffen als die meisten Mädchen. Mein Vater leitete eine Schule. Es war ein ärmliches Gebäude mit nichts weiter als ein paar Tafeln und Kreide, gleich neben einem stinkenden Fluss. Aber für mich war es das Paradies.
Meine Eltern erzählen immer, dass ich in den leeren Klassenraum tapste und Lehrerin spielte, noch bevor ich überhaupt sprechen konnte. Ich unterrichtete in meiner eigenen Babysprache. Manchmal setzte ich mich zu den älteren Kindern in die Klasse und lauschte ehrfürchtig dem Unterricht. Als ich älter wurde, konnte ich es kaum erwarten, die Uniform der großen Mädchen tragen zu dürfen, in der sie jeden Tag zur Schule kamen: den Shalwar Kamiz – eine lange tiefblaue Tunika und weite weiße Hosen – und ein weißes Kopftuch.
Mein Vater eröffnete die Schule ein Jahr vor meiner Geburt. Er war der Lehrer, Buchhalter, Schulleiter, Hausmeister, Mechaniker und das Mädchen für alles – in einer Person. Er stieg auf die Leiter und wechselte die Glühbirnen und kletterte in den Brunnen, wenn die Pumpe kaputt war. Wenn ich ihn im Brunnenschacht verschwinden sah, fing ich an zu weinen, weil ich dachte, er käme nicht zurück. Damals war ich zu klein, um es zu verstehen, aber heute weiß ich, dass nie genug Geld da war. Wenn die Miete und die Löhne bezahlt waren, blieb nicht mehr viel übrig, um Essen zu kaufen. Dann fiel das Abendbrot spärlich aus. Doch die Schule war der große Traum meines Vaters, und wir waren glücklich, dass dieser Traum Wirklichkeit geworden war.
Als ich endlich auch in die Schule gehen durfte, war ich so aufgeregt, dass ich hätte platzen können. Man könnte sagen, dass ich in einer Schule aufgewachsen bin. Die Schule war meine Welt, und meine Welt war die Schule.
2 Träume
Jeden Frühling und jeden Herbst fuhren wir über die Feiertage des Ramadan
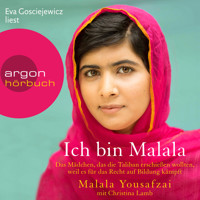
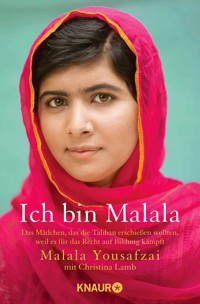
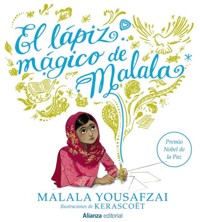
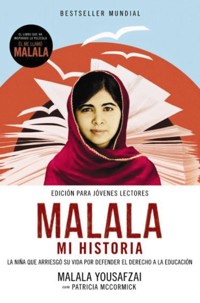
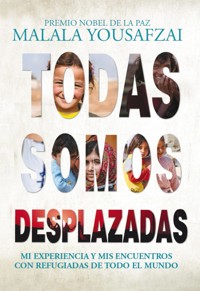
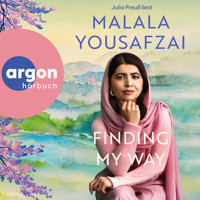













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









