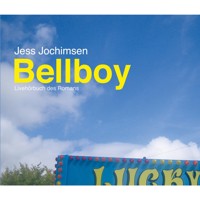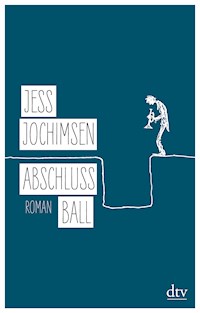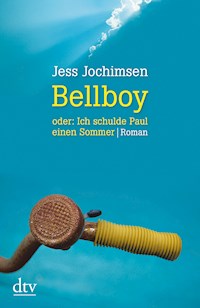7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Eine satirische Reise durch bewegte Zeiten »Ich habe nie kapiert, warum ausgerechnet meine Eltern für die Atomkraftwerke und den Weltfrieden zuständig waren – und das jedes Wochenende.« Zum runden Geburtstag von Protestkultur, antiautoritärer Erziehung und sexueller Revolte bietet dieser Band ein hochkomisches Generationen-Porträt. Versammelt sind die schönsten Geschichten aus Jochimsens Satire-Bestsellern ›Das Dosenmilch-Trauma‹ und ›Flaschendrehen‹.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 205
Ähnliche
Jess Jochimsen
»Mama und Papa hatte ich nicht, ich musste Renate und Eberhard sagen«
Das Dosenmilch-Trauma & andere Geschichten eines 68er-Kindes
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
»… über das Erwachsenwerden in einer Zeit, die man mit billigen Schweizer Plastikuhren misst.«
Schöller & Bacher
»Was sind das für Zeiten, in denen die Eltern ihren Kindern sagen müssen, dass sie spießig sind?«
Ralf Rothmann
Meine Eltern waren Hippies
Meine Eltern waren 68er, und obwohl man das damals noch gar nicht so nannte, war das ausgesprochen hart für mich. Regelrechte Hardcore-Hippies waren sie, mit Flokati auf dem Kopf, Che Guevara in der Küche und Frank Zappa aufm Klo, aber hallo. Sie hörten den ganzen Tag Pink Floyd, da wurdest du blöd in der Birne als Kind. Was für mich allerdings erschwerend dazukam: Meine Eltern sind auch noch Bayern. Bayern und 68er! Das ist eine Kombination, die gibt es eigentlich gar nicht. Man möge sich das bildlich vorstellen, Franz Josef Strauß in Schlaghosen und mit einem Arafat-Schal um den nicht vorhandenen Hals oder auch Stoibers Sturschädel von Dreadlocks bedeckt. Ein Ding der Unmöglichkeit, bayerische 68er, da kreuzen sich bigotte Dumpfheit mit sexueller Revolution, Klerikertum mit K-Gruppe, Pink Floyd mit Volksmusik – wenn die sich vermehren, kann man sich ja vorstellen, was da rauskommt: Das sieht nicht gut aus.
Schon im Mutterleib schwante mir Böses, aber ich war von all den Pülverchen und bewusstseinserweiternden Kräutern, welche meine Mutter zu sich nahm, derart benebelt, dass ich meinen Plan, noch etwas länger im Fruchtwasser zu planschen, nicht verwirklichen konnte und pünktlich nach neun Monaten auf das im Wohnzimmer ausgelegte Tüchersammelsurium schwappte. An sich war das ganz nett, alle waren da, die Oma väterlicherseits, meine Mutter, einige Leute, die ich nicht kannte, und mein Erzeuger. Ich hatte ihn ja nie zuvor gesehen, mir ihn aber in etwa so vorgestellt. Er war groß, an den seltsamsten Stellen mit Haaren bedeckt, ein bisschen abgerissen gekleidet, und er ließ sein donnerndes Lachen erschallen, das ich schon im Ohr hatte. Geburtsschlag erhielt ich keinen (logisch, Pazifisten!), und ich dachte: Wird schon werden. Mein Vater nahm mich auf den Arm und begann mit mir erst mal über die Geburt zu reden, völlig zwanglos führte er mich ins Leben ein:
»Ja, griaß di. Servus in der Welt, Burschi, supa, dass’d da bist. He – kloaner Hos’nscheißer, welcome on örf. Wir müssen da jetza ned das Diskutier’n anfangen, schau’ a mal her: I bin der Eberhard und die, wo da noch so saublöd umanand flackt, des is’ die Renate.«
Was für eine Begrüßung! Es war noch viel schrecklicher, als ich in den dunkelsten embryonalen Stunden befürchtet hatte. Und das Schlimmste war: Ich verstand kein Wort. Das muss man sich mal vorstellen, man wird in diese Welt geworfen und versteht noch nicht einmal die eigenen Eltern – weil die so einen grauenvollen Dialekt sprechen. Die ersten Jahre verlebte ich eher unbewusst, da habe ich summa summarum gar nichts verstanden. Und Mama und Papa hatte ich ja nicht, ich musste immer Renate und Eberhard sagen. In diesem Punkt folgten meine Eltern konsequent den pädagogischen Maximen der frühen 70er-Jahre. Der Eigenname durfte um keinen Preis aufgegeben werden. Nur um das ein für alle Mal klarzustellen: Mama ist für ein Baby wesentlich leichter zu artikulieren als Renate!
Gestillt wurde ich, bis ich acht war, und dann gab’s Körner. Dass ich überhaupt gewachsen bin, darf getrost als Wunder bezeichnet werden. Es handelte sich im Übrigen um Körner, die sich heute in keinem Laden dieser Republik mehr auf legalem Wege erwerben lassen. Garniert wurden diese Verdauungsbremsen mit allerlei Farnen und Moosen, von denen auch nur meine Eltern meinten, dass sie überhaupt essbar waren. Das Grünzeug war selbstredend im eigenen Garten angebaut und ungespritzt. Meine Fresse, das hätte man gar nicht spritzen brauchen, da wäre kein Schädling der Welt freiwillig rangegangen. Alsdann zermanschte derjenige, der laut Kochplan an der Reihe war, das Ganze in einem hölzernen Bottich und verrührte den bizarren Sud in rituellen, kreisenden Bewegungen. Linksdrehend.
Gesalzen wurde nicht. O nein, kein Salz, in den Salinen beutete die herrschende Klasse schließlich die Arbeiter aus, und der Eberhard und die Renate wollten da ein Stück weit schon auch ein Zeichen setzen. Curry gab es ebenso wenig, handelte es sich dabei doch um ein Produkt des englischen Imperialismus. Ketchup war aus antiamerikanischen Gründen vollkommen ausgeschlossen. Ketchup? No way! Die Renate wetterte in ihrer unnachahmlichen Diktion:
»Man tunkt seine Pommes ned in das Blut von Fietnam!«
Pfeffer hatten die Herrenmenschen auf den Kreuzzügen geraubt, neulich erst, kam also auch nicht auf den Tisch. Man kann sagen, dass meiner Kindheit ein bisschen die Würze gefehlt hat. Die Suppe jedoch musste ich auslöffeln. Das war ein typischer Erziehungswiderspruch meiner Eltern: antiautoritär kochen, aber aufessen müssen. Natürlich wehrte ich mich mit Händen und Füßen, allein der Eberhard und die Renate verfügten über sämtliche didaktischen Aufess-Tricks. Als ob man eine Wahl gehabt hätte, tunkten sie den Löffel in die Pampe und säuselten etwas von »komm’, noch einen Happen für den Opa«, und zack, schon bekam ich mit dem Zeug den Mund gestopft. Dabei hatte ich überhaupt keinen Opa, aber es gab schlicht und ergreifend keine zwei Meinungen: »Ein Happa für den Onkel, ein Happa für die Oma …«, wie oft wünschte ich mir, dass in der Verwandtschaft möglichst bald wieder jemand sterben möge. (Obwohl ich diesen Wunsch immer gleich bereute, denn die Bärenmarken-Oma wollte ich keinesfalls gefährden.) Wenn es aber absolut ungenießbar wurde und ich mich partout weigerte, auch nur einen Bissen runterzuwürgen, griffen meine sonst so toleranten Eltern doch mal in die Knüppelkiste teutonischer Pädagogik:
»Wenn du des ned aufisst, Burschi, wenn du des ned aufisst, gibt’s morgen schlecht’ Wetter!«
Mein Gott, diese Verantwortung. Ich entschuldige mich hier in aller Form für so manch verregneten Sommer in den 70er- und 80er-Jahren. Aber ich hab’s einfach nicht runtergebracht, dafür gewann der Begriff »Hungerstreik«, der in den Gesprächen der Erwachsenen so oft fiel, für mich schon sehr früh an Bedeutung.
Was darüber hinaus ebenfalls den eher scheußlichen Dingen meiner Kindheit zugerechnet werden muss und zudem auch wenig appetitanregend wirkte: Meine Eltern waren immer nackt. Das war … also schön war es nicht. Der Eberhard und die Renate hatten nie was an zu Hause, das war open. Sie liefen wie Adam und Eva durch die Kommune und nahmen da überhaupt kein Blatt vor den Unterleib. Total open war das. Unser Haus besaß auch keine Türen, alles open, und immer wenn meine Eltern im Schlafzimmer waren, wenn sie in trauter Zweisamkeit im Bett lagen, wenn ›Wish you were here‹ auf dem Endlosband lief und wenn ich das alles in Ermangelung von Türen auch noch mit ansehen musste, riefen sie schnaufend:
»Geh weiter, Burschi, schau dir des ruhig an. Des ist Liebe.«
Die Renate kniete auf dem Bett und der Eberhard dotzte ihr von hinten mit seinem Unterleib gegen den Allerwertesten, also Liebe konnte ich da keine entdecken.
»Magst du koa Schwesterchen?«, fragte mich die Renate keuchend. »So geht des nämlich. Oder glaubst du noch an den Klapperstorch?« Dass sie überhaupt sprechen konnte, so wie sie traktiert wurde, wunderte mich, und mein Vater schrie:
»Schau her, so haben der Eberhard und die Renate dich auch g’macht, g’rad a so ham wir dich aa g’macht!« Dann brüllte er wie ein russischer Hammerwerfer beim entscheidenden letzten Versuch.
Also ich hätte echt kein Problem damit gehabt, vom Affen abzustammen, aber von Eltern, die so was so open machten, wollte ich nicht abstammen! Das sah vielleicht krank aus. Das konnte unmöglich die herkömmliche Art der Fortpflanzung gewesen sein, denn das hieße ja, dass dann alle so einen Eiertanz aufführten. Nein, nein, das war nur bei meinen Eltern so, und deswegen bin auch nur ich ein derartig verkorkster Typ geworden.
Heute kommt mir gelegentlich in den Sinn, dass das Liebesleben meiner Freunde und Bekannten streng genommen noch viel kranker aussieht. Viele haben gar keines. Das sind die neuen Werte, also die ganz alten: Keinen Sex vor der Ehe, kein Petting vor der Verlobung. Oder Blümchen-Sex. Oder Dr.-Sommer-Sex. Also irgendwas hat sich im Wertegefüge doch verschoben, wir sind so: politisch indifferent, sexuell desorientiert, aber immer gut gekleidet. Und: Wir haben fun. Aber hallo haben wir einen fun. Wir hoppen von Event zu Event, von Club zu Club und haben aber so was von fun. Und einmal im Jahr scheißen wir in den Tiergarten und haben Spaß dabei. Welch eine Entwicklung – von der freien Liebe zur Loveparade, evolution sucks!
Was allerdings die moderne Musik, von House bis Techno, von Rap bis Big Beat angeht, daran bin ich unschuldig. Erstens kenne ich mich da nicht aus und zweitens wurden mir meine Vorliebe für Computer-Sounds und meine ablehnende Haltung gegenüber West-Coast-Protest-Geschrammel und anderer Handmade-Musik quasi in die Wiege gelegt. Bereits im Alter von fünf Jahren schenkte mir der Eberhard eine Klampfe. Alle meine Freunde bekamen Playmobil und ich eine E-Gitarre! Die Renate pickte eine Pril-Blume auf den Korpus, und ich sollte mich freuen, schönen Dank auch, das Teil wog so schwer, dass ich es kaum halten konnte. Und das Problem mit Instrumenten ist ja vor allem das Erlernen ebendieser. An sich verlief die musikalische Entwicklung streng linear. Aus dem gemeinsamen Orff’schen Singspiel kristallisierten sich genau zwei Stränge heraus: die Flöteneleven, die später mal Sologeigerin oder zumindest Konzertcellist werden sollten, und die zukünftigen Klavierschüler. Letztere Gruppe unterteilte sich noch in die Okarina- und die Melodica-Fraktion, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Ich stand sowieso außen vor, denn ich bekam als Einziger Gitarrenunterricht. Aus Kostengründen bei einem Weggefährten meines Vaters, einem Liedermacher, vor dessen Liedern der Staat oftmals erzitterte – und ich auch. Das erste halbe Jahr habe ich keinen einzigen Ton gelernt, die ersten 20 Stunden bestanden ausschließlich im politisch korrekten Bekleben des Gitarrenkoffers. Und was dann kam, war noch furchtbarer.
Warum ich mich im elektrischen Saitenspiel üben musste, fand ich schnell heraus. Meine Eltern wollten mich als Rhythmusgitarrero für ihre WG-Kapelle gewinnen. Keine Strafe war härter als Hippie-Hausmusik mit Eberhard an dem Sitar und Renate an den Bongos, hey, nach zehn Minuten hattest du Ohrmuschelkrebs im Endstadium. Ich glaube, die 70er-Jahre waren der Horror für alle, die sich in Hörweite befanden, speziell für unsere Nachbarn, die von Gintens. Irgendwann verboten sie ihrer Tochter Astrid sogar, mit mir zu spielen (was mir nicht unrecht war). Ich bin mir sicher, die von Gintens haben sich gedacht: Eltern, die solche Musik machen und nackt in der Gegend herumlaufen, wie werden die wohl ihr Kind erziehen? Ich gebe zu, dass ich mich das auch manchmal gefragt habe.
Dabei wollte ich doch eigentlich nur normal werden. Das konnte doch nicht so schwer sein. Wieso hat das nicht geklappt? Vielleicht weil ich nie Prügel bekam? Meine Eltern haben mich nie geschlagen, da wird man doch nicht normal. Ich wurde noch nicht einmal missbraucht. Wie sollten sich so die gängigen Neurosen herausbilden? Es ist ja nicht so, dass ich nicht ausreichend mit Wissen und Werten versorgt worden wäre, ich konnte damit nur nie so recht etwas anfangen. Meine gesamte Kindheit hindurch wurde ich mit Regeln und Richtungsweisern vollgeschrieben. Wie eine Tafel. Alle können lesen, was draufsteht, nur man selber nicht. Noch heute fühle ich mich manchmal so. So merkunwürdig. Wie ein geknicktes Vorfahrtsschild, das irgendwo, meilenweit von der nächsten Straße entfernt, rumsteht. Einfach nur dumm rumsteht.
Die Einschulung
Mit dem Namen Jess Jochimsen warst du in Bayern der komplette Volldepp, kein Schwein konnte das aussprechen, geschweige denn schreiben.
Ich wäre wegen dieses Namens beinahe nicht eingeschult worden.
Dabei wollte ich von ganzem Herzen in die Schule. Nach viereinhalb Jahren marxistisch-leninistischer Krabbelgruppe und ideologiekritischem Kinderladen wollte ich unbedingt da hin. Im schulfähigen Alter war ich, daran lag es nicht, außerdem hatte ich die beiden Tests für die Schulreife bestanden. Zum einen: Ich konnte auf dem Strich gehen. Problemlos. Das musste man damals, wenn man in die Schule wollte.
Zehn Meter auf einem Kreidestrich entlanglaufen, ohne auf die Fresse zu fallen. Konnte ich. Die zweite Prüfung bestand aus einer Turnübung. Mit dem rechten Arm über den Kopf ans linke Ohr. Und umgekehrt. Wenn man das konnte, war man in Bayern schulreif – oder hatte zumindest sehr lange Arme für sein Alter. Egal, ich war reif!
Die Problematik meiner Einschulung lag eher in meinen Eltern und der Zeit begründet. Ich sollte ja 1977 damit beginnen, lesen und schreiben zu lernen, und 1977 tobte der deutsche Herbst, es war die Zeit der Schleyer-Entführung und der RAF. Der Eberhard und die Renate hielten die Schule für eine ideologisch äußerst bedenkliche Einrichtung. Ein politisch hochbrisantes Klima herrschte, und Schule, sagen wir es, wie es ist, war für meine Eltern eine kryptofaschistische Institution des Staatsapparates.
Ich hatte keine Ahnung davon, was genau die Schule sein sollte, ich wusste gerade einmal, dass es sich um etwas Faschistisches handelte – und ich wollte da hin; meine Sandkastenkumpels wollten ja auch, warum ich also nicht?
Aber meine Eltern hat das mit der Schule schlicht und ergreifend nicht interessiert. Die saßen in der Küche, diskutierten endlos über die politischen Ereignisse und nahmen Drogen. Mich ergriff Panik, dass die Renate und der Eberhard meine Einschulung verpennen, die Anmeldung einfach vergessen könnten, weil sie ständig am Labern waren und dabei ganze Felder wegkifften. Sie hockten rum und bauten in einer Tour Tüten. Riesendinger waren das, don’t bogart that joint my friend, und diese Tüten wurden dann geraucht, bis die Augen nur noch aus den Pupillen bestanden. Als ich schließlich doch noch in die Schule kam, habe ich die Schultüten für etwas zum Rauchen gehalten!
Verunsichert und aufgeregt betrat ich den ungeheuren Betonbau der staatlichen Wittelsbacher Grundschule. Mein erster Schultag! Zur Begrüßung mussten sämtliche Eleven nebst ihren Eltern auf den akkurat aufgestellten Stühlen in der Aula Platz nehmen. Das erste Gefühl, welches mich beschlich, lässt sich mit einem Wort präzise beschreiben: Neid. Alle anderen Kinder waren gekämmt und anständig angezogen, ein sauberes Hemd, gebügelte Hose, Halbschuhe, in den Händen stolz die Schultüte und zur Rechten und Linken: Mama und Papa. Ich dagegen saß bedröppelt da, trug Sandalen und ein lila Batikleibchen. Neben mir lümmelten, in ihren Bewegungen doch recht verlangsamt, Renate und Eberhard mit verfilzten Haaren und Strickzeug. Welch ein Auftritt in der Aula der Wittelsbacher!
Der Direktor hielt seine Rede. Dass von nun an alles anders würde, sagte er, und dass uns ein neuer Lebensabschnitt erwarte. Er sprach von Verantwortung, Pflichten und Leistung. Die anwesenden Erziehungsberechtigten lauschten andächtig, ab und zu wurde geklatscht. Nur die Renate hat »buh« gerufen, während der Eberhard abwesend strickte. Mann, war mir das peinlich.
Sagen durfte ich freilich nichts, weil ich mich noch keineswegs auf der sicheren Seite befand. Ich war nämlich noch nicht wirklich eingeschult, denn hierzu mussten erst die Klassen eingeteilt werden. Bei hundertzwanzig ABC-Schützen sollte es dann doch drei erste Klassen geben. Zum Zwecke der Aufteilung wurden alle aufgerufen. Der Direktor himself rief alle Kinder namentlich auf, sie mussten sich erheben und wurden von einer der drei engelsgleichen Grundschullehrerinnen an der Hand genommen und in je eine Ecke der Aula zum Sammeln geführt.
Die ersten vierzig Kinder trafen sich an der linken Wand unter dem überdimensionalen Kruzifix. Das hing damals noch völlig legal an Bayerns Schulen. Die zweite Gruppe hatte sich auf der gegenüberliegenden Seite einzufinden, neben der marmornen Büste von Franz Josef Strauß. Der Ministerpräsident war zwar noch am Leben, stand aber trotzdem da rum. Die dritte Klasse schließlich durfte zur Hauptautorität der Institution, von Kirche und Staat quasi flankiert, zum Kiosk des Hausmeisters. Tempel der Glückseligkeit. Der Hausmeister war der Herrscher über Brezen und Brötchen, Snickers, Mars, Hanuta, Raider (Fuck Twix!), Ahoi-Brause, Sunkist und Capri-Sonne. Das Paradies! In diesem Moment wusste ich, warum ich in die Schule wollte.
Alle wurden sie nacheinander aufgerufen, ALLE – außer mir. Warum, zum Teufel, fiel mein Name nicht? Ich ahnte es, meine Eltern hatten die Anmeldung verschlafen. Ich hatte es gewusst! Jeder kam dran, nur ich nicht. Es war wie die Reise nach Jerusalem, nur umgekehrt. Ein jeder hörte das erlösende Zeichen, stand von seinem Stuhl auf und ging. Nur ich blieb sitzen. Mein Gott, noch nicht einmal in der Schule, und schon sitzen geblieben. Wie demütigend war es doch, die wenigen mir vertrauten Menschen fortgehen zu sehen. Katja Berger, die ich schon auf dem Spielplatz mehr als nur liebte, wurde aufgerufen und verließ mich. Harald Meyer durfte, obwohl er stark lispelte, in die Schule. Selbst Astrid von Ginten, die dumme Ziege, erhielt die Fahrkarte in die bessere Welt. Name um Name erschallte, aber kein Jess Jochimsen. Als einer der Letzten wurde dann sogar Erwin Moser aufgerufen, und ich brüllte mit tränenerstickter Stimme:
»Der kann keine zwei Meter auf dem Strich gehen, und an seine Ohren kommt er auch nicht ran mit seinen Wurstfingern!«
Keiner hörte mich. Die Schmach war perfekt: Der dicke Erwin durfte zum Kiosk, und ich musste zurück in den Kinderladen. Das war das Ende. Alle Namen, die es überhaupt gab auf der Welt, hatte der Direktor aufgerufen. Alle. Außer Jess Jochimsen.
Von meinen Eltern brauchte ich keine Hilfe zu erwarten. Ich senkte den Blick und begann zu beten, aber kein Engel erschien, um mich zu den anderen zu geleiten. Irgendwann schloss ich meine Augen, weinen sollte mich niemand sehen. Da hörte ich die sonore Stimme des Direktors:
»Jens Joachim.«
Ich blinzelte und wischte mir den Rotz aus dem Gesicht.
»Jens Joachim. Wo ist der?«
Vorsichtig sah ich mich um. So ein Idiot, dieser Jens, dachte ich, der wurde aufgerufen und war nicht da. In diesem Augenblick sagte die Renate zu mir:
»Jetza steh schon auf. Du wolltest doch in d’Schule.«
»Jens Joachim!« Der Direktor wieder.
»Zefix, bist du taub, Bua? Na geh schon!«
Da fiel es mir wie Schuppen von den verheulten Augen. Die Renate wollte bescheißen. Erst verpennte sie, mich anzumelden, und jetzt gab sie mich für einen anderen aus, für diesen Jens Joachim, und der Eberhard mischte natürlich auch mit.
»I hab’ koan Bock mehr, hier weiter rum zum Stricken. Burschi, schau’, dass’d nach vorn kimmst.«
Ein Komplott, eine Verschwörung. Der Direktor wurde jetzt langsam ungeduldig.
»JENS JOACHIM!!!«
Zaghaft meldete ich mich. Warum auch nicht, wenn ich so in die Schule kam. Vielleicht war dieser Jens ja tot? Was aber, reflexartig zog ich den Arm zurück, wenn er nur krank war? Windpocken, Pfeiffer’sches Drüsenfieber? Eines Tages würde er wieder gesund sein, wiederkommen, und der ganze Schwindel würde auffliegen. Ich nahm all meinen Mut zusammen und stand auf.
»Herr Direktor! Ich bin nicht der Jens, ich bin der Jess! Ich wollte …«
Doch dem Direktor war das egal. Er hörte gar nicht zu, sondern hakte mich einfach auf seiner Liste ab. Das durfte doch nicht wahr sein, meine Schullaufbahn sollte mit einer Straftat beginnen. Mit Betrug an Bayerns Schulwesen!
Was heckten meine Eltern da aus? Fieberhaft überlegte ich. Mein Gott, natürlich: September 1977. Die Schleyer-Entführung. Die RAF. Hatten der Eberhard und die Renate den kleinen Jens heimlich entführt, ermordet und verscharrt? Damit ich an seiner Stelle in die Schule könnte? Err-Aah-Eff, Renate-Eberhard-Fraktion, Kommando 1. Schultag! Es handelte sich um einen von langer Hand vorbereiteten Austausch. Jess Jochimsen statt Jens Joachim. Wegen der täuschend ähnlichen Namen fiel niemandem etwas auf. Das perfekte Verbrechen: den gleichaltrigen Jens beseitigt, damit ich unter seinem Namen eingeschult werden konnte. Wahrscheinlich müsste ich sogar zu seinen Eltern ziehen, damit die keinen Verdacht schöpften. Vor meinem geistigen Auge erschien eine modisch gekleidete, groß gewachsene Frau und fragte mich:
»Wie war denn dein erster Schultag, Jens, hm?«
Auf diese Frage vorbereitet, erfüllte ich, brillanter Schauspieler, der ich war, meinen Teil des teuflischen Plans:
»Ganz schön. Danke der Nachfrage, Frau Joachim, äh, Mama.«
Was aber, wenn sie wider Erwarten doch Verdacht schöpfte und zur Polizei ginge? Dann käme alles heraus. Ich sah schon die Fahndungsfotos beim Bäcker. Die GSG 9 stürmt die Grundschule, um mich ins Gefängnis zu bringen oder – schlimmer noch – zurück in den Kinderladen.
In diesem Moment nahm mich eine der Lehrerinnen bei der Hand und führte mich zum Kiosk.
»Komm, Jens!«
Und ich war zum Verbrecher geworden.
Aber immerhin eingeschult.
Die erste Zeit habe ich in unglaublicher Angst gelebt und gelernt. Wenn dieser Coup aufgeflogen wäre, wäre ich dran gewesen. Ich wäre nach Stuttgart-Stammheim verfrachtet worden, in die Isolationshaft des Hochsicherheitstraktes. RAF-Anwalt Otto Schily hätte sich ein paar Jahre lang vergebens um meine Verteidigung bemüht. (Wenn Herr Schily heute von diesem Verbrechen erführe, würde er freilich keinen Finger mehr krumm machen. Er würde mich wahrscheinlich direkt abschieben – wegen meines Namens nach Norwegen.) Allein, niemand hat jemals etwas gemerkt. Bis auf den heutigen Tag weiß ich nicht, wo meine Eltern den kleinen Jens vergraben haben.
Im Laufe der Zeit ließ meine Angst immer mehr nach, und was mich dann gänzlich in Sicherheit wog, war eine Banalität. Das Sportfest. Anfangs konnte man mich ja getrost als Fleisch gewordene Niete bezeichnen. Laufen, Werfen, Weitsprung stellten für den schmächtigen Jens Joachim große Probleme dar. Bei den Bundesjugendspielen in der dritten Klasse jedoch hatte ich den Dreh raus und erhielt eine Ehrenurkunde; keine vom Direktor unterzeichnete Siegerurkunde, nein, eine Ehrenurkunde, und die war vom unbestechlichsten Mann des Staates unterschrieben, von Karl Carstens persönlich. Und was stand da, schwarz auf weiß? »Ehrenurkunde für Jens Joachim.« Also, wenn nicht einmal der Bundespräsident etwas merkte, wer dann? Später, auf dem Gymnasium, wurde ich gelegentlich sogar bei meinem richtigen Namen genannt, und irgendwann schien die Sache gegessen zu sein. Ich glaube, diese Geschichte ist eines der ganz wenigen ungeklärten Verbrechen der RAF.
Rückblickend aber kann ich sagen, dass ich keinen Tag meiner Schulzeit missen möchte. Schule war so wichtig für mich, ich lernte Dinge, die kannte ich von meinen Eltern her gar nicht. Disziplin, Gehorsam, Prügelstrafe. Wunderbar. Zu Hause wurde Peace großgeschrieben, in der Wittelsbacher dagegen gab es endlich Waffen. Den Zirkel, die Laubsäge, das Linolschnittmesser. Und was am wichtigsten war: In der Schule ging es um die wirklich bedeutenden Fragen des Lebens, nicht um so läppische Unterscheidungen wie »links oder rechts«, »Russland oder Amerika«, »Krieg oder Frieden«. Nichts dergleichen. Die Frage, die nur in der Schule gestellt wurde, die alles entscheidend und prägend war, lautete:
»Geha oder Pelikan?«
Mein erstes Stofftier war ein Bär. Ich nannte ihn Teddy-Freddy. Wenn man dem Bären auf den Bauch drückte, brummte er, und das vertrieb die bösen Träume. Recht bald aber hatte Freddy nicht mehr viel von einem Teddy. Ich hatte ihn ziemlich entbärt: nur noch ein Ohr, die Augen hingen raus … Er brummte auch nicht mehr.
»Der Bär hat bloß Bauchweh«, sagte mein Opa, aber nach der Cola-Therapie und der nötig gewordenen Operation sah Teddy nicht mehr gut aus. Mein Opa sammelte die Holzwolle ein und sagte, er kenne einen Laden, der das wieder hinkriegt. Ich sah Teddy-Freddy nie wieder.
Dabei hatte ich den Bären vom Opa bekommen. Als Entschädigung. Der Opa hatte mich einmal mit ins Kino genommen, in ›Bambi‹, und auf dem Rückweg fuhr er ein Reh tot.
In memoriam Rechtschreibung
So komisch das klingt, meine Eltern legten großen Wert auf gute schulische Leistungen.
Ein bizarre Blüte der Post-68er-Pädagogik: Der Institution Lehranstalt gegenüber blieben der Eberhard und die Renate während meiner gesamten Schulzeit skeptisch eingestellt, aber die Noten hatten zu stimmen. Also, wenn das nicht paradox ist: Ich sollte gerne ein bisschen aufsässig sein und rebellieren, aber lauter Einsen heimbringen – schaff das mal. Was hatte ich Schiss, wenn es Zeugnisse gab und ich die zu Hause vorzeigen musste. Wenn in der Spalte für Betragen stand:
»Jens ist fleißig und ordentlich. Er macht mit und passt sich gut an.«
Da ist für meine Eltern beinahe eine Welt zusammengebrochen (und der falsche Name half gar nichts). Und hatte ich dann endlich mal die ersehnte Rüge für heimliches Rauchen auf dem Schulklo, waren eben auch die Noten dementsprechend. Recht machen konnte man es ihnen praktisch nie. Der Ehrgeiz meiner Eltern richtete sich vor allem auf die Rechtschreibung. Nicht genug, dass das in der Schule bis zum Erbrechen geübt wurde, die Leistungen in Deutsch mussten immer top sein. Bei einer Vier im Diktat war Schluss mit lustig. Über Wochen trainierte die Renate mit mir Lesen und Schreiben. Ich habe keine Ahnung, warum sie mich gerade hier so traktierte. Vielleicht, weil sie den Pädagogen der Nationalsprache einfach misstraute oder weil Sprache wirklich Macht war oder was auch immer. Nachmittage lang erfand sie Texte und versuchte, mir den lebenswichtigen Unterschied zwischen dem »Fenster-F« und dem »Vogel-V« und andere sprachliche Raffinessen einzutrichtern.
Einmal diktierte sie, um mir eine Freude zu machen, den Satz:
»Winnetou war der Häuptling der Apachen.« Und ich schrieb:
»Finetu war der Heubtling der Appatschen.«