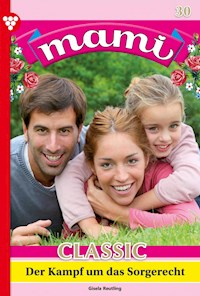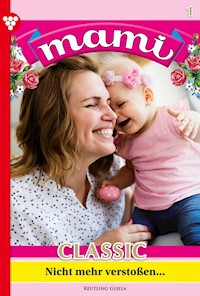Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mami Classic
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Seit über 40 Jahren ist Mami die erfolgreichste Mutter-Kind-Reihe auf dem deutschen Markt! Buchstäblich ein Qualitätssiegel der besonderen Art, denn diese wirklich einzigartige Romanreihe ist generell der Maßstab und einer der wichtigsten Wegbereiter für den modernen Familienroman geworden. Weit über 2.600 erschienene Mami-Romane zeugen von der Popularität dieser Reihe. »Danke, Herr Doktor«, sagte Gaby leise und reichte dem Arzt verabschiedend die Hand. »Ich wollte, Sie hätten Grund, mir zu danken«, gab Dr. Frey ernst zurück. Er begleitete sie bis zur Tür seines Sprechzimmers. »Auf Wiedersehen, Frau Morland«, sagte draußen mit freundlichem Lächeln seine Assistentin. Wie blind verließ Gaby die Praxis des Frauenarztes. Sie brauchte nicht mehr zu kommen. Ihre letzte Hoffnung war zunichte geworden. Auf der Straße brandete ihr der nachmittägliche Verkehr der Innenstadt entgegen. Was jetzt? Rüdiger würde heute erst später aus der Redaktion kommen. Allein in der großen stillen Wohnung auf ihn zu warten und sich nur zu fragen, warum gerade ich, dieser Gedanke ließ sie zurückschrecken. Ziellos schlenderte sie zwischen dahinhastenden Menschen die Straße entlang. Vorn am Goethe-Platz, wo ein Verkehrsknotenpunkt war, sah sie den Bus der Linie 5 stehen. Damit würde sie in einer knappen halben Stunde bei ihrer Mutter sein können. Gaby beschleunigte die Schritte, sie erreichte ihn gerade noch. Ja, sie wollte zur Mama.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mami Classic – 44 –
Hoffnung für ein verlassenes Kind
Gisela Reutling
»Danke, Herr Doktor«, sagte Gaby leise und reichte dem Arzt verabschiedend die Hand.
»Ich wollte, Sie hätten Grund, mir zu danken«, gab Dr. Frey ernst zurück. Er begleitete sie bis zur Tür seines Sprechzimmers.
»Auf Wiedersehen, Frau Morland«, sagte draußen mit freundlichem Lächeln seine Assistentin.
Wie blind verließ Gaby die Praxis des Frauenarztes. Sie brauchte nicht mehr zu kommen. Ihre letzte Hoffnung war zunichte geworden.
Auf der Straße brandete ihr der nachmittägliche Verkehr der Innenstadt entgegen. Was jetzt?
Rüdiger würde heute erst später aus der Redaktion kommen. Allein in der großen stillen Wohnung auf ihn zu warten und sich nur zu fragen, warum gerade ich, dieser Gedanke ließ sie zurückschrecken.
Ziellos schlenderte sie zwischen dahinhastenden Menschen die Straße entlang. Vorn am Goethe-Platz, wo ein Verkehrsknotenpunkt war, sah sie den Bus der Linie 5 stehen. Damit würde sie in einer knappen halben Stunde bei ihrer Mutter sein können.
Gaby beschleunigte die Schritte, sie erreichte ihn gerade noch. Ja, sie wollte zur Mama. Ihr konnte sie sich in den Arm werfen. Sie würde sie verstehen.
»Ja, Gaby«, sagte Sophie Haller überrascht, als sie ihrer Tochter die Tür öffnete. »Mit dir hatte ich heute nicht gerechnet. Wie nett! Komm herein.«
Die Tür zum Atelier stand offen. Gaby sah, daß ihre Mutter bei der Arbeit war. Sie malte auf Seide in zauberhaften Farben und Mustern. Ihre Tücher und hauchleichten Schals waren ein beliebtes Kaufobjekt in verschiedenen Boutiquen.
»Hoffentlich störe ich dich nicht, Mama.«
» Aber Kind, ich freue mich doch, wenn du kommst. Möchtest du eine Tasse Tee?« Ihr Blick wurde prüfend. »Du siehst blaß aus. Geht es dir nicht gut?«
»Ich möchte gar nichts. Nur ein bißchen bei dir sein.« Gabys Stimme schwankte. »Nein, es geht mir nicht gut, Mama. Ich weiß endgültig daß ich keine vollwertige Frau bin.«
»Was soll das denn heißen?« Sophie erschrak.
»Das heißt, daß ich nie ein Kind haben werde«, schluchzte Gaby auf. Mit Tränen in den Augen berichtete sie von dem Ergebnis dieser letzten Untersuchung. Dann lag sie wirklich an der Brust der Mutter, die sie bestürzt an sich drückte und zu beruhigen versuchte.
»Natürlich ist das sehr traurig, Gaby. Ich weiß, wie sehr ihr es euch gewünscht habt. Aber deshalb darfst du keine Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Rüdiger…«
»Ja, eben, Rüdiger«, fiel Gaby ihr ins Wort. »Am besten sucht Rüdiger sich eine andere Frau.« Die Tränen flossen.
»Das wird er nie tun«, entgegnete Sophie überzeugt. »Dafür liebt er dich viel zu sehr. Steigere dich nicht in solche Gedanken hinein.«
Die Traurigkeit konnte sie ihrer Tochter nicht nehmen. Die fühlte sie ihr nur zu gut nach. Waren doch Gaby und Anja, ihre beiden Mädchen, nicht auch immer ihr ganzes Glück gewesen? Aber sie konnte ihr die Tränen trocknen und ihr helfen, die Fassung in etwa wiederzugewinnen.
»Wenn ich dich nicht hätte, Mama«, sagte Gaby, als sie ihr Gesicht gekühlt und mit leichtem Make-up und Lippenstift wieder etwas Farbe gegeben hatte.
»Du hast vor allem deinen Rüdiger, vergiß das nicht«, sagte Sophie liebevoll und klopfte ihr die Wange.
Gaby war noch nicht lange zu Hause, als es kurz an der Wohnungstür läutete. Eine Nachbarin? Ein Hausierer? Sie spähte durch den Spion, sah aber niemanden. Als sie die Tür öffnete, glaubte sie ihren Augen nicht zu trauen…
Da saß doch tatsächlich auf der Matte ein kleiner Hund! Er blinzelte durch sein halb über das Auge fallende Haar ebenso verdutzt zu ihr empor wie sie auf ihn hinab.
»Ja, wer bist denn du? Hast du dich verlaufen?«
»Nicht verlaufen, der gehört jetzt da hinein«, erklang Rüdigers lachende Stimme. Er hatte das Hündchen da abgesetzt und sich auf dem unteren Treppenabsatz verborgen. Jetzt kam er die Stufen herauf.
»Guten Abend, mein Schatz. Darf ich vorstellen: Das ist die junge Hundedame Cora, aus dem Stamm der Tibet-Terrier, wachsam und mutig, aber nicht angriffslustig, lebhaft, intelligent und anhänglich.« Mit heiterster Miene zählte er alle diese Vorzüge auf. »Na, was sagst du?«
»Der ist ja süß«, mußte Gaby zugeben, als sie ihren neuen Hausgenossen auf dem Arm hatte. Das feine Fell war schwarz und weiß gefleckt, drollig waren die geringelte Rute und die großen runden Pfoten.
»Nicht wahr?« sagte ihr Mann ganz stolz. »Und stubenrein ist sie auch. Einen Korb und weiteres Zubehör habe ich noch unten im Wagen. Bring’ ich nachher mit rauf, wenn ich ihn wegstelle. Jetzt krieg’ ich erst mal einen Kuß!« Er spitzte die Lippen und nahm ihn von seiner Frau in Empfang.
Aber Gaby senkte den Kopf wieder tief auf den kleinen Gesellen, der aufmerksam stillhielt. Warm, weich und lebendig war er. Etwas zum Liebhaben. Ein Hund!
»Du hast es wohl schon geahnt«, murmelte sie halberstickt.
»Was soll ich geahnt haben?«
»Du hast es doch nicht vergessen, daß ich heute bei Dr. Frey bestellt war…« Endlich hob sie den Kopf. Sie sahen sich in die Augen. Sie brauchte nichts weiter zu sagen. In ihrem Gesicht stand alles geschrieben.
»Selbst der kann sich irren, und wenn dieser Neue noch so einen guten Ruf hat«, behauptete Rüdiger nach einem kurzen, angespannten Schweigen.
»Ein Arzt kann sich irren, Rüdiger, aber nicht zwei oder drei. Dieser hat mir nur bestätigt, was die anderen schon sagten. Es ist nichts zu machen.«
Sie setzte Cora auf den Teppich. Beide sahen ihr geistesabwesend zu, wie sie, vorsichtig schnuppernd, auf ihren breiten Pfoten umhertappte.
Rüdiger traf es nicht unvorbereitet. Er hatte Gaby nur nicht den Strohhalm nehmen wollen, an den sie sich klammerte. Schon an der Richtigkeit der ersten Diagnose hatte er nur wenig gezweifelt. Sie waren seit fünf Jahren verheiratet, ein Kind war ihnen von Anfang an als die Erfüllung ihrer Liebe erschienen.
Inzwischen war er von dieser Einstellung insgeheim schon etwas abgerückt. Er war kein Mann, der sich mit gegebenen Tatsachen nicht abfinden konnte. Sein Denken war positiv, und sein Verstand sagte ihm, daß man im Leben nicht alles haben konnte. Er hatte eine Frau, die für ihn die liebste und schönste auf der Welt war. Er hatte einen guten Job, bei dem er mitten im Zeitgeschehen stand, wo kein Platz war für trübe Seelenverstimmungen.
»Also, mein Liebes«, sagte er und nahm sie in den Arm, »darüber werden wir auch hinwegkommen. Wir haben uns. Das ist allein ein großes Glück.« Er hob ihr Gesicht zu sich empor und küßte sie zärtlich auf den Mund. Dann ließ er sie los. »Ich bringe jetzt den Wagen in die Garage, und nachher essen wir, ja? Außer einem Hacksteak in der Kantine und ein paar Tassen Kaffee am Nachmittag hatte ich nämlich heute noch nichts.«
Gaby hörte die Tür ins Schloß fallen, sie stand mit hängenden Armen. Konnte er wirklich so zur Tagesordnung übergehen?
Es schien fast so. Sie mußte mit ihm überlegen, wo der Hundekorb hinkommen sollte, Wasser- und Freßnapf für Cora, das Halsband und die Leine kamen an einen Haken in der Diele.
Auch das Abendessen ließ Rüdiger sich schmecken. Er trank eine Flasche Bier dazu. Cora, die ihr Futter bekommen hatte und nun neben ihnen saß und aufmerksam ihre neue Familie beäugte, gab das Gesprächsthema vor. Rüdiger erzählte von den Hunden, mit denen er aufgewachsen war in seinem Elternhaus. Auch Gaby und Anja hatten als Kinder so einen kleinen Liebling gehabt, mit dem sie herumtollen und spielen konnten. Aber sie blieb einsilbig. Das lag schon weit zurück. Ihre Gedanken waren ganz woanders.
Erst später, als sie im Wohnzimmer saßen, Gaby auf der Couch und Rüdiger im Sessel, sprach sie es aus, was ihr unentwegt durch den Kopf ging.
»Kannst du das beiseiteschieben, Rüdiger, daß unser Herzenswunsch nicht in Erfüllung gehen wird?«
»Nicht beiseiteschieben, aber akzeptieren«, antwortete er sanft. »Wenn es uns nun einmal verwehrt ist, Eltern zu werden, dürfen wir doch deshalb nicht in Trauer und Melancholie versinken. Es soll unser Leben nicht verschatten, Liebste.«
Mit einem verlorenen Blick sah Gaby sich um. Eigentlich sollte sie ja froh sein, daß ihr Mann es so hinnahm. Für ihn war der Verzicht wohl nicht ganz so schwer. Er hatte seinen Beruf. Sie hatte mit zweiundzwanzig Jahren geheiratet, nachdem sie gerade zwei Semester studiert hatte. Ihr Studium hatte sie ohne Bedauern aufgegeben, weil sie doch bald eine Familie haben wollte. So waren die Jahre dann vergangen, mit Warten und Hoffen.
»Wie oft habe ich mir vorgestellt«, murmelte sie vor sich hin, »wie wir unser drittes Zimmer als Kinderzimmer einrichten würden…«
Rüdiger unterdrückte einen Seufzer. Er merkte schon, daß seine Worte sie kaum erreicht hatten.
Er hatte eine Flasche Wein auf den Tisch gestellt. Er trank abends gern noch ein Glas Wein, und Gaby mit ihm. Es war ihnen noch nie langweilig zusammen geworden. Sie hatten einen netten Freundeskreis, es gab Besuche und Gegenbesuche, und hin und wieder gingen sie aus. Was wollte man mehr?
Er schenkte ein. »Komm, trink einen Schluck mit mir, Gaby«, bat er.
Sie wandte den Kopf ab. »Nein, danke. Heute nicht.«
Da setzte er sich zu ihr auf die Couch. »Gaby«, sagte er eindringlich und nahm ihre Hand, »so geht das aber nicht. Wenn du glaubst, ohne ein Kind deines Lebens nicht mehr froh sein zu können, dann könnten wir auch eins adoptieren.« Es hörte sich so einfach an.
Ihr Kopf flog herum. »Das würdest du tun?« fragte sie unsicher.
Rüdiger hob die Schultern. »Ja, eventuell. Warum nicht? Hast du noch nie daran gedacht?«
»Nein. Weil…«
»Weil du es nie wahrhaben wolltest, daß wir kein eigenes haben können, ich weiß. Aber es wäre zu erwägen.«
»Ja. Vielleicht.« Ihre Hand zuckte in der seinen.
»Das würde bedeuten«, fuhr Rüdiger sachlich fort, »daß unser Name auf eine lange Warteliste käme, denn adoptivwillige Paare gibt es genug. Man müßte natürlich auch wissen, woher das Kind kommt, welche Erbanlagen es hat. Und auf einen Behördenkrieg, der sich über Jahre hinwegziehen kann, muß man sich sowieso gefaßt machen.«
»Das klingt nicht gerade verheißungsvoll«, bemerkte Gaby matt. Der kleine Funke, der in ihr aufgesprungen war, war schnell wieder erloschen.
»Es muß ja nicht heute oder morgen entschieden werden, Gaby«, meinte ihr Mann. In diesem Augenblick läutete das Telefon.
Rüdiger stand auf.
Es war seine Schwägerin Anja, die aus Lyon anrief. Sie war in Frankreich als Austauschlehrerin und Assistentin des Deutschlehrers an einer Oberschule.
»Hallo, wie geht’s euch? erkundigte sie sich munter.
»Wir sind auf den Hund gekommen«, antwortete Rüdiger scherzhaft, und dann erzählte er von Cora, die seit heute zu ihnen gehörte.
»Da wird sich Gaby freuen. Gib sie mir mal.« Rüdiger reichte seiner Frau den Hörer, und Gaby nahm sich zusammen, um auf das leichte Geplauder ihrer Schwester einzugehen. Anja war drei Jahre jünger, vierundzwanzig war sie und von heiterem Temperament. Sie mußte nicht unbedingt von ihrem Kummer wissen.
Mit Grüßen an die Mutti, die sie am Sonntag anrufen wollte, beendete Anja das Gespräch. Langsam legte Gaby den Hörer zurück. War Anja nicht zu beneiden um ihre Sorglosigkeit? Dabei war sie zielstrebig und tüchtig, sie liebte ihren Beruf, die Schüler liebten sie. Begeistert hatte sie zugegriffen, als ihr diese Stelle in Lyon geboten worden war.
Gaby fühlte sich in ihrer augenblicklichen Stimmung klein und verzagt neben der jüngeren.
»Machen wir einen Spaziergang«, schlug Rüdiger vor. »Cora muß sowieso noch mal raus. Das wird jetzt zu unseren täglichen Pflichten gehören«, schloß er lächelnd.
»Sei mir nicht bös, Rüdiger, ich möchte nicht mit. Ich bin müde.«
»Dann lege dich schon hin.« Mit dem Handrücken streichelte er ihre Wange. Was würde er darum geben, ihre Augen wieder glänzen zu sehen! Dieser Tag hatte sie wahrhaftig mitgenommen.
Cora hatte in ihrem Korb schon geschlafen. Sie reckte und streckte sich und schüttelte sich das feine Fell, als ihr Herr mit Halsband und Leine kam. An der Tür sah sie sich um, als fehle noch etwas.
»Nein, Frauchen kommt heute nicht mit«, erklärte Rüdiger. »Morgen wirst du mit ihr spazierengehen, und alle Tage.«
Allein geblieben, ging Gaby in das Zimmer, das sie, als sie vor fünf Jahren hier eingezogen waren, als Kinderzimmer geplant hatten. Es war zu ihrem »Salon« geworden, so nannte sie es halb spaßhaft, weil einige schöne Stilmöbel dem Raum einen altmodischen Charme verliehen. Die Möbel waren von einer verstorbenen Tante, keiner hatte sie brauchen können, und so hatten sie sie, vorübergehend, wie sie meinten, übernommen. Anja wollte sie später gerne einmal haben, wenn sie sich erst einen eigenen Hausstand einrichten würde. Danach sah es freilich noch lange nicht aus.
Es würde, dachte Gaby traurig, ihr wenig benützter Salon bleiben Kein Kinderbettchen darin, kein Spielzeug, keine Märchentapete an den Wänden. Sie ging wieder hinaus, und diesmal drehte sie sogar den Schlüssel um. Es war, als schlösse sie damit etwas endgültig ab.
*
Man konnte nicht immer traurig sein, besonders wenn man einen lebensvollen Mann wie Rüdiger an seiner Seite hatte. Zumindest zeigte man es nicht. Gaby drängte ihr Weh zurück. Sie war Rüdiger die Frau, wie er sie liebte, interessiert an seinem Beruf und von anscheinend heiterer Ausgegeglichenheit. Niemand war froher darüber als er, daß sie sich wieder gefangen hatte. Auch das Thema Adoption war zwischen ihnen nicht mehr berührt worden.
Eines Tages sagte ein Kollege in der Lokalredaktion zu ihm: »Wolltet ihr nicht immer ein Baby haben? Da ist vor dem Polizeirevier V ein Neugeborenes in einem Karton abgestellt worden. Wie wär’s damit?«
Er war für seine Schnoddrigkeit bekannt, der Dieter Müller. Irgendwann, als er darüber stöhnte, daß seine Frau Zwillinge bekam, hatte Rüdiger ihm seine Meinung gesagt. Jetzt ärgerte es ihn nachträglich.
»Ich finde das gar nicht witzig«, erwiderte er.
»Nee, ich auch nicht. Sieh mal zu, daß eine Notiz davon noch in die morgige Ausgabe kommt.« Damit verließ er pfeifend das Büro, ein abgebrühter Journalist, den so leicht nichts mehr erschüttern konnte.
Gaby las es am nächsten Tag. »Warum hast du mir nichts davon erzählt?«
»Weil ich wußte, daß es dich aufregen würde. Du hast es ja jetzt gelesen.«
»Wen sollte das nicht aufregen«, sagte sie. »Das ist ja furchtbar. Wer tut so etwas?« In ihren Augen flackerte Empörung.
»Wenn man das wüßte! Der erste Fall ist das nicht, daß ein Baby ausgesetzt wurde.«
»Wo ist es denn jetzt?« fragte Gaby.
»Zur Untersuchung in einer Klinik, ob es gesund ist, und wie alt«, antwortete Rüdiger.
Der Säugling war, wie sich herausstellte, zwei Tage jung. Hungrig war das Bübchen gewesen, aber von bester Gesundheit.
Niemand meldete sich, niemand schien sich darum zu kümmern.
»Mutti«, klagte Gaby, als sie bei ihr war, »da gibt es Frauen wie mich, die sich wie nichts anderes auf der Welt ein Baby wünschen, und dann geschehen solche Verbrechen. Denn ein Verbrechen ist es doch, ein Kind sozusagen wegzuwerfen.«
Die Mutter nickte mehrmals vor sich hin. »Man weiß nicht, was für ein Schicksal dahintersteckt«, äußerte sie nach einer Pause sinnend.
»So grausam kann gar kein Schicksal sein, daß es eine solche Tat rechtfertigen könnte«, sagte Gaby erregt.
Sophie Haller sah auf ihre Tochter. »Nimm es dir nicht zu sehr zu Herzen«, riet sie ihr. »Wenn man alles Elend an sich herankommen ließe, käme man überhaupt nicht mehr zur Ruhe.«
Ihr Mann war derselben Meinung, als Gaby sich in den folgenden Wochen immer wieder nach dem Findling erkundigte.
»Das ist jetzt Sache des Jugendamtes, sich seiner anzunehmen«, erklärte er. »Es wird in einem Heim für verlassene Kinder landen. Niemand wird es haben wollen. Wer nimmt schon ein Kind, dessen Herkunft so völlig im Ungewissen liegt.«
»Aber es muß doch irgendeinem Menschen aufgefallen sein, daß da eine Frau ein Kind zur Welt bringt, beziehungsweise zur Welt gebracht hat«, beharrte Gaby. »So etwas kann doch nicht unbemerkt in aller Heimlichkeit geschehen. Keiner lebt für sich allein.«
» O doch, das gibt es schon. Und ich hätte nichts dagegen, wenn wir dieses Thema endlich ruhen ließen, meine liebe Gaby.«
Schließlich war es doch so, daß im Zeitungswesen eine Nachricht die andere jagte. Die Notiz über den gefundenen Säugling war im Bewußtsein der Leser längst von neuen und sensationelleren Berichten verdrängt.