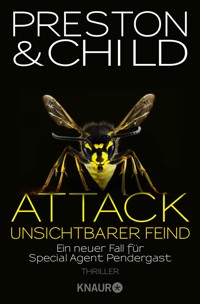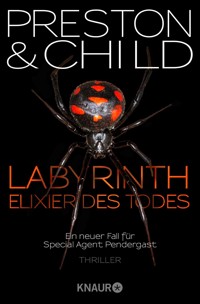9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Special Agent Pendergast
- Sprache: Deutsch
»Die Binden waren vom Gesicht der Mumie gerissen worden, der Mund mit den schwarzen Lippen stand offen, ein stummer Protestschrei angesichts dieser Schändung. In der Brust der Mumie klaffte ein großes Loch …« In einem Kellergewölbe des New York Museum of Natural History ruht ein besonderer Schatz: das Grabmal des Senef aus dem Tal der Könige. Nun soll es wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden – doch schon bei den Restaurierungsarbeiten gibt es einen Toten. Ist er das erste Opfer eines uralten Fluchs? Special Agent Aloysius Pendergast hat einen anderen Verdacht – und verfolgt die Spur eines Wahnsinnigen, den er besser kennt als jeder andere. Maniac von Lincoln Child, Douglas Preston: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 711
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Douglas Preston / Lincoln Child
Maniac
Fluch der Vergangenheit
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
Danksagung
Anmerkungen der Autoren
Lincoln Child widmet dieses Buch seiner Mutter Nancy Child.
Douglas Preston widmet dieses Buch Anna Marguerita McCann Taggart.
1
Die frühe Morgensonne tauchte die kopfsteingepflasterte Zufahrt zum Personaleingang des New York Museum of Natural History in goldenes Licht und strahlte hell in eine gläserne Pförtnerloge direkt vor dem großen Torbogen aus Granit. Auf einem Stuhl in dem Glaskasten döste ein älterer Mann, der allen Museumsmitarbeitern wohl bekannt war. Zufrieden zog er an seiner Calabashpfeife und genoss die trügerische Wärme, mit der die Februartage in New York City mitunter die Osterglocken, Krokusse und Obstbäume zu vorzeitiger Blüte verleiten, nur um sie dann später im Monat jämmerlich erfrieren zu lassen.
»Morgen, Doktor«, sagte Curly zigmal am Tag zu jedem Einzelnen, der an seiner Pförtnerloge vorbeikam, ob Poststellensekretärin oder Wissenschaftsdekan. Kuratoren mochten kommen und gehen, Direktoren mochten zu Amt und Würden aufsteigen, ruhmreich herrschen und schmählich stürzen; das einfache Volk mochte den Boden bestellen, in dem es begraben wurde, doch nichts, so schien es, würde Curly je aus seinem Glaskasten vertreiben können. Er gehörte ebenso sehr zum Inventar des Museums wie der Ultrasaurus, der die Besucher in der Großen Rotunde begrüßte.
»Hier, Opa!«
Curly quittierte diese Respektlosigkeit mit einem Stirnrunzeln und riss sich gerade noch rechtzeitig aus seinen Tagträumen, um zu sehen, wie der Bote ein Päckchen durch das Fenster seines Glaskastens schob. Die Sendung landete mit Schwung auf dem kleinen Bord, auf dem der Wachmann seinen Tabak und seine Fäustlinge aufbewahrte.
»’tschuldigung!«
Curly erhob sich und winkte aus dem Fenster. »Hey!« Doch der Bote mit seinem schwarzen Rucksack, prall gefüllt mit Päckchen, sauste bereits auf den dicken Reifen seines Mountainbikes davon.
»Du meine Güte!«, brummte Curly und starrte auf das Paket. Es war etwa 30×20×20 Zentimeter groß, war eingewickelt in schmieriges braunes Packpapier und mit einer übertriebenen Menge altmodischen Bindfadens zusammengeschnürt. Es war so zerbeult, dass Curly sich fragte, ob der Bote wohl unterwegs von einem Lastwagen überrollt worden war. Die Adresse, in krakeliger Kinderschrift geschrieben, lautete: An den Kurator der Gesteins- und Mineraliensammlung, Museum of Natural History.
Curly kratzte den Tabakrest aus seinem Pfeifenkopf und musterte nachdenklich das Päckchen. Das Museum erhielt jede Woche zahllose Päckchen mit »Spenden« von Kindern. Diese Spenden für die Sammlungen des Museums umfassten alles – von zerquetschten Käfern und wertlosen Steinen bis hin zu Pfeilspitzen und den mumifizierten Überresten plattgefahrener Tiere. Seufzend erhob er sich aus seinem bequemen Stuhl und stopfte sich das Päckchen unter den Arm. Er legte die Pfeife zur Seite, öffnete die Tür seines Glaskastens und trat blinzelnd ins Sonnenlicht hinaus. Dann steuerte er den Schalter der Poststelle auf der anderen Seite der Zufahrt an.
»Was haben Sie da, Mr. Tuttle?«
Curly schaute flüchtig in Richtung der Stimme. Sie gehörte Digby Greenlaw, dem neuen stellvertretenden Verwaltungsleiter, der gerade aus dem Tunnel vom Personalparkplatz kam. Curly antwortete nicht sofort. Greenlaw und sein herablassendes Mr. Tuttle gefielen ihm nicht. Greenlaw hatte vor einigen Wochen Anstoß an der Art genommen, wie Curly Ausweise kontrollierte, und sich darüber beklagt, dass »er sie gar nicht richtig ansah«. Blöder Fatzke. Curly musste sich keine Ausweise ansehen – er wusste bei jedem sofort, ob er zum Museum gehörte oder nicht.
»Päckchen«, brummte er als Antwort.
Greenlaw schlug einen offiziellen Tonfall an. »Päckchen müssen direkt bei der Poststelle abgegeben werden. Und Sie dürfen Ihren Platz nicht verlassen.«
Curly ging weiter. Er hatte ein Alter erreicht, in dem es das Beste schien, alles Unerfreuliche so zu behandeln, als existiere es gar nicht. Er hörte, wie der Verwaltungsbeamte hinter ihm den Schritt beschleunigte und seine Stimme um einige Oktaven hob, um Curlys vermeintlicher Schwerhörigkeit Rechnung zu tragen. »Mr. Tuttle? Ich sagte, Sie dürfen Ihren Posten nicht unbeaufsichtigt lassen.«
Curly blieb stehen, drehte sich um. »Danke für den Hinweis, Herr Doktor.« Er streckte ihm das Päckchen entgegen.
Greenlaw starrte es verdutzt an. »Ich habe nicht gesagt, dass ich es abgeben würde.«
Curly hielt ihm weiter unverdrossen das Päckchen hin.
»In Gottes Namen.« Greenlaw streckte verärgert die Hand aus, hielt aber plötzlich mitten in der Bewegung inne. »Das sieht ja merkwürdig aus. Was ist das?«
»Keine Ahnung, Herr Doktor. Kam per Boten.«
»Es ist offenbar unsachgemäß behandelt worden.«
Curly zuckte mit den Achseln. Aber Greenlaw nahm das Päckchen immer noch nicht an sich. Er beugte sich vor und beäugte es stirnrunzelnd. »Es ist kaputt. Da ist ein Loch … Schauen Sie mal, da kommt was raus.«
Curly sah auf das Päckchen hinunter. An einer Ecke befand sich tatsächlich ein Loch, aus dem ein feiner Strahl braunen Pulvers rieselte.
»Was zum Teufel …?«, fragte Curly.
Greenlaw trat einen Schritt zurück. »Da tritt eine Substanz aus.« Seine Stimme wurde plötzlich schrill. »O mein Gott! Was ist das denn?«
Curly blieb wie angewurzelt stehen.
»Um Himmels willen, Curly, lassen Sie das fallen! Das ist Anthrax!« Greenlaw taumelte zurück, Panik im Gesicht. »Ein Terroranschlag! Wir müssen die Polizei rufen! Ich war dem Gift ausgesetzt! O nein! Ich war dem Gift ausgesetzt!«
Der Verwaltungsbeamte stolperte und stürzte rücklings aufs Kopfsteinpflaster, krallte die Hände in den Boden, sprang dann sofort wieder hoch und rannte davon. Fast im selben Moment kamen zwei Sicherheitsbeamte aus der gegenüberliegenden Wachstation. Einer trat Greenlaw in den Weg, während der andere auf Curly zueilte.
»Was wollen Sie?«, kreischte Greenlaw. »Bleiben Sie, wo Sie sind! Rufen Sie 911!«
Curly rührte sich nicht vom Fleck, das Päckchen immer noch in der Hand. Diese Situation war so unwirklich, lag so weit außerhalb seiner üblichen Erfahrungswelt, dass sein Denkvermögen auszusetzen schien.
Die Wachen wichen zurück, dicht gefolgt von Greenlaw. Einen Moment lang legte sich eine unheimliche Stille über den kleinen Innenhof. Dann heulte ein schriller Alarm los. Kaum fünf Minuten später steigerte sich der Lärm durch den Klang näher kommender Sirenen und gipfelte in einem Ausbruch hektischer Aktivitäten: Streifenwagen, blinkende Blaulichter, quäkende Funkgeräte und uniformierte Männer, die hierhin und dorthin liefen, gelbes Absperrband entrollten und einen Sicherheitskordon um die potenzielle Verseuchungszone bildeten, während weitere Beamte in Megaphone brüllten, um die wachsende Menge der Schaulustigen zum Zurücktreten aufzufordern und gleichzeitig Curly zum Handeln zu bewegen: Legen Sie das Päckchen hin und treten Sie beiseite. Legen Sie das Päckchen hin und treten Sie beiseite.
Doch Curly legte das Päckchen nicht ab und trat auch nicht beiseite. Vielmehr blieb er wie angewurzelt stehen und starrte völlig verwirrt auf den dünnen braunen Strahl, der weiter aus dem zerrissenen Packpapier rieselte und langsam ein kleines Häuflein auf dem Kopfsteinpflaster zu seinen Füßen bildete.
Und dann näherten sich zwei seltsam aussehende Männer, die weiße Sicherheitsoveralls und Hauben mit Plastikvisieren trugen. Sie kamen mit ausgestreckten Händen langsam auf ihn zu, wie diese Gestalten, die Curly einmal in einem alten Sciencefictionfilm gesehen hatte. Einer berührte ihn sanft an der Schulter, während der andere ihm das Päckchen aus der Hand nahm und es – ungeheuer behutsam – in eine blaue Plastikkiste legte. Der erste Mann führte Curly zur Seite und saugte ihn vorsichtig mit einem komisch aussehenden Gerät ab. Dann machten sie sich mit vereinten Kräften daran, auch ihn in einen dieser Astronautenanzüge zu stecken, während sie ihm die ganze Zeit mit leisen, elektronisch verzerrten Stimmen versicherten, er müsse sich keine Sorgen machen, sie würden ihn zu einigen Tests ins Krankenhaus bringen und alles würde gut werden. Als sie ihm die Haube über den Kopf stülpten, hatte Curly das Gefühl, dass sein Verstand sich langsam wieder einschaltete und seine Bewegungsfähigkeit zurückkehrte.
»’tschuldigung, Herr Doktor«, sagte er zu einem der Männer, als sie ihn auf einen Van zuführten, der rückwärts durch die Polizeiabsperrung gesetzt hatte und mit geöffneten Türen auf ihn wartete.
»Ja?«
»Meine Pfeife.« Er deutete mit einem Kopfnicken auf den Glaskasten. »Vergessen Sie nicht, meine Pfeife mitzunehmen.«
2
Dr. Lauren Wildenstein sah zu, wie die Männer des ABC-Teams den blauen Plastikbehälter hereintrugen und unter der Absaughaube in ihrem Labor abstellten. Der Anruf war vor zwanzig Minuten hereingekommen, und gemeinsam mit ihrem Assistenten Richie hatte sie alle notwendigen Vorbereitungen getroffen. Zuerst hatte es sich so angehört, als hätten sie es zur Abwechslung einmal mit einem echten Alarm zu tun, der tatsächlich die Kriterien eines klassischen Giftanschlages erfüllte: Aus einem Päckchen, das an eine hochrangige New Yorker Institution adressiert war, rieselte ein braunes Pulver. Doch der erste Anthrax-Test, den man sofort vor Ort durchgeführt hatte, war bereits negativ ausgefallen, und Wildenstein wusste, dass sich auch dieser Fall höchstwahrscheinlich als falscher Alarm erweisen würde.
In den zwei Jahren, in denen sie das Sentinel-Labor in New York City leitete, hatten sie über vierhundert verdächtige Substanzen analysiert, und in allen Fällen hatte sich – Gott sei Dank – herausgestellt, dass es sich um harmlose Stoffe handelte, die nicht für einen Giftanschlag geeignet waren. Bis jetzt. Sie warf einen Blick auf die an die Wand gepinnte Strichliste: Zu den am häufigsten gefundenen Substanzen gehörten Zucker, Salz, Mehl, Backpulver, Heroin, Kokain, Pfeffer und Staub – in dieser Reihenfolge. Die Liste bezeugte die herrschende Paranoia und die irrwitzige Anzahl von ausgelösten Terroralarmen.
Das Team, das die verdächtige Substanz abgeliefert hatte, verließ das Labor, und Wildenstein schaute kurz auf den versiegelten Behälter. Erstaunlich, was für eine Bestürzung ein Paket mit Pulver heutzutage auszulösen vermochte. Es war erst vor einer halben Stunde im Museum eingetroffen, und schon befanden sich ein leitender Angestellter und ein Wärter des Museums in Quarantäne, erhielten Antibiotika und wurden von einem Psychologenteam betreut. Der leitende Angestellte hatte anscheinend besonders hysterisch reagiert.
Sie schüttelte den Kopf.
»Was meinen Sie?«, hörte sie eine Stimme hinter ihrer Schulter. »Terroristencocktail du jour?«
Wildenstein ignorierte die Frage. Richie leistete erstklassige Arbeit, auch wenn er in seiner emotionalen Entwicklung irgendwo im Alter von acht oder neun Jahren steckengeblieben war. »Lassen Sie uns das Ding durchleuchten.«
»Bin schon dabei.«
Das Falschfarbenbild auf dem Bildschirm zeigte, dass das Paket mit einer amorphen Substanz gefüllt war und weder einen Brief noch irgendeinen anderen sichtbaren Gegenstand enthielt.
»Kein Zünder«, sagte Richie. »Schade.«
»Ich werde jetzt den Behälter öffnen.« Wildenstein brach die Versiegelung der Sicherheitskiste auf und hob das Paket vorsichtig heraus. Sie bemerkte den ungelenken, kindlichen Schriftzug, den fehlenden Absender, das Bändergewirr der übertriebenen Verschnürung. Es sah fast so aus, als habe es jemand darauf angelegt, das Paket verdächtig wirken zu lassen. Eine Ecke war durch unsachgemäße Behandlung aufgerissen, so dass eine hellbraune, sandähnliche Substanz herausrieselte. Sie hatte keinerlei Ähnlichkeit mit irgendeinem gefährlichen biochemischen Stoff, den Wildenstein kannte. Etwas behindert durch die schweren Sicherheitshandschuhe durchschnitt sie unbeholfen die Schnur, öffnete das Paket und hob eine Plastiktüte heraus.
»Eine Sandsack-Attacke!«, schnaubte Richie.
»Bis zum Beweis des Gegenteils behandeln wir das als Gefahrenstoff«, sagte Wildenstein.
»Gewicht?«
»1,2 Kilo. Fürs Protokoll füge ich hinzu, dass alle Messanzeigen für gefährliche biochemische Stoffe unter der Abgashaube negativ sind.«
Mit einem Messlöffel nahm sie eine kleine Menge der Substanz auf, verteilte sie auf ein halbes Dutzend Reagenzgläser, verschloss die Proben und stellte sie in einen Ständer. Dann holte sie ihn unter der Haube hervor und reichte ihn an Richie weiter. Ohne dass sie etwas sagen musste, führte er die übliche Abfolge chemischer Reaktionstests zur Stoffbestimmung durch.
»Schön, dass wir gleich eine halbe Schubkarre von dem Zeug haben«, meinte er gutgelaunt. »Wir können es verbrennen, backen, auflösen und haben immer noch genug übrig, um eine Sandburg zu bauen.«
Wildenstein wartete, während er geschickt die Testreihen durchführte.
»Alle negativ«, verkündete er schließlich. »Mann, was ist das bloß für ein Zeug?«
Wildenstein zog ein zweites Probensortiment. »Mach einen Hitzetest in einer Oxidationsatmosphäre und leite das Gas zum Gasanalysator.«
»Alles klar.« Richie nahm ein weiteres Reagenzglas, verschloss es mit einem Saugröhrchen, das zum Gasanalysator führte, und erhitzte die Probe langsam über einem Bunsenbrenner. Erstaunt beobachtete Wildenstein, wie sich die Probe sehr schnell entzündete, einen Moment lang aufglühte und schließlich, ohne Asche oder andere Rückstände zu hinterlassen, verdampfte.
»Burn, Baby, burn.«
»Was haben Sie, Richie?«
Er untersuchte den Ausdruck. »Reines Kohlendioxid und –monoxid und eine Spur Wasserdampf.«
»Das muss reiner Kohlenstoff gewesen sein.«
»Jetzt hören Sie aber auf, Chef. Seit wann tritt Kohlenstoff in Form von braunem Sand auf?«
Wildenstein betrachtete den Splitt am Boden eines der Probenröhrchen. »Ich schau mir dieses Zeug mal unter dem Stereomikroskop an.«
Sie sprenkelte ein Dutzend Körner auf einen Objektträger und legte ihn auf die Mikroskopplatte, schaltete das Licht ein und blickte durch die Okulare.
»Was sehen Sie?«, fragte Richie.
Aber Wildenstein antwortete nicht. Sie war völlig versunken in den verblüffenden Anblick. Unter dem Mikroskop waren die einzelnen Körner gar nicht braun, sondern entpuppten sich als winzige Bruchstücke eines glasartigen Stoffes, der in unzähligen Farben schillerte – blau, rot, gelb, grün, braun, schwarz, purpur, pink. Ohne die Augen vom Okular abzuwenden, nahm sie einen kleinen Metalllöffel, drückte ihn auf eines der Körner und gab ihm einen kleinen Stups. Sie hörte ein leises Schrammen, als das Korn über das Glas kratzte.
»Was machen Sie da?«, fragte Richie.
Wildenstein schaute hoch. »Haben wir hier nicht irgendwo ein Refraktometer?«
»Ja, irgend so ’n billiges Teil aus dem Mittelalter.« Richie kramte in einem Schrank und zog ein Gerät in einer staubigen gelben Plastikhülle heraus. Er stellte es auf, stöpselte es ein. »Sie wissen, wie man damit umgeht?«
»Ich glaube schon.«
Mit Hilfe des Stereomikroskops nahm sie ein Körnchen der Substanz auf und ließ es in einen Tropfen Mineralöl fallen, den sie auf einen Objektträger gab. Dann schob sie den Objektträger in die Lesekammer des Refraktometers. Nach einigen Fehlversuchen fand sie heraus, wie sie die Skala bedienen musste, um den Messwert zu erhalten.
Sie sah hoch, ein Lächeln auf dem Gesicht.
»Wie ich’s mir gedacht habe. Wir haben einen Brechungsindex von zwei Komma vier.«
»Aha. Und was heißt das?«
»Volltreffer! Das ist es.«
»Das ist was, Chef?«
Sie sah ihn an. »Richie, was besteht aus reinem Kohlenstoff, hat einen Brechungsindex von über zwei und ist hart genug, um Glas zu schneiden?«
»Diamanten?«
»Bravo.«
»Sie meinen, wir haben es hier mit einer Tüte voller industriellem Diamantensplitt zu tun?«
»Ja, sieht so aus.«
Richie nahm seine Sicherheitshaube ab, wischte sich über die Stirn. »Das ist ’ne Premiere für mich.« Er drehte sich um und griff nach einem Telefon. »Ich ruf mal im Krankenhaus an und gebe Entwarnung. Dieser hochrangige Museumstyp soll sich doch tatsächlich in die Hosen gemacht haben.«
3
Frederick Watson Collopy, Direktor des New York Museum of Natural History, verspürte einen Anflug von Gereiztheit, als er im Keller des Museums aus dem Aufzug stieg. Es war Monate her, seit er diese Katakomben zum letzten Mal betreten hatte, und er fragte sich, warum zum Teufel Wilfred Sherman, der Leiter der Mineralogischen Abteilung, so hartnäckig darauf bestanden hatte, dass er ihn hier unten in seinem Labor aufsuchte, statt seinerseits in Collopys Büro im fünften Stock zu kommen.
Der grobkörnige Boden knirschte unter seinen Schuhen, als er in flottem Tempo um die Ecke zum Mineralogie-Labor bog. Als er auf den Griff der geschlossenen Tür drückte, musste er feststellen, dass sie abgesperrt war. Mit erneut aufflammendem Ärger hämmerte Collopy gegen die Tür.
Fast augenblicklich wurde sie von Sherman geöffnet, der sie genauso schnell wieder hinter ihnen beiden schloss und absperrte. Der Kurator sah aufgelöst und verschwitzt aus – wie ein Wrack, um genau zu sein. Geschieht ihm recht, dachte Collopy, er hat schließlich auch allen Grund dazu. Er ließ den Blick suchend durchs Labor gleiten und hatte den Stein des Anstoßes schnell entdeckt: Da, auf einem Arbeitstisch neben einem Stereozoom-Mikroskop, stand das Paket, schmutzig und zerbeult, in einem Plastikbeutel mit doppeltem Reißverschluss. Daneben lag ein halbes Dutzend weißer Briefumschläge.
»Dr. Sherman«, intonierte er, »die fahrlässige Art, in der dieses Material dem Museum zugestellt wurde, hat uns größte Unannehmlichkeiten bereitet. Das Ganze ist ungeheuerlich. Ich will den Namen des Absenders, ich will wissen, warum diese Sendung nicht vorschriftsmäßig angefordert wurde, und ich will wissen, wieso dieses wertvolle Material so nachlässig behandelt und zugestellt wurde, dass eine Panik ausbrechen konnte. Soweit ich weiß, beträgt der Wert von industriellem Diamantensplitt mehrere Tausend Dollar pro Kilo.«
Sherman antwortete nicht. Er schwitzte bloß.
»Man kann sich unschwer vorstellen, mit welcher Schlagzeile die Presse morgen aufwarten wird: ›Giftanschlag im naturgeschichtlichen Museum.‹Ich kann nicht gerade behaupten, dass ich mich auf die Lektüre freue. Ich habe gerade einen Anruf von einem Reporter der Times erhalten – Harriman oder so ähnlich – und muss ihn in einer halben Stunde zurückrufen, um ihm irgendeine Erklärung aufzutischen.«
Sherman schluckte, sagte aber noch immer nichts. Ein Schweißtropfen lief ihm über die Stirn, den er hastig mit einem Taschentuch abwischte.
»Nun? Haben Sie eine Erklärung? Und weshalb musste ich unbedingt in Ihr Labor kommen?«
»Ja«, brachte Sherman endlich heraus. Er nickte in Richtung des Stereomikroskops. »Ich wollte, dass Sie … dass Sie sich das einmal ansehen.«
Collopy erhob sich, ging zum Mikroskop, nahm seine Brille ab und schaute durch das Okular. Vor seinen Augen tanzten flirrende Punkte. »Ich sehe rein gar nichts.«
»Sie müssen es scharf stellen. Da.«
Collopy fummelte am Drehknopf und schob die Probe hin und her, um die richtige Einstellung zu finden, bis er schließlich eine wunderschöne Ansammlung zahlloser Kristallsplitter sah, die in atemberaubenden Farben schimmerten wie ein von hinten angeleuchtetes Buntglasfenster.
»Was ist das?«
»Eine Probe des Splitts aus dem Paket.«
Collopy trat einen Schritt zurück. »Ja, und? Haben Sie oder irgendein Mitarbeiter Ihrer Abteilung das bestellt?«
Sherman zögerte. »Nein, haben wir nicht.«
»Und wie erklären Sie sich dann, Dr. Sherman, dass Diamantensplitt im Wert von mehreren Tausend Dollar an Ihre Abteilung adressiert und geliefert wird?«
»Ich denke …« Sherman hielt inne. Mit zitternder Hand griff er nach einem der weißen Umschläge. Collopy wartete, aber Sherman war wie erstarrt.
»Dr. Sherman?«
Sherman antwortete nicht. Er zog sein Taschentuch hervor und tupfte sich erneut die Stirn.
»Dr. Sherman, sind Sie krank?«
Sherman schluckte. »Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll.«
Collopy erklärte energisch: »Wir haben ein Problem, und ich habe jetzt nur noch …«, er warf einen Blick auf seine Uhr, »fünfundzwanzig Minuten, um diesen Harriman zurückzurufen. Also reißen Sie sich zusammen und erklären Sie mir, was los ist.«
Sherman nickte stumm, tupfte abermals seine Stirn ab. Trotz seines Ärgers empfand Collopy ein gewisses Mitleid mit dem Mann. Im Grunde war er ein großes Kind mittleren Alters, das nie über seine Steinesammlung hinausgewachsen war. Plötzlich erkannte Collopy, dass der Mann sich nicht nur den Schweiß abwischte – ihm flossen Tränen über die Wangen.
»Das ist kein industrieller Diamantensplitt«, sagte Sherman schließlich.
Collopy runzelte die Stirn. »Wie bitte?«
Der Kurator holte tief Luft, schien all seinen Mut zusammenzunehmen. »Industrieller Diamantensplitt besteht aus schwarzen oder braunen Diamanten, die keinen ästhetischen Wert haben. Unter einem Mikroskop sieht man, wie zu erwarten, dunkle kristalline Teilchen. Aber wenn man sich diese Teilchen unter dem Mikroskop anschaut, erkennt man Farben.« Seine Stimme bebte.
»Ja, das habe ich gesehen.«
Sherman nickte. »Winzige bunte Splitter und Kristalle in allen Schattierungen des Regenbogens. Ich habe überprüft, dass es sich tatsächlich um Diamanten handelt, und ich habe mich gefragt …« Er stockte.
»Dr. Sherman?«
»Ich habe mich gefragt: Warum um alles in der Welt besteht ein Beutel Diamantensplitt aus unzähligen Splittern farbiger Diamanten? Zweieinhalb Pfund.«
Ein tiefes Schweigen senkte sich über das Labor. Collopy lief es eiskalt über den Rücken. »Ich verstehe nicht.«
»Das ist kein Diamantensplitt«, brach es aus Sherman heraus. »Das ist die Diamantensammlung des Museums.«
»Was zum Teufel reden Sie da?«
»Der Mann, der die Diamanten letzten Monat gestohlen hat. Er muss die Steine pulverisiert haben. Alle.« Die Tränen flossen Sherman jetzt offen übers Gesicht, aber er machte sich nicht mehr die Mühe, sie zu verbergen.
»Pulverisiert?« Collopy sah wild um sich. »Wie kann man einen Diamanten pulverisieren?«
»Mit einem Vorschlaghammer.«
»Aber Diamanten sind doch angeblich das härteste Material der Welt.«
»Hart, ja. Aber brechen können sie trotzdem.«
»Wie können Sie so sicher sein?«
»Viele unserer Diamanten haben eine einzigartige Farbe. Denken Sie zum Beispiel an die Königin von Narnia. Kein anderer Diamant weist diese blaue Färbung mit den leichten Violett- und Grüntönen auf. Ich konnte jedes kleine Bruchstück identifizieren. Das habe ich die ganze Zeit gemacht – die Splitter sortiert.«
Sherman nahm einen der weißen Umschläge in die Hand und schüttete den Inhalt auf ein Blatt Papier, das auf dem Labortisch lag. Ein Häuflein blauer Splitt entstand. Er deutete darauf. »Die Königin von Narnia.«
Er nahm einen weiteren Umschlag in die Hand, schüttete ein purpurnes Häuflein heraus. »Das Herz der Ewigkeit.«
Er leerte ein Kuvert nach dem anderen. »Der Indigo-Geist. Ultima Thule. Der vierte Juli. Der grüne Sansibar.«
Es war wie ein steter Trommelwirbel, ein vernichtender Schlag nach dem anderen. Collopy starrte entsetzt auf die kleinen Häuflein glitzernden Sandes.
»Das ist ein makabrer Witz«, sagte er schließlich. »Das können unmöglich die Diamanten des Museums sein.«
»Die Farben dieser berühmten Diamanten sind exakt messbar«, antwortete Sherman. »Ich habe harte Daten zu jedem einzelnen. Ich habe die Splitter überprüft. Die Messdaten entsprechen exakt den Färbungen der Diamanten. Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Das sind unsere Steine.«
»Aber doch bestimmt nicht alle?«, sagte Collopy. »Er kann nicht alle vernichtet haben.«
»Das Paket enthielt 2,42 Pfund Diamantensplitt. Das entspricht etwa 5500 Karat. Rechnet man die verschüttete Menge hinzu, dann enthielt die ursprüngliche Lieferung etwa 6000 Karat. Ich habe das Gewicht der gestohlenen Diamanten zusammengerechnet …«
Shermans Stimme stockte.
»Und?«, fragte Collopy schließlich, unfähig, sich länger zu beherrschen.
»Das Gesamtgewicht betrug 6042 Karat«, flüsterte Sherman.
Ein langes Schweigen senkte sich über das Labor, das einzige Geräusch war das schwache Summen der Neonlampen. Schließlich hob Collopy den Kopf und sah Sherman in die Augen.
»Dr. Sherman«, fing er an, aber weil ihm die Stimme versagte, musste er noch einmal ansetzen. »Dr. Sherman. Diese Information darf diesen Raum nicht verlassen.«
Sherman, der ohnehin schon blass war, wurde kreidebleich. Doch nach einem Moment nickte er stumm.
4
William Smithback jr. trat in die Dunst- und Duftschwaden des schummrigen Lokals, das als Knochenburg bekannt war, und blickte sich suchend in dem lauten, überfüllten Raum um. Es war fünf Uhr nachmittags, und die Kneipe war brechend voll. Überall Museumsangestellte, die sich nach einem langen Arbeitstag in dem staubigen Granithaufen auf der anderen Straßenseite die Kehle anfeuchteten. Wieso sie alle unbedingt an einem Ort herumhängen wollten, an dem jeder Quadratzentimeter Wandfläche mit Knochen bedeckt war, nachdem sie schon den ganzen Tag in einer solchen Umgebung verbracht hatten, war Smithback ein Rätsel. Er selbst besuchte die Knochenburg nur aus einem einzigen Grund – wegen des vierzig Jahre alten Single Malt Whiskys, den der Barkeeper unter der Theke bunkerte.
Sechsunddreißig Dollar das Glas war zwar nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber allemal besser, als sich die Eingeweide von einem billigen Cutty Sark für drei Dollar verätzen zu lassen.
Er erspähte das kupferfarbene Haar seiner frisch angetrauten Ehefrau Nora Kelly, die an ihrem Stammplatz in der hintersten Ecke des Lokals saß. Winkend schlenderte er auf sie zu und nahm eine dramatische Pose ein.
»Doch still, was schimmert durch das Fenster dort? Es ist der Ost und Julia die Sonne«, deklamierte er. Dann drückte er ihr einen flüchtigen Kuss auf den Handrücken und einen weitaus intensiveren auf die Lippen und setzte sich ihr gegenüber an den Tisch. »Na, wie läuft’s?«
»Die Arbeit im Museum ist irre aufregend.«
»Du meinst die Panik wegen des vermeintlichen Giftanschlags heute Morgen?«
Sie nickte. »Jemand hat ein Paket für die Mineralogische Abteilung abgegeben, aus dem irgendein Pulver rieselte. Sie hielten es für Anthrax oder so was.«
»Ich hab davon gehört. Genau genommen hat Bruder Bryce heute einen Artikel darüber eingereicht.« Bryce Harriman war Smithbacks Kollege und Erzrivale bei der Times, aber Smithback hatte kürzlich einige Riesenknüller gelandet und sich damit eine kleine Atempause verschafft.
Der Kellner, der wie immer ein Gesicht wie zehn Tage Regenwetter machte, kam an ihren Tisch und erwartete stumm ihre Getränkebestellungen.
»Ich nehme zwei Fingerbreit von dem Glen Grant«, sagte Smithback. »Von dem guten.«
»Ein Glas Weißwein, bitte.«
Der Kellner schlurfte von dannen.
»Es hat also einen Riesenwirbel ausgelöst?«
Nora kicherte. »Du hättest Greenlaw sehen sollen, den Typen, der es entdeckt hat. Er war sich so sicher, dass er sterben würde, dass sie ihn mitsamt Schutzanzug auf einer Tragbahre abtransportieren mussten.«
»Greenlaw? Den kenn ich gar nicht.«
»Er ist der neue stellvertretende Verwaltungschef. Frisch abgeworben vom Stromriesen Con Ed.«
»Und als was hat es sich entpuppt? Das Anthrax meine ich.«
»Als Schleifpulver.«
Smithback gluckste, während er seinen Drink entgegennahm. »O Mann, das ist perfekt.« Er schwenkte die goldene Flüssigkeit in seinem Glas und nahm dann einen Schluck. »Wie ist es passiert?«
»Offenbar wurde das Paket auf dem Transport beschädigt, und die Substanz rieselte heraus. Ein Bote hat es bei Curly abgegeben, und Greenlaw kam zufällig vorbei.«
»Curly? Der alte Kauz mit der Pfeife?«
»Genau.«
»Ist der immer noch im Museum?«
»Der geht nie.«
»Wie hat er’s aufgenommen?«
»Du weißt ja, den bringt so leicht nichts aus der Ruhe. Ein paar Stunden später saß er wieder in seinem Glaskasten, als ob nichts geschehen wäre.«
Smithback schüttelte den Kopf. »Wieso um alles in der Welt schickt irgendjemand einen Beutel Splitt per Boten ans Museum?«
»Keine Ahnung.«
Er nippte wieder an seinem Glas. »Meinst du, es war Absicht?«, fragte er zerstreut. »Dass jemand gezielt eine Panik auslösen wollte?«
»Du liest zu viele Krimis.«
»Weiß man, wer das Paket geschickt hat?«
»Ich hab gehört, dass es keinen Absender trug.«
Dieses kleine Detail machte Smithback plötzlich hellhörig. Er wünschte, er hätte Harrimans Beitrag im internen Netzwerk der Times angeklickt und gelesen. »Weißt du, wie teuer es ist, heutzutage in New York City ein Paket per Boten zu versenden? Vierzig Dollar.«
»Vielleicht war’s ja wertvoller Splitt.«
»Aber warum dann kein Absender? An wen war es adressiert?«
»Soweit ich weiß, einfach an die Mineralogische Abteilung.«
Smithback nippte erneut nachdenklich an seinem Glen Grant. Da war etwas an dieser Geschichte, das die journalistischen Alarmglocken in seinem Kopf läuten ließ. Er fragte sich, ob Harriman der Sache auf den Grund gegangen war. Nicht sehr wahrscheinlich.
Er zog sein Handy aus der Tasche. »Stört es dich, wenn ich kurz telefoniere?«
Nora runzelte die Stirn. »Wenn’s sein muss.«
Smithback wählte die Nummer des Museums und bat, mit der Mineralogischen Abteilung verbunden zu werden. Er hatte Glück: Es war noch jemand da. Schnell ratterte er los: »Hier spricht Mr. Hmmhmm vom Grmhmmhmm-Büro, und ich hätte da mal eine kurze Frage: Was war das für ein Schleifpulver, das heute Morgen die Panik ausgelöst hat?«
»Ich habe Ihren Namen nicht …«
»Hören Sie, ich habe es eilig. Der Direktor wartet auf eine Antwort.«
»Ich weiß nicht.«
»Ist jemand da, der es weiß?«
»Dr. Sherman ist hier.«
»Geben Sie ihn mir.«
Einen Moment später meldete sich eine atemlose Stimme. »Dr. Collopy?«
»Nein, nein«, antworte Smithback in lockerem Ton. »Hier ist William Smithback. Ich bin Reporter bei der Times.«
Schweigen. Dann ein sehr angespanntes »Ja?«
»Wegen der Anthrax-Hysterie heute Morgen.«
»Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen«, sagte die Stimme sofort. »Ich habe bereits alles, was ich weiß, Ihrem Kollegen Mr. Harriman erzählt.«
»Nur eine Routine-Nachfrage, Dr. Sherman, wenn es Ihnen nichts ausmacht …«
Schweigen.
»Dieses Paket war an Sie adressiert?«
»An die Abteilung«, lautete die knappe Antwort.
»Kein Absender?«
»Nein.«
»Und es war voller Splitt?«
»Das ist richtig.«
»Was für eine Art Splitt?«
Zögern. »Korundsplitt.«
»Wie viel ist Korundsplitt wert?«
»Das weiß ich nicht aus dem Stegreif. Nicht viel.«
»Verstehe. Das ist alles. Danke.«
Er legte auf und merkte, dass Nora ihn ansah. »Es ist unhöflich, in einem Restaurant zu telefonieren.«
»Hey, ich bin Reporter. Es ist mein Job, unhöflich zu sein.«
»Zufrieden?«
»Nein.«
»Ein Paket Splitt ist im Museum angekommen. Es hatte ein Loch. Jemand ist ausgeflippt. Ende der Geschichte.«
»Ich weiß nicht.« Smithback nahm einen weiteren großen Schluck von seinem Glen Grant. »Der Typ eben klang fürchterlich nervös.«
»Dr. Sherman? Der ist von Natur aus nervös.«
»Er klang mehr als nervös. Er klang verängstigt.«
Er klappte sein Handy wieder auf, und Nora stöhnte. »Wenn du jetzt anfängst herumzutelefonieren, gehe ich nach Hause.«
»Komm schon, Nora. Nur noch ein Anruf, dann gehen wir schnell rüber zum Rattlesnake Café und essen was. Diesen einen Anruf muss ich noch machen. Es ist schon nach fünf, und ich muss mich beeilen, wenn ich die Leute noch vorm Feierabend erwischen will.«
Schnell wählte er die Auskunft an, erhielt eine Nummer, tippte sie ein. »Amt für Gesundheit und Soziales.«
Nachdem man ihn ein bisschen herumgereicht hatte, wurde er schließlich mit dem gewünschten Labor verbunden.
»Sentinel Labor«, meldete sich eine Stimme.
»Mit wem spreche ich, bitte?«
»Richard. Und mit wem spreche ich?«
»Hi, Richard, hier ist William Smithback von der Times. Sind Sie der Leiter des Labors?«
»Zurzeit ja. Der Chef ist gerade nach Hause gegangen.«
»Glück für Sie. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?«
»Sie sagten, Sie seien Reporter?«
»Das ist richtig.«
»Na dann, meinetwegen.«
»Hat Ihr Labor das Paket untersucht, das heute Morgen im Museum abgegeben wurde?«
»So ist es.«
»Was war drin?«
Smithback hörte ein Schnauben. »Diamantensplitt.«
»Kein Korund?«
»Nein. Diamanten.«
»Haben Sie den Splitt persönlich untersucht?«
»Ja.«
»Wie sah er aus?«
»Auf den ersten Blick wie ein Sack mit braunem Sand.«
Smithback überlegte einen Moment. »Wie haben Sie herausgefunden, dass es sich um Diamantensplitt handelt?«
»Durch den Brechungsindex der Teilchen.«
»Verstehe. Und eine Verwechslung mit Korund ist ausgeschlossen?«
»Völlig ausgeschlossen.«
»Sie haben den Splitt doch sicher auch unter einem Mikroskop untersucht, oder?«
»Ja.«
»Wie sah er aus?«
»Wunderschön. Wie ein Haufen kleiner farbiger Kristalle.«
Smithback fühlte plötzlich ein Kribbeln im Nacken. »Farbig? Was meinen Sie damit?«
»Splitter und Teilchen in allen Farben des Regenbogens. Ich hatte keine Ahnung, dass Diamantensplitt so schön ist.«
»Kam Ihnen das nicht seltsam vor?«
»Viele Dinge, die hässlich sind, wenn man sie mit bloßem Auge betrachtet, sehen unter dem Mikroskop wunderschön aus. Brotschimmel zum Beispiel. Oder Sand, was das betrifft.«
»Aber Sie sagten, der Splitt sei braun gewesen.«
»Nur, wenn man ihn zusammenmischte.«
»Verstehe. Was haben Sie mit dem Paket gemacht?«
»Wir haben es an das Museum zurückgeschickt und die Sache als Fehlalarm abgehakt.«
»Vielen Dank.«
Smithback klappte langsam sein Handy zu. Unmöglich. Das konnte nicht sein.Er blickte auf und stellte fest, dass Nora ihn mit eindeutig verärgerter Miene ansah. Er griff nach ihrer Hand. »Es tut mir wirklich leid, aber ein Telefonat muss ich noch erledigen.«
Sie verschränkte die Arme. »Und ich dachte, wir wollten uns einen netten Abend machen.«
»Nur noch einen Anruf. Bitte. Ich lass dich mithören. Glaub mir, das wird interessant.«
Noras Wangen färbten sich rosa. Smithback wusste, was das zu bedeuten hatte: Seine Frau wurde allmählich sauer.
Schnell wählte er noch einmal die Nummer des Museums und drückte den Lautsprecherknopf des Handys. »Dr. Sherman?«
»Ja?«
»Hier ist noch einmal Smithback von der Times.«
»Mr. Smithback«, kam die schrille Antwort. »Ich habe Ihnen bereits alles gesagt, was ich weiß. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, sonst verpasse ich meinen Zug.«
»Ich weiß, dass es kein Korundsplitt war, der heute Morgen im Museum abgegeben wurde.«
Schweigen.
»Ich weiß, was es wirklich war.«
Wieder Schweigen.
»Die Diamantensammlung des Museums.«
In dem erneut einsetzenden Schweigen traf ihn Noras durchdringender Blick.
»Dr. Sherman, ich komme rüber ins Museum, um mit Ihnen zu sprechen. Wenn Dr. Collopy noch da ist, wäre es gut, wenn er sich zu uns gesellen würde – oder zumindest telefonisch zur Verfügung stehen könnte. Ich weiß nicht, was Sie meinem Kollegen Harriman erzählt haben, aber ich lasse mir dieses Märchen nicht auftischen. Schlimm genug, dass dem Museum eine Diamantenkollektion – die wertvollste der Welt – gestohlen wurde. Ich bin sicher, das Kuratorium wäre wenig begeistert davon, wenn direkt im Anschluss an die Enthüllung, dass ebendiese Sammlung gerade zu industriellem Schleifpulver zerstampft wurde, ein Vertuschungsskandal aufgedeckt würde. Haben wir uns verstanden, Dr. Sherman?«
Die Stimme, die schließlich aus dem Handy ertönte, klang sehr schwach und zittrig. »Wir wollten nichts vertuschen. Das versichere ich Ihnen. Die Bekanntmachung hat sich nur, äh, verzögert.«
»Ich bin in zehn Minuten bei Ihnen. Bleiben Sie, wo Sie sind.«
Anschließend rief Smithback bei seinem Redakteur bei der Times an. »Fenton? Du kennst doch den Beitrag, den Harriman über die Anthrax-Panik im Museum eingereicht hat? Ich habe die wahre Geschichte, und sie wird einschlagen wie eine Bombe. Halt mir die Titelseite frei!«
Er klappte das Handy zu und schaute hoch. Nora war nicht mehr wütend. Sie war kreidebleich.
»Diogenes Pendergast«, flüsterte sie. »Er hat die Diamanten vernichtet?«
Smithback nickte.
»Aber warum?«
»Das ist eine sehr gute Frage. Zu meinem unendlichen Bedauern muss ich allerdings jetzt leider sofort los, Schatz. Es ist unverzeihlich, ich weiß, und ich schulde dir ein Essen im Rattlesnake Café, aber ich muss ein paar Interviews führen und bis Mitternacht einen Artikel schreiben, wenn ich es in die landesweite Ausgabe schaffen will. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Warte nicht auf mich.«
Er erhob sich und gab ihr einen Kuss.
»Du bist unglaublich«, sagte sie mit ehrfürchtiger Stimme.
Smithback zögerte, von einer ungewohnten Empfindung erfasst. Es dauerte einen Moment, bis er merkte, was es war: Er wurde rot.
5
Dr. Frederick Watson Collopy stand hinter dem eindrucksvollen Schreibtisch aus dem 19. Jahrhundert in seinem Eckbüro im Südwestturm des Museums. Die riesige, mit Leder bezogene Schreibtischplatte war leer, abgesehen von einer Ausgabe der New York Times vom selben Morgen. Er hatte die Zeitung noch nicht aufgeschlagen. Das war nicht nötig. Collopy konnte auch so alles sehen, was er sehen musste: Auf der Titelseite, über der Knickfalte, prangte die Schlagzeile in der größten Schrifttype, die man bei der Times zu benutzen wagte.
Die Katze war aus dem Sack und ließ sich nicht wieder einfangen.
Collopy war überzeugt, dass er als Direktor des New York Museum of Natural History die bedeutendste Position in der amerikanischen Wissenschaftswelt bekleidete. Seine Gedanken wanderten vom Thema des Artikels zu den Namen seiner berühmten Vorgänger: Ogilvy, Scott, Throckmorton. Collopys Ziel, sein höchster Ehrgeiz, war es, seinen eigenen Namen in diese erlauchte Riege einzureihen – und nicht schmählich zu versagen wie seine beiden unmittelbaren Vorgänger: der kürzlich verstorbene und wenig betrauerte Winston Wright oder die unfähige Olivia Merriam.
Doch diese Schlagzeile, die ihm da von der Titelseite der Times entgegensprang, könnte leicht dazu führen, dass er mit Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt wurde. Er hatte in jüngster Vergangenheit mehrere heikle Situationen überstanden – eine ganze Reihe schlimmer Skandale, die einen weniger starken Mann zu Fall gebracht hätten. Aber er hatte sie souverän und entschlossen gehandhabt; und genau das würde er auch jetzt wieder tun.
Es klopfte leise an der Tür.
»Herein.«
Hugo Menzies, der bärtige Leiter der Ethnologischen Abteilung, wie immer elegant und ohne das übliche Ausmaß an akademischer Schlampigkeit gekleidet, betrat den Raum und nahm wortlos Platz. Ihm folgten die Leiterin der PR-Abteilung, Josephine Rocco, und die Justiziarin des Museums, die ironischerweise Beryl Darling hieß, von der Anwaltssozietät Wilfred, Spragg und Darling.
Collopy blieb stehen, beobachtete das Trio, während er sich nachdenklich übers Kinn strich. Schließlich sagte er: »Sie können sich sicher denken, wieso ich Sie herbestellt habe.« Er sah auf die Zeitung hinab. »Ich nehme an, Sie haben die Times gelesen?«
Seine Zuhörer bestätigten dies mit einem stummen Nicken.
»Es war falsch, diese Sache auch nur kurzfristig vertuschen zu wollen. Als ich diese Position als Direktor des Museums antrat, habe ich mir geschworen, dass ich diese Einrichtung anders führen werde, dass ich den geheimniskrämerischen und manchmal paranoiden Führungsstil der letzten Leiter nicht übernehmen werde. Ich war überzeugt, dass diese großartige Institution stark genug sein wird, um den Widrigkeiten von Skandalen und Kontroversen zu trotzen.« Er hielt inne. »Mein Versuch, die Vernichtung unserer Diamantensammlung herunterzuspielen, sie zu verheimlichen, war ein Fehler. Ich habe gegen meine eigenen Grundsätze verstoßen.«
»Eine Entschuldigung uns gegenüber ist schön und gut«, erklärte Darling in ihrem üblichen forschen Ton, »aber warum haben Sie sich nicht mit mir beraten, ehe Sie Ihre übereilte und schlecht durchdachte Entscheidung getroffen haben? Sie müssen doch gewusst haben, dass Sie damit nicht durchkommen können. Das hat dem Museum ernsthaften Schaden zugefügt und meine Arbeit erheblich erschwert.«
Darling nahm nie ein Blatt vor den Mund, und Collopy rief sich ins Gedächtnis, dass diese unverblümte Offenheit genau der Grund war, weshalb das Museum ihr vierhundert Dollar die Stunde zahlte. Er hob die Hand. »Vollkommen richtig. Aber diese Entwicklung habe ich nicht einmal in meinen schlimmsten Albträumen vorausgesehen – die Entdeckung, dass unsere Diamanten zu …« Seine Stimme versagte; er konnte nicht weitersprechen. Seine Zuhörer wechselten verlegen die Sitzposition.
Collopy fing noch einmal an. »Wir müssen handeln. Wir müssen reagieren. Deshalb habe ich diese Besprechung anberaumt.«
Als er innehielt, hörte Collopy gedämpften Lärm vom Museum Drive heraufdringen – die Rufe einer wachsenden Demonstrantenschar, dazwischen Polizeisirenen und Megaphone.
Rocco ergriff das Wort. »Die Telefone in meinem Büro stehen nicht mehr still. Es ist jetzt neun Uhr, und ich glaube, dass wir bis zehn, allerspätestens bis elf, eine offizielle Erklärung abgeben müssen. Die Leute sind außer sich. So was habe ich in meiner gesamten PR-Laufbahn noch nicht erlebt.«
Menzies rutschte unruhig auf seinem Stuhl herum, fuhr sich glättend über sein silbergraues Haar. »Darf ich einen Vorschlag machen?«
Collopy nickte. »Bitte, Hugo.«
Menzies räusperte sich, der Blick seiner tiefblauen Augen huschte zum Fenster und zurück zu Collopy. »Als Erstes müssen wir uns klarmachen, Frederick, dass sich an dieser Katastrophe nichts mehr drehen lässt. Hören Sie sich die aufgebrachte Menge da draußen an – die Tatsache, dass wir auch nur daran gedacht haben, einen derartigen Verlust zu vertuschen, treibt die Leute auf die Barrikaden. Nein. Wir müssen offen und ehrlich zugeben, was passiert ist. Unseren Fehler eingestehen. Ohne Beschönigungen.« Er schaute Rocco an. »Das ist mein erster Punkt, und ich hoffe, darin sind wir uns alle einig.«
Collopy nickte erneut. »Und Ihr zweiter?«
Menzies beugte sich leicht nach vorn. »Es reicht nicht, einfach zu reagieren. Wir müssen in die Offensive gehen.«
»Was meinen Sie damit?«
»Wir müssen irgendetwas Tolles auf die Beine stellen. Eine sensationelle Ankündigung machen, irgendetwas tun, das New York City und die Welt daran erinnert, dass wir trotz allem ein großartiges Museum sind. Vielleicht eine wissenschaftliche Expedition starten oder irgendein außergewöhnliches Forschungsprojekt initiieren.«
»Wird man das nicht sofort als Ablenkungsmanöver durchschauen?«, fragte Rocco.
»Vielleicht. Aber die Stimmen der Kritiker werden nach ein oder zwei Tagen verstummen, und dann haben wir die Möglichkeit, wieder auf uns aufmerksam zu machen und für positive Publicity zu sorgen.«
»Was für eine Art von Projekt schwebt Ihnen denn da vor?«, fragte Collopy.
»So weit habe ich noch nicht gedacht.«
Rocco nickte bedächtig. »Vielleicht würde es funktionieren. Wir könnten das Ereignis mit einem Galaempfang, nur für die Crème de la Crème, verbinden, es zu dem gesellschaftlichen Ereignis der Saison machen. Das wird die Journaille und die Politiker zum Schweigen bringen, weil sie natürlich eine Einladung haben wollen.«
»Klingt vielversprechend«, erklärte Collopy.
Nach kurzem Zögern sagte Darling: »Das ist eine schöne Theorie. Alles, was uns fehlt, ist die Expedition, das Ereignis oder was auch immer.«
In diesem Augenblick summte Collopys Gegensprechanlage. Verärgert drückte er den Knopf.
»Mrs. Surd, wir wollen nicht gestört werden.«
»Gewiss, Dr. Collopy, aber … also, das hier ist äußerst ungewöhnlich.«
»Jetzt nicht.«
»Es erfordert eine sofortige Antwort.«
Collopy seufzte. »Kann es nicht zehn Minuten warten, Himmelherrgott noch mal?«
»Es handelt sich um eine telegrafische Banküberweisung, eine Spende von zehn Millionen Euro für …«
»Eine Spende von zehn Millionen Euro? Her damit.«
Mrs. Surd, ebenso tüchtig wie rundlich, kam mit einem Schriftstück herein.
»Entschuldigen Sie mich einen Moment.« Collopy schnappte sich das Schriftstück. »Von wem ist es, und wo muss ich unterschreiben?«
»Es ist von Comte Thierry de Cahors. Er spendet dem Museum zehn Millionen Euro, mit denen das Grab des Senef restauriert und wieder eröffnet werden soll.«
»Das Grab des Senef? Was zum Teufel ist das?« Collopy schleuderte das Schriftstück auf den Schreibtisch. »Darum kümmere ich mich später.«
»Aber hier steht, Sir, dass die Summe auf ein transatlantisches Treuhandkonto eingezahlt wurde und innerhalb von einer Stunde angenommen oder abgelehnt werden muss.«
Collopy widerstand dem Drang, die Hände zu ringen. »Wir schwimmen in Spenden mit solchen verdammten Auflagen! Was wir brauchen, sind frei verfügbare Gelder, um unsere Rechnungen zu bezahlen! Faxen Sie diesem Graf Dingsbums und versuchen Sie, ihn zu einer Spende ohne irgendwelche Auflagen zu überreden. Fassen Sie das Schreiben in meinem Namen ab, mit den üblichen Höflichkeitsfloskeln. Egal, gegen welche Windmühle er kämpft, wir brauchen das Geld für etwas anderes.«
»Ja, Dr. Collopy.«
Die Assistentin drehte sich um, und Collopy wandte sich wieder der Gruppe zu. »Also, ich glaube, Beryl hatte das Wort.«
Die Rechtsanwältin öffnete den Mund, aber Menzies gebot ihr mit einer Handbewegung Einhalt. »Mrs. Surd? Bitte warten Sie noch ein paar Minuten, bevor Sie mit dem Comte des Cahors Kontakt aufnehmen.«
Mrs. Surd zögerte, blickte fragend zu Collopy. Als der Direktor zustimmend nickte, verließ sie den Raum und schloss die Tür hinter sich.
»Okay, Hugo, was hat das zu bedeuten?«, fragte Collopy.
»Ich versuche mich an die Details zu erinnern. Das Grab des Senef – das kommt mir bekannt vor. Und das Gleiche gilt, wenn ich es recht bedenke, für den Comte des Cahors.«
»Könnten wir zum Thema zurückkehren?«, fragte Collopy.
Menzies beugte sich plötzlich vor. »Frederick, das tun wir gerade. Denken Sie an die Geschichte Ihres Museums zurück. Beim Grab des Senef handelt es sich um ein ägyptisches Grabmal, das hier im Museum ausgestellt wurde, und zwar von seiner urprünglichen Eröffnung bis zur Wirtschaftskrise in den dreißiger Jahren, als die Ausstellung geschlossen wurde.«
»Und?«
»Wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, haben die Franzosen dieses Grab während des napoleonischen Feldzugs in Ägypten geraubt und auseinandergenommen. Später haben die Briten es dann in ihren Besitz gebracht. Es wurde von einem Gönner des Museums erworben und als eine der ersten Ausstellungen im Keller des Museums wiederaufgebaut. Dort muss es immer noch sein.«
»Und wer ist dieser Cahors?«, fragte Darling.
»Napoleon führte ein Heer von Naturkundlern und Archäologen mit, als er mit seiner Armee in Ägypten einmarschierte. Ein Mann namens Cahors leitete die Archäologengruppe. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Comte ein Nachfahre von ihm ist.«
Collopy runzelte die Stirn. »Ja, und was, bitte schön, hat das mit uns zu tun?«
»Verstehen Sie nicht? Das ist genau das, wonach wir suchen.«
»Ein staubiges altes Grab?«
»Genau! Wir kündigen die Spende des Grafen ganz groß an, setzen einen Eröffnungstermin fest, mit Galaparty und allem Drum und Dran, und machen ein Medienereignis daraus.« Menzies warf Rocco einen fragenden Blick zu.
»Ja«, erklärte Rocco. »Ja, das könnte klappen. Ägypten kommt beim breiten Publikum immer sehr gut an.«
»Könnte klappen? Es wird klappen. Das Schöne daran ist, dass das Grab bereits aufgebaut ist. Die Bildnisse des Heiligen-Ausstellung läuft aus, es ist Zeit für etwas Neues. Wir könnten das Ganze in zwei Monaten – oder weniger – auf die Beine stellen.«
»Viel hängt auch davon ab, in welchem Zustand das Grab ist.«
»Aber es ist auf alle Fälle vor Ort und verfügbar. Vielleicht müssen wir es nur ausfegen. Unsere Lagerräume sind voll mit allen möglichen ägyptischen Exponaten, die wir in das Grab stellen könnten, um die Ausstellung abzurunden. Der Graf bietet uns einen Haufen Geld für alle erforderlichen Restaurierungsarbeiten.«
»Ich verstehe das nicht«, sagte Darling. »Wie konnte eine ganze Ausstellung siebzig Jahre lang vergessen werden?«
»Zum einen ist sie zugemauert worden – das hat man häufig mit alten Ausstellungen gemacht, damit sie keinen Schaden nehmen.« Menzies lächelte ein wenig bekümmert. »Dieses Museum hat einfach zu viele Artefakte und zu wenig finanzielle Mittel oder Kuratoren, um sich darum zu kümmern. Deshalb fordere ich ja auch schon seit Jahren, dass wir die Stelle eines Museumshistorikers einrichten. Wer weiß, welche anderen Geheimnisse noch in längst vergessenen Winkeln schlummern?«
Ein kurzes Schweigen legte sich über den Raum, das abrupt durchbrochen wurde, als Collopy mit der flachen Hand auf den Tisch schlug. »So machen wir’s!« Er griff nach dem Telefon. »Mrs. Surd? Teilen Sie dem Grafen mit, dass er die Spende freigeben soll. Wir akzeptieren seine Bedingungen.«
6
Nora Kelly stand in ihrem Labor und schaute auf einen großen Arbeitstisch, der mit Bruchstücken antiker Anasazi-Keramik bedeckt war. Die Tonscherben bestanden aus einem außergewöhnlichen Material, das im hellen Licht fast golden schimmerte. Dieser Glanz wurde durch die zahllosen Muskovitteilchen in der ursprünglichen Tonerde hervorgerufen. Nora hatte die Scherben während einer Sommerexpedition zum Four Corner-Gebiet im Südwesten gesammelt und die Bruchstücke jetzt ihrem genauen Fundort entsprechend auf einer riesigen Reliefkarte der Gegend angeordnet.
Sie schaute angestrengt auf die schimmernde Sammlung und versuchte erneut, einen Sinn in der Anordnung zu entdecken. Dies war der Dreh- und Angelpunkt ihres wichtigsten Forschungsprojekts im Museum: Ihr Ziel war es, herauszufinden, auf welchem Wege sich diese seltene Glimmerkeramik von ihrem Ursprung im südlichen Utah über den ganzen Südwesten und darüber hinaus verbreitet hatte. Die Töpferwaren gingen auf eine religiöse Kachina-Sekte zurück, die vom aztekischen Mexiko nach Utah gekommen war. Wenn es Nora gelänge, den Verbreitungsweg der Keramik im Südwesten zu rekonstruieren, dann würde sie ihrer festen Überzeugung nach auch Aufschluss über die Verbreitung des Kachina-Kultes gewinnen.
Doch es gab so viele Scherben und so viele Kohlenstoff-14-Daten, dass es ein großes Problem war, die vielen verschiedenen Variablen in einen logischen Zusammenhang zu bringen, und sie hatte noch nicht einmal ansatzweise begonnen, dieses Problem zu lösen. Konzentriert betrachtete sie die Sammlung: Die Antwort lag direkt vor ihr. Sie musste sie nur finden.
Seufzend nahm sie einen Schluck von ihrem Kaffee. Ein Glück, dass sie vor dem Sturm, der oben im Museum tobte, in ihr Kellerlabor flüchten konnte. Die Anthrax-Panik gestern war schon schlimm genug gewesen, aber heute war es noch schlimmer – was zu einem Großteil ihrem Ehemann Bill zu verdanken war, der ein einmaliges Talent dafür hatte, in Wespennester zu stechen. Heute Morgen war sein Artikel in der Times erschienen, in dem er berichtet hatte, dass es sich bei dem Pulver in Wahrheit um die gestohlene Diamantenkollektion des Museums handelte und dass der Dieb diese auf zig Millionen Dollar geschätzte Sammlung zu Staub zermahlen hatte. Die Nachricht hatte einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, der schlimmer war als alles, was Nora bisher im Museum erlebt hatte. Der Bürgermeister, in die Enge getrieben von einem Riesenaufgebot an Fernsehkameras vor seinem Büro, hatte das Museum bereits heftig angegriffen und die sofortige Entlassung des Direktors gefordert.
Nora zwang sich, ihre Aufmerksamkeit wieder den Tonscherben zuzuwenden. Die Verbreitungswege ließen sich allesamt an einen einzigen Ort zurückverfolgen: an den Ursprungsort der seltenen Tonerde am Fuße des Kaiparwits-Plateaus in Utah, wo die Bewohner einer großen, in den Canyons versteckten Felsensiedlung es abgebaut und gebrannt hatten. Von dort aus war es an so weit entfernte Orte wie Nordmexiko und Osttexas gebracht worden. Aber wie? Und wann? Und von wem?
Sie erhob sich und ging zu einem Schrank, aus dem sie den letzten Beutel mit Tonscherben holte. Im Labor herrschte Grabesstille, das einzige Geräusch war das leise Zischen der Lüftungsschächte. Hinter dem eigentlichen Labor befanden sich die großen Lagerräume des Museums: alte Eichenschränke mit Milchglasscheiben voller Tonscherben, Pfeilspitzen, Äxten und anderen Artefakten. Ein schwacher Hauch von Paradichlorbenzol wehte aus dem direkt angrenzenden Lagerraum mit der indianischen Mumie herüber. Nora fing an, die Tonscherben auf dem letzten freien Raum der Reliefkarte auszulegen, und überprüfte noch einmal die Signatur auf jedem Bruchstück, bevor sie es ablegte.
Plötzlich hielt sie inne. Sie hatte gehört, wie die Labortür quietschend geöffnet wurde, und vernahm das Geräusch leiser Schritte auf dem staubigen Boden. Hatte sie die Tür nicht abgesperrt? Es war eine dumme Angewohnheit, die Tür abzuschließen, aber der riesige, stille Keller des Museums mit seinen düsteren Korridoren und dunklen Lagerräumen voller seltsamer und furchterregender Artefakte hatte ihr schon immer eine Heidenangst eingejagt. Und sie konnte nicht vergessen, was ihrer Freundin Margo Green erst vor wenigen Wochen in einem verdunkelten Ausstellungsraum zwei Stockwerke über diesem Labor zugestoßen war.
»Ist da jemand?«, rief sie.
Eine Gestalt tauchte aus dem Halbdunkel auf, zuerst die Umrisse eines Gesichtes, dann ein kurz geschnittener, silbergrauer Bart – und Nora atmete erleichtert auf. Es war nur Hugo Menzies, der Leiter der Ethnologischen Abteilung und ihr unmittelbarer Vorgesetzter. Er hatte sich kürzlich mit einer Gallenkolik herumgeschlagen und wirkte immer noch ein bisschen blass um die Nase, die fröhlichen Augen rot gerändert.
»Hallo, Nora«, sagte der Kurator mit einem liebenswürdigen Lächeln. »Darf ich?«
»Selbstverständlich.«
Menzies glitt auf einen Stuhl. »Was für eine himmlische Ruhe hier unten. Sind Sie allein?«
»Ja. Wie ist die Lage da oben?«
»Die Menschenmenge vor dem Museum wächst weiter an.«
»Ich hab die Leute gesehen, als ich gekommen bin.«
»Das Ganze ist äußerst unschön. Sie beschimpfen und schikanieren die eintreffenden Mitarbeiter und blockieren den Verkehr auf dem Museum Drive. Und ich fürchte, das ist nur der Anfang. Es ist eine Sache, wenn der Bürgermeister und der Gouverneur Erklärungen abgeben, aber eine ganz andere Sache, wenn auch die Bürger New Yorks in Harnisch geraten. Gott bewahre uns vor dem Zorn des vulgus mobile.«
Nora schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, dass Bill der Urheber …«
Menzies legte ihr sanft die Hand auf die Schulter. »Bill war nur der Bote. Er hat dem Museum einen Gefallen getan, als er diesen unklugen Vertuschungsplan aufgedeckt hat, bevor er sich durchsetzen konnte. Die Wahrheit wäre ohnehin ans Licht gekommen.«
»Ich begreife nicht, wieso sich jemand die Mühe macht, die Diamanten zu stehlen, um sie dann zu vernichten.«
Menzies zuckte die Achseln. »Wer weiß schon, was im kranken Hirn eines Geistesgestörten vor sich geht? Zumindest zeugt es von einem unstillbaren Hass auf das Museum.«
»Was hat das Museum ihm getan?«
»Diese Frage kann nur eine einzige Person beantworten. Aber ich bin nicht hier, um Mutmaßungen über die Motive eines Kriminellen anzustellen. Ich bin aus einem ganz speziellen Grund hier, der mit den Ereignissen da oben zu tun hat.«
»Ich verstehe nicht.«
»Ich komme gerade von einer Besprechung in Dr. Collopys Büro. Wir haben eine Entscheidung getroffen, und diese Entscheidung betrifft auch Sie.«
Nora wartete, von leiser Beunruhigung beschlichen.
»Kennen Sie das Grab des Senef?«
»Nie davon gehört.«
»Nicht überraschend. Kaum ein Museumsmitarbeiter weiß etwas darüber. Es handelt sich um eine der ersten Ausstellungen des Museums, ein ägyptisches Grab aus dem Tal der Könige, das in diesen Kellergewölben wieder aufgebaut wurde. In den dreißiger Jahren wurde die Ausstellung geschlossen, das Grab zugemauert und seither nie wieder geöffnet.«
»Und?«
»Was das Museum im Moment braucht, ist eine positive Meldung, irgendein Projekt, das jeden daran erinnert, dass wir immer noch wichtige Arbeit leisten. Eine Ablenkung, sozusagen. Diese Ablenkung wird das Grab des Senef sein. Wir werden es wieder öffnen, und ich möchte, dass Sie die Leitung dieses Projekts übernehmen.«
»Ich? Aber ich habe meine Forschungsarbeit seit Monaten aufgeschoben, um bei der Organisation der Bildnisse des Heiligen-Ausstellung zu helfen.«
Ein ironisches Lächeln umspielte Menzies’ Lippen. »Das ist richtig, und deshalb bitte ich Sie, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich habe gesehen, was Sie für die Bildnisse des Heiligen-Ausstellung geleistet haben. Sie sind die Einzige in der Abteilung, die das Zeug für dieses Projekt hat.«
»Wie viel Zeit hätte ich?«
»Collopy möchte die Sache im Eiltempo durchziehen. Wir haben sechs Wochen.«
»Das ist nicht Ihr Ernst.«
»Die Existenz des Museums steht auf dem Spiel. Um die finanzielle Lage ist es schon seit längerem sehr schlecht bestellt. Und angesichts dieser neuen Welle negativer Publicity könnte alles geschehen.«
Nora schwieg.
»Was diese Sache ins Rollen gebracht hat«, fuhr Menzies leise fort, »ist, dass wir gerade zehn Millionen Euro – dreizehn Millionen Dollar – erhalten haben, um das Projekt zu finanzieren. Geld ist kein Thema. Wir werden die uneingeschränkte Unterstützung des Museums erhalten, vom Kuratorium bis zu den Gewerkschaften. Das Grab des Senef war die ganze Zeit verschlossen, deswegen müsste es sich eigentlich in relativ gutem Zustand befinden.«
»Bitten Sie mich nicht, das zu tun. Betrauen Sie Ashton damit.«
»Ashton fehlt der Kampfgeist. Er ist Kontroversen nicht gewachsen. Ich habe gesehen, wie gut Sie sich gegenüber den Demonstranten bei der Eröffnung der Bildnisse des Heiligen-Ausstellung geschlagen haben. Das Museum kämpft ums Überleben, Nora. Ich brauche Sie. Das Museum braucht Sie.«
Schweigen. Nora schaute sich nach ihren Tonscherben um; sie hatte ein schrecklich flaues Gefühl im Magen. »Ich habe keinen blassen Schimmer von Ägyptologie.«
»Wir engagieren einen renommierten Ägyptologen zu Ihrer Unterstützung.«
Nora erkannte, dass es keinen Ausweg gab. Sie stieß einen tiefen Seufzer aus. »Na gut. Ich mach’s.«
»Bravo! Das wollte ich hören. Also dann, die Idee ist noch nicht sehr weit gediehen, aber das Grab ist seit siebzig Jahren nicht mehr ausgestellt worden, also wird es sicher eine kleine Auffrischung nötig haben. Heutzutage reicht es nicht mehr, eine statische Ausstellung zu organisieren: Wir brauchen Multimedia. Und natürlich einen Galaempfang zur Eröffnung, ein Ereignis, für das jeder New Yorker mit gesellschaftlichen Ambitionen eine Eintrittskarte haben will.«
Nora schüttelte den Kopf. »Und das alles in sechs Wochen?«
»Ich hatte gehofft, dass Sie vielleicht noch ein paar Ideen hätten.«
»Bis wann brauchen Sie die?«
»Sofort, fürchte ich. Dr. Collopy hat in einer halben Stunde eine Pressekonferenz anberaumt, auf der er die Ausstellung ankündigen will.«
»O nein.« Nora sackte auf ihrem Stuhl zusammen. »Und Sie sind sicher, dass wir Spezialeffekte brauchen? Ich hasse dieses aufwendige Computerdesign. Es lenkt doch nur von den Exponaten ab.«
»Anders lassen sich Museumsausstellungen heutzutage nicht mehr machen, leider. Schauen Sie sich die neue Abraham-Lincoln-Bibliothek an. Ja, in gewisser Weise ist es vielleicht ein bisschen vulgär, aber wir leben nun mal im 21. Jahrhundert und müssen mit dem Fernsehen und mit Videospielen konkurrieren. Bitte, Nora: Ich brauche sofort ein paar Ideen. Man wird den Direktor mit Fragen bombardieren, und er möchte in der Lage sein, etwas über die Ausstellung zu erzählen.«
Nora wurde ganz schlecht bei dem Gedanken, ihre Forschungsarbeit schon wieder aufzuschieben, siebzig Stunden die Woche zu arbeiten und ihren Ehemann, den sie erst vor wenigen Monaten geheiratet hatte, kaum noch zu Gesicht zu bekommen. Doch wenn sie diese Arbeit übernahm – und wie es schien, hatte sie keine andere Wahl –, wollte sie sie auch so gut wie möglich machen.
»Wir wollen nichts Klischeehaftes«, sagte sie. »Keine Mumien, die sich in ihren Sarkophagen aufrichten. Und es sollte lehrreich sein.«
»Ganz meine Meinung.«
Nora überlegte einen Moment. »Das Grab wurde ausgeraubt, richtig?«
»Es wurde im Altertum geplündert, wie die meisten ägyptischen Gräber, wahrscheinlich von denselben Priestern, die Senef beigesetzt hatten – der übrigens kein Pharao war, sondern Wesir und Regent von Thutmosis IV.«
Nora verdaute die Informationen.
Sie sollte es wohl eigentlich als große Ehre betrachten, dass man sie bat, die Leitung einer bedeutenden neuen Ausstellung zu übernehmen, die zudem noch ganz besonderes Aufsehen erregen würde. Wider Willen spürte sie, dass sie den Gedanken ziemlich reizvoll fand.
»Wenn Sie etwas Dramatisches suchen«, sagte sie, »warum dann nicht den Moment des Grabraubs nachstellen? Wir könnten in Szene setzen, wie die Grabräuber das Grab plündern – zeigen, wie sie sich vor Entdeckung fürchten, was mit ihnen geschehen würde, falls man sie erwischen würde. Dazu lassen wir eine Stimme aus dem Off laufen, die erklärt, was passiert ist, wer Senef war, solche Sachen.«
Menzies nickte. »Hervorragend, Nora.«
Nora spürte eine wachsende Erregung. »Wenn wir es richtig anstellen, mit computergesteuerter Beleuchtung und allem Drum und Dran, könnten wir es zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Besucher machen. Wir könnten das Grab nutzen, um Geschichte lebendig werden zu lassen.«
»Nora, eines Tages werden Sie dieses Museum leiten.«
Sie errötete. Die Vorstellung war ihr durchaus nicht unangenehm.
»Ich hatte selbst an eine Show mit besonderen Licht- und Toneffekten gedacht. Das ist perfekt.« Mit untypischer Überschwänglichkeit griff Menzies nach Noras Hand. »Das wird das Museum retten. Und es wird sich als Sprungbrett für Ihre Karriere erweisen. Wie gesagt, Sie bekommen alle finanziellen Mittel und jede Unterstützung, die Sie brauchen. Was die Computereffekte betrifft, überlassen Sie das mir – Sie konzentrieren sich auf die Objekte und die Schaukästen. Sechs Wochen reichen gerade aus, um die Werbetrommel zu rühren, die Einladungen rauszuschicken und die Leute von der Presse zu bearbeiten. Wenn sie auf eine Einladung scharf sind, werden sie nicht über das Museum herziehen können.«
Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Ich muss Dr. Collopy auf die Pressekonferenz vorbereiten. Tausend Dank, Nora.«
Menzies eilte geschäftig aus dem Raum. Nora, wieder allein in dem stillen Labor, warf einen bedauernden Blick auf den Arbeitstisch mit ihren sorgfältig arrangierten Tonscherben und fing dann an, eine nach der anderen wieder in den Plastikbeuteln zu verstauen.
7
Special Agent Spencer Coffey bog um die Ecke und steuerte das Büro des Gefängnisdirektors an. Seine mit Stahlkappen verstärkten Absätze klackten vernehmlich auf dem glatten Beton. Agent Rabiner, ein untersetzter Mann mit buschigem Schnurrbart, folgte in respektvollem Abstand. Vor der Anstaltstür aus Eichenholz blieb Coffey stehen, klopfte kurz und trat dann ein, ohne eine Antwort abzuwarten.
Die Sekretärin des Direktors, eine dünne Wasserstoffblondine mit alten Aknenarben im Gesicht und einer kühlen, geschäftsmäßigen Ausstrahlung, sah ihn flüchtig an: »Ja, bitte?«
»Agent Coffey, FBI.« Er wedelte mit seinem Ausweis. »Wir haben einen Termin, und wir haben es eilig.«
»Ich werde dem Direktor ausrichten, dass Sie da sind«, erklärte sie und zerrte mit ihrem breiten Akzent an Coffeys Nerven.
Er sah Rabiner an und verdrehte die Augen. Schon am Morgen war er wegen einer unterbrochenen Telefonverbindung mit der Frau in Streit geraten. Die persönliche Begegnung mit ihr bestätigte ihm, dass sie der Inbegriff all dessen war, was er verabscheute: eine Landpomeranze aus der Unterschicht, die sich in eine halbwegs angesehene Stellung hochgearbeitet hatte.
»Agent Coffey und …?« Sie warf einen Blick auf Rabiner.
»Special Agent Coffey und Special Agent Rabiner.«
Die Frau griff mit aufreizender Langsamkeit zum Hörer der Gegensprechanlage. »Die Agenten Coffey und Rabiner wünschen Sie zu sprechen, Sir. Sie sagen, sie haben einen Termin.« Einen Moment lang hörte sie aufmerksam zu und legte dann auf. Danach ließ sie sich Zeit – gerade so viel, um Coffey wissen zu lassen, dass sie es nicht annähernd so eilig hatte wie er. »Mr. Imhof«, erklärte sie schließlich, »wird Sie empfangen.«
Coffey schickte sich an, an ihrem Schreibtisch vorbeizugehen, hielt dann aber inne. »Und? Wie läuft’s denn so zu Hause auf der Farm?«
»Sieht so aus, als wären die Schweine gerade in der Brunft«, antwortete sie prompt und ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen.
Coffey ging weiter und fragte sich, was die blöde Kuh damit meinte und ob sie ihn vielleicht beleidigen wollte. Als er die Tür hinter sich und Rabiner schloss, erhob sich Direktor Gordon Imhof von seinem Stuhl hinter einem großen Formica-Schreibtisch. Coffey hatte ihn noch nie zuvor persönlich getroffen und war überrascht, dass der Mann wesentlich jünger war, als er erwartet hatte, klein und drahtig, mit einem Spitzbart und kühlen blauen Augen. Er war tadellos gekleidet, der dichte Haarschopf ordentlich in Form geföhnt. Schwer, ihn in eine Schublade einzuordnen. Früher arbeiteten sich Gefängnisdirektoren von der Pike auf hoch; aber dieser Typ sah aus, als hätte er irgendeinen Doktortitel in höherem Gefängnismanagement und noch nie das befriedigende Aufklatschen eines Schlagstocks auf der Haut eines Menschen vernommen. Dennoch, da war ein harter Zug um Imhofs schmale Lippen, der Coffey hoffen ließ.
»Nehmen Sie doch bitte Platz«, forderte Imhof die beiden FBI-Agenten mit einer einladenden Handbewegung auf.
»Danke.«
»Wie ist die Vernehmung verlaufen?«
»Wir kommen gut voran«, erklärte Coffey. »Wenn irgendein Fall alle bundesrechtlichen Kriterien für die Todesstrafe erfüllt, dann dieser.« Dass das Verhör in Wahrheit schlecht, um nicht zu sagen: miserabel gelaufen war, ließ er unerwähnt.
Imhof machte ein Pokerface.
»Ich möchte etwas klarstellen«, fuhr Coffey fort. »Eines der Mordopfer war ein Freund und Kollege von mir, der am dritthöchsten dekorierte Agent in der Geschichte des FBI