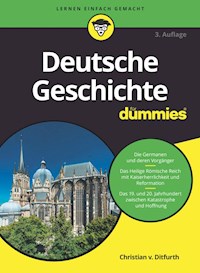9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Stachelmann ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Ein Historiker auf Mördersuche – der atemberaubende, mitreißende Krimi führt den Leser zurück in eines der abstoßendsten Kapitel der NS-Zeit, das bis heute nicht abgeschlossen ist. Berge von Akten türmen sich seit Jahren unbearbeitet auf Josef Maria Stachelmanns Schreibtisch. Material für seine längst überfällige Habilitation. Doch der Dozent für Geschichte an der Universität Hamburg, gleichermaßen geplagt von Arthritis und Historikerquerelen, hat alles Selbstvertrauen verloren. Da meldet sich ein ehemaliger Kommilitone und Genosse aus bewegter Zeit, Ossi Winter, inzwischen Kriminalkommissar in Hamburg. Er müht sich seit drei Jahren, eine Mordserie aufzuklären: Wer hat die Frau und zwei Kinder eines angesehenen Hamburger Maklers umgebracht? Es gibt nur eine schwache Spur, und die führt in die Vergangenheit. Winter bittet Stachelmann um Hilfe, und in dem Historiker erwacht die alte Neugier. Stachelmann macht sich auf die Suche und gerät in ein lebensgefährliches Labyrinth.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Sammlungen
Ähnliche
Christian von Ditfurth
Mann ohne Makel
Stachelmanns erster Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Christian von Ditfurth
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Christian von Ditfurth
Christian v. Ditfurth, Jahrgang 1953, ist Historiker und lebt als freier Autor und Lektor bei Lübeck. Er hat zuletzt die viel beachteten Romane »Die Mauer steht am Rhein. Deutschland nach dem Sieg des Sozialismus« (1999), »Der 21. Juli« (2001) und »Der Consul« (2003) veröffentlicht. Im Herbst 2004 erscheint Stachelmanns zweiter Fall bei Kiepenheuer & Witsch. Weitere Informationen zum Autor: www.cditfurth.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Was als Aktensuche begann, endet in einer mörderischen Jagd. Fast zu spät entdeckt Stachelmann, dass er das nächste Opfer eines rätselhaften Mörders sein soll. Mit dem immer vom Scheitern bedrohten Hamburger Historiker Josef Maria Stachelmann erfand Christian v. Ditfurth einen unverwechselbaren Romanhelden, der in der Kriminalliteratur einzigartig dasteht. Berge von Akten türmen sich seit Jahren unbearbeitet auf Josef Maria Stachelmanns Schreibtisch. Material für seine längst überfällige Habilitation. Doch der Dozent für Geschichte an der Universität Hamburg, gleichermaßen geplagt von Arthritis und Historikerquerelen, hat alles Selbstvertrauen verloren. Da meldet sich ein ehemaliger Kommilitone und Genosse aus bewegter Zeit, Ossi Winter, inzwischen Kriminalkommissar in Hamburg. Er müht sich seit drei Jahren, eine Mordserie aufzuklären: Wer hat die Frau und zwei Kinder eines angesehenen Hamburger Maklers umgebracht? Es gibt nur eine schwache Spur, und die führt in die Vergangenheit. Winter bittet Stachelmann um Hilfe, und in dem Historiker erwacht die alte Neugier. Stachelmann macht sich auf die Suche und gerät in ein lebensgefährliches Labyrinth. Der atemberaubende, mitreißende Krimi führt den Leser zurück in eines der abstoßendsten Kapitel der NS-Zeit. Es ist bis heute nicht abgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
XV. Kapitel
XVI. Kapitel
Nachbemerkungen
Für Gisela
I
Der Schmerz schoss ins linke Knie. Er unterdrückte einen Aufschrei und blieb stehen. Der Schmerz ließ nach, er ging langsam weiter. Als er die Puppenbrücke überquerte, hatte er das Stechen vergessen.
Das gar nicht so alte Postgebäude neben dem Bahnhof wurde abgerissen. Was von ihm blieb, wartete als eine Ansammlung von Steinen und Geröll darauf, von schweren Lastwagen weggefahren zu werden. Es staubte. Ein Mauerrest mit Fenster stand am Rand der Grube.
Der Bahnhof war älter als das Postgebäude, aber alle Versuche, ihn zu erneuern, wurden aufgeschoben. Erst wenn die letzte Berliner S-Bahn-Station in einen Miniaturpalast verwandelt war, durften die Lübecker hoffen, dass aus dem finsteren Gewölbe mitten in der Stadt ein neuer Hauptbahnhof entstand.
Stachelmann stieß eine Schwingtür am Eingang auf und ging durch die düstere Halle zum Gleis 9, wo der Zug nach Hamburg wartete. Er setzte sich in einen Großraumwagen der ersten Klasse mit blauen Sitzbänken. Am anderen Ende saß am Fenster eine ältere Frau, ein grüner Damenhut mit Silberkettchen ragte über die Rückenlehne des Sitzes vor ihr. Die Lichtanzeige an der Decke des Wagens war ausgefallen. Stachelmann setzte sich auf die Bank am Tisch. Er nahm aus seiner Aktentasche Simone Wagners Hausarbeit, er hatte sie gestern Abend müde weggelegt. Die Arbeit untersuchte die Hypothesen zum Reichstagsbrand im Februar 1933. Wer waren die Brandstifter? Waren es die Nazis? Waren es die Kommunisten? War es der Einzelgänger van der Lubbe? Stachelmann mochte Simone Wagner, sie hatte lebhafte Augen und interessierte sich wirklich für Geschichte. Sie schrieb flott und konnte mit Quellen umgehen. Jedenfalls bei anderen Themen. Beim Reichstagsbrand tappte sie in die Falle. Weil der Brand den Nazis nutzte und wie bestellt ausbrach, mussten sie ihn gelegt haben. Die Geschichte ist oft launisch. Manchmal fügt sie Ereignisse zusammen, wie sonst nur ein Verschwörer es vermocht hätte. Die Leute glaubten dann lieber an einen Verschwörer als an den Zufall. Wenn man es so will, dann ist der Zufall der größte Verschwörer, dachte Stachelmann und beugte sich wieder über Simone Wagners Arbeit. Er würde ihre Thesen bestreiten und ihr eine Zwei geben, für die Mühe, die sie sich gegeben hatte. Und er würde am Beispiel ihrer Arbeit darstellen, dass die Geschichtswissenschaft zwar politische Überzeugungen zum Gegenstand hat, dass diese aber zur Meinungsbildung möglichst wenig beizutragen hätten. Das war leicht gesagt und schwer getan.
Die Waggontür schlug zu, ein Mann betrat schwer das Großraumabteil und setzte sich gegenüber an den Tisch. Stachelmann zog die Hausarbeit näher an sich heran. Der Mann atmete pfeifend, als wäre sein Hals eng. Mit einem Taschentuch wischte er sich Schweiß von der Stirn. Er legte eine Plastiktüte mit dem Aufdruck eines Supermarkts auf den Tisch, stand auf und öffnete ein Fenster im Gang. Ein Pfiff, der Zug ruckelte und rollte los. Der Mann setzte sich, er schnaufte einmal tief. Er schaute sich um, musterte Stachelmann einige Sekunden und zog dann eine Bild-Zeitung aus der Plastiktüte. Er hustete und faltete die Zeitung auf.
Er hielt Stachelmann die Titelseite vors Gesicht. »Tragödie einer Familie« stand da in dicken roten Buchstaben, schwarz und kleiner darunter: »Hamburger Makler (46) verzweifelt – nun auch Tochter (6) tot. Es war Mord!« Ein Schwarzweißfoto zeigte einen Mann mit einer Hand vor den Augen. Daneben ein Farbfoto, ein Mädchen mit blonden Zöpfen, darunter ein Text: »Valentina Holler (6) vergiftet wie ihr Bruder – Opfer eines Serienkillers?«
Was heißt »nun auch tot«?, fragte sich Stachelmann. Er versuchte, den Text des Artikels unter den Überschriften zu lesen. Der Mann gegenüber blätterte um und schaute Stachelmann einen Augenblick durchdringend, an. Statt der Familientragödie hatte Stachelmann jetzt eine barbusige Blondine vor der Nase, die ihn aus den Augenwinkeln musterte. Daneben stand: »Sandra weiß, was sie will.« Stachelmann war egal, was Sandra wollte. Er wollte wissen, was der Familie des Maklers geschehen war. Aber auf Sandra folgten Berichte über das letzte Wochenende der Fußballbundesliga, die hinter Sandras Rücken darauf gewartet hatten, umgeblättert zu werden. Während der Mann sich mit pfeifendem Atem Sandra widmete, las Stachelmann über die Krise des Hamburger Sportvereins, wenigstens das, was auf der oberen Hälfte der Seite stand, da der Mann den Rest der Zeitung nun unter dem Tisch verborgen hielt. Er warf Stachelmann über die Zeitungskante hinweg einen scharfen Blick zu. Dann faltete er die Zeitung zusammen und schob sie über den Tisch. »Bitte sehr!«, sagte er krächzend und stand auf. Er lächelte. Stachelmann glaubte, Spott in dem Lächeln zu erkennen. Als hätte der Mann Stachelmanns wiederholte Bekundung gehört, dieses Blatt fasse er, wenn überhaupt, nur vor dem Händewaschen an und dann auch nur mit zwei Fingern. Der Mann verließ das Großraumabteil. Der Zug hielt in Bad Oldesloe.
Als er wieder zu rollen begann, schlug Stachelmann die Titelseite auf und las die Geschichte. Der Makler wohnte wie andere reiche Hamburger mit seiner Familie nahe der Elbchaussee. Vor zwei Jahren hatten Spaziergänger seine Frau erschlagen im Duvenstedter Brook gefunden. Vor einem Jahr war der zehnjährige Sohn im Schwimmbad vergiftet worden. Jetzt war auch Valentina tot, der Makler und ein vierjähriger Sohn blieben als Einzige übrig. Jedes Jahr ein Mord.
Stachelmann überlegte, wie würde er sich fühlen nach einem solchen Schlag? Er lebte allein in einer kleinen Wohnung in Stietens Gang, der von der Lichten Querstraße abzweigte, die wiederum die Dankwartsgrube mit der Hartengrube verband. In der Altstadtidylle zwischen Mühlenteich und Stadttrave fühlte er sich manchmal einsam. Aber dann las er Geschichten von verschleppten und ermordeten Kindern. Oder von einem Hamburger Makler, den Reichtum und Ansehen nicht davor schützten, seine Frau und zwei Kinder zu verlieren. Was man nicht hat, kann man nicht verlieren. Und man muss keine Angst darum haben.
Natürlich erreichte der Zug den Hamburger Hauptbahnhof einige Minuten zu spät. Stachelmann nahm die S-Bahn zum Dammtor. Den Rest des Wegs zur Universität lief er zu Fuß. Er schwitzte, es war schon heiß an diesem Vormittag. Es war Montag, der 9. Juli 2001. Bald würde das Sommersemester zu Ende sein. Dann würden das alte Hauptgebäude und die Betonklötze am Von-Melle-Park, auf die Hamburgs Universität verteilt ist, wieder entvölkert sein.
Renate Breuer winkte mit einem Zettel, als Stachelmann die grün lackierte Stahltür ihres Büros aufstieß. »Ein Anruf für Sie, vor fünf Minuten«, sagte sie, als handelte es sich um etwas Besonders. Für Renate Breuer war fast alles aufregend, obwohl sie schon so viele Jahre als Sekretärin des Historischen Seminars im Philosophenturm arbeitete. Auf dem Zettel standen eine Telefonnummer und ein Name: »Oskar Winter«. Stachelmann setzte sich hinter den Schreibtisch in seinem kleinen Arbeitszimmer und schaute auf den Zettel. Er musste nicht lange überlegen. Oskar Winter, ja, das war Ossi. Wer sonst? Sie hatten gemeinsam studiert in Heidelberg und außerdem versucht, die Weltrevolution anzufachen. Stachelmann griff zum Telefonhörer.
Der alte Mann atmete schwer. Immer wieder hielt er an beim Gehen. Er trug einen hellbeigen Anzug aus festem Tuch, der aus einem besseren Geschäft in Pöseldorf stammen mochte. Ein Schlips in einer unbestimmbaren Mischfarbe passte zum Anzug wie zu den schweren braunroten Schuhen. Der Mann nahm sich sonderbar aus unter all den sommerlich bekleideten Passanten. Schließlich hatte er den U-Bahnhof Kellinghusenstraße erreicht. Erschöpft sank der Mann auf eine Sitzbank, sie war blau und schwarz beschmiert mit Schrift und Zeichnungen. Fuck you! las der Mann auf der Rücklehne der Bank gegenüber. In der U-Bahn war es auszuhalten. Durch geöffnete Fenster strich ein Luftstrom. Er kühlte, obwohl er warm war. An den Landungsbrücken war der Mann wieder ausgeruht. Er stieg um in die S 1 nach Blankenese. Dieser Weg war weiter, aber er sparte ein Umsteigen.
In Blankenese stieg er aus. Er ging gemächlichen Schritts die Dockenhudener Straße hinunter. Er musste haushalten mit seiner Kraft. Ein Auftrag noch. Eigentlich waren es ja zwei gewesen, aber dann hatte er entschieden, seine Sache verlöre ihren Sinn, wenn es keinen mehr gab, der trauerte. Als er die Gätgensstraße erreichte, ging er Richtung Elbe, zum Hirschpark. Am Naturdenkmal setzte er sich auf eine Bank. Erstaunlich, wie viele junge Menschen an einem frühen Mittwochnachmittag Zeit fanden zu bummeln. Möwen vertrieben Tauben und Spatzen im Kampf um Brotkrumen, die Kinder ihnen hinwarfen. Er setzte seinen Marsch fort, erreichte den Elbuferweg und betrachtete die Fracht- und Passagierschiffe auf dem Strom, die den Hafen anliefen oder verließen, Richtung England, Amerika, Asien. Möwen kreisten am blauen Himmel, der Wind trieb Wattewolken vor sich her. Er stieg Jacobs Treppe hoch zur Elbchaussee und ging ein Stück in Richtung Stadtmitte. Er bog links ein in die Holztwiete, dann hatte er sein Ziel vor Augen, eine Jugendstilvilla, weiß verputzt, mit hellblauen Bögen über Türen und Fenstern. In der Nähe des Eingangs parkte ein Polizeiauto. Gegenüber der Rückseite lag eine große Baustelle, abgesichert mit einem Drahtzaun. Ein Bagger grub, sein Dieselmotor stieß schwarzen Rauch aus, ein Lastwagen stand neben einer Bauhütte. Er stellte sich an den Zaun, unter eine Buche, und schaute auf das Villengrundstück. Er hatte die Heckenlücke bei einem seiner ersten Ausflüge hierher entdeckt.
Er war ungeduldig. In den letzten Wochen hatte er manchmal gezweifelt am Sinn seines Auftrags. Er hatte mit der Planung des dritten und letzten Schlags begonnen, bevor er den zweiten geführt hatte. Vielleicht war seine Sorgfalt bei der Vorbereitung des letzten Schlags nur Ausdruck seines Zweifels? Er schüttelte den Kopf. Nein, wenn er diesen Schlag nicht führte, wären alle Schläge davor sinnlos, alle Anstrengung und Gefahr umsonst. Diesmal hatte er kein Jahr Zeit, um sich vorzubereiten. Er fühlte, wie der Tod nach ihm griff. Sobald die Aufregung über seinen letzten Schlag sich gelegt hatte, würde er es tun.
Dann sah er ihn. Es war ein blonder Junge. Er saß auf einem Bobby-Car und lachte hell. Eine Frau eilte ihm hinterher und setzte ihm eine Mütze auf zum Schutz gegen die Sonne. Der Kleine riss die Mütze herunter, biss in ihren Schirm und warf sie weg. Die Frau hob die Mütze auf und redete auf den Jungen ein. Der Mann konnte nicht verstehen, was sie sagte. Der Junge lachte und schob sich in seinem Bobby-Car weg von der Frau. Die Frau folgte ihm, mit der Mütze in der Hand. Der Mann glaubte sie weinen zu sehen. Wieder sprach sie auf den Jungen ein. Der schüttelte kräftig seinen Kopf und zeigte auf etwas, das der Mann nicht sehen konnte. Er rollte mit dem Bobby-Car dorthin und verschwand aus dem Bildausschnitt. Dann kam er zurück und fuhr auf die Lücke in der Hecke zu. Er strahlte, hatte nicht begriffen, dass seine Schwester tot war.
Eine junge Frau kam um die Ecke und ging an dem alten Mann vorbei. Sie schaute sich kurz nach ihm um. Er glaubte, Fragen in ihrem Blick erkannt zu haben. Es war Zeit, zu gehen. Während er langsam zur S-Bahnstation Klein Flottbek lief, arbeitete sein Kopf an dem Plan. Nur noch einmal, murmelte er. Dann würde er erlöst sein.
Er sah den S-Bahnhof. Er ging schneller. Auf dem Bahnsteig setzte er sich auf eine Bank. Erst jetzt merkte er, wie erschöpft er war.
Die Nummer war ihm gleich komisch vorgekommen. Es meldete sich das Polizeipräsidium. Nach kurzer Verwirrung fragte Stachelmann nach Oskar Winter. »Ich verbinde mit Kommissar Winter«, sagte die unfreundliche Stimme am Telefon.
»Winter!« Es klang laut aus dem Telefonhörer.
»Stachelmann …«
»Jossi?«, fragte Winter.
»Ja«, sagte Stachelmann. Er hasste diesen Spitznamen. Er hätte jetzt sagen können: Ich heiße Josef Maria, aber er erinnerte sich, es war zwecklos. Oskar alias »Ossi« Winter hatte schon damals über derlei Proteste gelacht.
»Da staunst du!«, sagte Ossi. Seine Stimme ließ keinen Zweifel zu.
Stachelmann staunte und ärgerte sich. »Ja«, sagte er.
»Und jetzt willst du bestimmt wissen, wie ich auf dich gekommen bin!«
»Ja.«
»Aus der Zeitung!«, rief Ossi. »Natürlich aus der Zeitung!«
Stachelmann stutzte, dann fiel es ihm ein. Da hatte es einen kurzen Bericht gegeben im Hamburger Abendblatt. Vergangene Woche hatte Stachelmann einen Vortrag gehalten über das Hoßbach-Protokoll an der Volkshochschule in der Schanzenstraße, und die Lokalzeitung hatte Platz übrig gehabt für eine kurze Erwähnung. Kein Leser dürfte wirklich verstanden haben, was irgendein Volontär geschrieben hatte über eine der wichtigsten Quellen zu den Ursachen des letzten Weltkriegs. Das hatte Stachelmanns Urteil gefestigt, in den Redaktionen säßen oft Ignoranten, die es keine Sekunde bewegte, was vor ihrer ersten Freundin geschehen war.
»Du hast doch da einen Vortrag gehalten!«, dröhnte Ossi, als er keine Antwort erhielt. »So viele Josef Maria Stachelmanns wird es ja nicht geben.« Ossi lachte.
»Ja, ja«, sagte Stachelmann.
»Hast du heute Abend schon was vor?«, fragte Ossi.
»Nein«, sagte Stachelmann. Er hatte den anderen nicht wieder auf eine Antwort warten lassen wollen und schon einen Fehler gemacht.
»Na, dann lass uns doch einen trinken!«, sagte Ossi. »Einen auf unser Wiedersehen! Oder auch zwei.«
Sie verabredeten sich für acht Uhr im Tokaja, einer Studentenkneipe nahe der Universität. Stachelmann legte auf und ärgerte sich. Er hatte sich auf einen ruhigen Abend gefreut mit Horatio Hornblower, C. S. Forresters britischem Seehelden in der Zeit der napoleonischen Kriege. Stachelmann hatte eine billige Gesamtausgabe gekauft, als ihn einmal die Sehnsucht nach seiner Jugend überwältigt hatte. Hornblowers Abenteuer hatten ihn als Fünfzehnjährigen gefesselt, und er staunte, weil sie es immer noch taten. Nun erfuhr er heute Abend also nicht, wie sich Horny aus französischer Gefangenschaft rettete, sondern wie es Ossi, den Revolutionär, zur Polizei verschlagen hatte. Da fiel Stachelmann ein anderer ein, der größte Revolutionär unter ihnen allen damals, ungekämmte schwarze Haare und ein mächtiger Bart, der irgendwann einmal nach dem Besuch bei seinem reichen Vater erklärte, er habe beschlossen, Wirtschaftsprüfer zu werden. Dies sei die wirksamste Art, die Macht des Kapitals zu brechen. Stachelmann grinste, als ihm diese Szene wieder einfiel.
Das Grinsen verging Stachelmann, als sein Blick auf einen Berg von Papier fiel, der auf einem kleinen Tisch aufragte. In einem Anfall von Pathos hatte er ihn Berg der Schande getauft. Er bestand aus fünf hohen Stapeln Akten, die den hoffnungslosen Zustand seiner überfälligen Habilitation anzeigten. Seit ein paar Jahren warteten die Akten auf ihn, und er bildete sich ein, dass er allmählich vergaß, welches Thema er sich ausgesucht hatte. Und weil er es nicht packte, würde er auch in den kommenden Jahren noch in dieser Rumpelkammer sitzen und Hausarbeiten und Klausuren korrigieren, wenn sie ihn nicht vorher rausschmissen. Ein Blick auf diesen Stapel erinnerte ihn an seinen Mangel an Disziplin, bestärkte ihn in seinem Glauben, eine Fehlbesetzung zu sein in seinem Beruf. Ihm mangelte es an Ehrgeiz und an Talent. Er zweifelte an seiner Fähigkeit, einen vernünftigen Satz zu schreiben. Lächerlich die Vorstellung, er könnte die Geschichte des Konzentrationslagers Buchenwald darstellen und dafür irgendwann sogar mit dem Titel eines Professors belohnt werden. An einen Lehrstuhl wagte er nicht einmal zu denken. Dabei war das am Anfang sein Ziel gewesen. Er wollte ein großer Historiker werden wie die Mommsens, Steinbach, Jaeckel, oder wie früher auch Baring, der sich inzwischen in Talkshows als Hysteriker entpuppte. Wenn Stachelmann an sein Ziel dachte und an das, was er mit seinen einundvierzig Jahren erreicht hatte, überkam ihn Verzweiflung. Las er die Arbeiten anderer Historiker, und waren sie noch so unbekannt, fühlte er sich wie eine Ameise. Offenbar hatte er seine Rolle gefunden, hielt Seminare und arbeitete Hasso Bohming zu, dem Professor, dem »Sagenhaften«, wie ihn manche nannten, weil es Bohming dürstete, sich seiner Mitwirkung an all den Historikerschlachten der jüngsten Vergangenheit zu rühmen, die ihm den Hass der Widersacher eingebracht habe wie die Bewunderung der Mitstreiter. Nicht nur Stachelmann war das Missverhältnis aufgefallen, das sich zeigte zwischen den Blutgeschichten von der Front und ihrem Niederschlag in Fachzeitschriften und Sammelbänden.
Stachelmann lachte leise vor sich hin. Natürlich, der nette Bohming war ein Aufschneider. Aber er, Stachelmann, war nicht mal das, er war ein Nichts. Er mochte noch so viel angeben, es wäre zwischen der Lüge und der Wahrheit kein Verhältnis auszurechnen, weil es kein einziges Körnchen Wahrheit gab. Seit Jahren hatte Stachelmann Angst vor seiner Unfähigkeit. Wohin würde sie ihn führen? Würde er enden wie der ewige Dozent der Geschichte, dieser Weitenschläger, der damals in Heidelberg mehr Zeit auf Weinfesten verbracht hatte als im Historischen Institut? Er sah den Mann vor sich, rote Haare, Säufergesicht, Glasaugen, irgendwo angelehnt, weil er sonst wanken würde. Stachelmann fühlte Neugier in sich, war fasziniert von seinem Fach, aber er konnte nicht verwirklichen, was die Neugier von ihm forderte. Er würde es wohl nicht mehr lernen, sich jahrelang auf ein Thema zu konzentrieren, nicht mehr lernen, sich zu langweilen und etwas zu schaffen, was ihm einen Platz in der Gemeinde der Historiker einbrachte.
Es klopfte an der Tür. Er rief: »Herein!« Er erschrak. Es war sie. Sie war Anne Derling. Anne arbeitete seit zwei Jahren als Assistentin bei Bohming, den seine Mitarbeiter seitdem Hasso nennen durften und der trotzdem nie einen Zweifel daran ließ, wer ihrer aller Meister war. Zu Anne war er besonders freundlich. Aber das waren eigentlich alle, denn Anne war klug und schön. Diese Kombination erlebt man selten, sagte ein Kollege. Wenn er sonst nie Recht gehabt hätte, hier lag er richtig. Als Anne ihre Stelle antrat, änderte sich die Stimmung am Lehrstuhl. Assistenten und Dozenten strahlten nun einen Eifer aus, dessen Entstehen kein Hellseher hätte vorausahnen können. Im Lauf der Zeit dämpfte sich das Summen unter den Kollegen, aber der Ton klang weiterhin freundlich, und die Diskussionen gestalteten sich lebhafter, wenn sie im Raum war. Ob Anne wusste, was sie bewirkte?
Sogar der schöne Rolf Kugler von den Politologen schwänzelte eine Weile um sie herum. Der jung-dynamische Neuprofessor stand im Ruf, an jeder neuen Kollegin seine Ausstrahlung zu testen. Vor Anne aber hatte er sich bei den Historikern nicht blicken lassen. Er verschwand dann auch bald wieder von der Bildfläche, offenbar war er nicht gelandet bei Bohmings neuer Assistentin.
Sie lachte Stachelmann durch den Türspalt an und fragte: »Willst du auch einen Kaffee?«
»Ja«, sagte er. Besser gesagt, er stammelte. Das hatte sie ihn noch nie gefragt.
»Ich bring dir einen mit«, sagte sie fröhlich. Der Kopf verschwand, die Tür blieb offen.
Stachelmann spürte, wie seine Hände feucht wurden. Mit der Schulter schob sie die Tür auf, in beiden Händen hatte sie Becher mit Kaffee aus der kleinen Kammer im Gang. Ihre Brille war verrutscht. Sie stellte beide Becher auf seinen Schreibtisch, nahm die Brille von der Nase, putzte sie an einem Zipfel ihrer Bluse, die sie über der Hose trug. Sie war hell und sommerlich gekleidet, es passte gut zu ihren lockigen, blauschwarzen Haaren.
»Was machst du gerade? Ich hoffe, ich störe dich nicht allzu sehr?«
»Nein, nein«, sagte Stachelmann. Er verfluchte innerlich seine Unsicherheit.
»Ich habe mit einer Studentin gesprochen, ich glaube, sie heißt Alicia oder so ähnlich. Die schwärmte geradezu von deinem Seminar.«
»Die hat mich wohl verwechselt oder war bei der letzten Sitzung betrunken«, sagte Stachelmann und grinste. Er hörte hin und wieder von Studenten, die seine Seminare gut fanden. Seine Veranstaltungen waren seit Jahren überbelegt. Die Beliebtheit schmeichelte ihm, sie bedeutete aber mehr Arbeit. Und irgendwie verstand er es, sich einzureden, dass es allein seine Themen seien, die den Studenten aus unersichtlichen Gründen gefielen. Vorgestern Abend hatte ihn Alicia Weitbrecht zu Hause angerufen, angeblich um etwas herauszufinden über die nächste Klausur. Er hatte ihre Frage schon vergessen, ihren Anruf nicht.
»Klar«, erwiderte Anne.
Stachelmann zuckte mit den Achseln. Er nahm den Kaffeebecher von der Schreibtischkante und trank einen kleinen Schluck. Was wollte Anne von ihm? Tratschen?
»Ich muss mal mit dir reden«, sagte Anne. »Ganz in Ruhe.«
Stachelmann blickte sie neugierig an. Hoffentlich begann er jetzt nicht zu schwitzen.
»Gerne«, sagte er. »Jederzeit.«
»Das ist gut«, erwiderte Anne. Sie schien erleichtert zu sein. »Dann heute Abend?«
Verdammt, dachte Stachelmann. Für heute Abend hatte er sich bereits mit Ossi verabredet. »Heute geht’s leider nicht. Wie wär’s mit morgen?«
Anne schaute ihn an. Es schien ihm, als wäre ein Schatten über ihr Gesicht gehuscht. »Gut, dann morgen«, sagte sie. »Bei mir, einverstanden? Ich wohne um die Ecke.«
»Gut«, sagte Stachelmann. Er wusste, wo sie wohnte. Er war schon ein paar Mal an dem Haus vorbeigelaufen.
Sie plauderten noch ein wenig über das Institut und den Sagenhaften, beklagten ihr Leid mit lustlosen Studenten, dann stand Anne auf, nahm die leeren Becher, lachte ihn fröhlich an und sagte: »Ich geh mich jetzt mal wieder langweilen.« Ein bisschen Parfümduft blieb im Raum. Es roch gut.
Als Anne gegangen war, spürte er den Schmerz im Rücken, ganz unten. Er stand auf und mühte sich, den Rücken gerade zu biegen. Diese verfluchten Schmerzen. Er schaute auf die Uhr. In einer halben Stunde begann sein Proseminar über den Nationalsozialismus 1933-39. Er hatte dieses Thema auch gewählt, weil er hoffte, es würde ihm bei seiner Habilitation helfen. Aber bisher hatte es nichts genutzt. Dieses Seminar war noch voller als die vorherigen. Die Studenten saßen zum Teil auf dem Boden. Sie protestierten nicht. Stachelmann und Ossi hatten protestiert, gegen schlechte Studienbedingungen, vor allem aber für die Revolution. Sie fanden, es gehörte alles zusammen. Er war froh, die Studenten heute sahen manches anders. Aber gleichzeitig spürte er einen Hauch von Verachtung, der in ihm deshalb aufkam. In Wahrheit war es ihm nicht gelungen, den Wahn, dem sie damals gefolgt waren, ganz aufzugeben. Er gab sich Mühe mit seinen Studenten, und sie belohnten ihn durch ihre Anwesenheit, weniger durch Eifer. Manche Studentin schaute ihn vielleicht nicht nur aus fachlichem Interesse an. Alicia war offenbar so ein Fall. Aber es bewegte ihn nicht. Er hatte keine Lust auf Anbetung und die ihr folgende Enttäuschung. Richtige Frauen hatten nichts für ihn übrig, falsche liefen ihm hinterher. So musste es wohl sein in seinem verpfuschten Historikerleben. Stachelmann hasste sich, wenn die Selbstzweifel ihn überwältigten.
Er musste in sein Seminar. Er nahm die Aktentasche, sie war prall gefüllt mit den Hausarbeiten. Im Gang war einiger Betrieb. An den Backsteinwänden hingen Plakate, die Diäten anpriesen und Technodiscos. Der Seminarraum war voll wie immer. Das Gerede wurde leiser, als Stachelmann den Raum betrat. Einige blickten ihn erwartungsvoll an, als er sich vorne an sein Pult setzte, das in Wahrheit nur ein Tisch war, wie sie zu Hunderten in Seminarräumen standen. Er packte die Hausarbeiten auf den Tisch und schob den Stapel einem Studenten zu, der ihn erst gelangweilt betrachtete, dann seine Arbeit heraussuchte und den Stapel weiterschob. Der Stapel wurde immer kleiner, schließlich blieben drei Arbeiten über, deren Autoren fehlten. Stachelmann packte sie in seine Aktentasche und erklärte seinen Studenten, er sei mit den Arbeiten insgesamt zufrieden. Für den Seminarschein würden sie auf jeden Fall reichen. Bliebe also am Ende des Semesters nur noch die Klausur als Stolperstein. Die Zuhörer nahmen Stachelmanns Wertung kommentarlos hin.
Stachelmann lobte Simone Wagners Arbeit, die Quellenbasis sei breit, die Gliederung vorzüglich, die Urteilsfindung aber leider fragwürdig. Er schaute kurz in die Ecke, in der Simone Wagner saß. Unverständnis stand in ihren Augen geschrieben. Sie meldete sich, er nickte, um ihr das Wort zu geben.
»Der Reichstagsbrand hat niemandem genutzt außer den Nazis«, sagte Simone Wagner. Sie klang empört. »Und es gab einen Geheimgang zwischen Görings Reichstagspräsidentenpalais und dem Maschinen- und Kesselhaus des Reichstags, durch den die Brandstifter unerkannt in den Reichstag eindringen und nach der Brandlegung fliehen konnten. Die Polizei hat später absichtlich Spuren nicht verfolgt, die in Richtung Göring liefen. Und der Dienstherr der Polizei war Göring selbst. Und dann, wenn man bedenkt, wie schnell Hitler, Göring und andere führende Nazis am Tatort waren und wie schnell sie die Reichstagsbrandverordnung …« Sie hatte sich in Wut geredet und blickte Stachelmann zornig an. »Überlegen Sie mal, am 27. brennt der Reichstag, am 28. ist die Reichstagsbrandverordnung fertig und in Kraft. Das ist entweder Zauberei oder Beweis dafür, dass die Verordnung schon geschrieben war, bevor es brannte.«
Stachelmann lachte innerlich. Er mochte es, wenn Studenten ihre Meinungen mit Vehemenz vertraten. Das gab es viel zu selten. Er ließ Simones Wortschwall über sich ergehen. Als sie fertig war, sagte er: »Ich habe Ihnen die Zwei nicht gegeben, weil Sie behaupten, die Nazis hätten den Reichstag angezündet. Sie haben keine Eins gekriegt, weil sie diese Behauptung nicht beweisen können. Da hat Ihre sympathische Meinung die Tastatur benutzt, nicht die Logik. Es gibt keinen Zeugen und keine sonstige Quelle, die Ihre These beweisen könnten. So einfach ist das.« Er stutzte kurz, den letzten Satz hätte er nicht sagen dürfen. Er mühte sich, den Fehler wiedergutzumachen: »Sie haben eine ausgezeichnete Arbeit geschrieben«, sagte er mit sanfter Stimme. »Wenn Sie behauptet hätten: Alle Indizien sprechen dafür, dass die Nazis den Reichstag selbst angesteckt haben, dann hätte ich Ihnen eine Eins plus gegeben, wenn es das Plus gäbe. Auch wenn ich sogar diese These für einseitig gehalten hätte. Aber man darf nicht etwas als bewiesen hinstellen, was man nicht beweisen kann. Das ist der Unterschied zwischen Wissenschaft und Politik.« Er schalt sich, er hätte nicht grundsätzlich werden dürfen. Er schaute Simone Wagner an, ihr Zorn war nicht verschwunden. Sie verweigerte sich nun der Diskussion. Stachelmann war traurig, es saßen nicht viele in seinem Seminar, die so gut mitmachten.
Er sah Alicia Weitbrechts schnippende Finger. Am Arm trug sie ein breites, silbrig glitzerndes Armband. Sie war auffällig geschminkt. Hat sie doch nicht nötig, dachte Stachelmann. Er begriff schnell, Alicia wollte Punkte sammeln. Sie wiederholte Stachelmanns Argumente und blickte ihn dabei fortwährend an. Er bedankte sich kurz für die Wortmeldung und blickte sich um, ob es weitere Beiträge gab. Er hatte keine erwartet. Ein Student in der ersten Reihe, sein Name war Stachelmann entfallen, blickte auf den Tisch vor ihm, andere schauten weg, wenn Stachelmanns Augen sie erfassten.
»Gut«, sagte Stachelmann. Es war nicht gut. Aber was sollte er machen? Den Rest des Seminars sprach er über einige Fehler und einige Stärken in den anderen Hausarbeiten und bereitete seine Studenten auf die Themen der nächsten Sitzungen vor. Es würde nichts nutzen, er wusste es. Trotzdem wäre es unfair gewesen, den Seminarteilnehmern diese Möglichkeit nicht zu geben. Manchmal fürchtete Stachelmann, es sei gleichgültig, ob er überhaupt in seinem Seminar auftauchte. Es gab nur eine Studentin, die aufnahm, was er anbot. Aber vielleicht sollte er damit zufrieden sein. In anderen Seminaren sah es eher schlimmer aus. Schade, nun war Simone Wagner sauer auf ihn. Er hoffte, sie trüge es ihm nicht nach.
Zurück in seinem Dienstzimmer hinter der grünen Stahltür, setzte er sich neben den Berg der Schande und schaute aus dem Fenster. Das Sommerwetter kam ihm unwirklich vor. Es hatte nichts mit seiner Stimmung zu tun. Musste er nicht froh sein? Gestern hätte er es noch für einen Wunschtraum gehalten, heute hatte Anne ihn zu sich nach Hause eingeladen. Er würde versagen, er wusste es.
Es klopfte an der Tür. Auf sein Herein erschien Alicia Weitbrecht. »Entschuldigung, Herr Stachelmann«, sagte sie mit unruhiger Stimme.
»Ja?«, fragte er. Seine Stimme klang barsch, obwohl er freundlich sein wollte.
Sie zuckte ein wenig. »Ich habe eine Frage zu meiner Hausarbeit.«
»Und warum kommen Sie nicht in meine Sprechstunde?«
»Da kann ich nicht, bin verreist.«
»Jetzt habe ich aber keine Zeit«, sagte Stachelmann freundlicher. »Können Sie morgen Nachmittag, so gegen 16 Uhr? Hier, in meinem Zimmer?«
Sie lächelte. Sie war ein hübsches Kind. Eben ein Kind, dachte Stachelmann.
II
Die Luft war heiß und verraucht. Im Halbdunkeln suchte Stachelmann nach Ossi. Er konnte ihn nirgendwo entdecken. Er war früh im Tokaja aufgetaucht. Er fand einen leeren Tisch in einer Ecke. Ein Spielautomat dödelte, Computerklänge. Er gewöhnte sich ans Dunkle. Er hatte die Tür im Auge. Er nahm die Speisekarte, das Übliche: überbackenes Gemüse, Nudeln, Pizza, billiger Wein. Eine Frau, in Schwarz gekleidet, stand neben ihm, er hatte sie nicht kommen sehen. Sie schaute ihn erwartungsvoll an und fragte: »Was darf es sein?« Sie hatte Rauch in der Stimme.
»Ich weiß noch nicht«, antwortete er. Als sie ihre Brauen leicht hochzog, fügte er hastig hinzu: »Ich warte auf jemanden.« Er stotterte und verfluchte sich dafür.
Die Schwarze schüttelte den Kopf und zog ab. Sie trug einen Pferdeschwanz, der bis zum Gürtel reichte.
Der Spielautomat dödelte.
Die Tür öffnete sich, ein Pärchen betrat die Kneipe. Stachelmann hatte den Blick fast schon abgewendet, da erschien hinter dem Pärchen Ossis Kopf. Das Gesicht war breiter geworden, aber er erkannte es sofort. Stachelmann stand halb auf und winkte. Er begriff nicht, Ossi konnte ihn nicht sehen, er kam aus dem Hellen. Stachelmann verfolgte, wie Ossi die Tische absuchte und sich seinem Tisch näherte. Stachelmann stand auf, da sah ihn Ossi und breitete die Arme aus.
»Mensch, alter Junge«, sagte er. »Hast dich ja gar nicht verändert.«
Stachelmann hasste solche Sprüche. Natürlich hatte er sich verändert. Nicht zum Guten, wie er fand. Er wich Ossis Umarmung aus, indem er seinen Arm weit vorstreckte zum Gruß. Ossis Händedruck war fest und ein bisschen wabbelig. Er war dick geworden. Ein roter Backenbart machte ihn alt.
Ossi setzte sich Stachelmann gegenüber und schaute ihm ins Gesicht. »Noch ganz der Alte«, murmelte er. Er blickte an Stachelmann vorbei an die Wand und sagte: »Das waren Zeiten, was?«
Stachelmann nickte.
Die Schwarze erschien und fragte nach Bestellungen, sie klang grell. Sie bestellten zwei Pils.
Ossi sagte: »Soso, da bist du jetzt also hier an der Uni. Historiker geworden. Das wolltest du ja immer werden.«
»Ja«, sagte Stachelmann.
»Und hältst Vorträge«, sagte Ossi.
»Ja, manchmal.«
»Und ich bin bei der Polizei gelandet. Mordkommission.«
»Du wolltest doch Anwalt werden?«, fragte Stachelmann.
»Ja, eigentlich schon. Aber dann kam die große Krise, kurz vorm zweiten Staatsexamen. Weibergeschichten, du weißt ja.« Ossi machte eine wegwerfende Handbewegung.
Stachelmann wusste nichts, er nickte. Ossi hatte kurz vor der letzten Prüfung geschmissen, das war klar. Er ahnte, es lag weniger an Frauen, sondern an Ossis fehlender Ausdauer. Ossi hatte es immer hingekriegt, hohen Hindernissen auszuweichen. Einem Examen konnte man nicht ausweichen. Das erste hatte er immerhin geschafft. Kleine Hindernisse übersprang er mit Triumphgeheul. Aber müssen nicht auch Polizisten ausdauernd sein? Stachelmann erinnerte sich, Ossi wollte einmal der Anwalt der Bewegung werden. Dazu wechselte er von Heidelberg nach Marburg. In Heidelberg waren ihm die Juristen zu schwarz gewesen. Aber in Marburg musste er gescheitert sein. Vielleicht weil es ihre Bewegung nicht mehr gab? »Mordkommission?«, fragte Stachelmann, als hätte er Ossi nicht verstanden.
»Ja. Seit elf Jahren bei der Polizei, seit knapp fünf hier bei der Mordkommission. Kriminalkommissar bin ich geworden, nicht Anwalt. Ist auch nicht schlecht.«
Stachelmann dachte an Leichen und sagte: »Bestimmt nicht.«
»Und wie hat es dich nach Hamburg verschlagen?«, fragte Ossi.
»Die Promotion. Es gab an der Uni einen Prof, der sich für meine Doktorarbeit interessierte. Jedenfalls tat er so.« Das war die halbe Wahrheit. Bohming hatte sich für seine Buchenwaldarbeit eingesetzt und ihm sogar eingeredet, das Thema zur Habilitation auszubauen. Aber die Doktorarbeit war eine Qual gewesen, und trotz allen Lobs glaubte Stachelmann nicht, dass sie so gut war, wie manche behaupteten. Die Besprechungen in den Fachzeitschriften waren meist zurückhaltend ausgefallen, wie üblich. Und doch war in einer die Rede gewesen von einem möglichen neuen Stern am Himmel der Geschichtsschreibung. Das hatte Stachelmann nicht vergessen, auch wegen des Schwulstes dieser Formulierung. Sie hatten ihn in Heidelberg halten wollen, ihm aber keine richtige Stelle anbieten können. Deshalb zog er nach Hamburg. Und hier würden sie ihn irgendwann rausschmeißen, wenn er mit seiner Habilitation nicht vorankam. Er hatte einen Zeitvertrag, und der würde in gut zwei Jahren auslaufen. Ob der Sagenhafte einen Versager am Institut behalten würde? Bestimmt nicht. Seine Mitarbeiter mussten Erfolg haben, der strahlte auch auf ihn ab.
»Dann hast du ja alles erreicht, was du wolltest, Jossi.« Ossi strahlte.
Stachelmann wollte nicht in die Vergangenheit gezogen werden. Wie er diesen Spitznamen hasste! Er war albern und erinnerte ihn an Ereignisse, die er längst verdrängt hatte. Ossi und Jossi, sie hatten sich dereinst einen Namen gemacht an der Universität. Sie traten oft zusammen auf bei Veranstaltungen und waren fast immer der gleichen Meinung. Politisch waren sie wie Zwillinge gewesen. Stachelmann hatte es für Freundschaft gehalten. Aber als die Wunschträume verflogen, verschwand, was die Zwillinge verbunden hatte. Stachelmann betrachtete Ossi. Was er sah, gefiel ihm nicht. Ossi würde bald fett sein, wahrscheinlich soff er, jedenfalls deutete dies die rote Farbe seiner Nase an und auch die kleinen Kraterpickel, die darauf wuchsen. »Nein, ich habe noch lange nicht erreicht, was ich wollte. Noch können Sie mich rausschmeißen. Irgendwann muss ich Prof werden, sonst ist der Spaß vorbei.«
Ossi lachte ihn an: »Das ist für dich doch ein Kinderspiel!«
»Schön wär’s«, erwiderte Stachelmann. »Schön wär’s. Davor liegt ein Aktenberg und wartet darauf, abgetragen zu werden.«
Ossi schaute ihn an, er lächelte nicht. Stachelmann wusste, Ossi begriff ihn nicht. Wie auch? In der Welt der Leichen türmte sich kein Berg der Schande, der einem den Schlaf raubte. Stachelmann hätte es als sinnlos empfunden, Ossi von seinen Ängsten zu berichten. Es hätte keinem von beiden genutzt. Aber er wollte nicht prahlen. Es war Zeit, das Thema zu wechseln. »Und welche Leiche beschäftigt dich gerade?«, fragte er bemüht humorvoll.
»Ein Kindesmord«, sagte Ossi. Seine Stimme klang traurig und erschöpft. »Ich weiß nicht, ob wir ihn jemals aufklären werden.«
»Warum?«
»Wir finden kein Motiv, und Spuren haben wir auch nicht. Es ist offenbar kein Sexualmörder. Fast scheint es so, als wäre der Tod wie ein Gespenst über das Mädchen gekommen und wäre einfach wieder verschwunden.«
Eine Wandlung war in Ossi vorgegangen. Stachelmann wunderte sich über die gestelzten Sätze. Vielleicht verarbeitet er so den Schrecken, dachte Stachelmann. Dann fiel ihm das Bild ein, das er am Morgen in der Bahn gesehen hatte. Ein Mädchen mit Zöpfen. »Ist es die Geschichte mit dem Makler?«, fragte Stachelmann.
Ossi nickte. »Ja, woher weißt du das?« Seine Hand zuckte kurz. »Ach so, die Zeitungen.«
Die Schwarze erschien: »Ja, bitte?«
»Valentina Holler, komischer Name«, sagte Ossi.
Die Schwarze zischte etwas, schüttelte ihren Pferdeschwanz und verschwand.
»Und ein komischer Fall«, fügte Ossi hinzu. Er strich mit Daumen und Zeigefinger an seinem Bierglas hinauf und hinunter. Sein Blick war leer. »Sie hatte gespielt«, sagte er. »Einfach nur gespielt. Sie spielte mit einer Puppe, schob sie im Puppenkinderwagen im Garten umher.« Er blickte auf vom Tisch, sah die Schwarze und winkte. Sie kam und sah ihn unfreundlich an. Ossi bestellte noch ein Bier und ein weiteres, nachdem er zu Stachelmann hinübergeschaut hatte. Dann sagte er: »Ich muss mal austreten«, stand auf und suchte den Weg zur Toilette.
Stachelmann war erstaunt, wie krass Ossis Stimmung umgeschlagen war. Klar, ein Kindesmord nahm einen mit. Viele Morde hatten handfeste Gründe, manche waren gut genug, um vor Gericht mildernde Umstände zu erwirken. Kindesmord war immer unverständlich. Da gab es keine Eifersucht, keinen Neid, keine Konkurrenz, keine Rache und was man sonst als Grund dafür anführen mochte, einen Menschen zu töten.
Ossi kam wieder. Stachelmann entdeckte einen Fleck an seinem Hosenbein.
Die Schwarze erschien und stellte zwei Bier auf den Tisch.
Der Spielautomat dödelte.
Ossi nahm einen Schluck aus seinem Glas. »Valentina schob ihren Puppenwagen durch die Gegend, dann fiel sie um. Sie war sofort tot. Vergiftet, Zyankali.«
Stachelmann staunte. Davon hatte nichts in der Zeitung gestanden. »Zyankali?«
»Ja, da hat jemand eine Sechsjährige mit Blausäure vergiftet.«
»Und wie?«
»Auf dem Grundstück hat irgendwo ein Bonbon gelegen. Ein Karamellbonbon, gefüllt mit Zyankali. Das jedenfalls hat mir der Pathologe gesagt. Den Obduktionsbericht gibt’s erst morgen. Das Bonbonpapier haben wir gefunden. Es lag neben der Leiche. Valentina hat ein Bonbon entdeckt, in blauem Papier, hat es ausgepackt und offenbar gleich in den Mund gesteckt. Ein paar Mal lutschen, und sie war tot. Genau das hat sich der Täter gewünscht.«
»Unfassbar«, sagte Stachelmann. »Einen Erwachsenen bringt man nicht mit einem Bonbon um.«
»Aber wer füllt ein Bonbon mit Zyankali und wirft es in den Garten einer Villa, damit ein Kind es findet und daran stirbt? Ich kapiere es nicht.«
Sie saßen eine Weile schweigend am Tisch. Stachelmann ließ seine Augen durch die Kneipe schweifen. Sie hatte sich mittlerweile gefüllt. Die Schwarze war gut beschäftigt, erledigte ihren Job mit Ruhe und Übersicht. Wenn sie heute Nacht fertig war, hatte sie ein paar Zentner geschleppt.
»Und das ist nun der dritte Mord im Haus Holler. Würde mich nicht wundern, wenn irgendwann zwei weitere passierten.«
»Wird der Mann erpresst?« Stachelmann wunderte sich über sein Interesse an diesem Fall. Er spürte, es lag nicht nur daran, dass Ossi befasst war mit der Sache. Was war es, was ihn ansprach? Holler, wer war Holler?
Ossi brauchte einige Sekunden für seine Antwort: »Nein, zumindest sieht es nicht nach Erpressung aus. Wir sind uns nicht einmal sicher, dass es sich um einen Serienmord handelt.«
»Reichen drei Tote in einer Familie nicht aus?«
Ossi zündete sich eine Zigarette an, zog kräftig und sagte ruhig, mit mutloser Stimme: »Bei einem Serienmord gibt es einen Täter oder eine Tätergruppe. Hollers Frau wurde erschlagen, der Sohn vergiftet und die Tochter auch. Dem Sohn hat jemand Zyankali in die Cola geschüttet. Zwei Giftmorde, der erste Fall passt nicht dazu. Erschlagen. Erschlagen ist was anderes.«
»Aber drei Tote binnen weniger Jahre in einer Familie?«
»Du hast Recht. Nur, keiner kennt ein Motiv. Holler ist ein ehrenwerter Geschäftsmann. Wir haben sein Umfeld geradezu durchwühlt. Er kommt einem manchmal vor wie ein Heiliger. Ist in allen möglichen Wohltätigkeitsvereinen, ohne es an die große Glocke zu hängen. Er hat zum Beispiel eine halbe Million gespendet für Tschernobylopfer. Als wir das herausgefunden hatten, wurde er stinksauer und hat uns verdonnert, das auf keinen Fall an die Presse weiterzugeben. Seine Geschäftspartner und Kunden sind begeistert. Der Mann ist ehrlich, zuverlässig, fast so eine Art Jesus von der Elbchaussee.«
Ossi berichtete von seinem letzten Besuch bei Holler in der Holztwiete. Es war am Morgen dieses Tags gewesen. Er hatte Holler angesehen, der Mann hatte geweint, nicht geschlafen. In seinen Augen stand Verzweiflung. Holler war groß gewachsen, hatte kurz geschnittene blonde Haare über einem Gesicht, das jünger aussah, als es seinem Alter entsprach. Nein, er hatte keine Ahnung, warum seine Tochter vergiftet worden war. Holler hatte Ossi versichert, er dürfe alles sehen, was er sehen wolle, für die Polizei werde es kein Bank- und kein Arztgeheimnis geben. Wenn sie es für richtig halte, dürfe sie das Haus und die Firma auf den Kopf stellen. »Tun Sie alles, was Sie für sinnvoll halten, um den Mörder zu finden«, sagte Holler mit brüchiger Stimme.
Es war Ratlosigkeit, die Ossi dazu brachte, so offen zu berichten, das begriff Stachelmann sofort. Wieder spürte Stachelmann, wie die Frage in ihm bohrte, wer Holler war und warum dem Mann dieser Schrecken widerfuhr. Tief in ihm glaubte er eine Stimme zu hören, die an etwas erinnerte. An was, verdammt? Was hatte er mit Holler zu tun? Er kannte den Mann nicht, er war noch nie auch nur in der Nähe seines Hauses gewesen. Und was hatte er mit Maklern zu tun oder mit Wohltätigkeitsvereinen oder mit einem Wahnsinnigen, der Zyankali in ein Bonbon spritzte, es in einen Garten warf und hoffte, ein Kind würde es essen? Ob der Mörder zugeschaut hatte, wie das Mädchen das Bonbon lutschte? Hatte er sich gefreut, als sein Plan aufging? Musste er nicht damit rechnen, dass jemand anders das Bonbon fand und es wegschmiss oder selbst lutschte? War das Kind überhaupt das Ziel eines Verbrechens? Oder war alles Zufall? Lief da einer durch die Stadt mit einer Tüte Karamellbonbons in der Tasche, in die er Zyankali gespritzt hatte und die er irgendwo verteilte, damit irgendjemand starb? Würde es weitere Vergiftungen geben? Wie besorgte man sich Zyankali? Wer stellte Zyankali her? Was für einen Tod stirbt einer, der Zyankali schluckt? Fragen gingen ihm durch den Kopf. Nein, es war ein Bonbon und ein totes Kind. Und der Mörder hatte dieses Kind gemeint. Aber woher wusste er, dass das Kind das Bonbon essen würde? Wie herum man es auch drehte, man kam zu keinem Schluss.
Ossi hatte bei der Schwarzen ein drittes Bier bestellt, dazu einen Schnaps. »Bin nicht im Dienst«, sagte er. »Bist du enttäuscht?«
Stachelmann schaute ihn fragend an.
»Na, weil es nicht so ist, wie es bei einem Veteranentreffen sein soll.«
Stachelmann lachte. »Und wie soll es bei einem Veteranentreffen sein?«
»Na ja, Schulterklopfen, Lachen, so laut, dass andere Gäste sauer werden, saufen, sich sagen, wie gut man sich gehalten hat, oder sich gegenseitig den Bauch tätscheln, wie das eben so sein muss. Also, ich bin geschieden und habe zwei Kinder.«
»Ich habe diesen Namen im Kopf«, sagte Stachelmann. »Irgendwo habe ich den vergraben, ich weiß nicht, wo.« Er starrte in den Rauch.
»Welchen Namen?«, fragte Ossi.
»Holler.«
»Den wollte ich gerade für ein, zwei Stunden vergessen«, sagte Ossi.
Der Spielautomat dödelte.
Ossi wischte sich mit dem Handrücken den Mund ab. Er sah müde aus. »Warum interessiert dich das überhaupt? Weißt du, wie viele Morde es im Jahr in Hamburg gibt?«
Stachelmann schüttelte den Kopf.
»Im Jahr 2001 waren es, glaube ich, siebenunddreißig.«
»Aber ein Kind?«, erwiderte Stachelmann.
»Ein Kind, ein Kind.« Ossi klang zornig. »Ich kann es nicht mehr hören. Alle Welt quatscht von einem Kind. Kindesmord, wie furchtbar das ist. Ich will dir mal meine ganz unmaßgebliche Meinung sagen: Mord ist Mord, ob Oma oder Kind. Oder findest du, ein Menschenleben ist mehr wert als ein anderes, tausend Mark statt zweihundert? Vielleicht der Industrie, weil die einem Kind im Lauf seines Lebens mehr andrehen kann als einer Oma mit begrenzter Lebenserwartung und jenseits des Konsumwahns. So ein Quatsch!«
»Alter Klassenkämpfer«, sagte Stachelmann. Es klang nicht lustig.
»Idiot«, sagte Ossi. »Die drehen noch durch im Präsidium. Die Presse macht ein Riesenremmidemmi, Mottenpost und Bild vorneweg. Und dann ist der Holler eben so eine Art Heiland, bekannt mit Bürgermeister, Innensenator, dem Chef der Industrie- und Handelskammer, dem DGB-Boss und so weiter und so fort.«
»Tanzt auf allen Partys.«
»Auf keiner. Aber kennt jeden. Und fast sieht es so aus, als wäre der Polizeipräsident sein allerbester Freund. Es hörte sich jedenfalls so an, als er der Mordkommission den Marsch geblasen hat.«
Stachelmann marterte sein Gedächtnis. Verdammt, wo hatte er diesen Namen schon einmal gehört oder gelesen? Er hatte ihn gelesen, er sah die Buchstaben vor sich. Sie waren mit einer Schreibmaschine geschrieben. Oder foppte ihn seine Erinnerung? Sein Gedächtnis war schlechter, als es einem Historiker zustand. Peinlich die Momente, in denen er als Fachautorität nach Jahreszahlen oder Namen gefragt wurde. Zu oft fielen sie ihm nicht ein.
»Du bläst ja auch nur Trübsal«, sagte Ossi.
»Nein, ich denke nach.«
»Das ist bei dir anscheinend das Gleiche. Wenn man dich so anschaut.«
Stachelmann ärgerte sich. Das hatte er schon oft gehört. »Mir geht dieser Name durch den Kopf …«
»Holler?«
»Irgendwo habe ich den gelesen.«
Ossi schaute ihn mit wachen Augen an. »Und wo?«
»Wenn ich das wüsste.«
»Denk nach.«
»Was glaubst du, was ich seit einer halben Stunde tue?«
Nein, der Name würde ihm nicht einfallen. Heute nicht und womöglich nie. Wahrscheinlich war es nur ein Anklang, vielleicht ein ähnlicher Name in einem Buch oder einer Zeitschrift. Vielleicht war er Opfer eines Déjà vu? Gewiss, Holler war nicht Meier, Müller oder Schmidt, aber exotisch war der Name nicht. Etwas anderes fiel ihm auf. So hartnäckig war Ossi früher nicht gewesen, auch nicht so ernst. Er hatte immer für alles einen Spruch gehabt. Stachelmann hatte sich damals überlegt, welcher Witz Ossi beim Weltuntergang eingefallen wäre. Bestimmt sein bester. Alle stehen am Abgrund und kreischen, aber Ossi hat noch einen Witz auf Lager. Hei, hört mal zu, kennt ihr den? Beim Fall Holler waren Ossi die Witze ausgegangen. Oder früher schon. Kannte er seinen Freund noch, oder hatte er ihn damals verkannt? Er hatte ihn beneidet wegen der Leichtigkeit, mit der er Schwierigkeiten begegnete, die Stachelmann den Schlaf kosteten. Aber vielleicht hatte Ossi ja auch nicht geschlafen?
Es war spät, als Ossi und Stachelmann bei der Schwarzen bezahlten. Stachelmann gab ihr ein gutes Trinkgeld, sie lächelte nicht, blickte ihn kaum an. Fast hätte er sich entschuldigt.
Erst im Zug nach Lübeck merkte Stachelmann, wie müde er war. Auf dem Tisch im Großraumabteil der ersten Klasse lag die Bild-Zeitung. Stachelmann schaute sich die Bilder noch einmal an. Valentina Holler, sechs Jahre, vergiftet mit Blausäure. Zyankali tötet schnell, aber bis man tot ist, leidet man unter entsetzlichen Schmerzen. Das Foto vom Vater, dem Makler, schwarz-weiß, unscharf. Er kannte den Mann nicht. Warum schwirrte ihm Hollers Name seit heute Morgen durch die Gedanken?
III
Der alte Mann gestand es sich ein. Er hatte bisher Glück gehabt. Niemand hatte ihn beobachtet bei seinen Tötungen, es musste kein Unschuldiger sterben. Er konnte seine Opfer immer beim ersten Versuch erledigen. Es war leichter gewesen, als er geglaubt hatte. Der alte Mann lag auf dem Bett und betrachtete die Decke. Er erkannte Bilder. Frühstück, die Mutter bringt ihm Griesbrei. Der Vater steht auf, er muss zur Arbeit. »Häuser verkaufen«, nannte er es. Dann ging es zur Schule, sie hatten eine eigene für sich. Er liebte die Lehrerin, sie hieß Esther, sie unterrichtete alle Fächer. Am Abend, Papi war oft noch arbeiten, brachte Mami ihn ins Bett. Immer las sie ihm etwas vor, am liebsten Märchen. Er schloss die Augen. Wie dem Todesengel das Schwert entrissen wurde, daran erinnerte er sich gut.
Eines Tages sprach Gott zum Todesengel: »Geh hin und führe die Seele des Josua ins Paradies.« Der Rabbi Josua war ein gerechter Mann, aber seine Zeit war gekommen. Weil er nie gesündigt hatte, sollte der Todesengel ihm einen letzten Wunsch erfüllen. »Zeige mir meinen Platz im Paradies«, sagte Josua. »Aber gib mir dein Schwert, damit ich es halte. Ich habe solche Angst davor.« Der Todesengel gab ihm das Schwert und hob den Rabbi auf die Mauer, die das Paradies schützte, damit Josua das Paradies überblicken konnte. Als Josua das Paradies in seiner Herrlichkeit sah, wollte er nicht mehr zurück zur Erde und sprang mit dem Schwert von der Mauer ins Paradies. Der Todesengel bat um sein Schwert, ohne das er seine Arbeit nicht verrichten konnte. Aber Josua gab es ihm nicht zurück. Weil Josua ein frommer Mann war, erlaubte Gott ihm, das Schwert sieben Jahre zu behalten. So lange starb kein Mensch. Aber nach sieben Jahren erhörte Gott das Flehen des Todesengels, und der Tod kehrte zurück. Als Erster starb Josua, aber er spürte keinen Schmerz. Der Todesengel zog ihm die Seele aus dem Körper, wie man einen Faden aus der Milch zieht. Sanft schwebte der Rabbi in sein Gemach im Paradies.
Es war das Lieblingsmärchen des alten Manns, als er ein Kind war. Der Tod konnte schön sein. Ihn würde er befreien. Das Leben war ihm ein Ballast, es zog an seiner Seele mit Tonnengewicht.
Würde er weiter Glück haben? Er erinnerte sich an die Frau. Ihr Schrei, als er hinter dem Busch hervortrat. Sie stand wie erstarrt und wehrte sich nicht. Er schlug ihr mit einem Knüppel auf den Kopf, immer fester, steigerte sich in einen Rausch. Erschöpft hörte er auf, ihr Kopf war ein unförmiger Klumpen, überzogen mit Blut und Hirnmasse.
Stachelmann hatte kaum geschlafen in dieser Nacht. Und wenn, dann träumte er von Toten. Er war verstört, als er aufwachte. Der Rücken schmerzte, er war steif, die Tabletten hielten nicht lange vor. Er mühte sich aus dem Bett, die Augen brannten. Er schmierte sich zwei Marmeladenbrote und trank einen Becher Instantkaffee. Dabei schaute er in die Lübecker Nachrichten. Auf der Seite Weltspiegel/Wetter entdeckte er eine Notiz über den Mord an Valentina Holler. Hamburg war keine Bahnstunde entfernt, schon sank das Interesse an diesem Verbrechen. Stachelmann stand im Bademantel am Fenster und schaute auf den Hinterhof. Es regnete, schwere Wolken am Himmel. Dann fiel es ihm ein, heute Abend erwartete ihn, was er sich seit langem erhofft hatte, das Treffen mit Anne. Sein Magen zog sich zusammen. Das tat er immer, wenn Stachelmann sich aufregte. Manchmal bekam er dann Durchfall. Hoffentlich nicht im Zug, dachte er. Er ekelte sich vor den Bahnklos.
Er überstand die Zugfahrt besser als befürchtet. Als er den Berg der Schande sah, verschlechterte sich seine Laune für kurze Zeit. Dann gewann die Vorfreude die Oberhand, bis Angst sie verdrängte, er würde wieder alles falsch machen. Er nahm sich den Stapel Fachzeitschriften, die er längst hätte lesen müssen. Er mochte sie nicht, hielt sie für ein Potpourri der Eitelkeit. In den gelehrten Debatten zeigte sich eher der Drang zur Selbstdarstellung als das Bemühen um Klärung. Heutzutage war die Wissenschaft Adams Dschungel, richtete er sich mächtig auf und schlug sich mit seinen Fäusten gegen den Brustkorb, damit der Urwald hörte, wer ein Alphatier war oder eines werden wollte. So trommelte es durch die Fachpresse. Wer ein Silberrücken werden wollte, musste fleißig dienern, viel schreiben und die Majestäten ausführlich zitieren. Stachelmann lachte trocken. So viel hat sich doch nicht geändert, seit die Menschen aufrecht gehen.
Er entdeckte einen Aufsatz über das Konzentrationslager Mittelbau-Dora, die Produktionsstätte der V-2-Raketen. Der Artikel war anders. Sachlich schilderte er die Leiden der Häftlinge und die rüstungstechnische Bedeutung des Lagers bei Nordhausen. Nein, nicht alle waren Möchtegernalphatiere. Dora war am Anfang ein Außenlager des KZ Buchenwald gewesen. Ein Lichtstrahl drang durchs Fenster ein, der Regen hatte aufgehört. Er legte einen Zettel in die Zeitschrift, nachher würde er den Artikel kopieren und ihn auf den Berg der Schande legen.
Er verzichtete auf den Gang in die Mensa. Einen Augenblick überkam ihn die Furcht, Anne könnte ihn dort ansprechen und das Treffen absagen. Er lief zum Harvestehuder Weg, ans Ufer der Außenalster, wo die Enten fast alle Scheu vor den Menschen verloren hatten.
Warum hatte Anne ihn eingeladen? Er schalt sich, sie nicht gefragt zu haben. Nun würde er die Ungewissheit noch lange Stunden ertragen müssen. Was konnte sie von einem Versager wollen? Die Angst erfasste ihn. Jedes Mal, wenn er Bohming am Historischen Seminar sah, fürchtete Stachelmann, dass der Sagenhafte ihn in sein Sprechzimmer bitten und ihn fragen würde, wann er denn seine Habilitation beenden wolle. Natürlich würde Bohming das in freundlichen Worten tun. Er würde von der großen Hoffnung sprechen, die er in ihn setze, vielleicht wiederholen, was er gesagt hatte, als Stachelmann nach Hamburg kam: »Sie haben hier alle Chancen, Stachelmann, ich bin nicht mehr der Jüngste.« Er hatte angedeutet, wie sich das Menetekel der Hausberufung umgehen ließe. »Wissen Sie, ich habe da ein paar Freunde in Köln. Was meinen Sie, zwei, drei Semester, Sie werden die geschwätzigen Rheinländer überleben, und dann zurück nach Hamburg. Sie sehen, ich habe an alles gedacht. Jetzt müssen Sie nur noch Ihre Habil schaffen. Aber das ist ja eine Kleinigkeit für Sie, nach dieser Promotion, >Stern am Historikerhimmel<, und wenn’s mal klemmt, ich habe immer für Sie Zeit.«
Konnte man bessere Startbedingungen haben? Stachelmann hatte ein schlechtes Gewissen, als er an die Freundlichkeit dachte, mit der er in Hamburg begrüßt worden war. Bohming und die anderen waren immer noch freundlich. Und doch glaubte Stachelmann, Enttäuschung bei ihnen zu spüren. Die Enttäuschung würde wachsen. Warum fehlte ihm die Kraft, diese letzte Hürde zu überspringen? Nicht nur Bohming war enttäuscht von ihm, er selbst war es viel mehr.
Er setzte sich auf eine Bank am Wasser und schaute den Enten zu. Einige schwammen heran und warteten auf die Brotkrümel, die sie in Stachelmanns Taschen vermuteten. Andere waren satt und dösten pärchenweise auf der Wiese. Er verfolgte Segelboote, die sich vom flauen Wind treiben ließen.
Auch seine Eltern wären enttäuscht, wenn sein Vertrag nicht verlängert würde. Er musste Professor werden, um endlich Ruhe zu finden. Aber er fand nicht die Ruhe, Professor zu werden. Er hatte das Gefühl, er habe zu seinem Thema schon alles geschrieben. Hätte er doch sein Material sparsamer verwendet, die Doktorarbeit ausgedünnt, es hätte immer für eine ordentliche Note gereicht. Aber dann hätten die Fachzeitschriften seine Arbeit nicht einmal erwähnt, und er wäre nicht nach Hamburg gekommen. Allerdings, für eine Habil an einer kleinen Uni hätte es gereicht. Er hatte Angst vor dem Tag, an dem er sich eingestehen musste, er würde es nicht schaffen. Diese Angst raubte ihm oft den Schlaf.
Die Enten setzten keine Hoffnung mehr in ihn. Sie schwammen und watschelten zur nächsten Bank, wo eine Oma mit ihrem Enkel Brotkrümel ins Wasser und auf die Wiese warf. Der Kleine stieß bei jedem Wurf einen spitzen Schrei aus. Es war Zeit, zu gehen.
Um sechzehn Uhr klopfte es an seine Tür. Alicia, er hatte sie ganz vergessen und hoffte, sie würde es ihm nicht ansehen. Dann sagte er sich, es wäre gut, sie würde es sehen. Sie hatte sich hübsch gemacht, einen kurzen Rock angezogen. Sie ist ein schönes Kind, dachte Stachelmann. Er dachte es nicht zum ersten Mal. Aber er fühlte sich nicht angezogen von ihr. Er mühte sich, ihr dies zu zeigen. Er gab sich kalt und barsch. Aber bisher hatte es sie nicht beeindruckt, jedenfalls ließ sie sich nichts anmerken. Sie sagte leise: »Hallo!«, schaute ihm etwas zu lange in die Augen, setzte sich auf den Besucherstuhl vor Stachelmanns Schreibtisch und beugte sich ein wenig vor, die beiden oberen Knöpfe ihrer Bluse waren geöffnet.
Ein schönes Kind, warum fiel ihm immer das Gleiche ein, wenn er sie sah?
Es klopfte an der Tür, Anne steckte ihren Kopf durch die Spalte. Sie öffnete den Mund, schloss ihn aber wieder, als sie Stachelmanns Besucherin sah. Stachelmann glaubte, ihr Lächeln sei einen Augenblick verschwunden. »Entschuldigung, ich störe«, sagte Anne und schloss die Tür.
Stachelmann begriff nicht, was Alicia von ihm wollte. Ging es ihr darum herauszufinden, warum sie eine Drei erhalten hatte und Simone Wagner eine Zwei, obwohl sie ihre These nicht beweisen konnte? Stachelmann spürte keine Empörung bei Alicia. Sie beklagte sich nur ein wenig, erklärte, ihre Arbeit befinde sich in Übereinstimmung mit der Haltung fast aller seriösen Historiker. Stachelmann fragte sich, ob er ihr die Wahrheit sagen sollte. Dass er ihre Arbeit mit einer Drei benotet hatte, weil sie keinen Funken Eigenständigkeit zeigte. Aber da gab es noch etwas. Er fürchtete die Zudringlichkeit Alicias und wollte sie nicht ermuntern, indem er ihr eine Note gab, die sie für schmeichelhaft halten konnte.
Früher, als Stachelmann studierte, gab es fast nur Einsen und Zweien. Die Professoren und Dozenten waren froh, wenn ein Student sich auf eine Leistungsprüfung einließ. Stachelmann hatte es genutzt, aber nicht dazu gebracht, diesem Vorbild zu folgen. Er benotete streng und mühte sich, gerecht zu sein. Er fragte sich, ob er Alicia jemals eine Eins geben könnte. Dann rief sie ihn wahrscheinlich zweimal die Woche zu Hause an, um ihm an den restlichen Tagen am Seminar nachzustellen. Er würde keinen Tag in der neuen Mensa im Philosophenturm sitzen können ohne die Furcht, dass sie sich zu ihm setzte.
Er fand sich sachlich und freundlich, distanziert. Sie strahlte ihn an. Er sagte ihr, sie möge künftig weniger auf die Mehrheitsmeinung der Historiker achten und sich stattdessen mehr um die Quellen kümmern. Sie nickte eifrig. Als es nichts mehr zu erläutern gab, sagte Stachelmann: »Ich freue mich, dass Sie meine Kritik annehmen«, und stand auf, um sie zu verabschieden.
Sie erhob sich gleichfalls und hielt ihm ihre Hand hin. Dann zog sie sie zurück und sagte: »Herr Stachelmann, noch eine Frage.«
»Ja?«
»Darf ich Sie auf eine Tasse Kaffee einladen? Ich kenne da ein nettes Café, nicht weit von hier, Richtung Klosterstern.«
»Warum?«, fragte Stachelmann. Er fühlte sich unwohl. Warum musste er fragen, statt einfach Nein zu sagen?
»Muss man für alles alle Gründe kennen? Ich fände es einfach nett. Und wenn Sie es auch nett fänden, würde es doch erst einmal reichen für einen Kaffee.« Ihr Lachen lockte und stieß ihn ab.
Stachelmann reichte ihr noch einmal seine Hand und sagte: »Es geht nicht. Tut mir leid.«
»Ach, Sie haben keine Zeit. Das macht doch nichts. Wir können es ja nachholen.« Sie sagte es mit einem Lächeln, das einigen Männern Unruhe bereitet hätte, drehte sich um und verließ federnden Schritts Stachelmanns Arbeitszimmer.
Er saß noch eine Weile auf seinem Schreibtischstuhl und ärgerte sich über sich selbst. Warum hatte er nicht Klartext gesprochen? Warum druckste er herum, wann immer er sich bedrängt fühlte? Warum konnte er in solchen Situationen nicht einfach Nein sagen?
Das Telefon klingelte, Bohming war dran. »Sagen Sie, Herr Stachelmann, würde es Ihnen etwas ausmachen, mich in meinem Zimmer zu besuchen?«
»Gerne«, sagte Stachelmann. »Wann?«
»Sagen wir, in einer Viertelstunde?« Bohming sprach wie immer etwas zu laut.
»Ich komme dann«, sagte Stachelmann und schaute auf die Uhr. Hoffentlich dauerte es nicht zu lange. Bohming