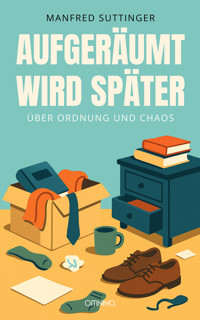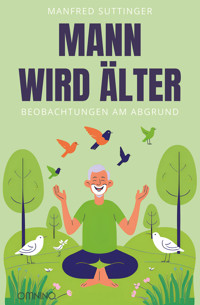
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Omnino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit 60 fängt das Leben erst richtig an – sagen zumindest die, die es noch nicht erreicht haben. Doch was bedeutet es wirklich, wenn die Brille plötzlich zum treuesten Begleiter wird, der Medikamentenschrank besser sortiert ist als die Werkstatt, und die Kinder endgültig durchschaut haben, dass Papa eben doch nicht alles kann? In seinen pointierten Beobachtungen nimmt der Autor mit viel Witz und Augenzwinkern den Alltag reiferer Herren unter die Lupe: vom Kampf gegen das Verschwinden der eigenen Haare bis zur Erkenntnis, dass ein Mittagsschläfchen kein Zeichen von Schwäche ist. Ein Buch für alle Männer, die älter werden und für die, die mit diesen Männern leben müssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mann wird älter
Manfred Suttinger
Mann wird älter
Beobachtungen am Abgrund
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 9783958943391
© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2025
Am Friedrichshain 22 / 10407 Berlin / [email protected]
www.omnino-verlag.de
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Inhalt
Einleitung
Davon weiß ich nichts
Oder: Die Sache mit der Vergesslichkeit
Ist es schon wieder soweit?
Oder: Besuch beim Facharzt
Was machst du da, Papa?
Oder: Wie sich der Kompetenzverlust in mein Leben schleicht
Nichts wie raus hier
Oder: Besuch im Altersheim
Du solltest etwas Sport machen
Oder: Die Last des Übergewichts
Wenn das Knie knackt
Oder: Herdenjammern mit Freunden
Alle Mann vorwärts
Oder: Eine Gruppenreise mit Rentnern
Alles, bloß das nicht
Oder: Kein typischer Rentner werden
Igel, Matte, Kranz und Platte
Oder: Das undurchschaubare Verhalten männlicher Haare
Sie auch hier?
Oder: Begegnungen in der Apotheke
Weg damit!
Oder: Endlich mal aufräumen
Vor dem Friedhof kommt das Heim
Oder: Wenn die Eltern Pflege brauchen
Immer noch der Alte
Oder: Fünfundvierzig Jahre Abi
Die Bären sind los
Oder: Shitstorm im Datingportal
Weg damit!
Oder: Endlich mal aufräumen (2)
Früher war mehr Lametta
Oder: Wie steht’s mit der Potenz?
Der Kampf gegen die Sinnlosigkeit
Oder: Wenn Sehen und Hören schlechter werden
Auf Erden bin ich nur ein Gast
Oder: Trauerfeiern und Todesfälle
Kasperle und die Stichsäge
Oder: Das richtige Programm für Enkelkinder
Der Fliehkraft entkommen
Oder: Wenn das Leben endlich ruhiger wird
So sicher wie nie
Oder: Endlich älter
Für Kornelia
Einleitung
Von meinem ersten Atemzug an hatte ich Gelegenheit, mich ans Älterwerden zu gewöhnen. Um es vorwegzunehmen: Es ist mir nur teilweise gelungen.
Über meine ersten drei oder vier Lebensjahre kann ich nicht viel berichten. Eigentlich gar nichts. Zwar habe ich ein paar wenige Bilder aus dieser Zeit im Kopf. Es sind unscharfe Momentaufnahmen, von denen ich nicht sagen kann, ob ich sie tatsächlich so erlebt habe oder ob sie durch Erzählungen anderer in mein Gedächtnis geraten sind.
Das Nachdenken übers Alter und den möglichen Verlauf meines Lebens begann wahrscheinlich erst mit der Grundschule. Da lernte ich: Nach der ersten Klassen kommt die zweite, und das hatte offenbar einen zeitlichen Zusammenhang, der sich nicht beeinflussen ließ.
Und trotzdem: Auch nach den ersten Monaten als Schulanfänger schien es mir völlig unwahrscheinlich, irgendwann einmal in die vierte oder fünfte Klasse zu gehen – die zweite war mit etwas Fantasie gerade noch vorstellbar. Ältere Mitschüler auf dem Pausenhof kamen mir vor wie eine völlig andere Art Kinder, groß und fremd und auch ein bisschen unheimlich. Waren sie vielleicht von vornherein in einem höheren Alter geboren worden?
In den kommenden Jahren hatte das Älterwerden überwiegend mit neuen Lernerfahrungen zu tun: dem privaten Flöten- und bald auch Klavierunterricht bei einer etwas schrulligen Musikpädagogin, der ersten Fremdsprache in der vierten Klasse, der anscheinend unvermeidbaren Sexualkunde sowie dem Beginn des traditionellen Konfirmandenunterrichts. Auf all diese Veränderungen wurde ich von Eltern, Großeltern und Lehrern schon Wochen, wenn nicht Monate im Voraus eingestimmt.
Beim Übergang auf die Oberschule (ich war gerade dreizehn geworden) trat eine andere Zeiteinheit in den Vordergrund, die zugleich eine wichtige Voraussetzung fürs Abitur war: von Jahr zu Jahr das Erreichen der nächsten Klassenstufe. Das war nicht selbstverständlich, denn ab der siebten Klasse auf dem Gymnasium konnte ich nachlassenden Fleiß, Desinteresse und Unkenntnisse nicht mehr so leicht hinter Freundlichkeit und Gewitztheit verbergen. Die Schule machte mir das Leben schwer. Algebra war mir ein Graus, Französisch als zweite Fremdsprache war très terrible, Biologie mutierte durch die Analyse der Photosynthese zu einer besonders perfiden Form von Mathematik, und mit Sport konnte man mich jagen.
An meinem vierzehnten Geburtstag erklärte mir mein Vater, der als Psychologe im Strafvollzug arbeitete, dass ich über Nacht meine kindliche Schuldunfähigkeit verloren hätte und von nun an strafmündig sei. Würde ich kriminell werden wollen, könnte immerhin noch ein paar Jahre lang das Jugendstrafrecht angewandt werden. Dann würde einer erzieherischen Maßnahme gegenüber einer Haftstrafe Vorrang eingeräumt. Irgendwie fühlte sich das Älterwerden in dieser Phase nicht so richtig gut an.
Mit großer Mühe näherte ich mich dem Abitur und überstand die Schulzeit eigentlich nur, weil in den letzten zwei Schuljahren das neue Kurssystem begonnen hatte und ich einige besonders missliebige Fächer abwählen konnte. Physik, Chemie und Französisch gehörten nun schon der Vergangenheit an.
Wenige Wochen nach meinem achtzehnten Geburtstag machte ich den Führerschein und war nach dem gerade erst in Kraft getretenen Gesetz volljährig. Das bedeutete: Wählen gehen, Alkohol trinken und Kinofilme ansehen, die vorher verboten waren.
Mit fünfundzwanzig beendete ich mein Studium, mit dreißig gründete ich eine Familie, mit fünfunddreißig zog ich in eine Eigentumswohnung am Stadtrand, und seither wurden die Veränderungen unbedeutender. An meinem vierzigsten Geburtstag gab es einen kurzen Augenblick, in dem ich daran dachte, dass mein Leben nicht ewig dauern könnte. Dieser Gedanke tauchte zunächst nur gelegentlich wieder auf, kehrte aber mit den Jahren immer häufiger zurück und blieb dann auch länger in meinem Kopf hocken, als mir lieb war.
Zwanzig Jahre später (ich war Mitte vierzig) begann eine Zeit, in der mich immer mehr störte: das schrille Piepen des Weckers am Morgen, das penetrant süßliche Parfum meiner Büronachbarin, die nach nichts schmeckenden Kartoffeln der Kantine und die besprenkelten Klobrillen der militanten Stehpinkler meiner Etage. Immer mehr Kollegen, Nachbarn, Verkehrsteilnehmer, Behördenmitarbeiter und Dienstleister gingen mir auf die Nerven, manchmal auch die Freunde und sogar die eigene Familie. Mein Einkommen verharrte auf der letzten Stufe der Gehaltstabelle, und in Haus und Garten fielen mir immer mehr Details auf, die mich daran erinnerten, dass ich viel zu lange nichts mehr gepflegt, instand gehalten oder erneuert hatte. Ich wurde auch unzufriedener mit mir selbst, denn ich bemerkte hin und wieder: Meine Kräfte, auf die ich mich immer hatte verlassen können, waren nicht mehr die alten. Tagsüber konnte ich mich oft nicht richtig konzentrieren, in den Nächten lag ich manchmal wach und fühlte mich am nächsten Morgen kaum regeneriert. An den meisten Wochenenden bekam ich Migräne, und auch der Jahresurlaub führte nicht mehr zur erhofften Entspannung. Im Gegenteil: Spätestens in der zweiten Urlaubshälfte begann ich deprimiert, die Tage zurückzuzählen, die noch blieben, und dachte immer häufiger an alle nur denkbaren unerfreulichen Entwicklungen und Aufgaben im Büro. Natürlich war es vollkommen irrsinnig, in dieser Stimmung auch noch die beruflichen E-Mails zu checken. Ich machte es trotzdem.
Kurzum: Mein bisheriges Leben erschien mir einigermaßen trostlos und kümmerlich. Interessiert verfolgte ich die Geschichten anderer Männer meines Alters, die sich plötzlich aus ihren beruflichen und privaten Bindungen lösten, um irgendwo anders, meist mit einer deutlich jüngeren Begleiterin, noch einmal von vorn zu beginnen. Dazu fehlte mir der Mut, und ganz so schlimm waren die eigene Familie und der Berufsalltag auch wieder nicht. War ich nun etwa in der Midlifekrise? Quatsch! So was gibt’s doch eigentlich nur bei anderen!
Am fünfzigsten Geburtstag gab ich mir einen Ruck und nahm mir vor, das Beste aus der Sache zu machen. Nun redete ich mir mantraartig ein, dass gerade erst die zweite Lebenshälfte angebrochen war. Mit etwas Glück konnte ich bestimmt noch die eine oder andere erfreuliche Überraschung erleben. Think positive!
Die Zeit zwischen fünfzig und sechzig verging wie im Flug. Meine tröstliche Idee von der zweiten Lebenshälfte war natürlich nicht ewig haltbar. Vielleicht gab es irgendwo in Japan noch einen einhundertzehnjährigen Greis ohne Zähne, der aufs Klo getragen werden musste. Die Wahrscheinlichkeit, dass mir das ebenfalls gelingen würde, stufte ich aber als gering ein, und die Aussicht auf solch ein Leben schien mir dann auch nicht besonders erstrebenswert.
Tatsache ist: Ab sechzig werden die Aussichten auf große Lebensveränderungen übersichtlich. Außerdem beginnt in absehbarer Zeit mein Ruhestand. Zehn Jahre später werden mich die Kinder ins Heim stecken, mich dann auf einer Pflegestation unterbringen und mir schließlich, wenn es gar nicht mehr anders geht, vielleicht noch einen Platz im Hospiz besorgen. Mit anderen Worten: Ab sechzig fährt man auf „Reserve“, ohne zu wissen, wie lang die Strecke ist, die man mit dieser Reserve noch bewältigen muss. Das ist bitter genug, solang man gesund bleibt. Die Erfahrungen anderer Gleichaltriger zeigen jedoch, dass man in dieser Lebensphase besonders empfänglich für weitere böse Überraschungen zu sein scheint: Unfall, Herzinfarkt, Tod des Partners, Schlaganfall oder Demenz – und schon steht überhaupt nichts mehr fest.
Worauf ich mich hingegen verlassen kann: Kein Bankberater wird mir mehr einen großzügigen Kredit aufschwatzen, der mit zwanzig bis dreißig Jahren Laufzeit kalkuliert ist. Sollte ich trotzdem noch einmal Geld brauchen, wird das Darlehen klein sein, der Zinssatz hoch und die Rückzahlphase kurz. Bei der Anmietung des Urlaubswagens falle ich zwar noch in die Kategorie „jünger als siebzig“, aber auch hier wird mir vor Augen geführt, dass die Risikobereitschaft der Dienstleister begrenzt ist. Schlimmer noch: Die örtliche Kirchengemeinde schickt mir eine Einladung zum Singkreis für Senioren, und Versicherungsleute belästigen mich mit Angeboten für eine Sterbegeldpolice. Schließlich bekomme ich von der Stiftung Warentest, die mich seit Jahrzehnten durchs Leben begleitet, ein Vorsorgepaket für den Todesfall angeboten. Es enthält alle Formulare, die im Ernstfall von Bedeutung sind: Pflegevollmacht, Bankvollmacht, Nachlassliste, Organspendeausweis, Testament.
Die vielen Fachärzte, die neuerdings eine Rolle in meinem Alltag spielen, stellen mir schon jetzt ein schwindelerregendes Sammelsurium von Pillen und Kapseln zusammen. Meine Enkelkinder haben Sprechen gelernt und nennen mich „Opa“. Im öffentlichen Nahverkehr und auf der Straße werde ich von Frauen, die jünger als vierzig sind, nicht mehr wahrgenommen. Diese Frauen starren einfach an mir vorbei. Dazu müssen sie sich noch nicht einmal abwenden – sie haben erst gar nicht in meine Richtung geschaut. Kein Blickkontakt, kein Lächeln, kein Flirten mehr. In meinem Alter bin ich für Frauen unter vierzig einfach unsichtbar. Manchmal habe ich den Impuls, ihnen schnell in den Weg zu springen und zu rufen: „Doch, doch, es gibt mich noch!“ Allerdings könnte das zu weiteren Demütigungen führen, schlimmer noch: durch die ungewohnte Hüpfbewegung zu einem Sturz.
Auch die Sicht meiner eigenen Frau auf mich hat sich mit der Zeit verändert. Immer häufiger bemerke ich bei ihr eine neue Form des Augenkontakts, eine Art Scanner, der sich nicht manipulieren lässt. Wirkt er belastbar? Was kann ich ihm heute noch zumuten? Hat er sein Hemd beim Frühstück bekleckert? Ist es sinnvoll, ihn jetzt daran zu erinnern, dass am Wochenende eine Freundin zu Besuch kommt, die er nicht ausstehen kann?
Und erst die Kinder! Schon lange kommen sie nicht mehr mit Fragen oder wollen sich helfen lassen. Ich habe das Gefühl, dass sie mich zunehmend rücksichtsvoll behandeln, so, als hätte ich eine leichte Behinderung. Vielleicht denken sie, sie müssten mich schonen. Immer häufiger erwähnen sie auch, dass ich eine Frage schon einmal gestellt oder eine Antwort schon wieder vergessen habe. Wenn ich eine andere Meinung vertrete als sie, streiten sie auch nicht mehr darüber, sondern lächeln milde und gehen nicht weiter darauf ein.
Sogar das Verhalten meiner Hündin ist nicht mehr dasselbe. Habe ich früher ihren Namen gerufen, kam sie augenblicklich angerannt und blieb schwanzwedelnd und erwartungsvoll vor mir stehen. In letzter Zeit aber kann ich das Tier so oft herbei pfeifen, wie ich will, ohne dass irgendetwas geschieht. Die Hündin bleibt einfach dort, wo sie ist. Manchmal öffnet sie etwas gequält ein Auge, um nachzusehen, ob eine Gefahr droht. Offenbar habe ich einen Teil meiner ursprünglichen Autorität eingebüßt, und sogar mein gutmütiges Haustier bemerkt es.
„Sie hört einfach nicht mehr so gut“, sagt meine Frau, die es meistens gut mit mir meint. Doch ich habe Zweifel daran, dass der Hörverlust der Hündin eine organische Ursache hat. Andere Laute nimmt das Tier nämlich sehr aufmerksam zur Kenntnis, auch dann, wenn sie sehr viel leiser sind als meine auffordernden Rufe oder Pfiffe. Wenn ich zum Beispiel vorsichtig eine Tüte mit Erdnussflips aus der Schublade ziehe, ist der Quadrupede augenblicklich zur Stelle, um seinen Anteil einzufordern. Er glaubt anscheinend, die Führungsposition des Rudels sei vakant, und setzt nun alles daran, meine Nachfolge anzutreten.
All das geschieht also, wenn man die sechzig überschritten hat. Aber gut, ich will nicht jammern. Andere sind in diesem Alter schon gestorben. Aber schön ist das Älterwerden auch nicht gerade. Oder doch?
Davon weiß ich nichts
Oder: Die Sache mit der Vergesslichkeit
Ich neige dazu, Termine, die mir nicht gefallen oder mir wenig bedeuten, schneller zu vergessen, als es sich Sigmund Freud hätte träumen lassen. Wenn das passiert, sind leider meistens auch andere davon betroffen. Dann rollen sie mit den Augen, reagieren verstimmt oder sind im schlimmsten Fall sogar richtig sauer. Damit das nicht ständig passiert, trage ich immer häufiger Termine und Erinnerungen in meinen Papierkalender ein. Weil ich ein Gewohnheitsmensch bin, ist es immer das gleiche Fabrikat – nicht ganz preiswert, dafür aber in einem ansprechenden Design. Das Modell meiner Wahl heißt Minister, und ich habe noch niemals vergessen, mir rechtzeitig im ablaufenden Jahr einen neuen Minister zu besorgen. Oft frage ich bereits im September im Schreibwarenfachgeschäft nach, ob die frische Ware schon eingetroffen ist. Den Kalender gibt es nämlich, wenn man ihn nicht online bestellen möchte, nur in Fachgeschäften. Bei Mr. Billig bekommt man ihn nicht. Dort haben die Angestellten, die natürlich keine Fachverkäuferinnen sind, noch nie etwas von einem Kalender dieses Namens gehört. Zweimal habe ich deren bunte Filialen betreten, zweimal habe ich den ratlosen Blick des Personals ertragen müssen. Danach war mir klar: Hier wird das nichts!
Freunde und Kollegen tragen ihre Termine längst ins iPhone oder in andere Zeitmanagementprogramme ein. Das ist mir zu heikel. Ginge die Elektronik kaputt oder das Smartphone würde gestohlen, geriete meine Zukunft in Gefahr. Der Papierkalender hingegen ist so groß, dass ich ihn eigentlich nicht verlieren oder verlegen kann, und stehlen würde ihn sicher auch niemand, da er, abgesehen vom Anschaffungspreis, keinerlei materiellen Wert hat.
Neulich, Anfang Dezember, finde ich beim Aufschlagen der neuen Woche einen Termin für den morgigen Dienstag: „14 Uhr März.“ Eine kryptische Eintragung. Als ich die Notiz irgendwann einmal gemacht hatte, hatte ich offenbar nicht in Erwägung gezogen, dass mir der Zusammenhang zwischen Zeit, Ort und Anlass jemals verloren gehen könnte. Ohne Zweifel habe ich den plötzlich rätselhaft erscheinenden Vermerk selbst gemacht. „14 Uhr März.“ Ich blättere zurück zum März. Gibt es dort vielleicht eine Spur? Leider nicht. Und im März vom neuen Minister, der schon seit geraumer Zeit einsatzbereit neben dem Minister des auslaufenden Jahres liegt, bekomme ich auch keinen Hinweis.
Da fällt mir mein alter Kollege ein, Tobias, der eine Firma mit dem Namen März-Movie-Media betreibt. Unser letztes gemeinsames Projekt fand vor mehr als einem Jahr statt. Haben wir damals vielleicht ein neues Treffen vereinbart? Ich rufe ihn an.
„Hatten wir morgen um 14 Uhr einen Termin?“, frage ich.
„Ich glaube nicht“, sagt Tobias, „aber ich schaue trotzdem mal nach.“ Die Prüfung dauert nicht lange. Tobias ist ein moderner Mensch und benutzt miteinander vernetzte Endgeräte, die Tag und Nacht angeschaltet sind, permanent interagieren und ihre Daten abgleichen.
„Nein, da steht bei mir nichts“, sagt Tobias, „wie kommst du darauf?“
Ich erkläre ihm meine Frage.
Tobias lacht.
„Als wir uns das letzte Mal sprachen, wolltest du über eine Investition nachdenken“, erinnert er mich. Die Empfehlung könne er immer noch machen, obwohl die Anteile natürlich längst nicht mehr so günstig zu erwerben seien wie damals. Trotzdem: Immer noch eine bombige Anlage. Pharmaforschung.
„Sie entwickeln RNA-Impfstoffe. Das ist die Zukunft“, meint Tobias.
„Nein“, sage ich, „ich habe kein Geld übrig.“
Tobias hat durch Investitions- und Aktiengeschäfte in kurzer Zeit mehr verdient als in den vierzig Jahren mit seiner Filmfirma.
„Gib dir einfach einen Ruck und probiere es mit einem kleinen Einsatz“, sagt er, „zehn- oder zwanzigtausend Euro und dann einfach drei, vier Jahre abwarten.“
„Sorry“, sage ich, „vielleicht später, wenn ich geerbt habe. Jetzt muss ich erst noch das Rätsel meines unbekannten Termins lösen.“
„Viel Glück bei der Spurensuche“, sagt Tobias, lacht und legt auf.
Ich bin ratlos. In den nächsten Minuten kann ich mich nicht konzentrieren. Aber dann fällt mir doch noch etwas ein: „14 Uhr März“ könnte ein Zahnarztbesuch sein. Wenn ich bei einer Kontrolluntersuchung bin, lege ich oft schon den Folgetermin fest. Es hilft nichts, ich muss in der Praxis anrufen.
„Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich morgen um 14 Uhr einen Termin bei Ihnen habe“, sage ich zur Sprechstundenhelferin Yvonne Klein, die die Stimme einer Zehnjährigen hat.
„Da kann ich Ihnen bestimmt helfen! Einen Moment, bitte!“
Ich höre sie auf ihrer Tastatur arbeiten.
„Morgen, sagen Sie?“
„So steht es in meinem Kalender!“
„Nein, bei uns steht da nichts“, sagt Frau Klein, „weder um 14 Uhr noch früher oder später.“
„Und nächste Woche?“, frage ich vorsichtig, „14 Uhr am nächsten Dienstag?“
Wieder nichts. Doch dann:
„Ich sehe, dass Sie im November kommen wollten. Aber Sie waren nicht hier.“
Ich bitte um Entschuldigung und frage gleich nach einem Ersatztermin. Zur Sicherheit schreibe ich ihn sofort in den Minister fürs nächste Jahr. Richtiger Tag, korrekte Uhrzeit plus Anlass – also: „Zahnarzt“ –, damit nicht noch mal etwas schief geht.
Kaum ist das Telefonat beendet, ruft meine Frau an. Ich soll doch bitte nicht vergessen, auf dem Rückweg heute Nachmittag noch eine hübsche Kunstpostkarte für Renate zu kaufen. Wie ich ja wisse, habe sie in der kommenden Woche Geburtstag.
„Ich weiß“, sage ich, obwohl ich es natürlich nicht mehr wusste. Auf der Heimfahrt halte ich also kurz bei der Buchhandlung, die auch Kunstpostkarten verkauft.
„Gut, dass Sie vorbeischauen“, sagt die Buchhändlerin, „hinten liegt noch Ihre Bestellung vom Oktober.“
„Darum wollte ich Sie gerade bitten“, sage ich schnell. Ob mir die Buchhändlerin das glaubt, weiß ich nicht.
An den Drehständern mit den Karten entscheide ich mich spontan für ein Foto von Dalis Lobster Telephone. Zu sehen ist ein surrealistisches Objekt aus den Dreißigerjahren: ein Hummer, der an ein Kabel angeschlossen ist und auf der Gabel eines Bakelittelefons mit Wählscheibe ruht.
„Was dachtest du dir dabei?“, fragt meine Frau, als ich ihr die Karte zeige.
„Eine Einladung zum Abendessen“, sage ich, „wir machen einen Gutschein daraus. Das Telefon steht für die Verabredung, der Hummer für ein gepflegtes Menü. Ist doch originell!“
Meine Frau schaut abwechselnd zu mir und auf die Kunstpostkarte und macht dabei diesen merkwürdigen Gesichtsausdruck, dem oft eine Bemerkung folgt, obwohl der Blick allein eigentlich keine Bemerkung mehr bräuchte.
„Du erinnerst dich aber schon daran, dass Renate eine Meeresfrüchteunverträglichkeit hat!?“
Gewusst hatte ich es. Aber nicht dran gedacht. Ich kann mir nicht alles merken.
Das Lobster Telephone verschwindet in meiner privaten Kunstpostkartensammlung. Aus der zieht meine Frau jetzt eine Karte mit etwas desolat wirkenden Sonnenblumen von Egon Schiele.
Nun könnte ich sagen:
„Diese Blumen sehen aus, als wären sie bereits am Verwelken! Nicht dass Renate das auf sich bezieht!“
Ich sage es aber nicht. Es würde zu sehr wie eine Retourkutsche klingen.
Anfang Januar prüfe ich in der Mittagspause meinen Kontostand. Online. Zum wiederholten Mal fällt mir auf, dass mein Telefonanbieter außer einer nachvollziehbaren höheren Summe noch weitere 12,99 Euro abbucht. Schon ein paarmal hatte ich mir vorgenommen, mich darum zu kümmern und herauszufinden, was das für eine Zahlung ist. Bisher hatte ich es immer vor mir hergeschoben und dann vergessen. Heute soll das nicht geschehen!
Ich wähle die Servicenummer und höre die üblichen Ansagen zur interaktiven Vorsortierung der Kundenwünsche. Auf meinem Display läuft die Zeit mit. Nach zwölf Minuten und zweiundvierzig Sekunden in der Warteschleife meldet sich eine Dame mit osteuropäischem Akzent. Ihren Namen verstehe ich nicht, nur dieses „Was kann ich für dich tun?“, das sie offenbar alle in der Callcenter-Fortbildung lernen. Neuerdings wird man am Telefon immer häufiger geduzt. Vermutlich soll der Eindruck entstehen, man habe es mit einem jungen, internationalen und dynamischen Unternehmen zu tun.
Ich erfahre: Vor gut drei Jahren bekam ich eine zweite SIM-Card mit einer zweiten Telefonnummer. Wozu ich die damals brauchte, weiß ich leider nicht mehr. Seither zahle ich monatlich 12,99 Euro Grundgebühr für eine Karte, die, statt in einem Telefon, vermutlich zu Hause irgendwo in, auf oder unter meinem Schreibtisch liegt und dem Telefonanbieter Monat für Monat eine geregelte Einnahme beschert.
„Ich möchte die Karte augenblicklich kündigen“, sage ich schroff, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass das telefonisch nicht geht und der Begriff augenblicklich eine zwar nachdrückliche, im telefonischen Geschäftsverkehr aber völlig bedeutungslose Aufforderung ist.
„Das kann ich dir telefonisch nicht machen!“, sagt meine Gesprächspartnerin erwartungsgemäß, und für die schriftliche Kündigung, die leider nur einmal im Jahr möglich sei, nämlich zum 14. März, sei es leider gerade ein paar Tage zu spät. Die hätte bis zum 14. Dezember eingehen müssen.
„Ja, was machen wir denn da jetzt?!“, frage ich, wobei ich das Fragezeichen wie ein Ausrufezeichen klingen lasse. Sie schlägt mir vor, ein preiswertes Mobiltelefon zu kaufen, die bisher ungenutzte Karte dort einzusetzen und so wenigstens die Grundgebühr zu verbrauchen. Dann will sie wissen, ob sie noch etwas für mich tun kann. Ich verneine das und verabschiede mich. Noch bevor ich auflegen kann, bittet sie mich, in der Leitung zu bleiben und an einer Befragung zur Kundenzufriedenheit teilzunehmen.
„Dafür habe ich keine Zeit“, sage ich unfreundlicher, als es die Dame im Callcenter verdient hat.
Nach dem Telefonat wird mir plötzlich klar, was die kryptische Eintragung in meinem Kalender zu bedeuten hatte: „14 Uhr März.“ Die 14 war keine Uhrzeit, sondern ein Datum: 14. März. Ich ziehe den abgelaufenen Minister aus der Schublade und sehe mir die Notiz noch einmal genau an. Kein Wunder, dass es hier zu einem Missverständnis kam: Die Zahl 14 hatte ich zufällig genau in das Feld hinter der gleichnamigen Uhrzeit geschrieben. Und tatsächlich ist da noch ein kleiner Punkt zu sehen. Ein winziger Punkt, gut getarnt, weil er genau mit einer Linie der Tabelle verschmilzt. Die fristgerechte Kündigung des Telefonvertrages zum 14. März hätte bis zum 14. Dezember beim Anbieter eingehen müssen, also wenige Tage nach meinem Eintrag. Mit der Notiz wollte ich mich an den bevorstehenden Ablauf der Kündigungsfrist erinnern. Gut überlegt, schlecht ausgeführt. Statt über mich selber ärgere ich mich nun über die Telefongesellschaft.
Noch am gleichen Abend suche ich zu Hause in meinem Schreibtisch die zum Vertrag gehörende SIM-Karte und finde sie in einem Briefumschlag. Ungeöffnet. Zusammen mit einem Flyer, der die Informationen zu meinem Tarif und auch zu den Kündigungsfristen enthält. Dann rechne ich nach. Seit das Schreiben unbeachtet in der Schublade ruht, wurden von meinem Konto fast fünfhundert Euro eingezogen und weitere hundert werden noch folgen. Es ist genau das Gegenteil von einer bombigen Geldanlage. Hätte ich damals auf meinen Freund Tobias gehört und die gleiche Summe in die Forschung von RNA-Impfstoffen investiert, hätten sich jetzt bestimmt schon die ersten vierstelligen Gewinne auf meinem Konto gesammelt. Aber man kann sich nicht um alles kümmern!
Ist es schon wieder soweit?
Oder: Besuch beim Facharzt
In meinem Kalender stehen neuerdings Termine, die es früher nicht gab: Internist, Hautarzt, Männerarzt. Darmspiegelung, Prostatavorsorge und Überprüfung des Augeninnendruckes – was, nebenbei bemerkt, eine ziemlich merkwürdige Bezeichnung ist, denn ich habe noch nie gehört, dass man auch den Außendruck eines Auges kontrolliert, das wäre, meiner Erkenntnis nach, der normale Luftdruck. Vielleicht muss man ja auch nicht alles verstehen.
Und dann ist da noch mein neuestes pflegebedürftiges Organ: die Schilddrüse. Jahrzehntelang hat sie gut funktioniert. Sie arbeitete, ähnlich wie ich, unauffällig und vollkommen zuverlässig vor sich hin. Aus irgendeinem Grund schraubte sie jedoch innerhalb weniger Jahre ihre Hormonproduktion zurück. Nach einer Routineblutuntersuchung, bei der die Schilddrüsentätigkeit versehentlich mitgeprüft wurde, stellte sich heraus: Unterfunktion. Seit das feststeht, muss ich die fehlenden Hormone durch Pillen ersetzen. Täglich. Ich fürchte, dass sich über die Schilddrüse der Tod in meinen Körper geschlichen hat, und ich weiß nicht, was er als Nächstes vorhat. Deshalb passe ich lieber auf.
„Das ist eine Autoimmunerkrankung“, sagte die Schilddrüsenspezialistin bei meinem ersten Besuch vor fünf Jahren. Immer im späten Frühjahr besuche ich sie in ihrem ebenerdigen Etablissement in Berlin-Charlottenburg, beste Lage.
Vom Betreten bis zum Verlassen der Praxis vergeht rund eine Stunde. Mit dem Blutabnehmen beginnt die Prozedur.
„Oh, ihre Venen verstecken sich ja vor mir!“, sagt Frau Friemel, die Mitarbeiterin der Schilddrüsendoktorin. Muss eine Dame, die mit einem spitzen Werkzeug in meiner Armbeuge herumstochert und verzweifelt nach einer Ader sucht, wirklich ‚Friemel‘ heißen? Nachdem sie mehrere Reagenzgläser wie an einer Zapfsäule mit meinem Blut befüllt hat, schickt sie mich ins Sprechzimmer 1. Der Raum ist an einem dunkelblauen, quadratischen Türschild zu erkennen, zwanzig Zentimeter Seitenlänge und eine gelbe 1 drauf. Das können sogar noch Schilddrüsenkranke mit minus dreißig Dioptrien lesen. In diesem Sprechzimmer setze ich mich auf einen Schwingstuhl mit Armlehnen und warte.