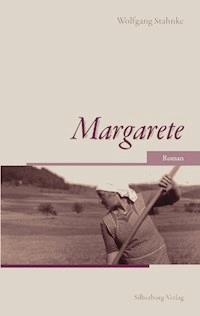
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem kleinen Dorf nicht weit vom Neckar kämpft eine junge Bäuerin um das Überleben ihres Hofes. Sie und ihre Familie müssen sich im »Dritten Reich« gegen die Feindschaft ihres Nachbarn, eines mächtigen Parteigenossen, behaupten. Sie heiratet den Mann, den sie liebt, aber er muss gleich an die Front und kommt nicht zurück. Die Entbehrungen des Krieges, die Aufnahme eines polnischen Zwangsarbeiters und die Verlogenheit der Nazi-Propaganda machen sie zu einer selbstbewussten, kritischen jungen Frau. In der schweren Nachkriegszeit gelingt es ihr mit Klugheit, Standhaftigkeit und List, den Betrieb zu retten, ihn dem radikalen Wandel in der Landwirtschaft anzupassen und am Ende zu neuer Blüte zu führen. Ihrem vermissten Mann hält sie dabei die Treue, mit Beharrlichkeit geht sie seinem Schicksal nach und stößt dabei auf seltsame Ungereimtheiten. Der Roman zeichnet das Porträt einer starken Frau, ihrer Familie und ihrer dörflichen Nachbarn. So entfaltet sich eine üppige Familien- und spannende Kriminalgeschichte und zugleich ein vielfarbiges Gemälde der dramatischen Jahrzehnte des »Dritten Reiches« bis zu den Gründerjahren der Bundesrepublik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang StahnkeMargarete
Wolfgang Stahnke
Margarete
Roman
Wolfgang Stahnke, geboren 1936 in Stettin, war 35 Jahre lang zunächst Diakon und später Pfarrer in mehreren badischen Gemeinden, davon zwölf Jahre in Lauda-Königshofen. Seine Eltern wie auch seine aus dem badischen Kraichgau stammende Frau kommen aus Bauernfamilien. Er lebt in Bad Mergentheim.
1. Auflage 2014
© 2014 by Silberburg-Verlag GmbH,Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.Alle Rechte vorbehalten.Umschlaggestaltung: Anette Wenzel, Tübingen,unter Verwendung einer Fotografie von Walter Frießaus dem Gemeindearchiv Gruibingen.Lektorat: Michael Raffel, Tübingen.Druck: Gulde-Druck, Tübingen.Printed in Germany.
E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1618-2E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1619-9Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-1314-3
Besuchen Sie uns im Internetund entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:www.silberburg.de
Im Andenken an Johanna
Im Nachwort findet sich eine Liste
mit den vorkommenden
Personen und Tieren des Romans.
Inhalt
Erstes Buch
1
2
3
4
5
Zweites Buch
6
7
8
9
10
11
Drittes Buch
12
13
14
15
16
Viertes Buch
17
18
19
20
21
Schluss
Nachwort
Personenliste
ERSTES BUCH
Da formte Gott den Menschen
aus Erde vom Acker
und blies ihm seinen Lebensatem in die Nase.
So wurde der Mensch ein lebendes Wesen.
(Bibel, Buch Genesis, Kap. 2,7)
September 1938
1
Was für ein schöner, milder Septemberabend! Aus dem ›Gasthaus zur Sonne‹ tönte gedämpfte Musik bis heraus auf die grob gepflasterte Dorfstraße. Drinnen wurde eifrig getanzt. Im Saal spielten die Musikanten unermüdlich Walzer, Foxtrott und Rheinländer, viele der Tanzenden sangen ergriffen die Texte mit, und die Wellen der Stimmung schlugen hoch. Kirmes war nur einmal Jahr, und da durfte die Jugend sich austoben, allerdings alles in Maßen und so, wie es sich gehörte. Denn die Bauern von Kerchwies waren traditionsbewusst protestantisch, und man achtete auf Anstand.
An der Giebelwand über dem Podium, auf dem die Musiker platziert waren, prangte die Hakenkreuzfahne. Deutschland hatte aller Welt vor Augen geführt, dass es wieder Gewicht hatte unter den Völkern. Die Reichsregierung war dabei, nach Österreich auch das Sudetenland ins Reich zurückzuholen. Da gehörte die populäre Melodie der Böhmischen Polka ganz selbstverständlich zum Programm der Kirmes, und alle sangen mit: »Rosamunde, schenk mir dein Herz und dein Ja, Rosamunde, frag doch nicht lang die Mama …« Die schwungvolle Melodie musste im Laufe des Abends mehrmals wiederholt werden.
In der Saalmitte drehten sich die meist jungen Paare. Sie wussten, dass sie unter Aufsicht standen, denn an den Tischen rund um die Tanzfläche saßen die aufmerksamen Mütter und wachsamen Väter, die das Geschehen unter der Jugend teils wohlwollend, teils streng beobachteten. Zwar sollten die jungen Leute der benachbarten Dörfer einander besser kennenlernen, aber für mehr sollten sie keine Gelegenheit bekommen.
Denn ›Gelegenheit macht Liebe‹, das wussten vor allem die Väter, die solche Erfahrungen längst hinter sich hatten und nun fürchteten, die jungen Burschen von heute könnten mit ihren Töchtern dasselbe anstellen, was sie selber vor dreißig Jahren mit deren Müttern getan hatten.
Oder wie der alte Bauer vom Buchsbaumhof in seiner bedächtig trockenen Art zu sagen pflegte: »Es soll wohl etwas geschehen, aber es darf nichts passieren.«
Karl-Friedrich Buchsbaum durfte nur von seiner Ehefrau Wilhelmine und daneben vielleicht noch von seinen allerengsten Freunden »Fritz« gerufen werden, sonst bestand er eisern auf seinem vollen Vornamen Karl-Friedrich. Er hatte im Saal des ›Gasthauses zur Sonne‹ für sich, Wilhelmine und seine zwei Töchter einen Tisch ausgewählt, welcher der Fensterwand gegenüberlag. Sorgfältig hatte er darauf geachtet, dass er dabei nicht in die Nähe von Adolf Kalkbrenner und der nicht in sein, Karl-Friedrichs, Blickfeld geriet, denn vor allem die Männer der Familien Buchsbaum und Kalkbrenner mieden einander seit Generationen, wenn sie nicht dann und wann einander gar noch Schlimmeres antaten. Adolf Kalkbrenner war der Ortsgruppenleiter der Partei, ›Ortsbauernführer‹ sagten sie im Dorf, ein rechthaberischer, fanatischer Finsterling, jedenfalls in Karl-Friedrichs Augen. Dem ging er aus dem Wege, wo das nur irgend möglich war. Wenn eine Begegnung sich nicht vermeiden ließ, grüßte er ihn, weil die Erwachsenen im Dorf einander üblicherweise von Kind auf kannten und mit dem Vornamen anredeten, mit »Hei’tler, PeGe Adolf«, wobei PeGe für ›Parteigenosse‹ stand. Dabei konnte Kalkbrenner die Ironie heraushören, die Buchsbaum diesen Worten mit auf den Weg gab. Karl-Friedrich Buchsbaum war bekanntermaßen eigensinnig und schon von seinem Wesen her niemandes Parteigenosse, weder dieses noch irgendeines anderen Adolf.
Wilhelmine schaute sich interessiert im Saal um. Sie saß Karl-Friedrich am Tisch gegenüber, eine kleine, rundliche und lebhafte, geradezu quirlige Person in schwarzem Kleid und mit grauem Haar, das glatt nach hinten gekämmt, dort zu einem eher dünnen Zopf geflochten und zu einem einfachen Knoten zusammengesteckt war. Ihre grauen Augen blickten klar und scharfsinnig, aber zugleich auch gutmütig umher. An ihrer Haut fiel eine ungesunde, gelblich angehauchte Blässe auf, man sah Wilhelmine an, dass sie kränkelte. Die Leber, so hatte Dr. Hamburger in der benachbarten Stadt Lennertshausen nach einer ausführlichen und aufwändigen Untersuchung im vergangenen Jahr gesagt, und ein recht bedenkliches Gesicht hatte er dabei gemacht. Dort wachse anscheinend etwas, das nicht dorthin gehöre, da könne man leider nicht viel mehr tun als strenge Diät einzuhalten.
Neben ihnen, ebenfalls am Tisch einander gegenüber, hatten ihre beiden Töchter ihre Plätze gefunden. Margarete, die Jüngste, saß neben ihrem Vater, und jedem, der Vater und Tochter betrachtete, fiel auf, wie ähnlich sie einander sahen. Auch in der Statur waren sie miteinander vergleichbar, beide waren sie groß und schlank, aber kräftig. Margarete, die vom Vater immer nur ›Grete‹ genannt wurde, war, wenn man bedachte, dass es sich bei ihr um ein Mädchen von siebzehn Jahren handelte, auffallend hoch gewachsen. Sie war genauso groß wie ihr Vater, und durch die Schlankheit der Jugend hatte es gar den Anschein, als wäre sie die Größte in der Familie. Wilhelmine hatte bei der Vorbereitung auf das Fest ihrer Jüngsten deren langes, dunkles, fast schwarzes Haar zu einer Art Zopfkrone geflochten. Margarete hatte sich für die obligatorische ›Landmädeltracht‹ entschieden. Sie trug die weiße Bluse mit Puffärmeln, die sie in der Landwirtschaftsschule im vergangenen Winter selbst genäht hatte, dazu einen schwarzen Rock, halb weit, um die Taille kunstvoll gesmokt, was ihre schlanke Gestalt betonte, und darüber ein Mieder aus schwarzem Samt. Wilhelmines Augen leuchteten vor Stolz auf ihre Tochter. Dieser Aufzug, der ihre herbe, kraftvolle Weiblichkeit hervorhob, stand ihrer Grete blendend, und zusammen mit ihrer bei der Feldarbeit unter der Sonne gebräunten Haut und den goldbraunen Augen gab es ihrem schmalen, ein wenig kantigen Gesicht etwas Apartes. Jeder, der Margarete anschaute, sah, dass dieses Mädchen neben einem ausgeprägten Temperament zugleich über einen starken Willen verfügte. Wenn sie von einer Sache überzeugt war, dann gab sie nicht nach, bis sie sie durchgesetzt hatte.
Margarete gegenüber war der Platz für deren ältere Schwester Elisabeth freigehalten. Die hatte sich aber nur am Anfang des Abends dort aufgehalten, um ihr Rippchen mit Sauerkraut zu verzehren, das Karl-Friedrich ausnahmsweise beim Sonnenwirt bestellt und seiner Familie zum Nachtessen spendiert hatte. Auch Wilhelmine hatte es ohne Weiteres als Diät für ihre kranke Leber akzeptiert. Elisabeth war mittelblond und mittelgroß, vierundzwanzig Jahre alt und damit über das heiratsfähige Alter fast schon hinaus. Beide, Karl-Friedrich und noch mehr Wilhelmine, hätten sie gerne längst unter der Haube gesehen. ›Unter die Haube kommen‹, so sagte man immer noch, wenn man meinte, dass ein Mädchen heiratete, weil früher die verheirateten Frauen solche weißen Hauben getragen hatten. Inzwischen war man von dieser Tradition längst abgekommen, übrig geblieben waren nur die Redensart und ein Stapel alter, weißer Hauben. Sie lagen alle sauber gefaltet als Teil einer vielfältigen Aussteuer aus leinenen Tisch-, Hand- und Betttüchern in dem schönen, bald zweihundert Jahre alten Eichenschrank, der in der Stube über der Hofeinfahrt stand. Elisabeth hatte sich für einen anderen als den traditionellen Lebensstil entschieden. Sie rauchte manchmal öffentlich Zigaretten, weigerte sich, einen Bauern zu heiraten und saß im Dorfgasthaus mit fremden Personen zusammen. Am liebsten, so hatte sie zu verstehen gegeben, hätte sie das dörfliche Leben ganz hinter sich gelassen und wäre in die Stadt gezogen. Sie wusste nur nicht, wie sie den Absprung schaffen sollte.
Nun ja, so seufzte Karl-Friedrich, die Zeiten drohten, unruhig zu werden. Er verspürte bei all dem, was sich in den letzten Jahren in seinen Augen viel zu schnell ereignet hatte, ein ungutes Gefühl in der Nackengegend. Zugegeben, die neue Reichsregierung hatte den festgefahrenen Karren mit geradezu brachialer Gewalt wieder in Bewegung gebracht, aber er, Karl-Friedrich, hatte von Anfang an befürchtet, die Sache könne eigentlich nicht gut ausgehen, und sein Argwohn hatte von Jahr zu Jahr zugenommen. Die Bewegung verlief nicht, sondern sie marschierte. Und sie marschierte in eine Richtung, die ihm gar nicht passte.
Da war zum Beispiel diese Sache mit dem Josef Kleinhans aus der Unteren Brunnengasse, die Karl-Friedrich sehr nachdenklich gemacht hatte. Josef war ein Müllergeselle und Sozi, mit dem er, Karl-Friedrich, kaum etwas zu tun hatte und der beim Sonnenblum zu sehr das Maul aufgerissen und große Töne gespuckt hatte. Dieser Josef Kleinhans war eines Tages nicht mehr da gewesen. Plötzlich verschwunden, frühmorgens abgeholt, so hatten die Nachbarn berichtet. Auf Karl-Friedrichs Nachfrage hatte Adolf Kalkbrenner nur schnarrend das Wort ›Umerziehungslager‹ zwischen seinen Zähnen hervorgezischt. Aber aus den Augen von Josefs Frau hatte die nackte Angst herausgeschaut, und man munkelte, ihr Mann sei, als sie ihn ins Auto geschleppt hätten, grün und blau und blutig geschlagen gewesen. Doch dann, nach etwas mehr als einem Jahr, war Josef Kleinhans wieder aufgetaucht, und das genauso plötzlich, wie er zuvor verschwunden war. Man hatte ihn kaum erkannt. Er war jetzt ein gebrochener, ein zusammengefallener Mann, der von da an alle Menschen gemieden hatte und bis heute über seine Zeit im Lager nie auch nur ein einziges Wort redete. Solche Dinge zeigten, dass sich hinter den Kulissen etwas abspielte, das sich, davon war Karl-Friedrich überzeugt, irgendwann rächen würde.
Man musste also mit unruhigen Zeiten rechnen. Er suchte nach Aufmunterung in dem Gedanken, dass sich in bewegten Zeiten manchmal ja auch positive Entwicklungen ergaben, die man nicht hatte vorhersehen können, gestand sich jedoch gleich ein, dass sich daraus nicht viel Trost schöpfen ließ. Er schaute quer durch den Saal hinüber zu Elisabeth, die er heimlich als sein Sorgenkind ansah. Elisabeth saß, wieder einmal in aller Öffentlichkeit eine Zigarette rauchend, an einem Tisch neben dem Eingang in einer Gruppe junger Leute bei einem Freund, der sie oder den sie nicht heiraten wollte oder konnte, der auch aus Karl-Friedrichs Sicht dafür keinesfalls in Frage kam, den sie aber schon seit bald zwei Jahren kannte. Der kam wohl von unten aus dem Tal, aus Steinbach, und hieß mit Vornamen Hans-Jürgen. Ein Arbeiter. Ein Arbeiter passte nicht in eine Bauernfamilie, möglicherweise war er gar ein heimlicher Sozi. Spengler hieß er wohl mit Familiennamen und war Maurer, oder auch umgekehrt, er hieß Maurer und war von Beruf Spengler, Karl-Friedrich wusste es nicht mehr, wollte es auch so genau gar nicht wissen. Man würde eben sehen.
Das Dorffest hatte bis vor ein paar Jahren noch im in der Gegend üblichen Dialekt ›Kerwe‹ geheißen, was im Hochdeutschen ›Kirchweih‹ bedeutete, war also ursprünglich ein Dankgottesdienst zur Erinnerung an die Einweihung der kleinen Kirche vor etwa zweihundert Jahren gewesen, dem sich das fröhliche Dorffest angeschlossen hatte. Doch seit vor ein paar Jahren unten in Steinbach Pfarrer Beetz eingezogen war, der auch Kerchwies zu versorgen hatte und der sich zu einer Gruppierung hielt, die sich ›Deutsche Christen‹ nannte, war der Festgottesdienst weggefallen. Aus der Kirchweih war ein ländliches, ein ›völkisches‹ Fest geworden. Dieses Fest hatte heute am Nachmittag damit begonnen, dass die Vereinigten Chöre des heimischen Gesangvereins ›Harmonie Kerchwies‹ im Sonnensaal gesungen hatten: »Ach, du klarblauer Himmel, und wie schön bist du heut.« Das hatte zu dem herrlich sonnigen Sonntagnachmittag im September und zur Stimmung im Dorf hervorragend gepasst. ›Vereinigt‹ waren vor wenigen Jahren der Männer- und der Frauenchor des Männergesangvereins worden. Jawohl, es hatte bis zur Vereinigung auch einen Frauenchor des Männergesangvereins gegeben, doch dessen Stimmmaterial, wie der ältliche Lehrer und Dirigent Schmid das nannte, war so dünn geworden, dass man beide zusammengelegt hatte zu einem gemischten Chor. Auch dessen Darbietungen klangen nicht sehr erhebend; die Tenöre knödelten, die Bässe knurrten und worgelten und die Soprane quiekten zu viel, als dass es ein wirklicher Hörgenuss hätte werden können. So ging es, wie es ja auch der Name ›Harmonie Kerchwies‹ erkennen ließ, mehr um das dörfliche Gemeinschaftserlebnis als um kunstvolle Chormusik, wenn man zu den wöchentlichen Proben zusammenkam. Dann, am Sonntagnachmittag, nachdem man sich eine Tasse echten Bohnenkaffees und ein Stück vom frischen Zwetschgenkuchen gegönnt hatte, war der Musikverein ›Eintracht‹ mit seinem Konzert an der Reihe gewesen. Für einen Musikverein für sich allein, dafür war Kerchwies mit seinen einhundertvierzig Einwohnern nicht stark genug. Der kleine Ort teilte ihn sich mit dem eine knappe Wegstunde entfernten und unten im Steinbachtal gelegenen Dorf Danstedt, und das war nicht immer einfach, denn die beiden Nachbardörfer waren, wie man das ja anderweitig auch kannte, einander nicht recht grün. So war der Name ›Eintracht‹ ein Versuch, voraussehbare Zwistigkeiten im Keim zu ersticken und gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Mit dem Konzert des Musikvereins Eintracht war das Nachmittagsprogramm vorüber gewesen. Der Saal hatte sich bis auf ein paar Kinder und alte Leute geleert. Es war Melkzeit, da wurde jedermann, der auch nur ein bisschen zupacken konnte, im Stall gebraucht, am Abend wie am Morgen jeweils pünktlich um sechs Uhr. Daran konnte nicht gerüttelt werden.
Gleich nach dem Melken hatte man sich wieder in der ›Sonne‹ zum Nachtessen getroffen, und jetzt hatten sich die Steinbachmusikanten, eine kleine Tanzkapelle, bereit gemacht, zum Tanz aufzuspielen. Weil in den Bauerndörfern jeder am andern Morgen wieder sehr früh aufstehen musste, begannen solche Tanzveranstaltungen meist schon in den noch frühen Abendstunden, damit die Nacht nicht allzu kurz wurde.
Karl-Friedrich Buchsbaums jüngste Tochter Margarete stürzte sich sofort ins Getümmel. Sie »tanzte sich durch die Kerle«, wie sie das lachend nannte, und sie meinte damit, sie wollte am Ende des Abends mit jedem der jungen Burschen wenigstens einen Tanz probiert haben.
Einer fiel ihr dabei ins Auge, den sie bisher nur flüchtig und ausschließlich vom Sehen kannte. Nur, dass er aus Danstedt kam, wusste sie. An den allerdings kam sie nicht heran, denn er saß bei den Musikern in der Kapelle und spielte dort die Ziehharmonika, aber nicht so ein billiges, klapperndes und fauchendes Ding wie ihr Nachbar Johann Urban eines besaß, sondern ein großes, eindrucksvolles Instrument mit einer langen Reihe weißer und schwarzer Tasten wie bei einem Klavier. Sie hatte bisher so etwas erst ein einziges Mal gesehen, auf einem der großen Lastkähne unten auf dem Neckar hatte einer auf so einem Instrument gespielt. Ein Schifferklavier also. An dem Jungen mit dem Schifferklavier schienen ihre Blicke sich geradezu festzusaugen. Ein kräftiger Bursche war der mit breiten, offensichtlich starken Schultern, die manches zu tragen vermochten, und dabei doch mit flinken, sicheren Händen und einer hellen, ungekünstelten, hübschen Stimme, wie sie feststellen konnte, als er wieder einmal »Rosamunde« anstimmte, dieses Mal jedoch mit dem abgewandelten Text: »Rosamunde, schenk mir dein Sparkassenbuch, Rosamunde, zehntausend Mark sind genug …« Auch dieses Mal sangen alle mit.
Seine Haut war hell, sein kurz geschnittenes Haar rötlich blond und seine Augen, mit denen er immer häufiger zu Margarete herübersah, waren von einem tiefgründigen Grau. Er heizte die Stimmung im Saal an, lachte viel ins ausgelassen tanzende Publikum hinein und zeigte dabei ebenmäßige Zähne.
Ein hübscher, ein sympathischer Junge, so dachte Margarete. Sie hatte das Gefühl, ihre Schultern, ihr Kopf und ihr ganzer Körper würden von ihm magnetisch angezogen. Sie konnte es nicht verhindern, dass sie immer wieder zu ihm hinüberschaute. Unauffällig schielte sie zum Podium, wo die Kapelle saß, hoffend, der Vater werde es schon nicht bemerken. Doch darin irrte sie sich gründlich, denn Karl-Friedrich erspürte durchaus mit väterlicher Eifersucht, dass sich da etwas anbahnte, ja, dass es zwischen den beiden über den halben Saal hinweg vor Spannung nur so knisterte.
»Grete!«, sagte er plötzlich mit warnender Stimme.
»Ja, Vadder?«
»Achtung, der Kurt!«
Der Sohn des Nachbarn »iwwer d’ Stroß« und Ortsgruppenleiters PeGe Kalkbrenner hatte nur noch drei oder vier Schritte bis zu ihrem Tisch. Er griff sich Margaretes Hand und sagte herrisch: »Komm, tanzen!«
»Na, Kurt«, flötete Wilhelmine so überbetont freundlich, dass der Angesprochene die Ironie sicher nicht überhören konnte, »hast schon fest getanzt heut?«
»Ja, Frau Buchsbaum«, antwortete der, »aber no lang net genung!«
Er ließ Margaretes Hand los, trat einen halben Schritt zurück und verbeugte sich übertrieben tief.
»Erlauben Sie, dass ich mit Ihrem Fräulein Tochter tanze, Herr Buchsbaum?«
Karl-Friedrich nickte stumm, ohne den Fragenden anzusehen, und Margarete stand auf, um mit Kurt Kalkbrenner den Walzer zu tanzen, dessen rhythmischen Schwung sie übrigens nicht sehr gut beherrschte.
Auch Kurt war alles andere als ein begabter Tänzer. Er schaukelte hin und her, schob sie und zog an ihr und wollte es offensichtlich besonders gut machen, doch Margarete versteifte sich und hielt ihn freundlich lächelnd auf Abstand.
Kurt hatte die ganze Zeit über das Gesicht zu einem eingefrorenen Lachen verzogen und starrte sie mit seinen auffallend blauen Augen an. Seit ihrer gemeinsamen Schulzeit war sie vor ihm auf der Hut. In der einklassigen Dorfschule hatten damals, am Ende der zwanziger und zu Anfang der dreißiger Jahre, nur zwölf oder dreizehn Schüler gesessen. Lehrer Schmid hatte streng auf Ordnung in allen Dingen geachtet, auch in der Sitzordnung war er streng gewesen: In den vorderen Bänken saßen die Schuljahre eins bis vier, dahinter die Jahrgänge fünf bis acht, rechts, also auf der Fensterseite, die Mädchen, auf der anderen Seite die Buben. Kurt, der anderthalb Jahre älter war als Margarete, war so über den Mittelgang hinweg ihr Nachbar gewesen, und sie hatte häufig genug mit ansehen müssen, wie er Furcht und Schrecken vor allem unter den jüngeren Schülern verbreitet hatte, um sich in seiner Anwesenheit vorzusehen. Er war launisch und unberechenbar gewesen, und er war es bis heute. Angst hatte sie nicht vor ihm gehabt, aber auf der Hut gewesen war sie schon, und sie war es immer noch, denn …
»Was denkst du?«, fragte Kurt in ihre Überlegungen hinein.
»Wie?«, antwortete sie erschrocken, »entschuldige, ich war mit meinen Gedanken grad woannerst. Bei uns macht nämlich die Sau wahrscheint’s heut Nacht noch Junge.«
Das war eine Ausrede, die ihr gerade noch eingefallen und die dabei doch nicht wirklich gelogen war, denn den Nachwuchs bei ihrer einzigen Muttersau erwarteten sie tatsächlich an einem der nächsten Tage. Es hätte, so tröstete sie sich, folglich auch in einer der nächsten Stunden sein können, so genau konnte man das ja nicht wissen.
»Du hast, scheint’s, bloß den Willi im Kopf«, brummte er.
»Was denn für ’n Willi?«, fragte sie, ehrlich erstaunt.
»Der Musiker da drüben mit der Quetschkommod.«
»Den kenn ich überhaupt nicht«, beteuerte sie und trat ihm absichtlich fest auf den Fuß.
So, dachte sie, Willi heißt der also. Sie musste lachen.
»Lachst mich jetzt an oder aus?«, fragte Kurt.
»Rat mal«, kicherte sie, machte ihm ein ironisches Kussmündchen und rümpfte zugleich die Nase. Das, so dachte sie, müsste eigentlich reichen, ihn auf Abstand zu bringen.
Nach dem Tanz brachte Kurt sie an ihren Platz zurück, verbeugte sich kurz, wie sie beide es im Tanzkurs des vergangenen Winters gelernt hatten, und sie drehte sich halb zu ihm hin und deutete dazu einen Knicks an. Er ging mit düsterer Miene seiner Wege.
Margarete tanzte sich weiter durch die Kerle, einmal mit Helmut Baltzer, der beim Foxtrott hampelte wie ein Zappelphilipp, dann den gefährlichsten aller Tänze, nämlich den langsamen Walzer, mit dem langen Haldenbauer Schorsch, bei dem sie ihre liebe Not hatte, seinen körperlichen Anschmiegungen und Anbohrungen auszuweichen, und einmal tanzte sie sogar mit dem Sohn des Kiesgrubenbesitzers Eggert aus Steinbach. Als sie an ihren Platz zurückkam, war sie ganz außer Atem.
Der rotblonde Schifferklavierspieler, von dem sie jetzt wusste, dass er Willi hieß, schaute wieder zu ihr herüber. Er sagte etwas zu dem älteren Musiker, der hinter ihm am leicht verstimmten Gasthausklavier saß. Obgleich es dafür im Saal viel zu laut und die Entfernung viel zu groß war, bildete sie sich ein zu hören, was die beiden sprachen. Willi sagte: »Da drüben wartet eine auf mich.« Und der Ältere antwortete: »Dann beeil dich, sonst ist sie weg.« Willi setzte sein Akkordeon auf den Dielen des Podiums ab und stand auf. Eilig wandte sie sich, um nur irgendetwas zu tun, womit sie der Tanzfläche und den Menschen den Rücken zudrehen konnte, an Karl-Friedrich und sagte, ohne zu überlegen, das Erste, was ihr einfiel: »Bekomm ich ein Glas Wein, Vadder?«
Karl-Friedrich sah seine Jüngste erstaunt an und zog die dichten Augenbrauen in die Höhe, was ihm ein ungemein spöttisches Aussehen verlieh. Wein tranken die Bauern in den Dörfern nicht oder doch nur selten, er war einfach zu teuer. Höchstens am Sonntag nach der Kirche, wenn er sich mit seinen Jahrgangskollegen zum Frühschoppen in der ›Sonne‹ traf, pflegte Karl-Friedrich ein Glas Wein zu trinken und dazu eine Zigarre zu rauchen, die einzige in der ganzen Woche.
»Schon gut.« Margarete zog, erschrocken über ihre eigene Kühnheit, ihre Bitte zurück. »’s muss net sei.«
»Ausnahmsweise«, sagte Karl-Friedrich. »Ich trinke auch eins. Du auch, Wilhelmine?«
»Nein, Fritz«, antwortete seine Frau, sie danke, aber es sei ihr jetzt nicht nach Wein, aber sie werde vielleicht später aus seinem Glas einen Schluck mittrinken.
Die Musik begann wieder und spielte Foxtrott.
»Fräulein Buchsbaum, darf ich bitten?«, sagte eine klare Stimme in ihrem Rücken.
Margarete stellte sich überrascht, stand auf und tanzte mit dem rotblonden Akkordeonspieler davon.
»Ich heiße Willi«, sagte er, während er sie tanzend in die Mitte des Saales führte, wo es mehr Platz gab.
»Ich weiß«, antwortete sie schnippisch. »Und ich bin die Margarete.«
»Ich weiß«, ahmte er ihre schnippische Art nach und zog die Nase kraus.
Schöne Zähne hat er, dachte sie. Ihr war, als würden sie sich seit Jahren kennen. Ein bisschen kam er ihr vor wie ein Bruder, wie sie ihn sich heimlich immer gewünscht hatte, ein älterer Bruder, zu dem sie aufsehen konnte, obgleich er kaum größer war als sie.
»Woher denn?«, fragte sie. »Du kennst mich doch gar nicht.« Es fiel ihr nicht auf, dass sie ihn wie selbstverständlich duzte.
»Vom Kurt«, antwortete er. »Den hab ich gefragt.«
»Ich auch«, lachte sie und machte, wie so oft, beim Tanzen zu große Schritte. Aha, dachte sie, daher also Kurts Eifersucht.
»Wir kennen uns von der Feuerwehr unten in Steinbach, der Kurt und ich. Ich bin von Danstedt«, erklärte er. »Mach ein bisschen kleinere Schritte! Hörst du? Du machst zu große Schritte! Und du führst anscheinend gerne selber. Bleib locker, lass dich tragen.«
»Du – und mich tragen!«, lachte sie.
Als Antwort legte er den Arm fest um sie und hob sie damit, scheinbar mühelos, hoch.
»Bist verrückt?! Lass mich sofort wieder runter! Was sollen denn die Leut denken!« Sie trommelte mit ihren Fäusten auf seine Schultern.
»Also gut. Aber ich meinte auch: Lass dich von der Musik tragen, dann geht es von allein. Versuch es!«
Sie versuchte es, schloss die Augen, konzentrierte sich auf die Musik statt auf ihre Schritte und stellte sich vor, Willi würde sie tragen. Und siehe da, es ging. Sie schwebte. Margarete Buchsbaum hatte mit ihren siebzehn Jahren noch nie geschwebt, und sie genoss diesen Zustand mit ungläubigem Staunen.
»Na?«, lachte er und zwinkerte ihr mit einem Auge zu.
Sie fühlte sich ertappt und kehrte prompt die Kratzbürste heraus: »Ist was mit deinem Auge?«
»Ja«, antwortete er. »Schaust du mal nach?«
Sie unterbrachen den Tanz und blieben stehen.
»Komm näher«, sagte er. »Noch näher!«
Sie stand dicht vor ihm und reckte ihren schlanken Hals, bis sie in seiner Pupille ihr eigenes, verkleinertes Spiegelbild erkannte.
»Ich glaub, ich hab was im Auge«, sagte er.
»Ja«, antwortete sie. »Ich seh’s. Mich. Mich hast du im Auge.« Sie bemühte sich dabei um eine strenge Miene, doch ihr Herz schlug bis herauf zum Hals.
Kalkbrenner, der alte Kalkbrenner, so stellte Margarete im Vorübertanzen aus den Augenwinkeln fest, also Adolf Kalkbrenner, der Ortsgruppenleiter, hatte heute Abend darauf verzichtet, seine SA-Uniform zu tragen. Am Nachmittag war er noch in Braunhemd und Breeches unterwegs gewesen, so, wie er das gerne auch bei anderen als offiziellen Anlässen tat, um zu unterstreichen, mit wem es die Leute bei ihm zu tun hatten. Er war erst wenig über vierzig Jahre alt, der alte Kalkbrenner hieß Adolf vor allem bei den jungen Leuten wie Margarete, einmal, um ihn vom jungen Kalkbrenner, nämlich seinem Sohn Kurt, zu unterscheiden, und zum anderen, um zu zeigen, wie wenig man mit ihm gemein hatte.
Kalkbrenner trug, als wäre er hier auf einer parteiinternen Beerdigung, einen schwarzen Gehrock zum steifen Kragen, an seiner schwarzen Brust prangte wie ein großer, rot-weißer Knopf das Parteiabzeichen. Zusammen mit seinem schwarzen, rechts schnurgerade gescheitelten und an den Seiten kurz geschorenen Haar und dem Bärtchen auf der Oberlippe, das Margarete immer an eine kleine, quadratische Schuhbürste erinnerte, sollte die Aufmachung an das strenge Aussehen seines Vorbildes, des ›Führers‹, erinnern. Doch die gefurchte Stirn und der gewollt strenge Blick gaben ihm eher das finstere Aussehen, das seinem Wesen entsprach.
Frau Kalkbrenner hatte ihren Platz neben ihrem Ehemann. So pflegte er es zu sagen: »Meine Gattin hat ihren Platz neben mir«, und möglicherweise meinte er es auch so. Auch heute Abend saß sie am Tisch neben ihm. Aber sonst, im Dorf, im Leben oder wo auch immer, war ihr Platz eindeutig nicht neben, sondern hinter ihm. Er bestimmte, und niemand sonst.
Lene Kalkbrenner war die leiseste Frau, die Margarete kannte. Still und in sich gekehrt lebte sie dahin, redete wenig, und wenn sie sprach, dann meist nur mit piepsig schwacher Stimme, so, als würde sie andauernd unter etwas leiden. Und so war es ja auch, das war offensichtlich. Jeder im Dorf wusste, worunter sie litt, nämlich unter ihrem Mann, Adolf Kalkbrenner, der nicht nur finster aussah, sondern auch ein autoritärer Finsterling war. Lene dagegen hatte, auch das wussten alle, ein im Grunde gutes Herz, das freilich auch ein bisschen furchtsam war und deshalb meist seine Güte nicht zu zeigen wagte.
Die Stimmung war auf dem Höhepunkt. Der Trompeter der Kapelle führte sein Paradestück vor. Einen Blechtrichter, den er sich bei seiner Frau in der Küche ausgeliehen hatte, steckte er in ein anderthalb Meter langes Stück Schlauch. In das andere Ende steckte er das Mundstück seiner Trompete und blies auf dem Gartenschlauch den Fanfarenmarsch. Er stand vorn an der Rampe, ließ den Schlauch mit dem Trichter über seinem Kopf kreisen, und die Tanzenden sangen mit: »Wir wollen unsern alten Kaiser Wilhelm wiederhab’n …«
Gerade als Margarete bei einem ihrer nächsten Tänze mit dem jungen Nachbarsohn Heinz Urban vorüberkam, stand Lene auf, um mit ihrer jüngsten, ein bisschen pummeligen Tochter, der vierzehnjährigen Sigrun, den Heimweg anzutreten.
Es ging auf zehn Uhr, und Bürgermeister und Parteigenosse Franz Funk, der ebenfalls öffentlich den rot-weißen Parteiknopf trug, stand mit warnendem Blick in der Saaltür. Er hatte im Dorf so gut wie keinen Einfluss, schon gar keine Macht, war vielmehr ein überzeugter, um nicht zu sagen serviler Anhänger der Partei, ein fast schon absonderlicher Junggeselle, der nichts dabei fand, von Adolf Kalkbrenner Anweisungen entgegenzunehmen und für ihn den Büttel zu spielen. Einfache Verwaltungsarbeit zu verrichten und bei Tanzveranstaltungen wie heute zu schauen, dass alles seine Ordnung hatte, Aufgaben dieser Art lagen und genügten ihm. Es hätte diese warnende Geste gar nicht gebraucht, denn der Sonnenwirt war bekannt dafür, dass er es mit Ordnungsregeln durchaus genau nahm.
Auch an den anderen Tischen brachen die ersten Gäste auf, ältere Leute vor allem, denen die Musik zu laut war, oder solche, für welche die Zeit in ihrem Leben, in der Tanzen ihnen noch Vergnügen bereitet hatte, vorüber war. Und solche wie Lene Kalkbrenner, die Kinder im jugendlichen Alter hatten, denn wer nach zehn Uhr abends auf einer öffentlichen Tanzveranstaltung angetroffen wurde, musste mindestens sechzehn Jahre alt sein. Wer jünger war, durfte sich bis dahin in Begleitung der Eltern dort aufhalten. Übertritte dieser Verordnung wurden streng geahndet.
Da wurde auch Wilhelmine unruhig. Sie hätte im Laufe des Abends gerne ein oder zwei Mal getanzt, hatte ihren Mann Karl-Friedrich dazu aber nicht bewegen können. Sie ließ den Sprungdeckel ihrer Uhr aufklappen und schaute nach der Zeit; am nächsten Morgen, so deutete sie damit an, würden sie alle wieder früh aus den Federn müssen. Die kleine Uhr war vergoldet, und Wilhelmine trug sie an einem dünnen Goldkettchen wie ein Medaillon um den Hals gehängt, ein Erbstück von ihrer Großmutter, das sie wie alle in der Familie hoch in Ehren hielt.
Karl-Friedrich beachtete ihre Zeichen nicht. Er hatte seiner Grete den Abend bis elf Uhr zugestanden, und alleinlassen wollte er sie nicht. Also stellte er sich taub und legte damit wieder einmal ein Verhalten an den Tag, das Wilhelmine nur allzu gut an ihm kannte.
Margarete hatte die Zeichen der Zeit erkannt und offenbar beschlossen, etwas zu unternehmen, damit die Dinge in ihrem Sinne ins Rollen kamen. Sie schaute immer wieder zu Willi hinüber, machte Zeichen mit den Händen und formte mit dem Mund, freilich stumm, das Wort »Damenwahl«.
Kaum ertönte der Tusch, da eilte sie schon hinüber zur Kapelle: »Willi, darf ich bitten?«
Der schaute sich fragend nach dem Mann am Klavier um, der allem Anschein nach der Kapellmeister war, und übergab ihm das Akkordeon.
»Komm«, sagte er dann. »Tango.«
Der Kapellmeister entlockte dem Akkordeon ein Feuerwerk aus Fingerakrobatik und Rhythmus, dass es Margarete nur so in die Beine fuhr.
Das war er also, dieser exotische, berüchtigte Tango, den sie in den Städten tanzten. Willi zeigte ihr, wie man ihn auch mit einfachen Schritten bewältigen konnte, und sie schwebte mit ihm auf den Wellen von ›Olé, Guapa!‹ davon.
»Was man auf dem Schifferklavier alles machen kann!«, staunte sie.
»Es heißt Akkordeon«, verbesserte er sie. »Es gehört dem Gerhard, und der ist so etwas wie mein Lehrer. Nicht mit richtigem Unterricht, den könnte ich nicht bezahlen. Am meisten lernt man, wenn man mit jemandem zusammen spielt, der besser ist als man selber. Ich hab daheim nur ein kleineres Instrument, und üben muss ich selber«, lachte er. »Jetzt Achtung! Ausfall nach links!«
»Der kann aber!«, sagte Wilhelmine zu Karl-Friedrich, die miteinander das Paar beobachteten.
»Tanzen und Quetschkommode spielen wird hoffentlich nicht das Einzige sein, was er kann«, brummte er und zog seine Stirn in Falten.
»Er kommt vom Hof«, erklärte sie, und als er sie überrascht ansah, fuhr sie fort: »Ich hab die Traudel vom Wirt gefragt. Von Danstedt ist er, Willi Sperling heißt er.«
»Vom Erich Sperling ein Sohn?«
Sie nickte. »Der einzige.«
Der einzige Sohn, dachte er, das bedeutete, er würde einmal den Hof in Danstedt erben.
»Man wird sehen«, sagte er. Erich Sperling, dachte er weiter, den kannte er recht gut, von dem hatte er vor ein paar Jahren eine Kuh gekauft. Der war zweifellos ein redlicher Mann, da könnte vielleicht auch der Sohn … Aber Erich Sperlings Hof in Danstedt, so erinnerte er sich, während er nach dem Geldbeutel in seiner Hosentasche tastete, der war nur zwischen dreißig und vierzig Morgen groß, oder, wie man neuerdings rechnete, acht oder neun Hektar, und er besaß kein Pferd, sondern musste die Feldarbeit mit Kühen bewältigen. Damit gehörte Erich zu einer Sorte Bauern, auf die Bauern mit Pferd und mit mehr als zwölf Hektar Besitz wie Karl-Friedrich nicht ohne einen gewissen Hochmut herabschauten. Er legte den Geldbeutel auf den Tisch zum Zeichen, dass er die Absicht hatte, demnächst aufzubrechen.
Margarete, welche die Geste ihres Vaters von Weitem beobachtet und richtig gedeutet hatte, sagte zu Willi: »Da nüber!«, und lenkte ihn tanzend quer über die ganze Tanzfläche.
»Bist arrich fidel heut«, bemerkte Wilhelmine, die Augenbrauen leicht hochgezogen, zu ihrer Tochter, als sie dicht an ihnen vorübertanzte.
»Quietschfidel, Mudder!«, lachte Margarete, lehnte sich in Willis Armen weit zurück und nahm neuen Schwung auf.
Karl-Friedrich, der aufgestanden war und sich ungeduldig für den Heimweg zu richten begann, zog demonstrativ seine Taschenuhr aus der schwarzen Weste, die er immer trug, ließ den Deckel aufschnappen und hielt seiner Tochter das Zifferblatt hin.
»Noch eine halbe Stund, Vadder!«, rief sie. Er antwortete nicht und steckte die Uhr wieder ein. Dann nickte er, er sei einverstanden, und brach zusammen mit Wilhelmine auf.
Der Sonnenwirt stand an der Theke und sah Karl-Friedrich und Wilhelmine kommen. Eigentlich hieß der Wirt Heinrich Blum, aber alle nannten ihn nur den ›Sonnenblum‹. Aus welchem Grunde sie das taten, darüber waren die Männer im Dorf geteilter Ansicht. Die einen behaupteten, das geschehe einfach, um ihn von seinem ebenfalls im Dorfe heimischen Bruder Hermann Blum zu unterscheiden; das jedoch war kein ausreichender Grund, denn dafür hätte der Vorname Heinrich vollkommen ausgereicht. Die Wahrheit war komplizierter, so, wie das fast immer der Fall ist. Einfache Wahrheiten sind selten.
In der Wirtsstube des Gasthauses ›Zur Sonne‹ hing im Halbdunkel hinter der Theke ein Bild an der Wand. Es war mit Ölfarbe auf ein Holzbrett, ein wenig ungelenk zwar, aber alles in allem doch gut erkennbar, gemalt. Es zeigte eine große Sonnenblume, die im leuchtend gelben Kranz ihrer Blütenblätter ein Paar dunkelbrauner Augen, einen breiten, lachenden Mund, ein üppiges Doppelkinn, eine fleischige Nase und darunter einen riesigen, schwarzen Schnurrbart aufwies. Alles zusammen bildete, zwar karikaturhaft übertrieben, aber doch unverkennbar das runde Antlitz des ›Sonne‹-Gastwirtes Heinrich Blum.
Der Sonnenblum behauptete, ein durchreisender Gast habe das Bild vor Jahren angefertigt und ihm gegen ein Mittagessen überlassen, und da habe er es halt aufgehängt, weil er es lustig gefunden habe.
Die Gäste zuckten darüber lachend ihre Schultern und schüttelten verständnislos ihre Köpfe, aber der Wirt hatte damit seinen Spitznamen weg, und die Leute dachten nicht mehr darüber nach, sondern fügten den Namen in die lange Liste ihrer unabänderlichen Gewohnheiten ein.
Aber die Wahrheit war noch komplizierter. In Wirklichkeit hatte nicht, wie der Sonnenblum behauptete, ein durchreisender Laienkünstler das Bild gemalt – was für ein Künstler, und wäre er noch so laienhaft, kam schon nach Kerchwies, um zu malen?
Nein, er, Heinrich Blum, hatte es selber mit Ölfarben auf ein Holzbrett gemalt, vor ein paar Jahren und einfach so zu seinem Vergnügen. Das freilich musste sein und seiner Frau Traudel Geheimnis bleiben, denn alles, was vom Gewohnten abwich, galt gemeinhin als zunächst einmal verdächtig. Dass einer von ihnen zu seinem Vergnügen Bilder malte, dazu noch so seltsame, das würden sie im Dorf kaum verstehen.
Doch dann hatten eines Tages die neuen Parteiherren begonnen, von entarteter Kunst zu reden, und hatten damit solche Bilder gemeint wie die von August Macke oder von Franz Marc, deren Kunst Heinrich Blum sehr ansprach, wenn er sie nicht gar verehrte, und die Männer vom Schlage Kalkbrenners hatten Bücher, die ihnen nicht gefielen, öffentlich verbrannt und auch noch damit angegeben und mit ihrer Barbarei geprahlt.
Heinrich Blum hatte, sorgfältig darauf achtend, dass niemand weiter zuhörte, zu seiner Frau Traudel gesagt: »Wer Bücher verbrennt, der verbrennt auch Menschen. Das hat jemand früher mal gesagt, ich weiß nicht mehr, wer. Aber es stimmt. Weißt du, was das bedeutet? Wir gehen harten Zeiten entgegen.« Dann hatte er, Ausdruck heimlichen, aber glühenden Protestes, das Bild aus der Kiste unter dem Dach herausgesucht, hatte es aufgehängt und dazu die Geschichte von dem durchreisenden Künstler erfunden.
Seither nannten sie ihn den Sonnenblum, und niemand außer ihm und seiner Frau Traudel wusste, dass er selber der eigentliche Urheber dieses Spitznamens war.
Jetzt sah der Sonnenblum Karl-Friedrich und Wilhelmine an die Theke kommen und griff schnell nach dem Notizblock für die Rechnungen.
»Heinrich, machst du mir die Rechnung?«, bat Karl-Friedrich.
»Willst schon gehen, Fritz?«, sagte der.
Karl-Friedrich nickte, und der Sonnenblum notierte, was der aufzählte: viermal Rippchen mit Kraut und Bubespitz, dazu Bier und Limonade, Kaffee und Kuchen, schließlich zwei Glas Weißwein, Leimener Müller-Thurgau, halbtrocken.
Heinrich Blum schrieb, ohne nachzufragen. Hätte Karl-Friedrich sich bei seiner Aufzählung geirrt, hätte er es sicher gemerkt. Aber er wusste, Karl-Friedrich Buchsbaum gingen Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit über alles. Wenn man sich im Dorf überhaupt auf einen verlassen konnte, dann auf ihn. Karl-Friedrich war ein Mann von geradezu sturer Geradlinigkeit, fromm, doch alles andere als weltfremd. Er beobachtete genau, was in der Welt geschah, und war der Ansicht, wer nur in den Himmel schaute, der müsse auf der Erde unweigerlich stolpern.
Die Wahrheit, so hatte Karl-Friedrich einmal zum Sonnenblum gesagt, sei nicht in den Menschen daheim, sie könne von ihnen vielmehr immer nur gesucht und in Annäherungen erfasst werden. Und als der Wirt das nicht verstanden und nachgefragt hatte, hatte Karl-Friedrich es ihm in einem Bild erklärt. Ein Mensch, sagte er, sei wie ein Schiff auf dem Meer. Das richte sich in der Nacht ja auch nach dem Leuchtturm auf dem festen Land; ein Kapitän, welcher nur der Laterne am eigenen Bug nachfahre, der sei ein gefährlicher Narr. Wer behaupte, die Wahrheit in sich selber zu haben, der werde auch bald sich selber für die Wahrheit halten. Solche Menschen, und das hatte er mit einem Blick auf Adolf Kalkbrenner gesagt, solche Menschen seien gefährlich. Das meine er, wenn er sage, die Wahrheit, der man nachstrebe, müsse immer außerhalb seiner selbst liegen.
Auch Margarete und Willi verließen den Tanzsaal, um draußen in der milden Luft an einem dunklen und stillen Plätzchen den Vorgang ihres Kennenlernens fortzusetzen und zu vertiefen.
Als er sie nach der vom Vater vorgeschriebenen halben Stunde ans Hoftor des Buchsbaum’schen Anwesens brachte, wo im Obergeschoss noch Licht brannte, kamen plötzlich dunkle Gestalten hinter den Ecken und hinter dem dicken Stamm der alten Blutbuche auf dem Dorfplatz hervor, und die beiden fanden sich von vier kräftigen, jungen Burschen umstellt.
Sofort schlug im Hof der Hund an.
»Lux! Still!«, rief Margarete, und der Schäferhundmischling, der ihre Stimme erkannte, schwieg.
Im Westen leuchtete am Himmel eine breite, zunehmende Mondsichel.
»Sperling!«, rief eine Stimme aus dem Dunkel, die Margarete als die von Kurt Kalkbrenner erkannte. »Spatz! Schwirr ab, oder du kriegst die Fresse poliert!«
»Wer ist das?«, fragte Willi flüsternd.
»Der Kurt«, antwortete Margarete genau so leise.
»Oh, der Herr Scharführer!«, rief Willi ins Dunkel hinein. »Du hast mir gar nix zu sagen, ich bin keiner von deine Pimpf.«
»Au no frech werde!«, antwortete Kurt. »Gleich kriegst die Zaunlatt quer über die Gosch, du Klavierspieler, du. Da spiele dir die Zähn im Arsch Klavier!«
»L-lass unsre Weiber in Ruh!«, kam eine zweite Stimme von der anderen Seite. Die gehörte eindeutig dem Helmut Baltzer, der beim Foxtrott mit Margarete so gezappelt hatte und dessen Sprache jetzt einen Akzent hatte, wie man ihn von acht oder neun Halben Bier bekommt.
»Genau!«, kam von der dritten Seite her die Stimme des langen Schorsch Haldenbauer. »Sperling, wir treten unsere Hühner selber!«
»Bei uns«, antwortete Willi laut und trat einen Schritt auf die Straße hinaus, »bei uns, da suchen sich die Hühner den Gockel immer noch selber aus! – Schnell!«, flüsterte er Margarete zu, »geh rein und schließ gut ab! Leg den Torriegel vor!«
»Frech werden will er also, der Spatz«, sagte Kurt und trat zwei Schritte ins Licht der über der Kreuzung hängenden Straßenlampe. Er trug eine abgebrochene Zaunlatte in der Rechten und schlug damit drohend in seine Linke. »So, so«, grinste er hämisch zu Margarete hin, »deine Sau macht heut Junge! Is des da«, dabei zeigte er auf Willi, »eins von dene Ferkel? Des taugt nix, des is en Bleichling, den schlage mir am beste glei dot.« Er schwang die Zaunlatte gegen Willi, der bis an die Hauswand zurückweichen musste. Auch die anderen rückten jetzt näher. Aus dem Dunkel tauchte ein Vierter auf, der bisher geschwiegen hatte.
»Schnell«, flüsterte Margarete, »komm mit rein!«
Kurt hatte es gehört. »Auch dann kriegen wir dich, Spatz«, zischte er drohend. »Irgendwann kriegen wir dich auf jeden Fall!«
Plötzlich flog ein Stein und prallte gegen den Fensterladen im Obergeschoss des Hauses, durch dessen Lamellen das Licht auf die Straße herunterfiel. Mit großem Gepolter, aber ohne nennenswerten Schaden anzurichten, landete er auf dem Straßenpflaster zwischen den Streitenden.
Im selben Augenblick hörten sie eine schrille weibliche Stimme: »Ihr seid wohl verrückt g’worde, ihr Kerle! Kurt, mach, dass d’ hoimkimmst!«
Elisabeth, Margaretes Schwester, kam von der anderen Seite her die Straße herunter, ihren unentschlossenen Freund, den Maurer Hans-Jürgen Spengler, an der Seite.
Zugleich wurde oben im Haus das Fenster samt Laden aufgerissen. Karl-Friedrich Buchsbaum, hemdsärmelig und in Hosenträgern, beugte sich heraus und rief zornig, er werde herunterkommen und den Hund losmachen, wenn die nächtliche Ruhestörung nicht augenblicklich ihr Ende finde.
Die Verwirrung, die dadurch entstand, nutzte Willi zu schnellem Handeln. Er stieß Margarete durch die Pforte, die sich im großen Tor befand, ins Haus, flüsterte: »Schnell verriegeln!« und rannte erst dicht am Haus entlang im Dunkeln und dann über die beleuchtete Kreuzung die Straße hinunter, wo er nach weniger als einhundert Schritten die Eingangstreppe des Gasthauses ›Zur Sonne‹ erreichte und in dessen Haustür verschwand.
Der Sonnenblum stand hinter der Theke und beobachtete aufmerksam das Treiben im Saal, als Willi in die Wirtsstube kam, schwer atmend und sich immer wieder umschauend. Er wusste, was solche Anzeichen bedeuteten. Die Hahnenkämpfe der jungen Burschen um Kurt Kalkbrenner waren dem Wirt nicht nur gefühlsmäßig zuwider. Sie konnten ihn auch teuer zu stehen kommen, weil häufig dabei Geschirr oder gar Mobiliar zu Bruch ging und die Gäste eilig den Saal räumten, was ihn leicht einen großen Teil des erhofften Umsatzes kosten konnte.
Willi war inzwischen mitten durch den Saal zu seinem Platz unter den Musikern geeilt, hatte sich das Akkordeon umgeschnallt und spielte, als seine Verfolger im Wirtshaus auftauchten, mit der Kapelle eifrig Walzer, als sei rein gar nichts gewesen.
Kurt Kalkbrenner stand breitbeinig im Eingang des Saales und schrie: »Sperling! Ich krieg dich!«
Hinter ihm standen der lange Haldenbauer Schorsch, der zappelige Helmut Baltzer und als Vierter war auch noch der siebzehnjährige Heinz Urban dazugekommen.
»Ich krieg dich, wenn du dich noch einmal hier sehen lässt, Spatz! Verlass dich drauf!«, schrie Kurt Kalkbrenner noch einmal.
Dann wandte er sich ab und verließ zusammen mit den drei jungen Burschen das Gasthaus.
Niemand im Saal ahnte, dass von diesen drei Burschen in Kurts Begleitung wenige Jahre später keiner mehr leben würde.
2
Die Bauern maßen die Entfernungen zwischen den Ortschaften nicht in Kilometern oder Meilen, sondern nach den Wegstunden, die sie mit einem Pferdefuhrwerk für die Strecke brauchten. Dabei konnte es vorkommen, dass Hin- und Rückweg verschieden lang waren, nämlich dann, wenn es den einen Weg bergauf und den anderen bergab ging und man in die eine Richtung eine ganze, in die andere aber nur eine halbe Stunde brauchte.
Bog man vom Neckar auf der Höhe von Bernstedt nach Süden in das Steinbachtal ein, erreichte man nach etwas mehr als einer halben Stunde den Flecken Steinbach a. d. Steinbach, Pfarrort und Bahnstation. Nach einer weiteren Viertelstunde das Steinbachtal hinauf zweigte nach der rechten Seite eine schmale, geteerte Landstraße ab. Sie führte steil und kurvenreich ein zunächst enges Tal hinauf, das aber bald weit und lieblich in welliges Hügelland auslief. Dort, am obersten Abschnitt des Hanges, lag das kleine Dorf Kerchwies, dessen Gemarkung, wie der Ortsname zu erkennen gab, vor Zeiten als Weidefläche zum Kirchensprengel Steinbach gehört hatte und das man nach einer weiteren halben Stunde erreichte. Von Bernstedt am Neckar brauchte man folglich bis Kerchwies fünf Viertelstunden, wie man hier sagte, umgekehrt von Kerchwies nach Bernstedt etwas weniger als eine Stunde, weil es in dieser Richtung die meiste Zeit bergab ging.
Das dörfliche Rathaus von Kerchwies stand auf der linken Straßenseite kurz vor der Ortsmitte neben dem Gasthaus und damit dem Kirchplatz mit der großen Blutbuche schräg gegenüber. Vier Stufen zum Eingang hinauf bildeten eine kleine Freitreppe. Über dem Eingang stand in schwarzer Schrift auf weißen Grund das Wort ›Rathaus‹.
Neben der Treppe stand der hölzerne Schaukasten, dessen oberer Teil wie ein Dachgiebel gestaltet war. In diesem Giebel stand in Großbuchstaben ›NSDAP‹, das Hakenkreuz in einer weißen Raute mitten unter den Buchstaben, darunter ›Ortsgruppe Kerchwies‹. An die Pfosten, auf denen der Kasten stand, war ein schwarzes Brett genagelt, darauf war quer über die ganze Breite in weißer Farbe mit der Hand der Satz ›Die Juden sind unser Unglück!‹ gemalt.
Dabei war das Gebäude nicht nur Rathaus, sondern zugleich auch Schulhaus. Die Schule befand sich im Erdgeschoss und hatte nur ein einziges Klassenzimmer. Das eigentliche Rathaus, also die dörfliche Verwaltung mit dem Amtszimmer des Bürgermeisters, füllte das Obergeschoss. Dort gab es zwischen Treppe und Wartebank die einzige öffentliche Telefonzelle des Ortes.
Das Buchsbaum’sche Anwesen befand sich etwas weiter oben, wo die beiden Dorfstraßen einander kreuzten, und damit lag es dem Kalkbrennerhof direkt gegenüber. Die beiden Gehöfte begrenzten den Dorfplatz auf der einen Seite, zwischen ihnen lag nur die Dorfstraße, die aber nach dem Nachbardorf ›Graabener Straße‹ hieß. An der südöstlichen Ecke des Platzes, vom Buchsbaumhof ebenfalls durch eine Straße, nämlich die ›Bachstraße‹ getrennt, lag das Grundstück des Nachbarn Johann Urban. Die vierte Seite des Platzes nahm die Kirche ein, zu der eine breite Treppe aus Sandsteinstufen hinaufführte. Mitten auf dem Dorfplatz stand ein alter Baum, eine Buche mit einer beeindruckend breiten und dichten Krone aus dunkelroten Blättern. Die Blutbuche war, so lernten es schon die Kinder in der Schule, zur Erinnerung an die Männer aus dem Dorf gepflanzt worden, die in den Napoleonkriegen auf den wechselnden Seiten ihr Leben verloren hatten.
Das Wohnhaus der Familie Buchsbaum, unmittelbar an der Straße, war ganz aus dem heimischen roten Sandstein erbaut. Über der Haustür, zu der drei oder vier Stufen hinaufführten, stand eingemeißelt ›Matteus Buchsbaum 1842‹ zu lesen. Allerdings stellte die Haustür nicht den üblichen Zugang zum Haus dar und war fast immer verschlossen. Man betrat das Haus, wie in den Bauernhäusern der ganzen Gegend üblich, von der Hofseite her oder wie in diesem Falle von der Einfahrt in den Hof, die auf der rechten Seite durch das Haus führte. Es war ein recht großes Haus, doch derzeit lebten nur vier Personen darin, und so wurden im Obergeschoss gar nicht alle Zimmer zum Wohnen genutzt. Zwei Räume, die nur notdürftig oder gar nicht beheizt werden konnten, dienten vielmehr als Vorratsräume, in denen Lebensmittel aus dem eigenen Anbau aufbewahrt wurden, solche, die lange gelagert werden konnten wie Mehl und Zucker in Säcken, sowie süßsaure Gurken oder eingemachtes Obst in Gläsern.
Im Erdgeschoss befanden sich nur das mit einem Kachelofen beheizbare Wohnzimmer, von Wilhelmine die ›Gute Stube‹ genannt, und die geräumige Wohnküche. Die übrige Hälfte wurde von der großen Einfahrt eingenommen. Die musste genügend Platz für die Heuwagen bieten, denn der Heuboden war über dem Stallgebäude, das den Hof nach hinten hinaus begrenzte.
Rechtwinklig an das Wohnhaus waren die kleineren Stallgebäude angebaut. Sie enthielten unten direkt am Wohnhaus den Abort, welcher unterirdisch eine direkte Verbindung zu Misthof und Jauchegrube hatte, daneben und zum Teil darüber lag der Backofen, der von der Küche, also vom Wohnhaus her, beheizt wurde und in dem im Abstand von drei Wochen unter Wilhelmines Anleitung frisches Brot gebacken wurde. Daran schloss sich der Schweinestall an, in welchem meist drei oder vier Schweine, überwiegend für den Eigenbedarf, gemästet wurden. Wiederum rechtwinklig schloss der große Stall den Hof nach hinten ab. Darin standen vier Milchkühe, dazu ein Jungrind und ein Kalb. Vorne, gleich rechts vom Eingang, war die große Box für das Pferd, auf das Karl-Friedrich nicht wenig stolz war. Es war ein schwerer, etwas phlegmatischer Ackergaul mit gewaltigen Kräften, ein Fuchswallach, der in den Papieren den seltsamen Namen ›Pferdinand‹ führte, der bei allen aber nur ›der Dicke‹ hieß.
Hinter dem Stall begann das eingezäunte Reich der Hühner, in welchem Wilhelmine uneingeschränkte, wenn auch nicht unangefochtene Herrscherin war, denn der Hahn Caruso meldete ebenfalls Herrschaftsansprüche an, indem er auf jeden, der das von ihm beanspruchte Gebiet betrat, losging und ihn mit Flügelschlägen und Schnabelhieben traktierte. Wilhelmine musste, um ihn sich mit mehr symbolisch als ernst gemeinten Fußtritten vom Leibe halten zu können, immer zu ihrem Schutz dicke Wollstrümpfe tragen. Sie hatte deshalb beschlossen, aus der in diesem Jahr heranwachsenden Kükenschar einen neuen Caruso auszuwählen und den alten der Hühnersuppe zuzuführen. Dahinter befanden sich noch der Bienenstand mit drei oder vier Völkern und ein recht großer Obst- und Gemüsegarten, die ebenfalls zu Wilhelmines Aufgabenbereich gehörten.
Zum Hof gehörten weiter der Hofhund Lux, ein schwarzer Schäferhundmischling, der seine Unterkunft in einer Hundehütte in der Durchfahrt neben der Kellertreppe hatte, und dessen Kette an einem quer über den Hof gespannten Drahtseil lief. Ebenso gehörten auch immer zwei Katzen dazu, die mit dem Verlaufe der Jahre zwar gelegentlich wechselten, die aber immer ›Oi‹ und ›Ana‹ genannt wurden, was auf Hochdeutsch schlicht ›die Eine‹ und ›die Andere‹ bedeutete, und deren Aufgabe darin bestand, Hof, Ställe und Scheunen ratten- und mäusefrei zu halten. Die derzeitige Oi war weiß mit einem schwarzen Fleck auf dem Rücken, Ana war grau gestreift und weiß gescheckt.
»Was war das gestern Abend für ein Kaspertheater?«, fragte Karl-Friedrich beim Frühstück unvermittelt und schaute streng in die Runde.
An Werktagen trug er Arbeitshosen aus grob geripptem, braunem Cordstoff, die man ›Manchesterhosen‹ nannte. Seine Töchter kleideten sich im Alltag in bunte Kittelschürzen. Darunter trugen sie praktische, weite Hosen mit Gummizug oben und an den Knöcheln, die ›Trainingshosen‹ genannt wurden, obgleich noch nie jemand darüber nachgedacht hatte, was mit ihnen denn trainiert würde. Zum Schutz gegen Sonne und Wind trugen sie Kopftücher, die im Nacken gebunden waren, Elisabeth meist geblümte, Margarete regelmäßig ein rotes oder rotbuntes. Wie an jedem Tag traf man sich im Anschluss an die nach genau festgelegtem Takt abgelaufene Morgenarbeit am Küchentisch zum gemeinsamen Frühstück.
Karl-Friedrich hatte schon vor sechs Uhr den dicken Pferdinand versorgt. Der hatte ihn, den schweren Kopf starr auf die geteilte Stalltür gerichtet, mit Ungeduld erwartet und mit einem unglaublich tiefen Wiehern begrüßt. Beim Dicken wurde immer zuerst eingestreut, der fraß dabei gegen den ärgsten Hunger schon mal vom Haferstroh, bekam dann eine große Portion Heu, ein wenig Grünfutter, doch keinen Klee, weil er davon leicht Koliken bekam, dazu eine halbe Futterrübe zum Nagen und einen Eimer Wasser und erst zum Schluss, quasi als Leckerli zum Nachtisch, eine große Holzschaufel Hafer in seine Krippe. Danach waren die Schweine an der Reihe, die Karl-Friedrich mit lautem Hungergeschrei empfingen. So konnte man am frühen Morgen an den Geräuschen im Hof immer feststellen, wo der Bauer sich gerade aufhielt.
Inzwischen hatten ›die Mädchen‹, wie Karl-Friedrich seine Töchter Elisabeth und Margarete nach alter Gewohnheit immer noch zu nennen pflegte, die Kühe mit reichlich Grünfutter versorgt, hatten sie mit der Hand gemolken und das Kalb getränkt. Danach war es Elisabeths Aufgabe, notdürftig auszumisten, während Margarete die Milch vom Morgen zusammen mit der vom vorigen Abend in zwei schweren Zwanzig-Liter-Kannen auf einem Handwagen die Dorfstraße hinunter zum Milchhaus karrte. Dort traf pünktlich wenige Minuten vor sieben Uhr das Milchauto ein, ein Lastwagen, der die mit den Namen der Bauern gezeichneten Kannen nach Bernstedt am Neckar in die Molkerei brachte. Die anfallende Arbeit konnte nur geschafft werden, wenn sie minutiös nach einem Zeitplan ablief. Zum Frühstück traf man sich dann um halb acht Uhr am Küchentisch.
»Bekomme ich eine Antwort?«, bohrte Karl-Friedrich nach und biss von seinem Brot ab, auf das er zuerst Leberwurst aus der Dose und oben drauf Marmelade gestrichen hatte. Karl-Friedrich strich sich auf jedes Brot, mochten Leberwurst, Schwartenmagen oder Käse darauf sein, zusätzlich von der Marmelade, die Wilhelmine selbst eingekocht hatte, während seine Töchter eine Scheibe vom Hefezopf aßen, auf die sie Butter gestrichen hatten.
»Was war los vor unserm Haus gestern Abend?«, wiederholte er. »Wer hat da Steine gegen das Fenster geworfen?«
Elisabeth blickte erst starr vor sich auf das blank gescheuerte Holz des Küchentisches, rührte in ihrer großen Tasse den Malzkaffee um und schielte dann zu Margarete hinüber. Die trank einen Schluck von ihrer heißen Milch und nestelte verlegen an ihrer Kleidung herum.
»Grete«, hakte Karl-Friedrich nach, »du warst dabei! Was war los? Hörst du mir überhaupt zu?«
»Die ist noch nicht ganz hier«, bemerkte Elisabeth boshaft. »Für die schmeckt die ganze Welt noch nach den Küssen von ihrem Willi! Der hat ihr komplett den Kopf verdreht.«
»Elisabeth«, schimpfte Wilhelmine leise, »nimm dich zusammen! Hört, was der Vadder sagt!«
»Was war los, Grete?«, wiederholte Karl-Friedrich. »Wollte der Kurt uns die Fensterscheiben einschmeißen?«
»Nein«, sagte Margarete kleinlaut. »Das …«, sie stockte und hob dann mutig den Kopf: »Das war ich, Vadder.«
Darauf schwiegen alle verblüfft. Mit dieser Eröffnung hatte niemand gerechnet, auch Elisabeth nicht, die doch gestern Abend auch auf der Straße gewesen war.
»Du?« Karl-Friedrich fasste sich als Erster. »Wieso? Was gefällt dir nicht an unseren Fenstern?«
»Der Fensterladen war geschlossen, und auf den hab ich gezielt«, erklärte Margarete, »nicht auf das Fenster. Der Kurt und der Schorsch haben Streit vom Zaun gebrochen. Sie wollten den Willi zusammenschlagen. Zu viert waren sie und mit Zaunlatten und Knüppeln bewaffnet. Der Baltzer Helmut war auch dabei. Da hab ich gedacht, wenn sie dich sehen, dann hauen sie ab. Der Stein war ein bissele zu groß, aber ich hab in der Eile keinen anderen gefunden.«
»Wie hat das angefangen?«, fragte Karl-Friedrich. »Was hat dieser Willi Sperling angestellt?«
»Gar nichts«, antwortete sie. »Er hat mich heimgebracht bis ans Tor. Das war alles. Und da haben sie auf ihn gewartet und haben was gebrüllt. Was ganz Böses.«
»Was denn?«
»Sag ich nicht, so was Böses. Das nehm ich nicht in den Mund.«
»Elisabeth, was haben sie gesagt?«
»Ich weiß nicht mehr, Vadder. Irgendwas mit Hühnern.«
»Lass nur, ich kann’s mir schon denken.«
Karl-Friedrich sah nachdenklich zu Wilhelmine hinüber. Die verstand den Blick. Sie brachte vom Herd frischen Malzkaffee herüber und füllte seine große, blau geblümte Steinguttasse.
»Es wird schon nichts kaputtgegangen sein«, sagte sie, und nach einer Weile fügte sie leise hinzu: »Es ist ein Kreuz mit solchen Menschen.«
»Na gut«, seufzte Karl-Friedrich. »Grete, du gehst gleich hoch auf den Speicher und schaust nach, ob am Dach noch alles ganz ist. Sollten Ziegel gebrochen sein, wechselst du sie gleich aus. Das schaffst du allein. Die Dachziegel stehen am Kamin gestapelt an der Rückseite.«
»Ja, Vadder, ich weiß«, antwortete Margarete.
»Ich spann inzwischen den Dicken an. Grete, du gehst dann mit mir, Grünfutter holen. Danach machen wir zu dritt am alten Lennertshäuser Weg weiter mit den Frühkartoffeln. Der Kartoffelroder steht noch draußen im Feld. Elisabeth, du machst erst den Kuhstall fertig, und dann kümmerst du dich um Kartoffelsäcke und Körbe.«
Damit stand Karl-Friedrich auf, und die morgendliche Dienstbesprechung war beendet.
»Dann gibt es heute zum Mittag neue Kartoffeln mit Quark«, verkündete Wilhelmine.
Um elf Uhr läutete die Glocke vom Kirchturm. Wilhelmine war mit einem Korb aufs Feld hinausgekommen. Sie sammelte, während die anderen bei ihrer Arbeit waren, die jungen Kartoffeln ein, rollte ihr Kopftuch zusammen und formte daraus einen Tuchring. Den legte sie sich auf den Kopf, setzte den vollen Korb darauf und trug ihn so die Dorfstraße hinunter. Als die anderen vom Feld heimkamen, war das Mittagessen fertig.
Karl-Friedrich nahm seinen gewohnten Platz auf der Eckbank ein, erst danach setzten sich die Töchter an den Tisch. Wilhelmine trug die dampfenden Pellkartoffeln auf und stellte die Steingutschüssel mit dem mit viel gehackter Zwiebel und frischen Kräutern aus dem Garten verfeinerten Quark vor Karl-Friedrich. Der sprach das kurze Tischgebet und langte als Erster zu.
Während sie aßen, hörten sie die Mittagsnachrichten aus dem Volksempfänger. In München, so erfuhren sie, sei ein Abkommen geschlossen worden, in welchem die Regierungen von England, Frankreich und Italien der deutschen Reichsregierung die Angliederung des Sudetenlandes und der Tschechoslowakei an das Reich zugestanden hätten.
»Na also«, murmelte Elisabeth und löffelte sich ein zweites Mal von dem Quark auf den Teller, »wer sagt’s denn!«
Der Propagandaminister, so hieß es weiter, habe in Berlin auf einer Großveranstaltung über die jüdische Weltverschwörung gesprochen und habe dabei die ›Entjudung Deutschlands durch die Mobilisierung des Volkszorns‹ gefordert. »Die Juden sind unser Unglück!«, mit diesen bekannten Worten habe er seine Rede geschlossen.
»Klar«, kommentierte Elisabeth, »der Viehhändler! Du brauchst dir nur in Lennertshausen den Viehhändler Mode anzuschauen. Das weiß doch jeder, dass der die Leut bescheißt, wo er nur kann.«
»Was hast du gegen den dicken Pferdinand?«, fragte Karl-Friedrich. »Das war ein gutes Geschäft, als ich den Gaul vor ein paar Jahren beim Samuel Mode gekauft hab. Selbstverständlich hab ich gewusst, was die Leute reden über ihn, aber ich hab mich über ihn nie beklagen können. Weißt du, was er zu mir gesagt hat? ›Buchsbaum‹, hat er zu mir gesagt, ›zu einem ehrlichen Mann bin ich auch ehrlich. Andere sagen, er ist nur ein Jud, man darf ihn betrügen. Nu, wenn einer mich will betrügen, betrüg ich auch.‹ Das hat er zu mir gesagt. Und ich werde mich nicht, bloß wegen eines Juden, selber zum Betrüger machen.«
»Ach, Vadder«, warf Margarete ein, »den Gaul hast du vor fünf oder sechs Jahren gekauft. Da mag das so gewesen sein, wie du sagst. Heute könnte sich so etwas niemand mehr erlauben. Da täten sie dich öffentlich als Judenknecht anschwärzen.«
Karl-Friedrich schwieg. Seine einzige Antwort war, dass er eine finstere Miene aufsetzte und vor sich auf seinen Teller starrte.
»Ach«, knurrte Elisabeth nach einer Weile, »die Juden sen nu mal bös. Schon immer. Des woiß doch jeder.«
Pfarrer Beetz kam an jedem zweiten Sonntag mit seinem Opel-Zweisitzer von Steinbach auf neun Uhr zum Gottesdienst nach Kerchwies herauf. Die wie die meisten Häuser aus dem heimischen roten Sandstein erbaute Dorfkirche mit dem protestantisch trutzigen Giebelturm bot innen für einhundert Menschen Platz. Die Kanzel für die Predigt hing wie ein Schwalbennest hoch über dem Altar. Die Inneneinrichtung war in einfachem, aber geschmackvollem Bauernbarock gehalten. Sie erinnerte die Dorfbewohner daran, dass viele von ihnen Nachkommen von aus Tirol vertriebenen, evangelischen Bauern waren, die der damalige Herrscher der Kurpfalz Karl Philipp vor etwas mehr als zweihundert Jahren eingeladen hatte, sich in dem nach dem Dreißigjährigen Krieg fast ausgestorbenen Dorf anzusiedeln. Unter denen, so konnte man in den Chroniken nachlesen, war auch ein Michael Buchsbaum gewesen.
Mit Pfarrer Gustav Beetz hatten viele Bewohner von Kerchwies ihre liebe Not wegen seiner übertrieben konservativen und deutschtümelnden Art. Er hielt den Führer der völkischen Partei mit der rauen, auf markig getrimmten Stimme für den von Gott gesandten Retter Deutschlands. In seiner Predigt erklärte er, die Volksgemeinschaft sei eingeteilt in Wehrstand, Lehrstand und Nährstand, denen seit alter Zeit in allen indogermanischen Völkern die Gottheiten des Krieges, der Weisheit und der Fruchtbarkeit entsprochen hätten. Von der hohen Kanzel herunter redete er vor nicht viel mehr als einer Handvoll Leuten. Die Kerchwieser mochten ihren Pfarrer nicht.
Karl-Friedrich Buchsbaum, demonstrativ im Gehrock und neben sich den Zylinder, saß allein auf der Bank, deren vier Plätze den Mitgliedern des Kirchenvorstandes vorbehalten waren, von denen immer eines für den sonntäglichen Kirchendienst eingeteilt war. Er gehörte diesem Gremium seit nun bald zehn Jahren an und war fest entschlossen, dort auch seinen Platz zu behalten, damit er nicht von einem der neuen völkischen Herren besetzt werden konnte. Einem von denen, dem grauhaarigen und im Grunde eher gutmütigen Parteigenossen Albert Baltzer, dem Vater des zappeligen Jungen, war es gelungen, sich in den Vorstand wählen zu lassen, und Ortsgruppenleiter Kalkbrenner hörte regelmäßig ab, was der ihm aus den Kirchenvorstandssitzungen berichtete. Baltzer saß ebenfalls in der Kirche, aber er saß halb versteckt auf der Empore in der letzten Bankreihe vor einem der großen seitlichen Fenster. Bei ihm war seine sechsjährige Enkelin Waltraud. Das Kind kniete umgekehrt auf der Bank, hatte Arme und Kinn auf die Banklehne gelegt und schaute die ganze Zeit zum Fenster hinaus auf die Dorfstraße, obgleich es dort um diese Zeit absolut nichts zu sehen gab.
Die Orgel wurde von Lehrer Schmid gespielt. Zu dessen Orgeldienst gehörte auch, dass er auf jeden Sonntag zwei Schüler des fünften oder sechsten Schuljahres verpflichtete, die hinter der Orgel für eine geringe Entlohnung aus dem Klingelbeutel den Blasebalg treten mussten. Da konnte es vorkommen, dass während der Predigt einer der Buben oder auch beide durch die hinter der Orgel versteckte, meist unverschlossene Tür in den Kirchturm und dort die Treppe hinauf entwischten, dort allerlei Allotria trieben und nicht wieder rechtzeitig an ihrem Platz waren. Dann gab die Orgel, wenn Lehrer Schmid das Lied nach der Predigt einleiten wollte, mit einem Seufzer ihren Geist auf, da mochte der alte Lehrer noch so heftig an dem Klingelzug rütteln, um die Buben herbeizurufen.
Und nach dem Gottesdienst hagelte es dann Ohrfeigen.
Die anderen, einzeln über den Raum verteilten Besucher waren alte Frauen, zwei von ihnen hatten ihre kleinen, herausgeputzten Enkelinnen dabei, die alle von dem, was Pfarrer Beetz redete, nichts verstanden und auch gar nichts verstehen wollten, sondern einfach still dasaßen und abwarteten. Sie waren hier, nur um unter den Segen zu kommen, der am Ende des Gottesdienstes über ihnen gesprochen wurde.





























