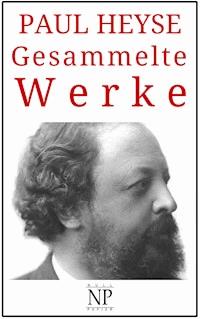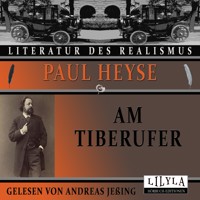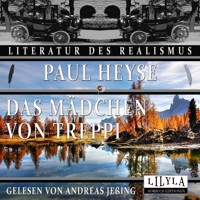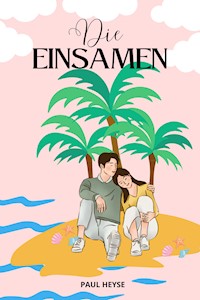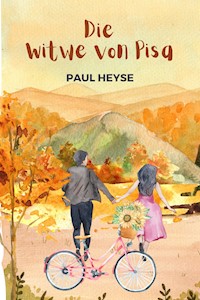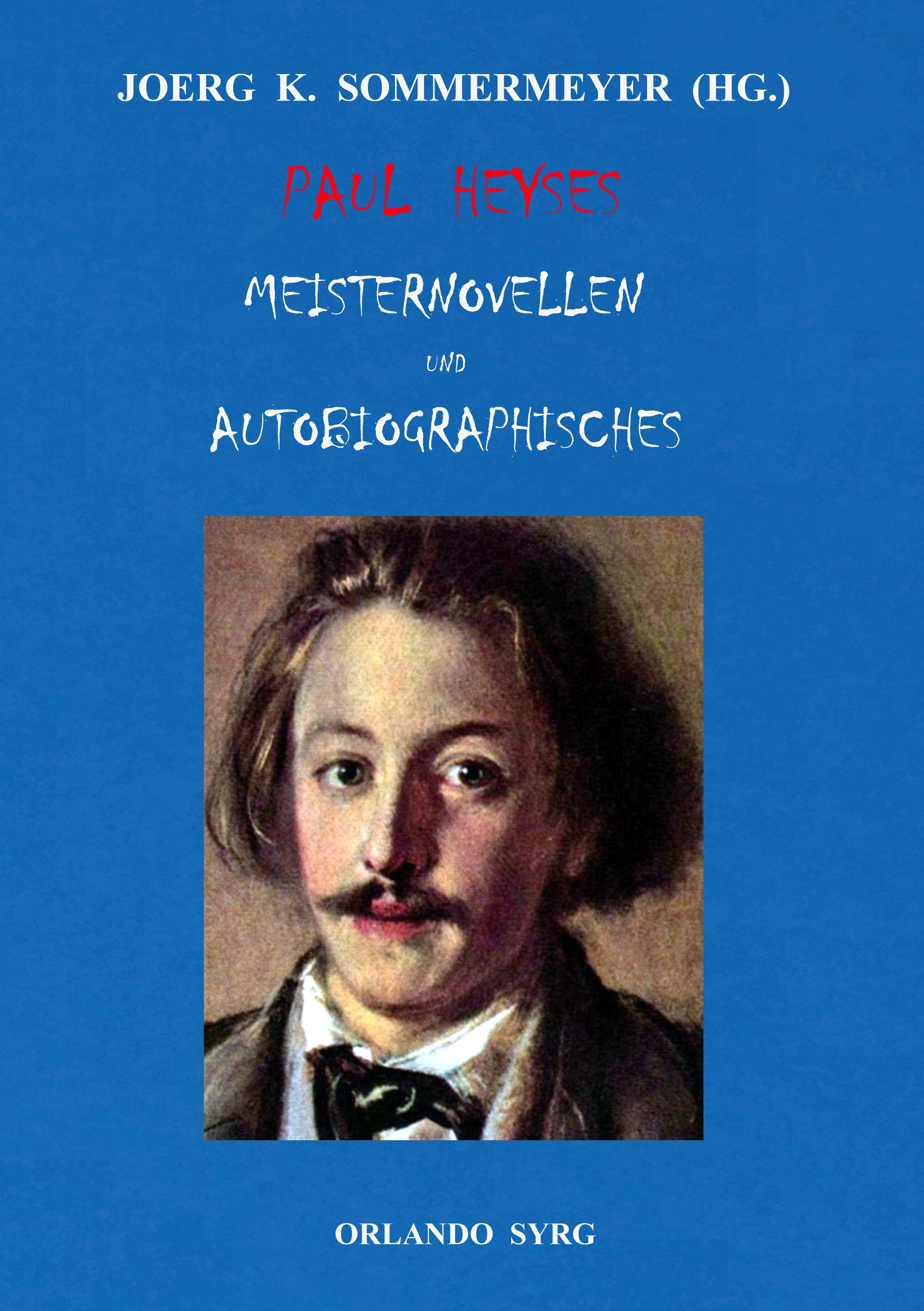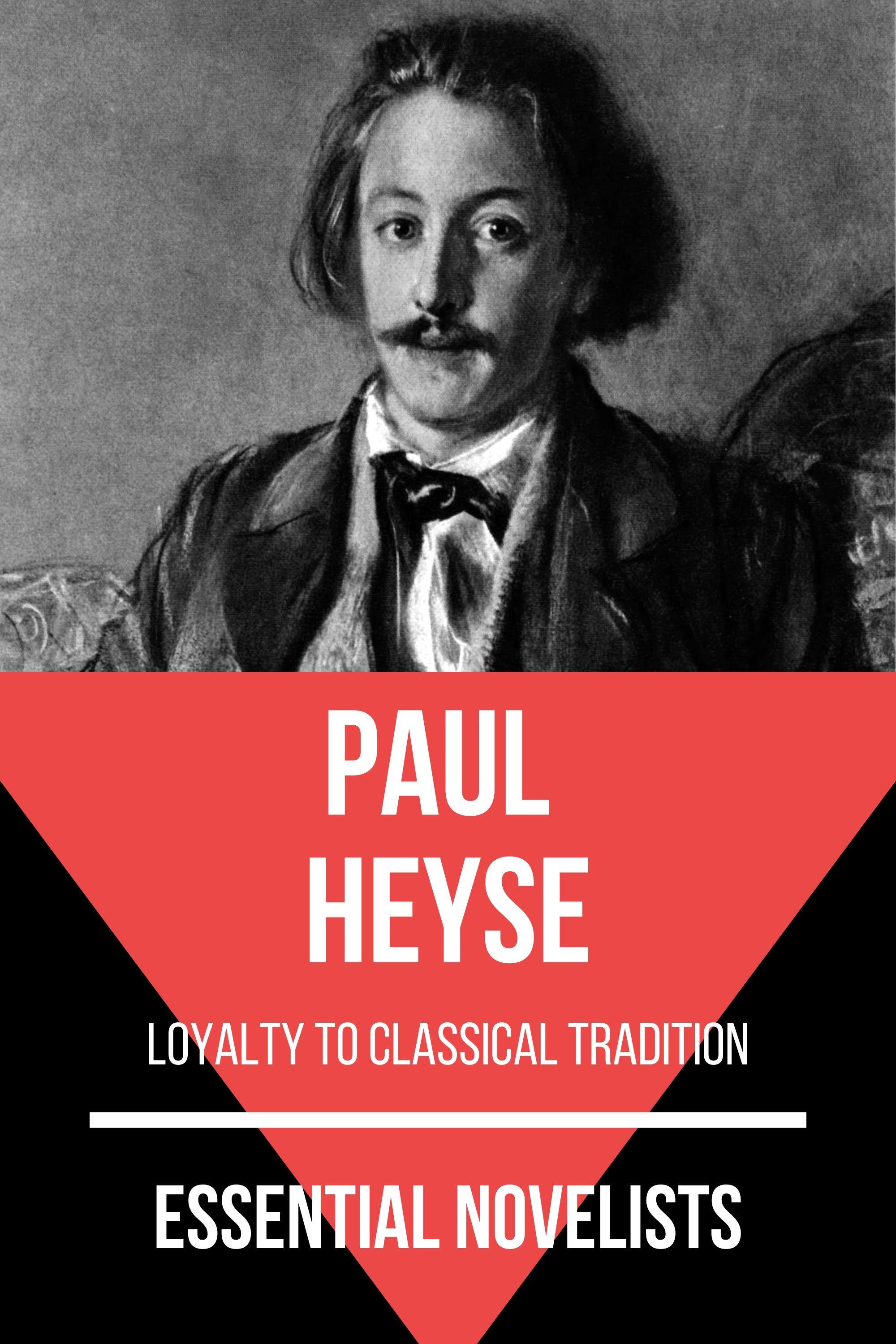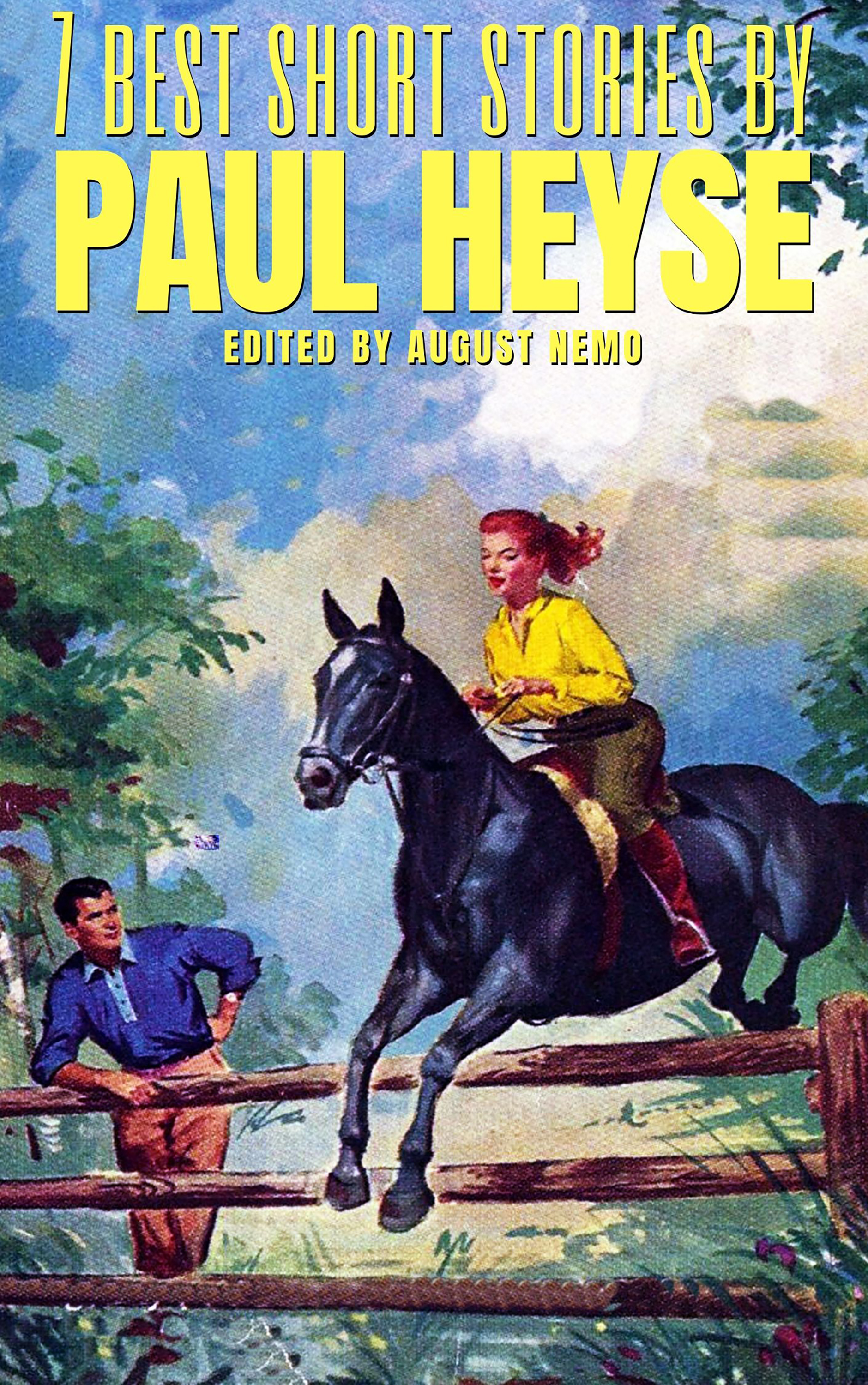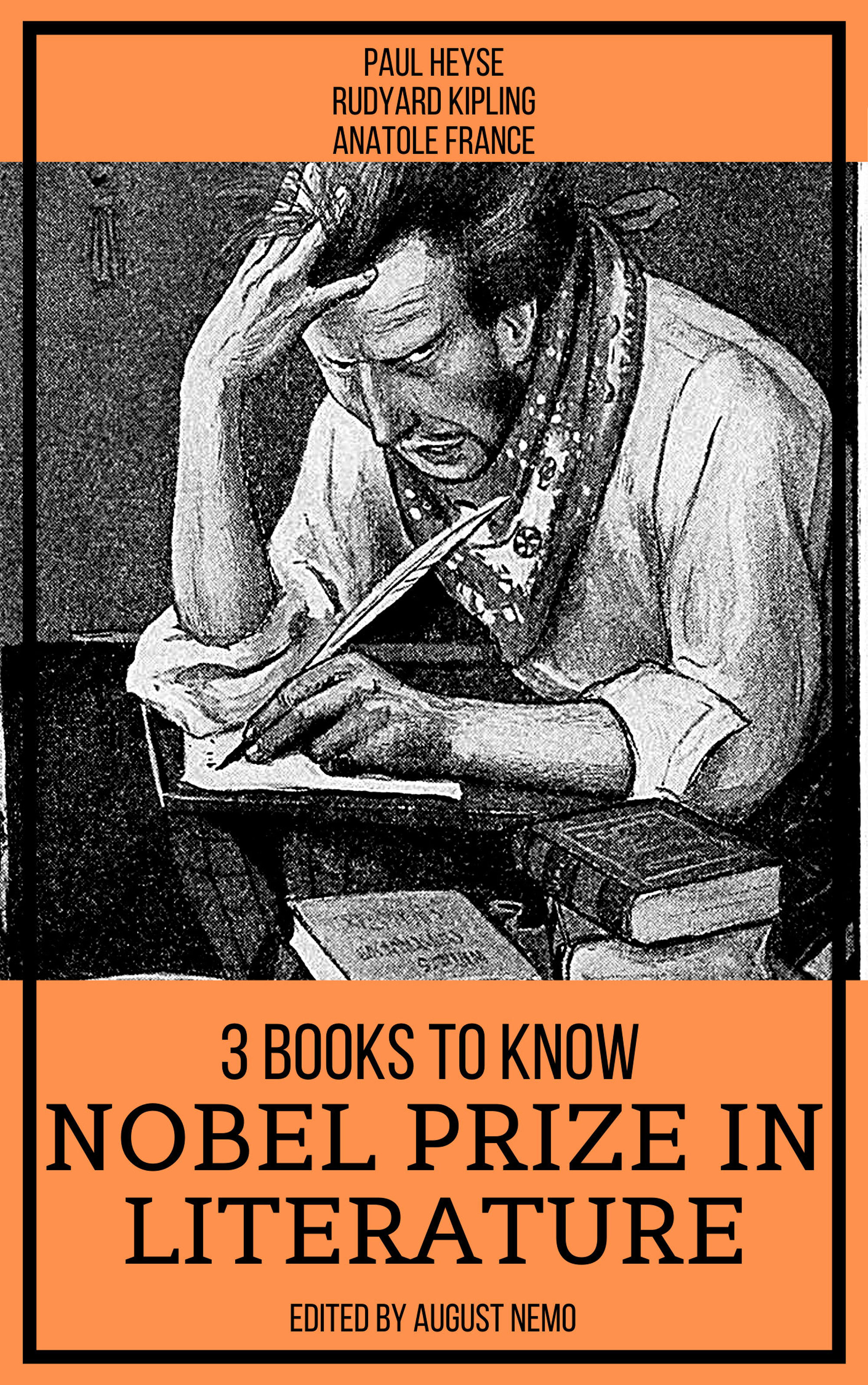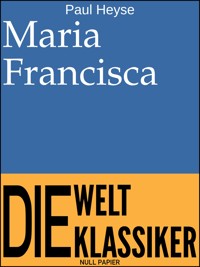
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Paul Johann Ludwig von Heyse (15.03.1830–02.04.1914) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Neben vielen Gedichten schuf er rund 180 Novellen, acht Romane und 68 Dramen. Heyse ist bekannt für die "Breite seiner Produktion". Der einflussreiche Münchner "Dichterfürst" unterhielt zahlreiche – nicht nur literarische – Freundschaften und war auch als Gastgeber über die Grenzen seiner Münchner Heimat hinaus berühmt. 1890 glaubte Theodor Fontane, dass Heyse seiner Ära den Namen "geben würde und ein Heysesches Zeitalter" dem Goethes folgen würde. Als erster deutscher Belletristikautor erhielt Heyse 1910 den Nobelpreis für Literatur. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Heyse
Maria Francisca
Novelle
Paul Heyse
Maria Francisca
Novelle
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962811-73-0
null-papier.de/angebote
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Maria Francisca
(1858)
Wir hatten den sommerheißen Tag in der engen, trägen Postkutsche fast ganz verschlafen. Denn die Fenster waren zu schmal, um uns bequem an den wolkenlosen Linien des Gebirges, dem wir entgegenfuhren, zu weiden, und Sonnenbrand und Staub hatten das flache Vorland seit Wochen übel heimgesucht. In einer Art von trotziger Müdigkeit und wehmütiger Verstocktheit aller Sinne saß mein Freund, der Maler, mir gegenüber, und mit einem kräftigen Freudenfluch sprang er Abends aus dem schwülen Kasten, als wir vor dem Posthause des letzten Städtchens an der Schwelle des Gebirges hielten. Er warf seinen Mantelsack neben den meinigen in einen Winkel der Gaststube und zog mich sogleich wieder auf die kühle Straße hinaus.
Der Ort hatte jenes gemischte Ansehen, wie man es nur bei solchen an das Vorgebirge gerückten Vorposten der Ebene findet. Die Häuser zeigten sich gegen das Hochlands-Klima wohl verwahrt, manche ganz in einen Schuppenpanzer von Schindeln gekleidet, die Dächer mit Felsstücken beschwert, andere wiederum mit aller flachen Zierlichkeit großstädtischer Bauten ausgerüstet. Mitten aber durch die Stadt lief ein rascher Bach, so klar, dass wir der Lockung nicht widerstanden, die staubigen Hände darin zu kühlen. Dabei nahm sich mein Freund sehr befremdlich und gefährlich aus, da ihm beim Bücken die Haare tief übers Gesicht fielen und mit dem Bart zusammenflossen, wie ein mächtiger Stromgott, von dessen Haupt und Angesicht die Quellen entspringen. Bei näherer Betrachtung erkannte man freilich, dass dieser einschüchternde Haarwuchs zu dem kindlich-sinnlichen Ausdruck seines Gesichts nicht passte. Er hätte, geschoren, trotz seiner sechsunddreißig Jahre noch immer ein ganz artiges Mädchen vorstellen können. Und so war es auch mit seinem inneren Wesen bestellt. Man konnte wohl sagen, dass er Haare auf den Zähnen hatte, denn wo es galt, sich nach außen hin Respekt zu verschaffen, war er allezeit unverlegen. Im Übrigen teilte er mit jenem alten lockenberühmten Helden die Schwäche, dass manch ein Philister ihn zu überlisten und manche Delila seine arglose Seele zu schädigen verstanden hatte.
Als er nun den Tagesstaub von sich getan hatte und sich aufrichtend den reinen, heiteren Abendwind empfand, der durch die Gassen streifte, wurde er ganz aufgeräumt und lachte über die verdrießliche Fahrt. Er nahm mich unter den Arm und schlenderte, das ergrauende Blau des Himmels studierend, längs dem Bach die Straße hinunter. Mir ist wohl, sagte er, wie der Raupe, die aus der Schachtel eines Schulbuben entwischt und in einen frischen Strauch gerät, wo sie sich zu Verpuppen denkt, ohne den Wissensdrang irgend eines zuschauenden Menschenauges dadurch zu befriedigen. Du sollst sehen, wie gut ich morgen erst, wo es ans Wandern geht, zu brauchen sein werde.
Ich freute mich seiner guten Stimmung; denn als ich ihn vor vier Wochen nach einer langjährigen Trennung wiederfand, hatte mich der Druck, der sein Gemüt belastete, nicht wenig geschmerzt. Durch entferntes Hörensagen wusste ich wohl, dass er inzwischen seine Frau verloren hatte. Ich war ihm in den Jahren seiner Ehe nie begegnet, und da man von geliebten Toten nur zu denen sprechen mag, denen wenigstens die äußere Gestalt des Abgeschiedenen nicht fremd war, so vermied ich es, nach seinem Kummer zu fragen. Vornehmlich um ihn zu zerstreuen, hatte ich die Gebirgsreise eifrig veranstaltet, und sah nun mit großer Genugtuung, dass Alles nach Wunsch zu gehen versprach.
Während wir so planlos uns ergingen und mit der Aufmerksamkeit, die man bei Beginn einer Reise auch den geringsten neuen Gegenständen schenkt, uns nach allen Seiten umsahen, entdeckten wir ziemlich am Ende der Stadt ein niedriges Haus von Einem Stockwerk, nach Art der italienischen mit einem flachen Dache gedeckt. Ein Zelt war oben ausgespannt, unter dem ein Haufe von Männern beim Weine saß. Über der Tür aber schwankte ein metallenes, wunderlich ausgeschnittenes Schild mit der kunstlosen Inschrift: Marionetenspil und Rosolio, ausgeübt durch Alessandro Tartaglia. Uns beide gelüstete nach dem luftigen Platz in der Höhe, wo wir auch das Volk, in dem schon viele romanische Elemente spuken, zu beobachten hofften, und da sich kein Aufgang von außen erspähen ließ, traten wir in die nicht gar saubere Schenke ein.
Ein Gewirr wunderlicher Stimmen drang uns entgegen, zugleich ein unfeiner Mischgeruch der verschiedensten gebrauten und gebrannten Getränke, der uns fast den Atem benahm. Links vom Eingang war ein schwerfälliger Schenktisch aufschlagen, hinter dem eine blasse Frau mit dunklen und lose aufgedeckten Haaren saß, einen Säugling an der offenen Brust. Sie starrte teilnahmslos in ein Glas mit rotem Wein, das vor ihr stand und aus dem sie von Zeit zu Zeit trank. Auf den Gestellen an der Wand hinter ihr sah man verschiedenartige Flaschen, deren Inhalt in allen Farben spielte. Ein Spinnrad lehnte im Winkel, eine gelbe Katze schlief auf dem Fußgestell und hielt einen herausgezupften Faden im Traume fest. Auch die Frau schien halb zu schlafen. Wenigstens sah sie uns Eintretende mit einem zerstreuten, ungastlichen Blicke an, nickte kaum mit dem Kopf und machte sich mit dem Kinde zu tun, das die Brust verloren.
Unsere Aufmerksamkeit wurde auch bald von der übrigen Ausstattung der Schenke in Anspruch genommen. Da saßen und standen eine große Zahl von Landleuten und Gebirgsbewohnern vor dem ziemlich umfangreichen Marionettenkasten, der aus dem Hintergrunde des Zimmers mit seinen zwei trüben Seitenlichtern und dem von oben erhellten Bühnenraum allerdings fantastisch genug hervorsah. Es war sehr geschickt so veranstaltet, dass, wer nur im Vorübergehen am Hause einen Blick in die Schenke warf, die grell bemalten Puppengesichter erkennen musste. Den Text des Schauspiels verstand man aber nur, wenn man eingetreten war und scharf zuhörte. Denn die Stimme des Schenkwirtes Alessandro Tartaglia schien durch den Umstand, dass er mit dem Marionettenspiel das Rosoliogeschäft verband, an Tonfülle nicht wenig eingebüßt zu haben, zu geschweigen, dass die Sprache, die aus der heiseren Kehle kam, ein bedenkliches Gemengsel deutscher, französischer und italienischer Phrasen war, dem man erst nach einiger Übung Sinn abgewinnen konnte.
Wie wir nun, unschlüssig, ob wir bleiben oder gehen sollten, die Treppe zum Dach hinauf umsonst mit den Augen suchten, hatten die Letzten der andächtigen Zuhörerschaft uns bemerkt und mit unwillkürlicher Höflichkeit uns einen Zugang in ihre Mitte geöffnet. Es musste nichts Ungewöhnliches sein, dass Fremde sich hier den Abend vertrieben, denn ehe wir es uns versahen, fanden wir uns zu einer leergelassenen Bank ganz vorn an der Bühne durchgeschoben, auf der wir nun wohl oder übel Platz nehmen mussten. Ich für mein Teil ließ mir die Ehre gern gefallen. Die munteren Bewegungen der grotesken Figuren, die ein Stück nach dem Ariost tragierten und auch bei den lebhaftesten Prügelszenen ihre lächelnde bunte Miene oder den Ausdruck erhabenen Tiefsinns nicht veränderten, waren mir sehr ergötzlich. Und als ich mit dem Jargon des »ausübenden« Künstlers erst vertrauter geworden war, bewunderte ich das Geschick des Stimmenwechsels und den Reichtum an kreischenden, quietschenden, lispelnden und schnarrenden Naturlauten, die zuweilen das Publikum zum höchsten Jubel fortrissen. Je mehr mich aber, trotz des erstickenden Dunstes in der trüben Höhle, die Lustigkeit des Schauspiels ansteckte, desto unruhiger und verstimmter wurde das Gesicht meines Freundes. Er rückte unmutig auf der Bank hin und her, wandte sich verdrießlich um, ob an kein Entrinnen zu denken sei, und als er die lebendige Mauer sah, die sich hinter unserem Rücken wieder starr geschlossen hatte, verbiss er sich in seinen dichten Schnurrbart und schloss die Augen. Nicht der glücklichste Spaß des unsichtbaren Stimmführers konnte ihm mehr ein Lachen ablocken.
So war das Stück zum Ende gediehen und die feierliche Mordschlacht des Finales, die einen großen Lumpenhügel aus sämtlichen mitspielenden Personen auftürmte, hatte den tiefsten Eindruck auf die Zuschauer nicht verfehlt. Auf einmal aber fuhr eine kolossal erscheinende Hand über das Totenfeld hin und fegte mit den sämtlichen Helden, Königinnen und lustigen Personen alle Nebel der poetischen Illusion von der Bühne. Schon machte sich ein Rühren und Regen hinter unserem Rücken bemerklich, wie es dem Aufbruch vorherzugehen pflegt, als eine gellende Klingel hinter der Bühne noch einmal die Aufmerksamkeit fesselte. Aus der Tiefe des Kastens tauchte ein Kopf herauf, wiederum riesenhaft gegen die Verhältnisse der Kulissen, und von so sonderbarem Ausdruck, dass ich einen Augenblick zweifelte, ob hinter dieser Maske eine lebende Seele stecke. Die kurzen schwarzen Haare standen ihm starr zu Berge, eine große Stirnnarbe lief von den Augen aus hoch hinan über den Kopf und hatte in das schwarze Gestrüpp eine breite rote Lichtung gebahnt. Die Augen bewegten sich rasch aber automatenhaft in den geschlitzten Höhlen, der lachend offene Mund zeigte zwei Reihen glänzender weißer Zähne, die Ringe in den Ohren blitzten, ein Gemisch von Brutalität und gutmütiger Lustigkeit sprach so wunderlich aus allen Falten des Kopfes, dass derselbe fast das Ansehen einer karikierten Studie hatte, wie sie niederländische Maler wohl zu machen pflegten.
Dieser Kopf schaute eine Weile durch den Rahmen der Bühne in die dunkle Schenkstube hinaus und schien sich die Gesichter zu merken, damit Keiner mit der Bezahlung durchgehen könne. Dann sprach er mit amtsmäßig monotoner Stimme: Morgen wird aufgeführt una brava Commedia lirica, benannt Castruccio Castracani – – Wie durchgeschnitten stockte hier die Ankündigung. Der Ausrufer hatte endlich die beiden Fremden ausfindig gemacht, die, weil sie tiefer saßen, unter seinen Horizont fielen. Ich bemerkte, wie sich die Augen des Kopfes mit starrer Bestürzung auf meinen Freund hefteten, der seinerseits ruhiger, aber ebenfalls nicht gleichgültig die Züge im Kasten musterte. Nur einen Moment dauerte diese gegenseitige unheimliche Begrüßung. Dann tauchte der Puppenspieler blitzschnell unter, die lange Gardine, die das Gerüst verhing, bewegte sich, und dicht vor uns stand in Hemdärmeln und bloßen Füßen die untersetzte Gestalt des Herrn Alessandro Tartaglia selbst.
Ich war aufgestanden, denn es schien mir nicht anders, als ob eine Katze, die eine Weile unschuldig getan, sich plötzlich zum Sprunge anschicke. Mein Freund aber blieb unbeweglich auf seinem Sitz, nur sah ich, wie er den rüstigen Bergstock mit langer Eisenspitze fester zwischen die Faust nahm. Indessen war jede Besorgnis grundlos. Denn nach dem ersten Schrecken der Überraschung erhellte sich das possenhafte Gesicht des Schenkwirtes, und mit einem freundschaftlichen schmunzeln sagte er: Che diavolo! So ist es nicht Euer Gespenst, Professor, sondern der Sohn von Eurer Mutter selbst? Aspetta, aspetta, nur zwei Momente, und ick sein zu Euer service. Ick ’ab Euch zu sagen multe cose, multe! –