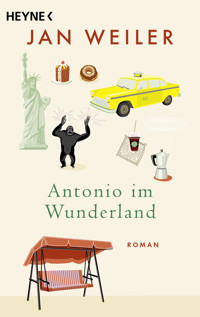8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
»Ein wunderbar witziges, warmherziges Buch. Wer noch keine italienischen Verwandten hat, wird nach der Lektüre unbedingt welche haben wollen.« Axel Hacke »Ein unverzichtbarer Beitrag zur deutsch-italienischen Freundschaft. Und saukomisch.« Stern »Jan Weiler spielt gewitzt mit Sprach- und Nationenstereotypen.« Der Spiegel »Hilft garantiert gegen trübe Tage« Für Sie Wenn Sie Jan Weiler als Redner buchen möchten, kontaktieren Sie bitte die Econ Referenten-Agentur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Nach der Hochzeit verändern sich die Dinge grundlegend – besonders, wenn man wie Jan Weiler in eine italienische Großfamilie einheiratet: »Es gibt nämlich einen riesenhaften Stammbaum, der sich in der Mitte in zwei etwa gleich starke Äste teilt. Man hat sich vor vielen Jahren endgültig zerstritten, aus Gründen, die keiner mehr so richtig kennt. Seitdem heißt es vom einen Zweig, er sei blöd, und vom anderen, er sei geizig. Die meisten Männer der einen Familienhälfte heißen Mario (blöd), die meisten Männer der anderen heißen Antonio (geizig). Mein Schwiegervater ist ein Antonio und gar nicht geizig. Jedenfalls lassen beide Familienhälften kein gutes Haar aneinander.«
Die herrlich komische Geschichte einer unglaublichen Verwandtschaft aus der italienischen Region Molise, die laut ihrer Bewohner »am A… der Welt« liegt.
Der Autor
Jan Weiler, 1967 in Düsseldorf geboren, arbeitete zunächst als Texter in der Werbung. Nachdem er die Deutsche Journalistenschule in München absolviert hatte, wurde er 1994 in der Redaktion des Süddeutsche Zeitung Magazins tätig, das er von 2000 bis Anfang 2005 als Chefredakteur leitete. Jan Weiler lebt mit seiner italienischen Frau und zwei Kindern südlich von München.
JAN WEILER
Maria, ihm schmeckt’s nicht!
GESCHICHTEN VON MEINER
ITALIENISCHEN SIPPE
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,
wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,
Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Erweiterte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Oktober 2003
45. Auflage 2010
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2004
© 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG
Einige Passagen dieses Buches sind in gekürzter Version im
Süddeutsche Zeitung Magazin erschienen.
Lektorat: Angela Troni, München
Umschlaggestaltung und Gestaltung des Vor- und Nachsatzes:
Sabine Wimmer, Berlin,
unter Verwendung verschiedener Illustrationen von Sylvia Neuner
Titelabbildung: Sylvia Neuner
eBook-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
Printed in Germany
eBook ISBN 978-3-548-92109-9
Für Sandra
Eins
Ein Fremder steht vor der Tür. Das bin ich. Genau genommen bin ich nicht nur den Menschen hinter der Tür fremd, sondern vor allem mir selber. Ich habe mich nämlich mit einem Strauß Blumen als Schwiegersohn verkleidet. So kenne ich mich nicht, denn ich habe noch nie Schnittblumen an Menschen verschenkt, die nicht entweder zu meiner Familie gehörten oder wenigstens gleichaltrig und weiblich waren. Man bittet auch nicht sehr häufig im Leben um die Hand einer Tochter. Da kann man sich schon mal vor sich selber fremd fühlen.
Es ist unser erster gemeinsamer Besuch bei ihren Eltern. Zwar sind wir bereits mehr als zwei Jahre zusammen, aber ich kenne bisher nur ihre Schwester und sie. Das reicht ja auch, fand ich bisher. Dann jedoch machte ich Sara einen Heiratsantrag, was bei uns wie bei den meisten Menschen zu einem Besuch bei den Eltern führte.
Sara steht hinter mir und schubst mich.
Wir sind mehr als sechshundert Kilometer gefahren, und dabei erzählte Sara fast die ganze Zeit von ihrem Vater, der ihr den wundervollen Nachnamen Marcipane vererbt hat. Er sei ein wenig anstrengend, sagte sie. Manche fänden ihn wunderlich. Andere hätten sogar Angst vor ihm, aber das verstehe sie nicht. Er sei eine echte Nummer. Er habe Humor. Verstand, Appetit. Sei großzügig. Und besitze nun einmal die Angewohnheit, ohne Unterbrechung zu reden, wenn er sich wohl fühle. Da er sich die meiste Zeit seines Lebens ungemein wohl fühle, habe dies nun zur Folge, dass er von morgens bis abends rede. Das habe ihr früher in der Jugendzeit den letzten Nerv geraubt. Er habe damals ihre Verehrer, allesamt Deppen, wie sie etwas zu deutlich betont, regelrecht aus dem Haus gequasselt. Nun sei das alles nicht mehr so schlimm, er werde ja älter. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, ist mir nicht klar.
Ihr Vater sei, dozierte Sara, eine Art Windmaschine, die aber nicht nur Luft bewege, sondern auch Herzen. Er sei kaum zu Argem imstande, und wenn er doch mal sauer werde, dann doch nur um des Effektes willen, denn für wahren Zorn sei er eigentlich zu ignorant. Nichts interessiere ihn so sehr, dass es ihn wirklich aufregen könne. Dann fügte sie noch hinzu, dass es eigentlich nur eine Gefahr gebe, und die trete ein, wenn er nichts mehr sage, stumm bliebe. Je nach Dauer des Schweigens könne man sich dann auf Ärger einstellen, mitunter auf großen Ärger.
Kompliziert, dachte ich und fragte: »Und was ist mit deiner Mutter?«
Bisher weiß ich nur, dass Saras Mutter Ursula heißt, aus dem Rheinland kommt und die Geduld eines belgischen Brauereipferdes besitzt. Auf einem Jugendbild, das auf Saras Schreibtisch steht, ähnelt Ursula ihrer Tochter: sehr schmaler Mund, kleine Nase, viele Sommersprossen drum herum. Ihre Augen und die blonden, eigentlich unitalienischen Haare muss Sara aber von ihrem Vater haben. »Meine Mutter ist das komplette Gegenteil von Papa«, sagte sie. »Ich habe echt keinen Schimmer, wie die das Gequassel aushält, aber immerhin sind die beiden schon knapp fünfunddreißig Jahre zusammen. Irgendwie muss es also funktionieren.«
Als wir das Auto parkten, hatte ich ein mulmiges Gefühl. Was, wenn er mich nicht mag? Wenn er mir den kleinen Finger nach alter italienischer Väter Sitte abschneidet und ihn in einem mit bitterem Mandelduft parfümierten Briefumschlag meinen Eltern schickt, um diese zum Wohle eines landsmannschaftlichen Vereins zu erpressen? Wenn ich dann also in einem niederrheinischen Reihenhauskeller verblutend auf Nachricht warte und oben meine dann ja wohl Exfreundin mit den Kumpanen ihres Vaters heiser lachen höre? Meine Sorgen scheinen etwas übertrieben und speisen sich aus einer sehr exakten Unkenntnis des italienischen Wesens.
Eigentlich habe ich es bisher nur mit drei Italienern wirklich zu tun gehabt, wenn man mal die Kellner in Pizzerien und Hotelangestellten in den Dolomiten beiseite lässt, zu denen ich im Laufe meines Lebens zwar Kontakt, aber kein irgendwie geartetes Verhältnis hatte. Doch ich kenne auch nur zwei Franzosen und drei Engländer sowie eine Spanierin, einen Sachsen und überhaupt keinen Dänen. Insofern ist drei schon wieder viel.
Der Name des ersten Italieners ist mir bis heute unbekannt. Er verkaufte Eis und schenkte mir im Siegestaumel nach dem Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 1982 eine Portion mit drei Kugeln. So viele Tore hatten die Italiener damals in Madrid gegen die Deutschen erzielt. Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit durch Rossi, Tardelli und Altobelli. Paul Breitner schoss auch noch eines für die schwachen Deutschen, dann waren die Italiener Weltmeister und knapp zehn Minuten später bimmelte der Eismann.
Ich war sein Stammkunde. Im Sommer wartete ich täglich auf das Klingeln seines Eiswagens, mit dem er langsam durch unsere Siedlung fuhr. Dann sprang ich auf mein Fahrrad und jagte der Glocke nach, bis ich ihn endlich einholte und zum Anhalten zwang. Ich bestellte Banane und Vanille, manchmal Heidelbeere, der blauen Zunge wegen, und er bediente mich in betont geschäftsmäßiger Manier, als sei ich ein Rothschild. Unsere Konversation beschränkte sich auf das Nötigste, und deshalb kann ich nicht mit Gewissheit sagen, ob er nicht am Ende gar kein Italiener war, sondern vielleicht Zypriote mit portugiesischem Pass oder Türke oder Kroate. Da er nun aber in einem mit einer italienischen Fahne bemalten Kleinbus unterwegs war, liegt die Vermutung zumindest nahe, dass er tatsächlich aus Cortina in den Dolomiten war, wo das italienische Eis herkommt.
Der zweite Italiener, mit dem ich mehr als eine flüchtige Erinnerung verbinde, war Masseur. Signor Pantoni hatte stark behaarte Arme und roch nach Zitronenöl. Ich wurde zu ihm überwiesen, weil ich im Nackenwirbelbereich irgendwie unlocker und kaum den Kopf zu wenden in der Lage war. Signor Pantoni nahm meinen Schädel in die Hand, sah mir in die Augen und sagte: »Mal sehn wie iste Blockierung.« Dann drehte er meinen Kopf so lange gegen den Uhrzeigersinn, bis es gar nicht mehr wehtat. Dabei brummte er Lieder, deren Melodie er immer genau dann betonte, wenn er mir besonders zusetzte.
Er bearbeitete meine Schulter und den Rücken mit seinen Riesenhänden, und einmal sagte ich im Spaß: »Sie sollten Pizzateig kneten.«
Signor Pantoni grunzte unverständlich und klatschte dann in die Hände. »So, fertig, nächste Woche komme Sie wieder und mache wir Übungen für die Kopfe.«
Daraus wurde dann aber nichts, denn Pantoni schloss über Nacht seine Praxis und verschwand spurlos. Der Arzt, der mich zu ihm überwiesen hatte, erzählte mir, dass Pantoni gar kein Masseur gewesen sei, dass er eigentlich gar keine Erlaubnis zum Massieren und erst recht nicht für krankengymnastische Therapien hatte, sondern sein Geld abends mit dem Kneten von Pizzateig in einer Düsseldorfer Pizzeria verdiente. Wenig später stand der Fall in der Zeitung und es wurden Geschädigte gesucht. Ich fühlte mich aber keineswegs von ihm geschädigt, höchstens durch den Umstand, dass er einfach abgehauen war. Also meldete ich mich nicht.
Der dritte Italiener, mit dem ich es zu tun bekam, war genau genommen eine Halbitalienerin. Ich lernte sie eines Tages beim Bäcker kennen, als ich nicht genug Geld für Brötchen dabeihatte und sie mir mit zwei Mark aushalf. Ich kann nur jeden ermuntern, nicht genug Geld dabeizuhaben, für den Fall, dass man die Frau seines Lebens kennen lernen möchte. Allerdings muss man darauf achten, dass man nicht vor halb neun morgens in der Bäckerei kein Geld hat, denn da trifft man nur Handwerker oder überspannte Senioren und das ist ja nicht unbedingt Sinn der Sache. Diese Italienerin, die mir mit zwei Mark aushalf, war Sara, und wenn ich vor dem Einkaufen zum Geldautomaten gegangen wäre, könnte ich jetzt nicht vor der Tür ihres Vaters stehen. Jedenfalls hörte ich mich seinerzeit den schwachsinnigen, aber betriebsimmanenten Satz sagen: »Sie können natürlich anstelle des Geldes auch die Brötchen zurückhaben. Vielleicht bei einem kleinen Frühstück, wenn Sie wollen.«
Die meisten Frauen, die ich bisher getroffen hatte, hätten darauf geantwortet: »Och nö, betrachten Sie doch die zwei Mark als Geschenk.« Sara dagegen nicht. Sie sagte: »Na super. Keine Kohle, aber einen auf dicke Hose machen. Das muss jetzt aber ein sensationelles Frühstück werden.« Kaum zwei Jahre später stehen wir also vor dem Reihenendhaus ihrer Eltern. Der Klassiker mit roten Backsteinen. Neben der Haustür rechts das kleine Klofenster. Links das große von der Küche.
Die Architektur eines Reihenhauses beruht auf der Stapelung einer Fünfzimmerwohnung. Während man jedoch vor einer Fünfzimmerwohnung stehend nie genau weiß, wie sie geschnitten sein wird, ist dies bei Reihenhäusern absolut sicher. Das Haus der Marcipanes unterscheidet sich in nichts von jenen etwa acht Millionen Reihenhäusern, die es sonst noch überall in Deutschland gibt. Gewöhnlich kommt bei diesem Menschenverwahrtypus hinter dem Eingang erst einmal die so genannte Schmutzschleuse. Dort kann man sich die Schuhe ausziehen, rechts geht’s ins Klo. Die Kloschüssel ist unter dem Fenster angebracht. Links vom Hauseingang die Küche, die immer eine zweite Tür zum Wohnzimmer hat. Im Flur geht rechts eine geschwungene Treppe nach oben und nach unten. Den Grad der Bürgerlichkeit der Bewohner vermag der geübte Reihenhausbesucher an Geländern und Stufen abzulesen. Sind diese zum Beispiel von matter schmiedeeiserner Eleganz, so hat man es fast immer mit Volksmusikfreunden zu tun, während die ungehemmte Verwendung von astlochreichen Holzsorten unschwer auf Pädagogen schließen lässt. Auf der linken Seite des Flures immer: Telefontischchen und Garderobe. Geradeaus führt der Weg ins Wohnzimmer dessen Türen immer Fenster haben, weil sonst zu wenig Licht in den Flur fällt. Meistens sind diese Fenster aus geriffeltem Glas oder haben eine rustikale Butzenscheibenoptik, die zu den Schwanenhalsgriffen an den Türen passt.
»Hallo, klingeln«, sagt Sara und schubst mich erneut. Unter der Klingel ist ein braunes Schild angebracht, auf dem aus Salzteigwürsten geformt »Marcipane« steht. Die Buchstaben werden im Laufe des Wortes immer enger und kleiner, so dass der Name nur mit einiger Fantasie zu entziffern ist. Es sieht so aus, als klingele man bei Familie Marciq3?g.
»Hier sind wir falsch, hier wohnen die Marciq3?gs«, sage ich.
»Das Ding habe ich in der Schule gemacht«, erwidert Sara und drückt auf die Klingel. Ding Dong.
Fast in derselben Sekunde geht die Tür auf und Frau Marcipane steht vor mir. Sie sieht tatsächlich aus wie ihre Tochter, was mir auf Anhieb gefällt. Offenbar hat sie bereits seit einiger Zeit hinter der Tür gestanden, wollte aber nicht öffnen, damit wir nicht den Eindruck bekommen, sie könne es nicht erwarten, uns zu sehen. Ich halte die Blumen wie einen Schild vor meinen Bauch und sage: »Guten Tag, da sind wir also.«
Darauf sie: »Hallo, mein Engel.« Sie läuft einfach durch mich hindurch. Sie drückt ihre Tochter, anschließend sehen mich beide an und sie fragt: »Isser das?«
»Das isser.«
»Na, dann kommt mal rein.«
Auf die ganze Vorstellerei mit Hände schütteln und sich freuen, sich kennen zu lernen, scheint Mutter Marcipane keinen großen Wert zu legen. Ich betrete das Haus und es ist tatsächlich genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das einzig Verstörende an diesem Flur ist, dass er sich nicht einordnen lässt, weil eigentlich kein Stil überwiegt. Über dem Telefon hängt ein gerahmter Druck, der einen Sonnenuntergang und einen Hafen zeigt, darunter steht: »Napoli«. Direkt daneben prangt ein Holzteller, in welchen ein Dichter mit einem Lötkolben einen Satz gebrannt hat. Er lautet: Im Himmel gibt’s kein Bier, drum trinken wir es hier.
»Geh durch, geh durch«, befiehlt Saras Mutter von hinten, und so laufe ich durch den Flur Richtung Wohnzimmer, aus dem gleißendes Licht fällt, als sei dort ein Tunnel zu Ende.
Ich öffne die Wohnzimmertür und trete in einen hellen Raum mit einer großen Scheibe, neben welcher es in den Garten geht. Rechterhand die unvermeidliche Schrankwand, auf der linken Seite des Raumes die Sitzgruppe. Kennt man alles, so weit bin ich vorbereitet.
Auf einem Sofa vor dem großen Fenster sitzt ein Männlein und schaut auf, als ich hereinkomme. Ich sehe ins Licht und so kann ich es nur in Umrissen erkennen: Das Männchen hat einen kleinen Kopf, den es gesenkt hält. Gleichzeitig scheint es mich zu mustern, ähnlich wie ein Stier, kurz bevor er einen Torero tottrampelt.
Ich halte ihm meine Blumen entgegen.
»Guten Tag«, sage ich mit fester Stimme.
»–«
»Wir sind da«, ergänze ich, denn ich habe den Eindruck, er halte mich für jemand anderen, jedenfalls nicht für den Verlobten seiner Tochter. Wo ist die eigentlich? Ich finde, es ist nun an der Zeit, dass Sara die Konversation übernimmt. Ich drehe mich nach ihr um, aber da ist niemand. Offensichtlich sind Sara und ihre Mutter hinter mir in die Küche abgebogen und haben sich dort irgendwie festgequatscht. Jedenfalls stehe ich mit meinen Blumen alleine vor Don Marcipane. Und der macht keinerlei Anstalten aufzustehen oder wenigstens irgendetwas zu sagen. Knack. Er öffnet Pistazien mit den Fingernägeln und sieht mich an, soweit ich das im Gegenlicht beurteilen kann. Der Strauß ist nass und das Wasser rinnt mir den Arm hinunter. Knick.
»Hallo, ja, Sie müssen Saras Vater sein.« Knick, knack. Und dann der Horrorsatz: »Ich habe ja schon eine Menge von Ihnen gehört.«
Knack.
»So, habbe Sie. Wasse denn?«
»Ach, na ja, dass Sie nett sind.«
»Binne sogar sehr nett.« Knack.
Ich kann nicht sehen, ob er lächelt. Verdammt, wo bleibt Sara?
»Ja, jedenfalls wollten wir Sie mal besuchen.«
»Warum?«
Er will mich quälen. Das scheint also seine Art von Humor zu sein. Ich drehe den Kopf und sehe hilflos nach hinten. In der Küche höre ich die Frauen lachen. Sara! Aus dem Garten kommt ein Tier durch die geöffnete Terrassentür gelaufen und springt auf den Schoß des Mannes, der sich nun aufrichtet und die Katze streichelt.
»Liebe kleine Gauner. Wo haste du denn gesteckte?«
Immerhin erwartet er keine Antwort von mir auf seine blöde Warum-Frage. Ich überlege: Soll ich in die Küche gehen? Stehen bleiben? Weiterreden?
»War ganz schön voll auf der Autobahn. Aber wir haben trotzdem nur fünf Stunden gebraucht. Das ist ein guter Schnitt für freitags«, plappere ich los.
»Willste du eine Nuuuß?« Er meint die Katze. Knack.
Langsam wird mir die Sache zu doof. Warum soll ich wie ein Idiot hier herumstehen, während dieser Kerl seine Katze mit Pistazien füttert? Warum hilft mir denn keiner? Was mache ich hier eigentlich? Und: Ob es was zu essen gibt? Ich habe nämlich Hunger. Ich zähle bis zehn und raschle ostentativ mit dem Blumenpapier, auch um mein Magenknurren zu übertönen. Wenn sich bis zehn nichts tut, dann – ja, was dann? Bei acht kommt Sara mit ihrer Mutter herein.
»Was stehst du denn hier herum?«
»Wir unterhalten uns«, sage ich.
»Hallo, Papa!«, ruft sie und stürzt sich auf den Mann mit der Katze. Sie umarmen sich und er redet auf Neapolitanisch auf sie ein.
»Unde dasse hier iste deine Freund«, stellt er abschließend fest und nickt in meine Richtung.
»Ja, das isser.«
»Hatte er die ganze Zeit dagestanden. Setzte sich nichte hin, nimmt keine Nusse, iste er eine bescheidene Charakter.«
Er steht auf und kommt auf mich zu. Herr Marcipane ist fast einen Kopf kleiner als ich. Obwohl er ein bisschen dick ist, kommt er mir flink vor, wie er auf seinen kurzen Beinchen auf mich zusteuert.
»Marcipane«, sagt er ernst und nickt dabei mit dem Kopf. Dann gibt er mir die Hand. Ich muss den Strauß in die linke Hand nehmen und ihm meine nasse Rechte geben, was er vollkommen ignoriert. Er hat einen festen Händedruck, den ich erwidere. Dennoch gewinnt er dieses Kräftemessen, weil seine Hände viel größer sind als meine. Es fühlt sich an, als umschlösse er meine Finger, wie ein Hotdog-Brötchen.
»Ich habe Blumen mitgebracht«, sage ich linkisch und halte ihm den Strauß vor die Nase.
»Fur mich?«, fragt er, und es klingt etwas enttäuscht.
»Die sind für Sie beide, sozusagen zum Kennenlernen.«
Endlich nimmt Frau Marcipane mir die blöden Blumen ab.
»Die sind ja ganz warm«, sagt sie unpassenderweise und verschwindet mit dem Gestrüpp in der Küche.
»Setz dich«, sagt Sara, »bei uns kann man sich einfach setzen, wenn man will. Meine Eltern machen sich nicht viel aus Konventionen.«
Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich frage mich, was wohl als Nächstes passiert. Oder nicht passiert. Normalerweise gibt es Kaffee in solchen Situationen. Und Kuchen.
»Was machte meine schöne Kind hier bei seine alte Eltern?«, will Herr Marcipane nun wissen.
»Das sage ich dir gleich, wenn Mama wieder da ist. Es ist etwas ganz Besonderes.«
»Ah so, ganze besonders. – Uuuursuulaaaa, komme mal wieder zuruck. – Wie gefällte dir die neue Sofa? Habe ich mit deine Mama selber ausgesuchte. Schicke, nichte?«
»Na ja«, sagt sie. Kinder dürfen das sagen. Verlobte nicht.
»Also mir gefällt’s«, entschleimt es sich mir.
»Siehste du, Kind, ihm gefällte. De Junge hatte Geschmacke.«
Während Sara mir den tödlichen Blick zuwirft, kommt Uuuursuulaaaa mit den Blumen zurück und stellt sie auf den Couchtisch.
»Ihr habt doch bestimmt Hunger nach der weiten Reise.«
Na endlich. Klar habe ich Hunger, ich sterbe vor Hunger. Reflexartig sage ich: »Nein, nein, alles halb so wild.«
»Komisch, im Auto hast du noch gesagt, du hoffst, dass es hier irgendwas zu essen gibt«, sagt Sara.
Ihre Rache für die Sitzmöbel. Nun stehe ich endgültig wie ein Volltrottel da. Ist jedoch auch irgendwie egal. Wenigstens habe ich die Blumen nicht mehr in der Hand. Ich wische mir die Hand an der Hose ab und starre auf die Pralinen, die vor uns auf dem Tischchen in einem geblümten Steingutschälchen stehen.
»Aber jetzt habe ich keinen Hunger mehr«, antworte ich zickig.
»Nu lasse der Junge. Meine Tochter iste immer so wild mit die Jungen. Mussen Sie verstehen, iste sie eine echte Marcipane.«
So langsam müssen wir mal zur Sache kommen. Ich will es hinter mich bringen, denn normalerweise wird nach der Bekanntgabe einer Verlobung irgendwas aufgemacht. Oder sogar gegessen. Wenn mich später einmal jemand fragt, warum wir geheiratet haben, werde ich immer antworten: »Weil ich so einen großen Hunger hatte.«
»Du, Papa, wir sind ja nicht ohne Grund gekommen.«
»Nein? Brauchste du Geld?«
Diese Frage ist auf keinen Fall zynisch, sondern typisch, wie ich später lerne. In den meisten deutschen Familien würde so eine Frage sehr übel genommen, nicht aber in den meisten italienischen, wo die Eltern oft sehr lange für ihre Kinder sorgen. Die brauchen tatsächlich immer Geld, bringen jedoch deswegen noch lange keine Blumen mit.
»Nein, wir wollen euch etwas sagen.«
Ich fühle mich nun verpflichtet, das Wort zu ergreifen, schließlich kann Sara schlecht um ihre eigene Hand anhalten. Also unterbreche ich sie.
»Ja, lieber Herr Marcipane. Ich möchte gerne Ihre Tochter heiraten. Also, wir möchten heiraten und deshalb sind wir hier. Ich will – ganz förmlich – um die Hand Ihrer Tochter bitten.«
Schweigen.
Er schaut mich nicht an, sondern starrt in Saras Richtung.
Jetzt ist er dran, finde ich. Inzwischen hat sich eine Wolke vor die Sonne geschoben und ich kann meinen zukünftigen Schwiegervater endlich richtig erkennen. Er hat einen kleinen, eckigen Kopf mit dunkelblonden Haaren, in dessen Mitte eine knubbelige Nase sitzt. Seine hellblauen Augen leuchten wie zwei kleine Taschenlampen und irrlichtern zwischen uns umher. Er hat extrem viele Zähne, mir scheint es fast, als habe er sogar doppelt so viele Zähne wie normale Menschen. Einige von ihnen glänzen golden. Er trägt ein kariertes Flanellhemd und darunter ein Unterhemd, dem ein Dschungel aus grauem Brusthaar entweicht.
Ganz schwer zu sagen, was jetzt kommt. Ich denke: Entweder er bereitet gerade in Gedanken die Amputation meines Fingers vor oder er wird gleich anfangen zu weinen. Er schluckt und macht ein helles Geräusch, eine Art Piepsen. Seine Stimme klingt jetzt heiser.
»Du willste heiraten?«
»Ja, Papa.«
»Den da?«
»Ja, den da. Und keinen anderen.«
Seine Stimme dreht nun ins Jammerige. Er schaltet eine Art Vibrato ein und gestikuliert wie bei einem Sturmgebet.
»Aber du biste noch so junge. Viel zu junge.«
»Ach komm, ich bin sechsundzwanzig.«
»Heißte das etwa, du kommste nie wieder ssu uns nach Haus?«
»Papa, ich wohne seit fünf Jahren nicht mehr hier. Jetzt mach bitte nicht so ein Theater.«
»Ursula, das Kinde will uns verlasse.«
»Ich finde, wenn die beiden wollen, dann sollen sie ruhig heiraten. Ist doch ein netter Kerl.«
Tatsächlich frage ich mich, woher sie das wissen will, sie hat sich ja praktisch noch nie mit mir unterhalten. Allerdings wirkt sie so wenig überrascht, dass mir klar wird, dass sie Bescheid weiß. Sara hat es ihr längst gesagt.
Herr Marcipane wendet sich mir zu. »Schwörren Sie, dasse Sie immer lieb sind zu meine Schnucke?«
Ich weiß, dass Sara es hasst, wenn ihre Eltern sie Schnucke nennen.
»Natürlich.«
»Schwörren!«
»Ich schwöre«, sage ich und hebe indianermäßig die Hand. Den letzten Schwur in dieser Form habe ich vor knapp zwanzig Jahren auf einem Kinderspielplatz abgelegt und anschließend einen Regenwurm gegessen. Würde ich jetzt übrigens auch tun. Herr Marcipane meint das mit der Schwörerei ganz ernst. Plötzlich geht alles blitzschnell.
»Gut, dann könne Sie sie habbe. So. Nun: Ich heiße Antonio und ab heute biste du meine liebe Sohn.«
Darauf springt er aus seinem Sessel und eilt wieder auf mich zu. Ich stehe auf, und Antonio Marcipane, der Mann, der mich vor nicht ganz zehn Minuten behandelt hat, als käme ich von der Gebühreneinzugszentrale, umschlingt mich mit seinem ganzen Körper, seine Hände drücken meinen Rücken, er klopft und juchzt dabei. Ich bin erleichtert. »Meine Sohn, ich habe eine Sohn! Wirste du sehen, du haste eine neue Vater. Dasse muss gefeierte werde. Ursula, habbe wir Spumante?«
»Wir haben nie Sekt. Wir haben Kaffee, Mineralwasser, Bier und Milch«, leiert sie. »Und ich kann Orangen pressen.«
»Aber wir habbe der tolle Wein«, raunt Antonio im Verschwörerton.
»Toni, der Wein ist tabu.«
Der verbotene Wein gehört Schwiegersohn Nummer eins. Saras ältere Schwester Lorella hat nämlich bereits geheiratet, einen Ingenieur, der nie da ist. Sie leben gerade in Asien und daher hat Jürgen seinen Weinkeller bei Antonio zur Aufbewahrung gegeben. Ausdrücklich zur Aufbewahrung. Nicht zum Trinken.
»Was heißte hier tabu? De Jürgen hatter gesagt, das iste vino für besondere Tage, und trinkt er nicht ofte eine Flasche. Heute iste eine besondere Tag. Es wurde mir eine neue Sohn geboren.«
»Ein neuer Sohn geboren«, äfft Ursula. »Aber nicht einen von den ganz teuren.«
Antonio verschwindet in den Keller, wo man ihn mit allerhand Flaschen herumhantieren hört. Dabei singt er.
»Siehst du. Es ist gut gelaufen, habe ich doch gesagt. Mein Vater ist wirklich lieb«, flüstert mir Sara zu. Und Ursula gibt mir einen Kuss, sie weint sogar ein bisschen und sagt leise: »Herzlich willkommen.« Es klingt eher bedauernd als erfreut, als begrüße sie mich als Mithäftling in einer feuchten Gefängniszelle im Polizeipräsidium der Hauptstadt eines Andenstaates. Ich drücke sie und freue mich, anschließend umarmt mich meine zukünftige Frau. Sie sagt nichts, aber ich spüre ihre Erleichterung. Immerhin hat es Männer in ihrem Leben gegeben, die dieses Haus nur einmal betreten haben. Und das lag ganz gewiss nicht an Sara.
Dann kommt der Wein. Er ist tatsächlich sehr gut, was Antonio darauf zurückführt, dass er höchstpersönlich diesen vino im Keller ausgesucht hat.
»Warum willste du meine Tochter?«, fragt er nach dem zweiten Glas und sieht mich aus seinen Funkelaugen an.
»Welche denn sonst?«, antworte ich. Etwas Besseres fällt mir nicht ein, denn ich bin immer noch benommen vom plötzlichen Stimmungsumschwung meines Schwiegervaters. Außerdem steigt mir Jürgens Barolo zu Kopf. Kein Wunder: Barolo auf nüchternen Magen um halb drei.
»Weißte du, Sara iste eine bisschen delikat, eine eikle Person, möchte ich faste sagen und betonen, iste sie nett, aber diffizil in Umgang.«
Worauf will er hinaus?
»Ihre Schwester iste anders, feiner, bisschen netter auch. Warum willste du nicht Lorella heiraten?«
»Papa!«, ruft Sara empört.
»Ja, iste nichte wahr, Mama?«
Mama lacht und schaut mich an. Was sagt man denn darauf?
»Ja, Lorella ist leider schon vergeben, da habe ich mich eben notgedrungen für Sara entschieden.«
Daraufhin bricht Antonio in ein dampflokartiges Gelächter aus, er kann sich gar nicht mehr beruhigen.
»Das iste guuut. Biste du witzig. Du haste eine Satire gemachte. Großartig. Mama, haste du gehört?«
Er prostet mir mit Jürgens Wein zu und wir trinken. Eine Minute später bin ich besoffen.
Der Rest des Tages steht voll im Zeichen der Familieneinführung. Die Verwandten in Italien müssen reihum angerufen werden. Alle sollen die freudige Nachricht erfahren. Anschließend sehen wir Fotoalben an. Antonio als Kind, Sara als Kind, Urlaub am Strand, Taufe, Hochzeiten, neue Autos.
Dann gehen wir essen, denn nicht nur die Italiener in der Heimat, sondern auch alle Bekannten im Ort sollen erfahren, wie glücklich Antonio ist. Wie stolz. Mein Trunkenheitsgrad führt dazu, dass ich willenlos alle Vorstellungsrunden über mich ergehen lasse, außerdem mehrere Runden Grappa und Bitterliköre.
Als wir ins elterliche Haus zurückkehren, will ich nur noch ins Bett. Vorher jedoch kredenzt Antonio einen ausgezeichneten Vin Santo aus Jürgens Sammlung. Der Hausherr hat ihn selbst ausgesucht.
Wir liegen schließlich in Saras Kinderzimmer, einem kleinen holzvertäfelten Raum unterm Dach. Das Bett ist so schmal, wie ich breit bin, aber was soll’s. Ich bin so glücklich, wie man im Rausch nur sein kann. Heute bin ich sechshundert Kilometer mit dem Auto gefahren, habe große Mengen Alkohol getrunken, um die Hand einer Halbitalienerin angehalten, alles über Oliven und Pecorino-Käse erfahren und Antonio kennen gelernt. Und: Ich habe noch alle Finger an der Hand.
»Und? Wie findest du sie?«, will Sara von mir wissen.
»Nett. Ist dein Vater immer so?«
»Habe ich dir doch erzählt. Jedenfalls liebt er dich, das ist die Hauptsache.«
»Woran merkst du das denn?«
»Er ist wirklich glücklich.«
In diesem Moment geht die Tür auf. Toni im Schlafanzug.
»I wollte nur buona notte sagene.« Er hebt den Daumen und zwinkert mir zu. »I bin so gluckliche, dasse i eine neue Sohn habe.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, schließt er die Tür.
»Siehst du, er meint es ernst.«
»Das ist schön. Geht er jetzt ins Bett?«
»Schwer zu sagen. Manchmal bleibt er die ganze Nacht auf und läuft im Haus herum.«
»Warum das denn?«
»Er ist so aufgeregt und dann kann er nicht schlafen. Bist du müde?«
Ach, bin müde, so müde, mein Kopf sinkt auf ihre Brust und die Augen schließen sich ganz sanft und schwer. Sara krault mir den Hinterkopf. Das ist schön.
Tür auf. Toni.
»Habte ihr die Eizung anne?«
»Ach Papa!«
»I wollte nur mal kontrolliere, ob alles gut iste fur die Nacktruhe. Musse man achten für die Schlafe.«
Er geht zur Heizung und nestelt an dem Drehknauf herum. Er öffnet das Fenster, denn »combinazione von warme Temperatur und frische Lufte ist Beste von Beste für gesunde Schlaf«. Grazie. Prego.
Danach schlafe ich einen traumlosen Schlaf. Ich kann nicht mit Gewissheit sagen, ob und wenn ja, wie oft Antonio noch hereingekommen ist. Sara behauptet, nur vier Mal.
Am nächsten Morgen passt mein Kopf nicht durch die Tür. Ich bewege mich seitwärts ins Bad und bewundere mich für meinen Atem, der nach Froschtümpel riecht.
Das Badezimmer von Herrn und Frau Marcipane sieht aus wie das Wohnmobil von Siegfried und Roy. Lachsfarbene Kacheln und goldene Armaturen, wohin man blickt. Neben dem Spiegel mit dem goldenen Rahmen hängen auf jeder Seite zwei brokatige und ansonsten funktionslose Bommel. Die Waschbecken – es gibt zwei davon – haben die Form von Muscheln. Es riecht nach Agua Brava.
Ich versuche, mich in Form zu bringen, was mir passabel gelingt. Heute ist noch eine Hürde zu nehmen. Wir müssen nämlich auch zu meinen Eltern. Die wissen zwar bereits von unseren Hochzeitsplänen, weil wir ihnen davon erzählt haben, als sie uns in der Woche zuvor besuchten, aber natürlich müssen sich die Eltern vor der Hochzeit kennen lernen. Ein zwangloses Mittagessen soll es geben. Mein Elternhaus ist für zwanglose Mittagessen zwar nicht weltberühmt, doch meine Mutter ist eine großartige Köchin und der Weinkeller meines Vaters enthält Flaschen, die mit Jürgens Schätzen durchaus mithalten können.
Bei diesem Gedanken wird mir kurzfristig enorm übel und ich öffne den mit einem cremefarbenen Flokati bezogenen Deckel des Klos. Der Geruch von pinkfarbenen Klosteinen desinfiziert mich aber in Sekundenschnelle – alles klar, ich werde mir nicht die Blöße geben und bereits am ersten Tag meiner Zugehörigkeit in dieser Familie das Klo meiner Schwiegereltern voll kotzen.
Antonio ist bester Dinge. Er läuft in Hausschuhen herum und dekoriert den Frühstückstisch mit allerhand Tand, den er aus einer Schublade der Schrankwand holt. Auf meinem Platz liegen zwei Zeitungen, die er eigenhändig heute Morgen für mich gekauft hat, wie er mir zur Begrüßung mitteilt. In seiner Vorstellung von mir gehören eine gewisse Verzierung des Frühstückstisches und das Lesen von mindestens zwei Zeitungen nach dem Aufstehen einfach zum Leben dazu.
Das Frühstück ist übrigens ziemlich unitalienisch, will sagen reichhaltig. Schließlich wohnt Antonio bereits seit über dreißig Jahren in Deutschland und weiß ein Käsebrötchen am Morgen durchaus zu schätzen. Außerdem ist er mit einer Deutschen verheiratet. Es gibt nicht viele Bereiche im Leben der beiden, in der sie eindeutig die Regeln festlegt. Zumindest beim Frühstück scheint das absolut der Fall. Es gibt allerdings Espresso, da hat er sich durchgesetzt. Diese Verschränkung von Lebensgewohnheiten ist wie das Bild von Neapel und der Holzteller im Flur, nämlich der Versuch, Mentalitätsunterschiede durch gemeinschaftlich begangene Verbrechen am guten Geschmack zu überwinden. Ich glaube, so ist Europa.
»Möchtet ihr ein bisschen spazieren gehen?«, fragt Sara. »Die frische Luft wird dir gut tun.«
»Oh, wir gehen spazieren!«, ruft Antonio erfreut. »Ich zeige dir Schönheite hiere inne Ort und die Attraktionen von diese schöne Umgebung.«
Also gehen wir spazieren, das heißt, wir stehen mehr spazieren, als dass wir gehen. Antonio muss immer mal wieder innehalten und etwas erzählen. Dafür bleibt er stets stehen, weil er mir dann besser in die Augen sehen kann. Wir unterhalten uns wie richtige Männer. Eigentlich unterhält sich Antonio. Ich werde unterhalten. Das macht mir aber nichts aus, ich kann auch mal schweigen, besonders heute.
Die Hauptattraktionen der Nachbarschaft sind: der Garagenhof, die Garage, der dort geparkte Mercedes, Kinderspielplatz, Bäcker, Getränkemarkt und Lottoannahmestelle.
Dorthin zieht es Antonio mit aller Macht, denn Lotto ist für ihn das Größte. Er spielt immer dieselben Zahlen, nämlich seinen sowie die Geburtstage seiner Kinder. Das führt zwangsläufig dazu, dass kein Zahlenwert höher ist als 11, denn seine Töchter haben nun einmal am 6. 7. und am 10. 1. Geburtstag, er selbst am 2. 11., so dass er immer wieder aufs Neue 1, 2, 6, 7, 10, 11 tippt.
»Wann haste du Geburtstag?«, fragt er mich.
»Am 28. Oktober«, antworte ich, und er kreuzt anstelle der 11 die 28 an.
»Wenne ich ein Million gewinne, bekommst du die Hälfte«, versichert er mir, und es besteht überhaupt kein Zweifel, dass er das auch so meint. Es gilt das gesprochene Wort.
»Binne i keine Geizhalse, liebe Jung. Wenni habe, gebe auch und machte mir nix aus.«
Ich warte auf die üblichen Schwiegersohn-Gespräche, irgendwie habe ich mich sogar darauf gefreut. Es ist doch schön, wenn man ermahnt wird und die Fragen beantworten muss, die ein besorgter Vater sich stellt. Ob man die Tochter denn auch ernähren könne. Und ob man Kinder wolle, schließlich seien Kinder das Salz der Erde. Und was denn der eigene Vater beruflich mache. Und ob man Abitur habe. Und wie das alles weitergehe. Aber ich warte vergebens. Antonio, stelle ich fest, hat sich für mich entschieden, nicht ich mich für seine Tochter. Ich könnte auch Bratschist in einem usbekischen Kammerorchester sein oder Schiffschaukelbremser auf der Kirmes oder Außenminister von Österreich.
Als habe er meine Gedanken erahnt, bleibt er plötzlich stehen und sagt ernst: »Auptsach, du bist keine carabiniere.«
»Keine was?«
»Keine carabiniere. Dorfpoliziste. Aber du bist keine dumme Salat.«
Später frage ich Sara, was ein dummer Salat ist. Es handelt sich hierbei um einen Ausdruck, den Antonio höchstpersönlich erfunden hat und den er mit Stolz immer wieder anbringt. Ein dummer Salat ist ein Kopfsalat, den man frisch aus der Erde geholt hat. Solch ein Salat ohne Essig und Öl ist in Antonios Augen langweilig, weil er nach nichts schmeckt, also fad und somit dumm. »Dumme Salat« ist der wahrscheinlich stärkste Kraftausdruck in Antonios Sprachschatz. Manchmal sagt er auch »baccalà«, das heißt Stockfisch und bedeutet ungefähr dasselbe wie »dumme Salat«. Dass ich keiner bin, solle mich stolz machen, sagt Sara. Sie sei jahrelang einer gewesen.
Dann fahren wir zu meinen Eltern. Ein großer Moment, für den sich Antonio, die Würde des Augenblicks erkennend, ordentlich in Schale geworfen hat. Italiener wissen sich von Natur aus gut anzuziehen, besonders die Männer. Selbst eine geflickte schmutzige Windjacke können sie tragen wie einen Smoking. Sie bewegen sich in ihren Kleidern wie Stars auf einem roten Teppich. Toni trägt eine Kombination aus einer braunen Cordhose und einem weißen Hemd mit einem grünen Jackett. Er ist frisch rasiert und lächelt sein Goldzahnlächeln. Er riecht wie Al Pacino, Marlon Brando und Lino Ventura. Und zwar gleichzeitig.
»Wie seh i aus, seh i gut aus?«
Frau Marcipane, die ein hübsches Sommerkleid und kaum Make-up trägt, ist ein wenig nervös, schließlich kennt sie ihren Toni schon eine geraume Zeit. Er ist ein unberechenbares Risiko im Umgang mit Fremden. Seine Auftritte sind entweder Sternstunden der Unterhaltung oder sie führen zur völligen Verstörtheit des Publikums. Das hängt von ebendiesem Publikum ab, niemals von Toni. Der ist immer nur ganz er selbst.