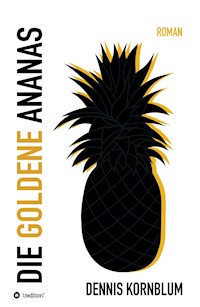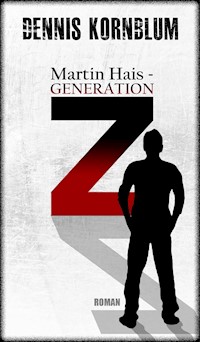
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Brutale Morde an Teenagern machen den Stadtbezirk Quarrenberg unsicher. Ein durch eine Horrormaske verhüllter Todesschütze hinterlässt Zettel am Tatort, die mal mit einem antiken Zitat, mal mit einem merkwürdigen Aphorismus beschrieben sind. Die Polizei glaubt, dass es um Drogen geht, doch der autistische Fachlektor und Psychologe Martin Hais hat eine andere Vermutung. Er entdeckt einen alten Manuskriptauszug in seinem Schrankfach, bei dem er aufgrund darin enthaltener Textstellen einen Zusammenhang zu den Tatortbotschaften sieht. Während der ermittelnde Kommissar Wójcik daran wenig interessiert ist, wird die aufgeweckte, extrovertierte Kioskbesitzerin Ina Ruíz, eine Zeugin des letzten Mordanschlags, die dem Killer bereits gegenübergestanden hat, auf Martins Theorie aufmerksam. Schließlich überredet sie ihn, mit ihr zusammen auf eigene Faust zu ermitteln, und Martin nimmt eher widerwillig eine große Herausforderung an: die Überwindung tiefsitzender Ängste, die sich nicht nur auf die Gefahr erstrecken, die von der Jagd auf einen Serienkiller ausgeht, sondern auch auf die enge Zusammenarbeit mit einer attraktiven weiblichen Person.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dennis Kornblum, geboren am 03. November 1980 in Frechen, studierte ein paar Semester Psychologie, bevor er 2005 aufgrund depressiver Verstimmung in die Uni-Klinik in Bonn kam, kurz darauf in ein Übergangswohnheim für psychisch Kranke. Mit der Diagnose Asperger-Syndrom im Jahr 2007 wurden in ihm selber und in seiner Familie die Weichen für ein besseres Verständnis seiner Probleme im Alltag gestellt. Dennoch kam er im selben Jahr in ein Langzeitwohnheim, in dem er fast neun Jahre blieb. Im März 2016 zog er in eine eigene Wohnung in Bonn-Bad Godesberg.
Nachdem er sich bis zu seinem 22. Lebensjahr intensiv mit Literatur und dem eigenen Schreiben beschäftigt hatte, folgte eine lange Zeit, die von gänzlich anderen Spezialinteressen dominiert war. Im Frühjahr 2019 besann er sich schließlich wieder auf seine schriftstellerischen Wurzeln zurück und begann mit der Arbeit an dem Roman Die goldene Ananas, der am 9.12.2020 bei Tredition erschien und in dem er seine Schwierigkeiten im sozialen Kontakt und seiner praktischen Lebensführung literarisch verarbeitete.
Martin Hais – Generation Z ist sein zweiter Roman. Auch hier übernimmt wieder ein Asperger-Autist die Rolle des Protagonisten, und es werden einige Einblicke in eine autistische Lebens- und Denkweise gegeben, diesmal eingebettet in eine Kriminal- bzw. Thriller-Handlung.
Dennis Kornblum
Martin Hais - Generation Z
Roman
© 2021 Dennis Kornblum
Umschlag, Illustration: mbarth-design
Lektorat, Korrektorat: Mentorium
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-35889-8
Hardcover:
978-3-347-35890-4
e-Book:
978-3-347-35891-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Und noch mal für Aysen Bayar, ohne die ich dieses Buch nicht geschrieben hätte.
Prolog
Sein Handy zeigte 0 Uhr 32 an. In dunkelgraue Jeans, ein beiges T-Shirt und eine braune Lederjacke gekleidet, an den Füßen Sneakers und auf dem Rücken einen schwarzen Herrenrucksack tragend, schritt er zielstrebig auf den kleinen Altbau zu. Das eher unscheinbare Gebäude, das neben einem türkischen Imbiss auf der Ecke lag, sah von außen mehr nach einer kleineren Shisha-Bar als nach einer Disco aus; der Anblick ließ nichts von dem gewaltigen Kellersaal erahnen, der sich darin verbarg. Auf einer über dem Eingang angebrachten Trägerplatte leuchtete in großer dunkelvioletter Neonschrift der Club-Name Generation Z; früher hatte hier einmal Tanzkeller gestanden. Hinsichtlich des geistigen und moralischen Niveaus gab es bereits hier draußen einen Vorgeschmack auf das, was man im Inneren antraf: Eine Gruppe mal undeutlich lallender, mal provokativ grölender junger Männer stand vor dem Club, ein paar Meter weiter drei albern kichernde Teenagerinnen. Alle rauchten Zigaretten.
Zwei Türsteher, die, das war auch durch die dicken Parker hindurch erkennbar, von nicht unbeträchtlicher Körpermasse waren, bewachten den Eingang. Als sie den Neuankömmling sichteten, warfen sie ihm einen gelangweilten Blick zu. Diese beiden trägen Wächter muteten ein wenig wie friedlich dösende Löwen an – theoretisch ein großes Gefahrenpotenzial, momentan jedoch harmlos. Denn der Anblick der braunen Lederjacke, des schwarzen Herrenrucksacks sowie des vertrauten Gesichts hatte eine sättigende Wirkung auf sie. Resigniert nickten sie ihm zu, er nickte auf die gleiche Weise zurück, und sie ließen ihn passieren.
Er gab seine Jacke an der Garderobe ab, zahlte an der Kasse vier Euro fünfzig, ließ sich einen Stempel auf die Hand geben und ging die breiten Treppenstufen hinunter.
Schon war er eingetaucht in diese Hölle, wurde von ihr verschluckt. Statt Flammen loderten hier Lichteffekte, überall stieg Nebel auf, strahlten Scheinwerfer; es war, als würde direkt vor seinen Augen eine riesige Wunderkerze gezündet, die sein gesamtes Blickfeld ausfüllte. Doch nicht nur visuell, auch akustisch war er in eine fremdartige Sphäre eingedrungen. Ein sich wiederholender Grundbeat pulsierte in seinen Ohren, Kick-Drum auf jedem Vierteltakt; es hämmerte, pochte und stampfte in seinem Kopf. Sein Körper verband sich schon nach wenigen Minuten mit dem treibenden Puls der Musik zu einer einlullenden, zermürbenden Synthese.
Er schob sich zu der großen, langen Bar, vor der etliche, momentan allesamt besetzte Hocker standen, zwängte sich durch zwei dicke Schichten trinkwütiger Menschen hindurch und bestellte wie gewöhnlich ein Becks. Wenige Augenblicke später, nachdem er der jungen, hübschen Barkeeperin drei Eurostücke hingelegt hatte, hielt er die geöffnete Flasche in der Hand, drängte sich zurück durch die Menge, in Richtung der Tanzfläche, dann an dieser vorbei und schließlich zu der vertrauten, hüfthoch in die Wand eingebauten Sitzbank, auf der gewöhnlich immer ein Platz frei war. Heute saß lediglich ein junger Mann am Rand der Bank, vielleicht achtzehn Jahre alt, und blickte verträumt nach vorne, ein Mixery-Getränk in der rechten Hand haltend. Mit zwei bis drei Sitzplätzen Abstand setzte er sich neben den Jungen und richtete seine Augen auf die Tanzfläche. Von hier aus konnte er das gesamte Geschehen gut überblicken; er war nicht hier, um zu tanzen, und auch nicht wegen dieser eintönigen, blechernen Elektro-Musik, die jeden Freitag hier lief – nein, er war hier, um sein Ritual abzuhalten. Das beinhaltete Beobachtung, gemischt mit Hass und dem Gefühl des allmählich in ihm aufsteigenden Alkohols, der seine Sinneswelt einnahm, verklärte und den Hass immer weiter anwachsen ließ. Irgendwann wurde er eins mit diesem Hass, wurde nahezu vollständig von ihm ausgefüllt; hier und dort mischte sich ein wenig Wehmut hinein, eine gewisse Melancholie sowie eine tief aus seinem Inneren heraufsteigende Erinnerung an Enttäuschung, Leid, Traurigkeit und Einsamkeit. Er fühlte sich einsam, obwohl er in dieser Räumlichkeit mit so vielen Menschen zusammen war.
Ein wenig apathisch, aber doch konzentriert schwenkte er seinen Blick von einem Gesicht zum nächsten, beobachtete einige Augenblicke lang ein männliches, dann wieder für einen kurzen Moment ein weibliches Gesicht, versuchte, aus ihren Mienen zu lesen, ihre Blicke zu deuten. Er war mittlerweile sehr versiert darin geworden und erkannte meist sehr schnell, was der jeweilige Ausdruck bedeutete. Der Großteil der Männer und Frauen, die da vor seinen Augen tanzten oder wippten, tranken, sich gegenseitig anschrien und anlachten, waren etwa achtzehn bis zwanzig Jahre alt; einige waren nicht einmal volljährig – das Generation Z (von der dieser Generation angehörenden Mehrheit der Besucher meistens abgekürzt einfach Z genannt) war dafür bekannt, es mit den Alterskontrollen nicht allzu streng zu nehmen. Sie alle waren also in einem Alter, in dem noch jene Mischung aus Unbekümmertheit, Stumpfheit und erschreckender Bösartigkeit vorherrschte, die er nur zu gut kannte. Er hatte sie selbst an Leib und Seele zu spüren bekommen, vor vielen Jahren, damals noch von einer anderen, einer früheren Generation. Er war sehr geübt darin geworden, Machtstrukturen zu durchschauen. Er erkannte auch in dieser Nacht wieder schnell, wo die Stars waren, wo die Mitläufer, wo die Clowns und wo die … Ja, es gab noch eine weitere Art, eine, die anders war, eine seltene; wie kleine erfrischende Oasen in der unendlichen Dürre der Wüste. Der Junge, der zwei Meter weiter neben ihm auf der Bank saß, war so einer, ein seltener Stern, das erkannte er in dessen unschuldigen, hoffnungsvollen Augen.
Er betastete kurz die Innentasche seines Rucksacks und spürte die harten Umrundungen seiner Pistole. Er hatte einen Entschluss gefasst: Die heutige Nacht würde die Nacht der Nächte werden.
Er hatte noch keine zehn Minuten auf der Bank gesessen, als rechts von ihm, etwa fünf Meter entfernt, das letzte fehlende Glied der Kette erschien: ein junger Mann, um die achtzehn Jahre alt, mit aufwendig gegelter Undercut-Frisur, blauem Polo-Hemd und frech blitzenden Augen; der dominante Part einer Gruppe aus sechs Leuten, drei Jungs und drei Mädchen, von denen erstere ihn lachend, saufend und (wahrscheinlich aufgrund des Alkoholpegels) unbeholfen im Takt der Elektro-Klänge auf der Stelle wippend umgaben. Die Mädchen standen ein klein wenig abseits, und doch war nicht zu verkennen, dass sie zu der Gruppe gehörten. Zwei von ihnen warfen dem Anführer anhimmelnde Blicke zu, während die dritte mit einem Gesichtsausdruck von Unnahbarkeit ins Leere guckte und sich wie in Trance zu der Musik bewegte; weitaus stimmiger und eleganter als der Rest. Sie himmelte niemanden an, sie tanzte einfach nur, völlig im Einklang mit ihrer unendlichen Arroganz. Sie war die Diva, der Junge mit dem Polo-Hemd der Superstar dieser Clique. Ein anderer, etwas beleibterer Junge mit hellblonden Haaren war ganz augenscheinlich dessen rechte Hand. Der dritte Junge schließlich war ein völlig austauschbarer Statist; er sabberte regelrecht vor Stolz und Zufriedenheit, im Dunstkreis seiner beiden Kumpels wippen zu dürfen, erfüllt von Dankbarkeit, dass sie ihn unter sich atmen, leben ließen. Er war ein Wurm, der das Glück hatte, dass keiner der Großen auf die Idee kam, ihn zu zertreten, zumindest im Moment nicht.
Jahrelang war es für ihn immer ausreichend gewesen, sich Konstellationen dieser Art, von denen es unendlich viele gab, anzuschauen, sie zu beobachten und dabei in Hass und Verachtung zu schwelgen. Die unbändige Wut, die er seit nunmehr fast eineinhalb Jahrzehnten in sich trug, glühte und dampfte immerzu, war allerdings bisher nicht übergekocht … bis vor genau einer Woche. Seitdem reichte ihm das stille Betrachten und Analysieren nicht mehr; seitdem fühlte er sich zum Handeln gedrängt.
Er war im Begriff gewesen, die Herrentoilette zu betreten, als er ungewohnt helle Laute vernahm. Irritiert hatte er die angelehnte, äußerst schäbige Toilettentür aufgeschoben und die beiden dann plötzlich unmittelbar vor Augen gehabt – die Diva und den Superstar, die zwischen den Pissoirs lehnten und angeregt schäkerten. Der dieser öffentlichen Toilette eigene, üble Geruch war mit beißendem Parfum vermischt. Sie sahen ihn belustigt an. Die Mundwinkel des Superstars formten ein breites, spöttisches Grinsen, während die Augen der Diva ihn herausfordernd anfunkelten.
»Is was?«, fragte der Superstar forsch.
»Nein«, entgegnete er überrumpelt. Mehr als eine Silbe wollte er in diesen sich ihm aufzwingenden Wortwechsel auf keinen Fall investieren, niemals hatte er in diesem Schuppen mehr als ein oder zwei Worte von sich gegeben.
»Dann guck nich so blöd.«
Eigentlich hatte er gehofft und auch irgendwie geglaubt, dass diese Zeiten vorbei wären, da er erstens mittlerweile zu alt war, man ihn zweitens nirgendwo näher kannte und außerdem, weil er eben mit niemandem mehr als zwei Worte sprach. Doch plötzlich war er gegen seinen Willen von seinem Beobachtungsposten weggerissen worden; in dieser Sekunde war er wieder Teil dieser dunklen Welt, die er so sehr verachtete, welche ihm aber immer noch eine so ungeheure Angst einjagte. Er schämte sich für diese Angst. Früher hatte er sich nicht dafür geschämt, heute tat er es. Eigentlich hätte er auf den vor ihm an der Wand lehnenden, menschlichen Dreck spucken müssen; stattdessen wich er von seiner Zwei-Worte-Regel ab und stammelte: »Ich geh in die Kabine.«
Die beiden sahen sich kurz an, und dann lachten sie, als hätten sie einen urkomischen Witz gerissen. Der Superstar äffte ihn nach, die Diva blickte auf ihn herab wie auf ein Insekt.
»Was ist denn das für einer?«, hörte er den Superstar fragen, als er in der Toilettenkabine stand, und er merkte, wie seine Hände kribbelten, wie sein ganzer Körper von einem Zittern erfasst wurde. Es kochte in ihm, eine brodelnde Suppe aus Scham, Angst, Wut und Hass. Er war nicht in der Lage zu pinkeln, spülte trotzdem nach einer Weile ab und verließ die Kabine. Er warf den beiden einen teils beschämten, teil aggressiven Blick zu, den sie mit einem weiteren albernen Gelächter kommentierten, und als er aus der Tür heraus war, hörte er noch ein provokatives »Tschöhö« hinter sich her schallen. Er ging den Gang entlang und tauchte bald wieder in das blechern-monotone Stampfen des Kick-Drum-Pulses und in die dichte Masse tanzender junger Menschen ein.
Heute, eine Woche später, war es so weit; endlich würde er ein Statement abgeben. Oft hatte er davon geträumt, in den letzten fünfzehn Jahren hatte er es sich unzählige Male ausgemalt. Vor genau einer Woche hatte es Klick gemacht.
Es ertönte der Song In my Mind von Dynoro. Während dessen mystischer Groove in seinem Kopf wummerte, visierte er düster seine Zielgruppe, ließ sie nicht aus den Augen, nur hier und dort einmal für einen kurzen Augenblick, wenn einer von ihnen genau in seine Richtung schaute.
In my Mind, in my Head … Er fiel bald in eine Art Trance.
Die Stunden vergingen, immer wieder verließ er seinen Stammplatz und stieg die Treppen hinauf, um eine Zigarette zu rauchen. Während er das tat, achtete er stets ganz genau darauf, wer die Disco verließ. Hin und wieder suchte er auch die Toilette auf oder bestellte sich an der Bar ein weiteres Becks; letzteres tat er heute allerdings seltener als sonst, denn seine Sinne durften in dieser Nacht nicht zu stark vernebelt werden. Stets kehrte er wieder zu seiner Bank zurück und legte sich erneut auf die Lauer. Ab etwa halb drei Uhr morgens leerte sich der Saal allmählich und er hatte die Bank schließlich ganz für sich allein. Die Diva und der Star nahmen ihn niemals wahr, er schien Luft für sie zu sein, die Episode von letzter Woche hatten sie womöglich auch bereits wieder vergessen, zu unwichtig, zu nichtig war er für sie. Es war einfach bloß ein amüsanter Zwischenfall gewesen, wie eine lustige Szene in einer Sitcom, und ihr Alltag war voll von solchen Szenen, sodass natürlich nicht jede einzelne in ihrem Gedächtnis haften blieb.
Gegen kurz vor halb fünf, es waren vielleicht noch zwei Dutzend Leute im Saal, wurden seine mittlerweile etwas träge gewordenen Augen plötzlich wieder hellwach. Die Clique schien aufbrechen zu wollen. Die Jungs hatten keine Bierflaschen mehr in den Händen und standen nahe der breiten Flügeltür, die aus dem Saal hinausführte. Sie warteten wohl auf die Mädchen, die gerade noch ein paar letzte Tanzschritte ausführten. Schließlich hatten die Mädchen genug und schwankten zu den wartenden Jungen. Auf dem Gesicht des Blonden, des Superstars rechter Hand, hatte sich bereits ein wenig Ungeduld sichtbar gemacht. Er schien müde zu sein und den Heimweg antreten zu wollen.
Fünf Minuten später schritten die sechs auf dem Bürgersteig der breiten, sowohl an Wohnhäusern als auch an einigen kleinen Bistros, Shishabars und Geschäften vorbeiführenden Pelzerstraße in Richtung Bahnhof, der etwa vierhundert Meter vom Generation Z entfernt und gegenüber des großen Stadtparks lag.
Er folgte ihnen, in gewissem Sicherheitsabstand, tat so, als sei er ebenfalls auf dem Weg zum Bahnhof. Ein unangenehm kühler Wind pfiff durch die Straße, wehte ihm eklige kleine Nieselregentropfen ins Gesicht, wie die feuchte Aussprache eines Lisplers. Die morgendämmerige Gegend, erhellt vom Licht der Straßenlaternen, war noch ziemlich einsam; nur vereinzelt fuhr ein Auto vorbei oder tauchten Fußgänger auf.
Kurz vor dem Park hielt die Gruppe an. Zwei von ihnen, zwei Frauen (darunter nicht die Diva), verabschiedeten sich und schlugen eine andere Richtung ein. Sein Augenmerk richtete er auf die vier Verbliebenen, die nun zwischen dem Park und dem schräg gegenüberliegenden Bahnhof die Rolltreppe zur U-Bahn hinunterfuhren, immer wieder lauthals rufend, lachend, grölend.
Sie kommen sich so wichtig vor, dachte er, so bedeutend. Ihnen war gar nicht bewusst, dass sie im Grunde nicht mehr wert waren als ein Krümel Rattenscheiße.
Er blickte auf die über den Treppen angebrachte Anzeige; die nächste Bahn fuhr in neun Minuten. Angespannt sah er sich um. Er spürte ein starkes Kribbeln, als flatterten lauter Fledermäuse in seinem Brustkorb herum. Um ihn herum schien es menschenleer zu sein, kein Augenpaar war auf ihn gerichtet. Flink wieselte er über die Rasenfläche des Stadtparks und schlug sich in ein großes Buschgehege, wenige Meter von einem Teich entfernt, dessen dunkles, grünblaues Wasser im Mondlicht glitzerte. Im Schutz der Büsche, die sich im Übrigen auch optimal zu einer heimlichen Verrichtung einer Notdurft eignen würden, öffnete er seinen Rucksack. Er hatte alles dabei, was er brauchte. Er entnahm dem Rucksack einen weißen Schutzanzug, eine Fasching-Horror-Maske, ein Paar alte Sportlatschen sowie zwei braune Lederhandschuhe. Er zog seine Lederjacke und seine bernsteinfarbenen Merinoschuhe aus, stopfte sie in den Rucksack und zog die neuen Sachen an, setzte die Maske auf und zog die Kapuze des Schutzanzuges über. Dann kramte er in der Seitentasche seine Glock hervor, eine halbautomatische Pistole. Nachdem er den Rucksack tief im Gebüsch vergraben hatte, schaute und lauschte er noch einmal nach allen Seiten, sprang aus seinem Versteck und lief wieder über den Rasen. Während er wenige Augenblicke später die Betonstufen zur U-Bahn heruntertrippelte (er nahm nicht die Rolltreppe), schob er ein 15-Schuss-Magazin in die Pistole, schraubte einen Schalldämpfer auf die Mündung des Laufs und steckte die Waffe unter den Schutzanzug in den Hosenbund seiner Jeans.
Er wusste nicht, in welche Richtung die Gruppe fahren wollte, also wandte er sich auf gut Glück erst einmal nach links, stieg ein paar Stufen einer weiteren Treppe hinunter und warf einen vorsichtigen Blick in die Halle. Da er dort bloß einen dösenden Mittzwanziger mit langen, struppigen Haaren sitzen sah, lief er die Stufen sogleich wieder hinauf. Er nahm die Treppe, die zur parallel liegenden Haltestelle hinunterführte. Sein Herz pochte, stampfte, wie der Beat eines House-Songs, als er seine vier Zielobjekte entdeckte, die nebeneinander auf einer der langen Holzbänke an der Wand saßen. Eine Bank weiter lag ein Penner und schlief, ansonsten schien niemand hier unten zu sein.
»Ey, Karneval is vorbei!«, johlte der Superstar, bereits ein deutliches Lallen in der Stimme, als der Mann im Schutzanzug sich demonstrativ in einem Abstand von etwa zwei Metern vor ihnen aufgestellt hatte, und ließ ein infantiles Wiehern hören, in das die anderen munter einfielen.
Im nächsten Augenblick zog er die Pistole unter seinem Schutzanzug hervor und ließ den Schlittenfang nach vorne schnappen; die Waffe war feuerbereit. Er zielte auf den Kopf des Superstars, mit beiden Händen, so wie er es in diversen Youtube-Videos gelernt hatte, eine Hand hielt den Griff, die andere war darum gewickelt, sein Oberkörper leicht nach vorne gebeugt.
Die vier schienen mit den visuellen Informationen, die sich ihnen darboten, erst einmal nicht viel anfangen zu können. Erst als er den Zeigefinger am Abzug krümmte, ein dumpfer Knall ertönte und der Kopf des Superstars durch einen Treffer unterhalb seines rechten Auges nach hinten gerissen wurde, zuckten die drei Verbliebenen erschrocken zusammen. Die rechts neben dem Superstar sitzende Diva, auf der gesamten linken Gesichtshälfte mit Blut besprenkelt, schaute mit einem Ausdruck fassungslosen Entsetzens erst zu ihrem Nebenmann, dann zum Schützen und stieß daraufhin einen panischen Schrei aus, dessen schriller Klang sich augenblicklich in die abgedämpften Schallwellen weiterer Schüsse mischte.
»Schrei doch nicht so!«, hörte man von der anderen Bank den Obdachlosen ausrufen. »Hier will jemand schlafen.«
Im Halbsekundentakt feuerte er ab. Eine leer geschossene Hülse nach der anderen wurde ausgeworfen, sie fielen zu Boden wie goldenes Laub. Der Blonde und die Diva, mit Treffern im Hals- und im Brustbereich, waren sehr schnell regungslos, der am linken Rand sitzende Statist jedoch war bereits nach den ersten drei Schüssen aufgesprungen. Kurz darauf wurde er ebenfalls getroffen, stürzte hin und robbte sich auf allen vieren vorwärts, dicht am Schützen vorbei.
Da kroch er, der Wurm, der noch nicht zertreten worden war, genau vor seinen Füßen. Er zielte, und im nächsten Moment traf den Kriechenden eine Kugel im Hinterkopf. Es sah so aus, als wäre vor ihm auf dem Boden eine rote Farbpatrone geplatzt.
Das alles ging sehr schnell und lief irgendwie unwirklich, schemenhaft vor ihm ab. Er agierte in einer Mischung aus Rage und Trance; es war wie ein Traum, irgendwie kaum anders als die vielen Szenen, die sich im Vorfeld bereits in seinem Kopf abgespielt hatten. An diesem Morgen waren sie Realität geworden.
Jetzt registrierte er, dass der Erstgetroffene, der Superstar, noch nicht tot war. Er trat ganz nah an ihn heran und blickte in sein verkrampftes, zitterndes Gesicht. Der Kopf bebte, zuckte immer wieder zur Seite und nach vorne und erinnerte ihn an das Haupt eines Parkinson-Patienten. Die Augen waren starr aufgerissen und in Richtung der Decke gerichtet; des Sprechens schien er nicht mehr mächtig zu sein, stattdessen stieß er immer wieder ein leises, erbärmliches Röcheln aus.
Der Blutrausch, die Ekstase, von der er wenige Sekunden zuvor noch erfüllt gewesen war, hatte sich ein wenig gelegt. Zögernd und erschöpft blickte er auf seine rechte Hand, die immer noch fest den Griff der Pistole umfasst hielt.
Ich bringe das jetzt zu Ende, dachte er, erhob seine Rechte und richtete die Pistole auf die Stirn des Superstars (er war so nah dran, dass die Laufmündung fast auf sie aufsetzte). Er holte noch einmal tief Luft, dann drückte er ab.
Im nächsten Augenblick schaute er sich hektisch um und vergewisserte sich, dass niemand den Bahnsteig betrat. Der Obdachlose lag, so erweckte es zumindest den Anschein, mittlerweile wieder in friedlichem Schlummer.
Er steckte seine Pistole zurück in den Hosenbund und kramte aus seiner rechten Hosentasche ein zusammengefaltetes Blatt Papier hervor. Dann trat er nahe an den toten Superstar heran und legte den Zettel auf der Jeansoberfläche zwischen Knie und Hüfte ab, ziemlich genau in der Mitte des rechten Oberschenkels.
Wenig später, als er die zur U-Bahn herunterführenden Stufen wieder hinaufgelaufen war, erblickte er in einer Entfernung von etwa 50 Metern eine weitere Gruppe Jugendlicher, und ihre durcheinander brabbelnden Stimmen drangen an sein Ohr. In gemäßigtem Tempo schritten sie geradewegs auf ihn zu, da sie wohl auf dem Weg zum Bahnhof waren.
Er flitzte, um aus ihrem Blickfeld zu verschwinden, in den Park und zurück in das Gebüsch, in dem er seinen Rucksack versteckt hatte. Da kauerte er und sah im Schutz des Dickichts die Gruppe seitlich am Park vorüber und auf den Bahnhof zugehen. Sie waren auf ihn aufmerksam geworden, wahrscheinlich irritiert aufgrund eines durch die Gegend sausenden Mannes mit Schutzanzug und Faschingsmaske, und stierten neugierig in Richtung des Gebüschs. Glücklicherweise legte sich ihr Interesse rasch wieder, und sie richteten ihre Blicke wieder nach vorne. Bald waren sie, die Rolltreppe zur U-Bahn herunterfahrend, aus seinem Sichtfeld verschwunden.
Jetzt musste es schnell gehen! Im Eiltempo zog er Anzug, Maske, Handschuhe und Sportlatschen aus und stopfte sie zusammen mit der Waffe in seinen Rucksack. Nachdem er sich wieder in die Lederjacke geworfen und die Merinoschuhe angezogen hatte, warf er noch einmal kurz einen gründlichen Blick in alle Richtungen, sicherte sich nach allen Seiten hin ab, sprintete aus dem Gebüsch und folgte dem in einem großen Bogen verlaufenden klinkergepflasterten Weg durch den Park, bis er vor dem Holzzäunchen stand, das einen kleinen Kinderspielplatz umgab und an dem er sein Fahrrad angeschlossen hatte, so, dass es vom Weg aus kaum erkennbar war, fast vollständig verdeckt von einer der großen Birken, die den Spielplatz flankierten. Er machte es los, schwang sich darauf und fuhr davon, während der gellend-laute Pedalton der Polizeisirenen in seinen Gehörgängen dröhnte.
Kapitel 1
Martin Hais saß, so wie jeden Tag eine graue Baumwollhose und eines seiner acht stahlblauen Hemden tragend (heute eines seiner vier langärmeligen), in seinem schwarzen Lederlehnsessel, im Schoß ein neu erschienenes Fachbuch über Entwicklungspsychologie. Seine Füße steckten in hellgrauen Slippern, sein halb langes, leicht grau meliertes Haar war heute von ihm, wie jeden Morgen, mit etwas Gel sorgfältig zu einem Seitenscheitel gekämmt worden. Soeben hatte er von seinem Buch aufgesehen, den Blick auf die Zeigertischuhr gerichtet, die, schwarz auf weiß mit anthrazitfarbenen Metallrahmen, auf seinem kleinen Couchtisch stand und 17 Uhr 23 anzeigte. Um 17 Uhr 30 wollte Oliver ihm einen Besuch abstatten, Oliver Stolzmann, sein Nachbar, der mittlerweile auch so eine Art Freund für ihn geworden war. Zumindest war er derjenige, den Martin von allen Bekannten, die er hier in Oberdorf hatte, und das waren nicht allzu viele, am ehesten als Freund bezeichnen würde. Sicher war er sich allerdings auch bei Oliver nicht; Freundschaft war die gesamten siebenundvierzig Jahre, die er nun bereits auf dieser Welt verweilte, immer ein Mysterium für ihn gewesen, ein schwer greifbarer, schwer erklärbarer Begriff, fast so schwer zu determinieren wie der Begriff der Liebe. Im Grunde hatte Martin mit allen Begriffen seine Schwierigkeiten, deren Wesen auf Gefühlen basierte, auf unsichtbaren Bändern zwischen Menschen.
Er erinnerte sich noch gut an diesen einen Sonntag vor ziemlich genau viereinhalb Jahren, als Oliver das erste Mal sein Haus betreten hatte, nachdem sie zwei Jahre lang, obwohl sie Nachbarn waren, kaum ein Wort miteinander gewechselt, lediglich einen zurückhaltenden Gruß, mitunter ein vorsichtiges Nicken ausgetauscht hatten, wenn sie sich zufällig über den Weg gelaufen waren.
Als Martin vor sechseinhalb Jahren nach Oberdorf gezogen war, einem kleinen Stadtteil des Schäbenauer Stadtbezirks Quarrenberg, sich diesen massiv gebauten 70er-Jahre-Bungalow auf kleinem Grundstück gekauft hatte, hatte er bloß die ruhige Lage direkt an dem kleinen Stadtwäldchen genießen wollen und wenig Interesse gehabt, soziale Kontakte zu schließen. Da hatte es ihm sehr gut gepasst, dass es in unmittelbarer Nachbarschaft lediglich ein Einfamilienhaus gab, nämlich das der Stolzmanns. Ganze zwei Jahre lang hatte er tatsächlich seine Ruhe gehabt, seine Tage waren stets auf die gleiche Art und Weise abgelaufen: arbeiten, lesen, arbeiten, ein wenig Musik hören, wieder arbeiten, dann den Rest des Tages lesen; am Wochenende nur lesen und Musik hören; zwischendurch natürlich auch mal etwas essen, und zweimal die Woche stand eine Dreiviertelstunde Hantelsport auf dem Programm, um die einigermaßen sportliche Körperform aufrechtzuerhalten. Die Wochen liefen nach einem strikten Muster ab, ohne störende Unterbrechungen oder Irritationen. Lediglich hin und wieder überkam ihn ein leiser Anflug von Schwermut und verhaltener Sehnsucht, das Gefühl, doch ganz gerne einmal privat ein paar Sätze mit einem menschlichen Wesen zu wechseln, nicht nur im Supermarkt und im Telefonat mit einem Kunden. Seine einzige Gesellschaft bestand aus zwei anmutigen, eleganten norwegischen Waldkatzen, welche die ungemein dämlich anmutenden Namen Tiger und Maus trugen. Die Namen hatte ihnen Martins Cousin Theo gegeben, von dem er die Katzen im Alter von etwa fünf Monaten vor gut sechs Jahren, ein paar Monate nach seinem Einzug, bekommen hatte. Theo, die einzige Person aus der Familie, zu der Martin noch Kontakt hatte, war zeitlich nicht mehr in der Lage gewesen, sich um die teuren Tiere zu kümmern und hatte Martin gefragt, ob er sich vorstellen könnte, zwei insgesamt fünfzehn Kilo schwere Rassekatzen zu halten. Martin hatte zugesagt; er war schon immer fasziniert von den Felidae, der Familie der Katzen, gewesen.
Schließlich war der Tag gekommen, jener besagte Sonntag vor viereinhalb Jahren, von dem an Martins Leben einen neuen Anstrich erhalten sollte, der Tag eben, an dem Oliver zum ersten Mal seinen Bungalow betreten hatte.
Martin hatte nur eben den Restmüll rausbringen und danach sogleich wieder seine Lektüre aufnehmen wollen. Es war kurz nach 18 Uhr an einem sonnigen Spätsommertag. In regelmäßigen Zeitabständen wehte eine frische Brise durch die angenehm warme Luft.
Er betrat seinen kleinen, pflegeleicht eingerichteten Vorgarten, ging ein paar Schritte über den Rasen, und während er den Deckel der Restmülltonne öffnete, glitt sein Blick kurz einmal zum Nachbarsgarten, in dem Oliver mit der Gießkanne beschäftigt war und genau in diesem Augenblick zu ihm hinübersah.
»Hallo, Nachbar!«, grüßte Oliver freundlich.
»Hallo«, grüßte Martin in leisem, zurückhaltendem Tonfall zurück; das Wort war etwas nuschelnd hervorgekommen. Nachdem er den Plastiksack in die Tonne geworfen und den Deckel wieder heruntergeklappt hatte, geschah das Ungewohnte.
»Wie geht es Ihnen heute?«, fragte Oliver mit einem gewinnenden Lächeln.
»Äh, soweit ganz gut«, antwortete Martin überrascht. »Und wie ist es bei Ihnen?«
Und dann war er plötzlich in eine kleine, nette Konversation gestolpert, sie tauschten ein paar Worte über das schöne Wetter aus, das ihnen dieser September kurz vor dem Beginn der Herbstzeit unerwartet bescherte, und Martin konnte sich des deutlichen Eindrucks nicht erwehren, dass Oliver Interesse an einem längeren Gespräch hätte. Es wirkte, als wollte er ihn näher kennenlernen, nach den zwei Jahren, die sie nun schon nebeneinander wohnten, heute, genau an diesem Sonntag. Aber warum denn auf einmal?
Immer wenn Martin dachte, die Unterhaltung hätte ihr Ende erreicht, setzte Oliver mit einer weiteren Frage oder Bemerkung nach; so kamen sie thematisch vom Wetter auf diese schöne, ruhige Wohngegend, in der sie lebten, auf das nebenan liegende Wäldchen mit seinen vermietbaren Hütten, und schließlich sprach Oliver über seinen Garten, in den er einiges an Arbeit steckte, und brachte zum Ausdruck, wie schön Martins Bungalow doch sei. Merkwürdigerweise empfand Martin das Gespräch überhaupt nicht als nervig, im Gegenteil: Obwohl die Themen im Grunde überhaupt nicht in sein Interessensgebiet fielen, fühlte er eine angenehme Entspannung, ein gewisses Wohlgefühl, während er mit seinem Nachbarn sprach und ihm zuhörte. Er stellte fest, dass Oliver ihm sehr sympathisch war.
Irgendwann – Martin hatte bestimmt schon sieben oder acht Minuten lang vor der Restmülltonne gestanden und Oliver mit der Gießkanne in der Hand auf dessen Grundstück – trat eine Pause ein, die Martin als den Zeitpunkt deutete, an dem es angebracht war, dem Dialog ein Ende zu setzen. Doch unvermittelt durchfuhr ihn ein Impuls, dem ein seltsamer innerer Zwiespalt vorangegangen war. Dieser bestand in dem Widerspruch, dass er auf der einen Seite froh war, gleich endlich weiterlesen zu können, aber andererseits auch irgendwie bedauerte, dass dieser angenehme Wortwechsel schon vorüber sein sollte. Letzteres Empfinden überwog schließlich.
»Also, ich weiß nicht«, hörte er sich selbst sagen, »aber wenn Sie Lust haben, könnten wir uns ja vielleicht mal kurz bei mir reinsetzen? Dann könnten Sie meinen Bungalow auch mal von innen sehen. Auch wenn es da nicht wirklich etwas Spektakuläres zu sehen gibt. Meine Wohnung ist eher minimalistisch eingerichtet.« Kurz danach kam ihm das Gesagte unheimlich unangebracht, ja gar aufdringlich vor. Ausgerechnet er, der so gern für sich allein war und Kontakten jedweder Art eigentlich immer bestmöglich aus dem Weg ging, brachte eine derartige Aufdringlichkeit zutage.
»Ja, gerne, das können wir machen«, antwortete Oliver, ohne sonderlich überrascht zu wirken. »Ich sag nur eben meiner Frau Bescheid, damit sie mich nicht sucht.«
Martin ging zurück in seinen Bungalow und ließ die Tür angelehnt, an der es wenige Minuten später zaghaft klopfte.
Oliver betrat einen Wohnbereich, der tatsächlich recht minimalistisch anmutete, aber dennoch nicht gänzlich ohne Geschmack eingerichtet war. Nach Durchschreiten des kleinen Eingangsflures befand man sich sogleich in einem großen, offen gestalteten Wohnzimmer mit eingegliedertem Essbereich. Große Fenster sowie eine Glastür zu einer überdachten Terrasse ließen viel Sonne hereinstrahlen. Eine karg ausgestattete Küche und ein geräumiges Schlafzimmer grenzten an den großen Raum, durch den Oliver nun seine Augen schweifen ließ, nach oben, unten und zu den Seiten. Wo er auch hinschaute, alles war entweder in Grau-, Schwarz- oder Weißtönen gehalten, wobei die Farbe Grau überwog – grau gefliester Boden, grau verputzte Wände, ein anthrazitfarbenes Zweisitzsofa aus Leder, das genau vor dem mit einem schwarzen Esstisch und zwei schwarzen Holzstühlen eingerichtetem Speisebereich stand, schräg dahinter, schon halb im Essbereich, ein schwarzer Lederlehnsessel neben einer hohen, gebogenen Stehlampe und weiter vorne, nahe dem Eingangsflur, ein weiß lackierter, an die Wand geschobener Schreibtisch mit einem mausgrauen Drehstuhl davor. Gegenüber der Fensterbank, die zwei Töpfe mit Scindapsus-Zimmerpflanzen zierten, zog sich eine etwa vier Meter breite und fast bis zur Decke reichende Bibliothek die Wand entlang.
»Wie gesagt, nicht allzu spektakulär hier«, sagte Martin.
»Also ich find es ganz nett«, meinte Oliver.
Dann schwiegen sie, und Martin spürte Unsicherheit in sich aufkommen. Wie würde es jetzt weitergehen? »Also, dann setzen wir uns mal«, sagte er, um das ihm peinlich anmutende Schweigen zu beenden.
Oliver blickte sich unschlüssig um und sah dann zu Martin. »Ähm … Wo soll ich mich denn hinsetzen?«
Gute Frage, dachte Martin, erwiderte jedoch nichts. Unruhe stieg in ihm auf. Das mit dem Besuch war vielleicht doch keine so gute Idee gewesen.
Oliver schien seine Unsicherheit zu bemerken und wollte ihm wohl entgegenkommen. »Okay … Wo wollen Sie denn sitzen?« Als Martin, immer noch in angestrengte Nachdenklichkeit versunken, nichts entgegnete, fügte er hinzu: »Also, wo sitzen Sie denn normalerweise?«
»Also … Das kommt drauf an«, sagte Martin zögerlich.
»Worauf?«
»Darauf, was ich gerade mache. Wenn ich lese, sitze ich immer in dem Sessel dort. Es sei denn, es ist bereits nach 22 Uhr, dann lese ich im Liegen auf der Couch. Von dort aus schaue ich auch fern. Also … Wenn ich hin und wieder fernsehe, aber das kommt eher selten vor.«
»Ich vermute aber mal, dass Sie jetzt nicht lesen und auch nicht fernsehen wollen?«
Martin zögerte. »Na ja, ähm … Ich denke nicht, das wäre ja jetzt irgendwie unhöflich.«
»Wo sitzen Sie denn sonst, wenn Sie mal Besuch haben?«
»Hm …« Als Martin darüber nachdachte, stellte er fest, dass in den ganzen sechseinhalb Jahren, die er hier wohnte, erst dreimal jemand außer ihm sein Haus betreten hatte: zweimal sein Cousin und einmal ein Elektriker. Der Elektriker hatte sich gar nicht gesetzt, und Theo hatte ihn bloß für einen Spaziergang im Wäldchen abgeholt; sie hatten sich kaum im Haus aufgehalten. Martin musste jetzt eine Entscheidung treffen.
»Wissen Sie was?«, kam ihm Oliver zuvor. »Setzen Sie sich doch einfach auf Ihre schöne Couch. Und wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich auf dem Sessel Platz nehmen. Versuchen wir das doch mal.«
»In Ordnung«, entgegnete Martin. Als er sich gerade auf der Couch niedergelassen hatte und Oliver vor dem schräg dahinter platzierten Lehnsessel stand, erschrak er plötzlich und verzog entsetzt das Gesicht. »Nein!«, rief Martin aus, die Augen weit aufgerissen. Er registrierte sogleich, dass er sich im Ton vergriffen hatte, und fügte etwas sanfter hinzu: »Bitte nicht.«
Oliver, der sich heruntergebeugt und die Hände um die Armlehnen des Sessels gelegt hatte, im Begriff, ihn von der Stelle zu bewegen, ließ sofort vom Sessel ab und runzelte irritiert die Stirn. »Sorry«, entschuldigte er sich. »Ich hab gedacht, ich schieb den mal ein bisschen darüber, damit wir uns gegenübersitzen können.«
»Nein, tun Sie das nicht, bitte nicht. Dieser Sessel steht genau richtig so, wie er da steht, in exakt der richtigen Position, also vom Abstand zu den Fenstern her, und zur Stehleuchte. Wenn ich ein Fenster auf Kipp habe, habe ich dort die optimale Luftzirkulation. Wissen Sie, ich habe diesen Sessel, seitdem ich hier wohne, noch niemals einen Millimeter bewegt, und ich habe Angst, dass wenn wir ihn jetzt verschieben, ich nicht mehr die exakte Position wiederfinde, in der er gestanden hat. Das kommt Ihnen wahrscheinlich merkwürdig vor, oder?«
»Um ehrlich zu sein, ja«, entgegnete Oliver. »Aber wenn Ihnen das so wichtig ist, dann setze ich mich jetzt eben einfach so in den Sessel, wie Sie ihn immer stehen haben.«
Martin stimmte zu, und Oliver nahm Platz. Dann sah er Martin an, der den Oberkörper fast um neunzig Grad herumgedreht hatte, um seinen Blick erwidern zu können.
»Kann ich Ihnen vielleicht einen Kaffee anbieten?«, fragte Martin.
»Nein, danke, ich hab vorhin erst zwei Tassen Kaffee hintereinander getrunken.«
»Ein Glas Wasser?«
»Auch nicht, danke.«
Erneut trat eine Pause ein. Draußen war ihr Gespräch so locker und flüssig verlaufen, und Martin fragte sich, warum es jetzt in seinem Haus irgendwie schleppender ging. Er befürchtete, dass er mit seiner die Position des Sessels betreffenden Eigenart womöglich die Stimmung getrübt hatte.
»Also, tut mir leid«, brach diesmal Oliver das Schweigen, »aber ich finde das hier einfach komisch. Das ist doch nicht bequem, wie Sie dasitzen, so nach hinten verrenkt. Ich kann mir das nicht ansehen. So können wir uns doch nicht unterhalten.« Oliver schaute sich um »Vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. Wie wär’s denn, wenn ich mir diesen Drehstuhl da vor dem Schreibtisch schnappe und der Couch gegenüber schiebe. Oder muss der auch immer in exakt derselben Position stehen?«
Martin musste kurz in sich gehen. Diesen Drehstuhl hatte er zwar noch nie vom Schreibtisch weggeschoben, allerdings stand er aufgrund der Rollen unter den Stuhlbeinen nicht immer ganz genau auf dem gleichen Fleck, da bestand durchaus etwas Spielraum. Das wäre eventuell akzeptabel.
Er willigte, wenn auch ein wenig zögerlich, in den Vorschlag ein. Oliver schob den Stuhl vor den kleinen Couchtisch, frontal zum Sofa, und nahm darauf Platz. Martin bemerkte, dass es sich, so wie sie jetzt zueinander saßen, tatsächlich angenehmer und irgendwie natürlicher anfühlte. Er betrachtete sein Gegenüber nun etwas genauer.
Oliver sah irgendwie lustig aus, ein wenig wie ein Komiker, mit seinen großen, abstehenden Ohren und den kleinen, eng aneinander liegenden Augen, aber sehr gutmütig. Er hatte zwar kein hübsches, aber ein angenehmes Gesicht mit einer warmen, freundlichen Ausstrahlung. Die Haare trug er kurz geschoren, wodurch er wahrscheinlich seine bereits sehr weit vorangeschrittene Glatze zu verbergen versuchte. Er hatte ein paar Kilo Übergewicht, und das Oberteil seines türkisfarbenen Trainingsanzugs war am unteren Bauchbereich deutlich gewölbt. Martin vermutete, dass Oliver älter war als er, vermochte aber nicht abzuschätzen wie viel.
»Ich bin dreiundvierzig Jahre alt«, sagte Martin jetzt. »Wie alt sind Sie?«
Oliver machte ein verdutztes Gesicht. »Sie können ja froh sein, dass ich keine Frau bin.«
»Wieso?«, fragte Martin verwundert.
»Weil man Frauen in dem Alter, in dem ich mich befinde, nicht nach ihrem Alter fragen sollte.«
»Ach so … Das war mir gar nicht so klar.« Martin spürte, wie ihm ein leichtes Kribbeln durch den Brustkorb zog. Frauen – das war ein Thema für sich.
»Ich bin vierundvierzig«, antwortete Oliver. »Wir sind also etwa im gleichen Alter.«
»Oh, ich hätte Sie älter geschätzt.«
Oliver lachte auf. »Danke Ihnen. Sie können wirklich froh sein, dass ich keine Frau bin.« Als Martin hierauf nichts erwiderte, bemerkte Oliver mit Blick auf das silbergraue Kurzhantelset, dessen zwei Stangen und insgesamt zwölf Gewichtsscheiben zwischen Heizkörpern und Zimmerpflanzen aufgestapelt standen: »Wie ich sehe, halten Sie sich körperlich fit.«
»Ja«, erwiderte Martin. »Ich trainiere zweimal pro Woche jeweils eine Dreiviertelstunde. Ich habe das vor etwa zehn Jahren in meine Gewohnheiten aufgenommen.«
»Ich hab früher auch mal viel trainiert, als ich noch jung war. Ich war fünfmal pro Woche im Fitnessstudio. Wie dem auch sei … Was machen Sie beruflich?«
»Ich bin Fachlektor für Psychologie.«
»Und was macht man da so?«
»Mein gewöhnlicher Arbeitstag besteht hauptsächlich aus der Lektüre von Manuskripten, außerdem deren Korrektorat, stilistischem Lektorat und, wenn erwünscht, auch Fachlektorat.«
»Hört sich ziemlich intellektuell an. Sie haben hier auch eine beeindruckende Bücherwand. Haben Sie das alles gelesen?«
»Ja, natürlich. Ich lese, wenn ich keine Manuskripte korrigiere, auch in meiner Freizeit sehr viel.«
»Also ich bin eher ein Lesemuffel, muss ich zugeben. Meine Frau liest ziemlich viel. Und meine Tochter gelegentlich. Mein Sohn kommt da eher nach mir und liest auch nicht besonders viel. Wie wird man denn Fachlektor für Psychologie? Dafür muss man doch mit Sicherheit lange studieren.«
»Eigentlich müsste man nicht zwingend ein Studium dafür absolvieren. Lektor ist keine gesetzlich geschützte Berufsbezeichnung. In meinem Fall kann ich das aber bejahen. Ich habe ein abgeschlossenes Psychologie-Studium sowie ein Germanistik-Studium hinter mir.«
Während Martin von seiner Studienzeit erzählte, steigerte er sich allmählich in ein immer stärker werdendes Mitteilungsbedürfnis hinein und legte Oliver in den nächsten zwanzig Minuten etwa seine halbe Lebensgeschichte dar. Er berichtete, wie er nach Abitur und Zivildienst ein Psychologiestudium begonnen hatte, und zwar durchaus mit dem Segen seines Vaters, des Soziologiedozenten Professor Hais, als Fernstudium, da die Jahre auf dem Gymnasium bereits von starken Problemen behangen gewesen waren, was das Zusammensitzen und -lernen in großen Gruppen und das Vortragen von Referaten anging. Er hatte immer schon am besten für sich allein lernen und arbeiten können, und so zog er sein Studium sehr gewissenhaft und überaus erfolgreich durch. Als er danach jedoch als Vorbereitung auf den Zielberuf des Psychoanalytikers einige Praktika an diversen Psychotherapiezentren absolvierte, hatte er schmerzlich feststellen müssen, dass er sich ganz und gar nicht für die enge Zusammenarbeit mit Kollegen und Patienten eignete. Anstatt also, wie es ihm sein Vater vorgeschlagen hatte, in die Forschung zu gehen, war ihm ein plötzlicher Geistesblitz gekommen angesichts des lebhaften Interesses, das er schon immer an deutscher Grammatik und Literatur gehabt hatte: Er beschloss, noch einmal einen ganz neuen Weg einzuschlagen und Lektor zu werden, und da er ja bereits ein abgeschlossenes Psychologiestudium in der Tasche hatte, war ihm die Idee des Fachlektor gekommen.
Obwohl es nicht unbedingt nötig gewesen wäre, hatte er sich erneut in der Universität eingeschrieben, diesmal für das Studium der Germanistik, und legte dieses, eher unwillig noch einmal komplett von seinem Vater finanziert, in Rekordzeit hin. Was er danach in Angriff nahm, hatte endgültig einen Keil in seine familiären Beziehungen getrieben: Er wollte sich tatsächlich als freier Lektor selbständig machen, ein Risiko, das sein Vater angesichts Martins bekannter Unbeholfenheit in jeglichen finanziellen Angelegenheiten für fatal und blödsinnig erachtete. Schließlich hatte Martin es, nachdem er mehr oder weniger von zu Hause rausgeschmissen worden war, doch geschafft, allerdings mit einiger Unterstützung seines Cousins Theo. Er war der Einzige gewesen, der immer an ihn geglaubt hatte, und war außerdem in seiner Position als Leiter eines Bauunternehmens erfahren im freiberuflichen Arbeiten.
Martin schloss seinen Bericht mit der Diagnose ab, die er schließlich erhalten hatte, und zwar auf seinen eigenen Verdacht hin, als er auf einen aussagekräftigen Artikel im Internet gestoßen war. Das war gewesen, kurz nachdem etwas Ruhe in seinen Alltag eingekehrt war und er erfolgreich Fuß im Beruf des freien Lektors gefasst hatte. Man hatte bei ihm ein Asperger-Syndrom diagnostiziert.
»Davon hab ich noch nie gehört«, entgegnete Oliver stutzig.
»Das ist eine leichte Form von Autismus«, erklärte Martin. »Deshalb bin ich auch so … seltsam.«
Er stellte fest, dass er sich durch das ungewohnt viele Erzählen ziemlich erschöpft fühlte. »Aber darüber erzähle ich Ihnen ein andermal vielleicht mehr … Was machen Sie beruflich?«
»Ich bin Heizungsinstallateur. Mit eigenem Betrieb.«
»Aha.« Weiter fiel ihm nichts ein. Das war einer der Berufe, von denen er überhaupt keine Ahnung hatte und die ihn auch nicht die Bohne interessierten.
Oliver wollte – glücklicherweise – offensichtlich auf eine ähnlich ausführliche Erörterung seines beruflichen Werdegangs verzichten, denn er gestand, dass es darüber nicht allzu viel Spannendes zu berichten gäbe. »Meine Frau findet meinen Beruf auch stinklangweilig.«
In diesem Moment ertönte ein kurzes Klacken; Tiger war durch die unten an der Haustür angebrachte Katzenklappe hereingekommen. Oliver wandte sich um und blickte direkt auf die nun den Wohnbereich betretende, ungemein große und sich elegant bewegende norwegische Waldkatze. Tiger war eine eindrucksvolle Erscheinung, mit seinem überaus kräftigen, muskulösen, stattliche neun Kilo schweren Körper, der von einem beigen, halblangen Fell mit dunkelgrauen Flecken bedeckt war.
»Komm zu mir, Tiger!«, forderte Martin den Kater in strengem, scharfem Tonfall auf, und gleich darauf beschleunigte das Tier seinen Gang und lief, Oliver ignorierend, an diesem vorbei auf sein Herrchen zu.
»Du lieber Mann«, sagte Oliver, während Tiger seinen bulligen Kopf an Martins Hand rieb und ein lautes, ekstatisches Schnurren vernehmen ließ. »So aus der Nähe sieht dein Stubentiger ja noch gewaltiger aus. Aber das ist ein wirklich schönes Tier.« Er rieb die Fingerspitzen aneinander, versuchte scheinbar, Tiger zu sich zu locken.
»Lieber nicht«, meinte Martin und nahm Tiger auf den Arm. »Beim letzten Mal, als jemand ihn hat streicheln wollen, musste ich im Nachhinein mehr als tausend Euro Schmerzensgeld bezahlen.«
»Im Ernst?« Oliver sah ihn ungläubig an.
»Ja. Vor ein paar Monaten hatte ich hier einen Stromausfall und musste einen Elektriker kommen lassen. Der hat das Problem auch recht schnell in den Griff bekommen, hat aber dann anschließend den Drang verspürt, Tiger am Kopf zu streicheln. Ich hatte mir nichts dabei gedacht, ich hatte nur immer gehört, was für sanftmütige, verschmuste Wesen die Vertreter dieser Rasse wohl seien und bis dahin ja auch noch gar keine Erfahrungen mit Tiger in Bezug auf fremde Menschen gemacht. Im Gegensatz zu Maus, seiner kleineren – und ruhigeren – Schwester, die immer sofort Reißaus nimmt, wenn sich ein Mensch nähert, schien er zumindest nie Angst vor Menschen zu haben. Jedenfalls hat er nach der Berührung des Elektrikers plötzlich einen wilden, ziemlich blutigen Angriff auf den Mann gestartet, hat ihm die Arme zerkratzt und ihn schließlich in die Hand gebissen. Das hat sich dann später entzündet, er musste ins Krankenhaus und so weiter. Und dann hat er den Vorfall gemeldet und ich bin zur Kasse gebeten worden. Also … Gehen wir das Risiko lieber nicht ein.«
»Ja, das denke ich nach dieser Geschichte auch«, bekräftigte Oliver. »Schade eigentlich. Wissen Sie, ich mag Katzen sehr, wenn es nach mir ginge, hätte ich mindestens zwei, aber … Meine Frau hasst Katzen.«
An dieser Stelle wurde Martin hellhörig. Er setzte Tiger ab, der sich gleich auf den Weg in die Küche machte, wo sein Futternapf stand. »Sie haben jetzt schon ein paarmal Ihre Frau erwähnt, und ich fasse mal zusammen: Sie sind ein Lesemuffel, Ihre Frau liest gerne; Ihre Frau findet Ihren Beruf stinklangweilig; und schließlich hasst sie Katzen, die Sie wiederum sehr gerne halten würden. Das klingt für mich durchaus nach einem gewissen Konfliktpotenzial. Läuft Ihre Ehe gut?«
»Sie sind wirklich ein sehr direkter Mensch«, bemerkte Oliver. »Ich würde mich nicht trauen, jemandem, den ich kaum kenne, eine solch private Frage zu stellen. Aber … Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich Ihnen vertrauen kann.«
Und ehe Martin sich versah, war er in ein großes Ehedrama hineingerutscht, als hätte er mit seiner Frage eine Lawine ins Rollen gebracht.
Oliver redete wie eine Stromschnelle, raste mit seinen Worten immer weiter und weiter über Eindrücke und Begebenheiten hinweg, die seine nun schon neunzehn Jahre währende Ehe hervorgebracht hatte. Er berichtete davon, wie sie damals die dringende Empfehlung erhalten hatten, ihren gemeinsamen Sohn Eve in die Vorschule zu schicken, und wie Britta, seine Frau, die Tochter eines Gymnasiallehrers, dies strikt abgelehnt und darauf bestanden hatte, ihn in die erste Klasse zu stecken. Als Eve schließlich das Schuljahr wiederholen musste, hatte sie Oliver die Schuld daran gegeben, da er angeblich seinen Sohn nicht genug motiviert und zum Lernen animiert hätte; außerdem hätte er durch seine eigene »intellektuelle Phobie« einen schlechten Einfluss auf das Lernverhalten ihrer Kinder. Wenngleich ihre Tochter Marianne, zwei Jahre älter als Eve, wesentlich mehr Erfolg in der Schule hatte und dadurch schnell zu Brittas Lieblingskind avanciert war, deren Leistungen sie Eve stets unter die Nase hielt, um ihn zu erniedrigen. Als sie Eve schließlich gegen seinen Willen und gegen alle Empfehlungen der Lehrer aufs Gymnasium gepackt hatten – das gleiche, auf das auch Marianne ging –, hatte Britta es tatsächlich so dargestellt, als wäre sie damals der Meinung gewesen, ein Jahr Vorschule hätte ihm ganz gutgetan, und Oliver wäre derjenige gewesen, der sich dagegen ausgesprochen hatte.
»Ich dachte, ich bin verrückt geworden«, sagte Oliver. »Sie hat mir Worte in den Mund gelegt, die ich niemals von mir gegeben hatte, und zwar mit einer solchen Sicherheit und Selbstverständlichkeit, dass ich plötzlich zu zweifeln begann. Ich zweifelte daran, ob meine Erinnerung richtig ist oder ob ich nicht vielleicht tatsächlich etwas anderes gesagt habe.«
»So etwas nennt man Gaslighting«, entgegnete Martin. »Ihre Frau leugnet und verdreht die Dinge so, wie sie ihr am besten passen. Sie trauen dann Ihren eigenen Erinnerungen nicht mehr. Eine andere Bezeichnung dafür ist Crazymaking.«
Wie auf ein Stichwort hin erzählte Oliver darauf weitere Anekdoten seines, so empfand Martin, schrecklichen Ehelebens. So hatte Britta eine Affäre gehabt, und als Oliver dahintergekommen war, hatte sie es dennoch geschafft, ihm Schuldgefühle aufzudrängen, weil er sie angeblich vernachlässigt hätte. Oliver berichtete ferner, dass sie ihn häufig erniedrigte, indem sie ihn mit anderen Männern verglich, die attraktiver oder intelligenter seien als er. Martin glaubte zu wissen, von welcher Art Mensch diese ziemlich kleine, unglaublich schlanke, immer sportlich-schick gekleidete Frau war, deren Anblick und eisige Atmosphäre ihm schon einige Male ein sehr unwohles Gefühl bereitet hatten.
»Aufgrund Ihrer Ausführungen«, sagte Martin schließlich, »bin ich zu folgendem Schluss gekommen: Sie leben in einer manipulativen Beziehung. Ihre Frau ist eine Narzisstin, die Sie auf die scheußlichste Weise emotional missbraucht. Und das tut sie wahrscheinlich nicht nur mit Ihnen, sondern auch mit Ihren Kindern, vor allem mit Ihrem Sohn, nehme ich an.«
Mit diesen Worten war der Bund besiegelt, den die beiden Männer von diesem Tag an eingegangen waren, diese Sätze formten das leidige Thema vor, das die Gespräche ihrer nachfolgenden Treffen dominieren sollte. Denn von diesem Tag an war der Nachbar regelmäßig zu Martin rübergekommen, und sie hatten über Olivers Emotionen, Sorgen und Ängste gesprochen, darüber, wie unzulänglich, wie hilflos er sich häufig fühlte. Martin hatte ihm immer wieder nahegelegt, ihn zu animieren versucht, hinter die Fassade der Vernünftigkeit und Rechtschaffenheit zu blicken, die Beweggründe seiner Frau zu hinterfragen, sich nicht in eine Rolle drängen zu lassen, in der er ständig Mitgefühl empfinden sollte, und vor allem: Nein sagen zu können. Er hatte sich Mühe gegeben, ihn gegen ihre Drohungen und ihren Liebesentzug zu immunisieren, versucht, mit ihm gemeinsam ein Schutzschild aufzubauen gegen ihre Waffen der passiv-aggressiven Kommunikation. Er hatte sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, ihm Erklärungen zu psychologischen Zusammenhängen geliefert und es nach einiger Zeit tatsächlich geschafft, Oliver zu einem anderen Verständnis, zu einem bewussteren Umgang mit seiner Ehe zu bewegen. Letztlich hatte Martin zu einer deutlichen Steigerung von Olivers Selbstwertgefühl beigetragen.
»Ich bin mir sicher«, hatte Oliver einmal gesagt, »dass du ein sehr guter Therapeut geworden wärst.« Das hatte Martin sehr geschmeichelt, ihn aber auch ein wenig nachdenklich gestimmt.
Dass Oliver sich verändert hatte, war, wie eigentlich zu erwarten, von Britta nicht unbemerkt geblieben, und schnell hatte sie den Zusammenhang zu dessen häufigen Besuchen bei dem merkwürdigen Nachbarn hergestellt. Dies hatte zu einer ausgeprägten Feindseligkeit Martin gegenüber geführt, welche Martin, wenn er ihr über den Weg lief, eindeutig hatte spüren können, auch wenn Britta sie ihm gegenüber niemals offen zum Ausdruck brachte. Oliver hingegen hatte sie befohlen, den Kontakt zu seinem neuen Bekannten zu unterbinden. Eine Zeit lang war Oliver dann wieder stark zurückgerudert, ihre Drohung, ihn zu verlassen und die Kinder mitzunehmen, hatte Wirkung gezeigt, sodass er Martins Bungalow eine Weile ferngeblieben war. Irgendwann, als Britta davon ausgegangen war, ihren Mann wieder vollends in der Hand zu haben, hatte sie das Verbot ein wenig aufgelockert, und schließlich setzten die Männergespräche wieder ein. Martin war sogar das eine oder andere Mal bei den Stolzmanns eingeladen gewesen, wobei Brittas eisige, latent feindselige Haltung ihm gegenüber die Atmosphäre stark unterkühlt hatte. Bisher hatte es Martin noch nicht hinbekommen, Oliver vollständig von dem schädlichen Einfluss seiner Ehefrau zu befreien, doch sie arbeiteten daran. Es war ein Langzeitprojekt.
Jetzt, viereinhalb Jahre später, an einem trüben Nachmittag im späten März, klingelte es an Martins Tür; es war 17 Uhr 33. Er erhob sich, legte sein Buch auf den Couchtisch, ging zur Haustür und öffnete dem erwarteten Besuch – Oliver Stolzmann.
»Hast du schon davon gehört?«, fragte dieser, nachdem sie sich - beide hatten jeweils eine Tasse mit brühend heißem, frisch aus Martins Espressomaschine gezogenem Kaffee vor sich auf dem Couchtisch stehen - wie immer einander gegenüber hingesetzt hatten, Martin auf dem Sofa, Oliver auf dem mausgrauen Drehstuhl, der normalerweise seinen Platz vor dem Schreibtisch hatte.
»Wovon gehört?« Martin pustete über seinen Kaffee und nahm einen kleinen, vorsichtigen Schluck davon.
»Mann, du guckst wirklich überhaupt kein Fernsehen oder schaltest mal das Radio ein, oder?«
»Nein, nie vor dem Abend.«
»Ich hatte schon davon gehört, bevor ich die Nachrichten gesehen hab; so was spricht sich schnell rum. Quarrenberg ist nicht so groß.«
»Was denn?«
»An der U-Bahn-Haltestelle Alt-Quarrenberg sind heute ganz früh am Morgen vier Jugendliche erschossen worden; siebzehn und achtzehn Jahre alt. Zweieinhalb Kilometer von hier entfernt, also ganz in der Nähe. Drei Jungs und ein Mädchen. Zwei der Jungen hätten dieses Jahr mit meiner Tochter gemeinsam Abi gemacht.«
Martin überkam ein Schauder. Ein Mord in Schäbenau, und dann auch noch hier in ihrem Stadtbezirk? »Ist der Schütze schon gefasst?«, fragte er ängstlich.
»Nein. Soweit ich gehört habe, wurde eine Mordkommission gegründet, die von jetzt an rund um die Uhr ermittelt.«
Ein Mörder lief frei in dieser Gegend herum, und er könnte Martin, rein theoretisch, wenn er zum Beispiel zum Einkaufen rausging, über den Weg laufen; eine Vorstellung, die ihn mit Grauen erfüllte.
»Einzelheiten zur Tat sind noch nicht bekannt«, fuhr Oliver fort. »Aber wie ich gehört habe, ist der Kriminalkommissar Wójcik der erste Ermittler am Tatort gewesen. Er hatte Bereitschaft, und sie haben ihn wohl heute Morgen gegen fünf aus dem Bett geklingelt. Das heißt, du wirst wohl bald mehr erfahren.«
Ja, Wójcik würde mit Sicherheit bald zu ihm kommen; bei einem solchen Fall hatte er sicherlich starken Redebedarf.
»Gibt dir das nicht irgendwie ein mulmiges Gefühl?«, fragte Martin. »Ich meine, das ist ja wieder mal ein grausiges Beispiel dafür, was man mit einer Schusswaffe alles anrichten kann.«
Plötzlich breitete sich Unbehagen in ihm aus; schließlich hatte er Oliver immer wieder nahegelegt, dass er sich in seinen Entscheidungen nicht immer von seiner Frau beeinflussen lassen, dass er tun und lassen sollte, wonach ihm war, unabhängig, selbstbestimmt. Und Oliver war immer schon ein begeisterter Sportschütze gewesen, fasziniert von allen möglichen Arten von Pistolen. Britta hatte für so etwas überhaupt nichts übriggehabt, aber schließlich hatte Oliver sich durchgesetzt und seine langjährige Mitgliedschaft im Schützenverein wiederaufgenommen. Seine Lieblingswaffe, eine Walther P99, für die er auch einen Waffenschein besaß, hatte er nach ihrer Hochzeit ihr zuliebe verkaufen müssen, da sie so etwas unter keinen Umständen in ihrem Haus herumliegen haben wollte. Das war einer der wenigen Punkte, bei denen Martin wirklich auf Brittas Seite stand. Daher war er auch gar nicht begeistert gewesen, als Oliver ihm vor etwas mehr als einem Jahr mitteilte, sich heimlich, hinter Brittas Rücken, wieder eine Walther angeschafft und sie in einem guten Versteck deponiert zu haben. So hatte er wieder seine eigene Waffe auf dem Schießstand, die er aber auch außerhalb von diesem regelmäßig, wenn die Luft rein war, hervorholte, um sie zu putzen.
»Na ja, ein bisschen schon«, gab Oliver zu. »Aber für mich ist das Schießen ein Sport, eine Leidenschaft, so wie es für andere Leute das Billardspielen oder das Musikhören ist. Auch Darts könnte man theoretisch auf Menschen werfen, einen Tennisball einem Menschen ins Gesicht schlagen. Aber im Normalfall tut man das eben nicht. So wie ich im Normalfall nur auf Pappziele schieße.«
Martin kam in den Sinn, dass Darts und Tennisbälle ursprünglich nicht dafür konzipiert worden waren, Lebewesen zu verletzen oder zu töten, Pistolen hingegen schon; aber er ließ es gut sein. Das fiese Angstgefühl, das sich aufgrund dieser morgendlichen Begebenheit in seinem Inneren manifestiert hatte, lähmte ihn auf eine gewisse Weise, ließ ihn sich erschöpft fühlen. Plötzlich realisierte er, dass er soeben wieder angefangen hatte, in Abständen von ein bis zwei Sekunden die Augen so fest zusammenzukneifen und dabei die Nase zu rümpfen, als wollte er mit den Augenlidern seine Nase gewaltsam in den Mund drücken.
Für Oliver war dieser Anblick nicht ungewohnt. »Das nimmt dich ja ganz schön mit«, sagte er. »Aber das braucht es nicht, bleib mal locker. Das hatte bestimmt irgendwas mit Drogen zu tun; die werden den Täter bald schnappen. Lass uns über etwas anderes sprechen.«
Martin atmete einmal tief ein und wieder aus; seine Augen beruhigten sich allmählich wieder ein wenig, fühlten sich aber immer noch so an, als stünden sie unter Dauerspannung. »Ja, ist vielleicht besser«, meinte er.
»Es gäbe da nämlich noch etwas, worüber ich gern mit dir reden würde. Das ist allerdings auch kein erfreulicheres Thema.«
Martin blickte ihm direkt in die Augen, etwas, das er nur bei Oliver hin und wieder tat. »Ich nehme an, es ist wieder etwas mit Britta?«
Oliver senkte kurz seinen Blick und richtete ihn dann erneut auf Martin. »Ich glaube, sie hat wieder eine Affäre. Vielleicht hatte sie auch nur einen kleinen Seitensprung; es ist auf jeden Fall irgendwas in dieser Art. Ich spüre einfach, dass da was im Busch ist.«
Martin, allmählich wieder entspannter, lehnte sich zurück. »Dann analysieren wir das mal. Erzähl mir genau, was sie gesagt und gemacht hat, erzähl mir von jedem Wort und jeder Bewegung.«
Gegen viertel vor acht war Oliver wieder bei sich daheim und saß mit Britta in ihrer weißen Hochglanzdesignerküche auf den silbergrauen Hockern vor der klinisch sauberen Granitplatte, die in die recht mondäne Kochinsel integriert war; vor ihnen standen zwei bauchige Porzellantassen mit cremigem Edelkaffee.
Oliver betrachtete seine Frau, die gerade in der aktuellen FAZ las, von der Seite. Sie war, auch mit ihren mittlerweile dreiundvierzig Jahren noch, eine sehr attraktive Frau. Zwar wirkte ihr schmales Gesicht immer auch ein wenig eingefallen, ihre grasgrünen Augen waren eher klein, ihre strohblonden Haare und ihre Lippen dünn, und dennoch war ihr Gesicht auf eine gewisse Art und Weise sehr schön geschnitten. Außerdem hatte sie eine Bombenfigur, mit ihren knapp fünfzig Kilo bei 1,63 war sie für seinen Geschmack vielleicht ein klein wenig zu schlank, aber an allen wichtigen Stellen wohlgeformt; auch nackt sah sie immer noch verdammt gut aus. Das war bei ihrer asketischen, streng veganen Ernährung und dem harten Training, das sie mindestens viermal pro Woche mit eiserner Disziplin in ihrem Fitnessstudio absolvierte, im Grunde auch kein Wunder.
Britta schien zu bemerken, dass er sie von der Seite anstarrte. Mit einem Seufzen, das ein wenig genervt anmutete, wandte sie ihren Blick kurz von ihrer Lektüre ab und zu ihm, um gleich darauf wieder zurück auf die Zeitung zu blicken.
»Na, habt ihr wieder schön über mich gelästert?«, fragte sie, während ihre Pupillen weiter den Buchstaben des vor ihr liegenden Artikels zu folgen schienen, als könnte sie gleichzeitig lesen und sich unterhalten. Vielleicht konnte sie das sogar tatsächlich.
»Nein, wir lästern nie über dich«, antwortete Oliver in beruhigendem Tonfall. »Wir unterhalten uns einfach, aber nicht nur über dich. Heute Morgen haben wir zum Beispiel über den Mord gesprochen, der von heute Morgen in Alt-Quarrenberg .«
»Da hat er sich bestimmt in die Hosen gemacht, oder?«
»Na, findest du das nicht auch beunruhigend, dass vier Menschen ganz bei uns in der Nähe erschossen werden? Und bisher noch keine Spur vom Täter?«
»Tja«, gab Britta kühl zurück, immer noch die Augen auf die Zeitung geheftet, »da gibt es wohl jemanden, der genauso gerne schießt wie du.« Als Oliver darauf nichts entgegnete, fuhr sie fort: »Ihr sprecht also nicht nur über mich. Aber ihr sprecht über mich; und heute habt ihr es mit Sicherheit auch wieder getan.«
»Na ja …«
Sie starrte ihm jetzt direkt und mit einer Intensität, die Oliver als beängstigend empfand, in die Augen. Dann formte sie ihre Lippen zu einem sanften Lächeln, die Art Lächeln, die ihr unverschämt gut stand und die vor langer Zeit einmal ein Grund für Oliver gewesen war, sich in sie zu verlieben. Mittlerweile schlich sich ein derartiges Lächeln deutlich seltener als früher auf ihre Lippen, aber es hatte immer noch die gleiche starke Wirkung auf ihn. »Du machst dir doch wieder Sorgen über irgendetwas; ich spüre das. Komm, erzähl schon. Was schiebst du wieder für Filme?«, fragte sie.
»Ach, gar nichts«, wehrte Oliver hastig ab und erhob sich. »Ich werde mich mal noch ein wenig um den Garten kümmern.«
Während er durch das große Wohnzimmer in Richtung der Haustür schlurfte, dachte er noch einmal kurz an seine Unterhaltung mit Martin zurück sowie an eine Aufforderung, die er nicht bloß heute, sondern bereits etliche Male von ihm erhalten hatte: Er durfte sich nicht von Brittas falschem, süffisantem Lächeln beeindrucken lassen.
Kapitel 2
Durch die Bekanntschaft mit seinem Nachbarn war ein frischer Wind in Martins Alltag geweht; sie trafen sich regelmäßig, zumeist in seinem Bungalow, ein- bis zweimal pro Woche, an Wochentagen und zu Uhrzeiten, die Oliver genau mit ihm absprechen musste, denn Martin kalkulierte seine Zeit sehr streng. Er war eben jemand, der sehr viel Zeit für sich selbst brauchte und Besuch nur in ganz bestimmten Situationen empfangen wollte, da es ihm ansonsten mehr Stress als angenehme Unterhaltung einbrachte.
Die ersten Male, als er sich mit Oliver getroffen hatte, hätte er es kaum für möglich gehalten, dass sein strikt ritualisiertes Alltagsleben schon bald noch weiter durcheinandergebracht und seine spärlichen sozialen Kompetenzen noch stärker auf die Probe gestellt werden würden. Es war nämlich nicht nur bei Oliver Stolzmann geblieben.
Eines Tages hatte Oliver einen Termin in dem kleinen, auf der Hauptstraße von Oberdorf gelegenen Friseursalon gehabt. Der mittlerweile 29-jährige türkische Barbier Ahmed Silsupur hatte Oliver den Kopf rasiert und war gerade mit der Pflege des Anchor-Bartes beschäftigt. Wie immer hatten sie sich angeregt unterhalten, über dieses und jenes; sie kannten sich schon lange. Oliver hatte Ahmed gegenüber im Vertrauen schon das eine oder andere Mal Andeutungen dahingehend gemacht, dass sein Eheleben häufig nicht unbedingt ein Zuckerschlecken war, und als Ahmed ihn an diesem Tag danach fragte, wie es derzeit mit Britta lief, waren auf Olivers Antwort hin seine großen dunkelbraunen Augen immer größer geworden. Oliver berichtete ihm von einer deutlichen Verbesserung seiner Lage, von einem viel größeren Selbstwertgefühl, davon, dass er einige Dinge jetzt endlich einmal durchschaut hätte und besser damit umgehen könnte. Und der Mann, der ihn dabei unterstützt hatte, ein hochintelligenter Kopf mit schier unerschöpflichem psychologischem Fachwissen, dieser Mann sei sein Nachbar Martin Hais. Ahmed hatte nicht schlecht gestaunt.