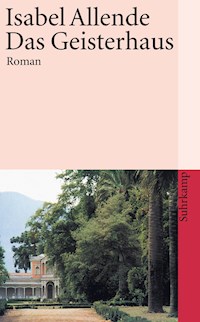11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Die neunzehnjährige Maya ist auf der Flucht. Vor ihrem trostlosen Leben in Las Vegas, der Prostitution, den Drogen, der Polizei, einer brutalen Verbrecherbande. Mit Hilfe ihrer geliebten Großmutter gelangt sie auf eine abgelegene Insel im Süden Chiles. An diesem einfachen Ort mit seinen bodenständigen Bewohnern nimmt sie Quartier bei Manuel, einem kauzigen alten Anthropologen und Freund der Familie. Nach und nach kommt sie Manuel und den verstörenden Geheimnissen ihrer Familie auf die Spur, die mit der jüngeren Geschichte des Landes eng verbunden sind. Dabei begibt Maya sich auf ihr bislang größtes Abenteuer: die Entdeckung ihrer eigenen Seele. Doch als plötzlich Gestalten aus ihrem früheren Leben auftauchen, gerät alles ins Wanken.
»Mayas Tagebuch« erzählt von einer gezeichneten jungen Frau, die die unermesslichen Schönheiten des Lebens neu entdeckt und wieder zu verlieren droht. Ein unverwechselbarer Allende-Roman: bewegend, spannend und mit warmherzigem Humor geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Ähnliche
Die neunzehnjährige Maya ist auf der Flucht. Vor ihrem trostlosen Leben in Las Vegas, der Prostitution, den Drogen, der Polizei, einer brutalen Verbrecherbande. Mit Hilfe ihrer geliebten Großmutter gelangt sie auf eine abgelegene Insel im Süden Chiles. An diesem einfachen Ort mit seinen bodenständigen Bewohnern nimmt sie Quartier bei Manuel, einem kauzigen alten Anthropologen und Freund der Familie. Nach und nach kommt sie Manuel und den verstörenden Geheimnissen ihrer Familie auf die Spur, die mit der jüngeren Geschichte des Landes eng verbunden sind. Dabei begibt Maya sich auf ihr bislang größtes Abenteuer: die Entdeckung ihrer eigenen Seele. Doch als plötzlich Gestalten aus ihrem früheren Leben auftauchen, gerät alles ins Wanken.
Mayas Tagebuch erzählt von einer gezeichneten jungen Frau, die die unermesslichen Schönheiten des Lebens neu entdeckt und wieder zu verlieren droht. Ein unverwechselbarer Allende-Roman: bewegend, spannend und mit warmherzigem Humor geschrieben.
»Mayas Tagebuch ist das einfühlsame Psychogramm einer starken Frau, die zu sich selbst findet – und doch alles zu verlieren droht. Und es stammt von einer Autorin in Bestform!«
emotion
Isabel Allende, 1942 geboren, hat ab ihrem achtzehnten Lebensjahr als Journalistin in Chile gearbeitet. Nach Pinochets Militärputsch ging sie 1973 ins Exil, wo sie ihren Weltbestseller Das Geisterhaus schrieb. Auch ihr letzter Roman Die Insel unter dem Meer stand wochenlang auf der Bestsellerliste. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Kalifornien. Ihr Werk erscheint auf Deutsch im Suhrkamp Verlag.
ISABEL ALLENDE
Mayas Tagebuch
Roman
Aus dem Spanischen von Svenja Becker
Suhrkamp
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel
El cuaderno de Maya
bei Plaza & Janés, Barcelona.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage
der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4444
Korrigierte Fassung, 2019.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Isabel Allende, 2011
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Millennium Images/LOOK-foto
Umschlaggestaltung: cornelia niere, münchen
eISBN 978-3-518-79970-3
www.suhrkamp.de
INHALT
SOMMERJanuar, Februar, März
HERBSTApril, Mai
WINTERJuni, Juli, August
FRÜHLINGSeptember, Oktober, November und ein dramatischer Dezember
LETZTE SEITEN
Für die Halbwüchsigen in meiner Sippe:
Alejandro, Andrea, Nicole, Sabrina,
Aristotelis und Achilleas
Tell me, what else should I have done?
Doesn’t everything die at last, and too soon?
Tell me, what is it you plan to do
with your one wild and precious life?
Sag mir, was hätte ich sonst tun sollen?
Stirbt nicht am Ende alles, und zu früh?
Sag mir, was willst du selber tun
mit deinem einzigen wilden und wertvollen Leben?
MARY OLIVER
The Summer Day
SOMMER
Januar, Februar, März
Vor einer Woche verabschiedete mich meine Großmutter mit einer tränenlosen Umarmung am Flughafen von San Francisco und schärfte mir noch einmal ein, wenn mir mein Leben lieb sei, dann solle ich mit keinem, der mich kennt, in Verbindung treten. Jedenfalls bis wir uns sicher sein könnten, dass meine Verfolger nicht mehr nach mir suchten. Meine Nini ist paranoid wie alle Bewohner der Unabhängigen Volksrepublik Berkeley, die sich von der Regierung und von Außerirdischen verfolgt fühlen, doch hat sie in meinem Fall nicht übertrieben: Wir können nicht vorsichtig genug sein. Sie drückte mir ein Heft mit hundert leeren Seiten in die Hand, damit ich Tagebuch schreibe, wie ich das zwischen acht und fünfzehn getan habe, ehe alles anfing aus dem Ruder zu laufen. »Du wirst jede Menge Zeit haben, dich zu langweilen, Maya. Du kannst sie nutzen und über den monumentalen Mist schreiben, den du gebaut hast, vielleicht kriegst du ein Gespür für die Ausmaße«, sagte sie. Von mir existieren acht mit Industrieklebeband versiegelte Tagebücher, die mein Großvater früher in seinem abschließbaren Schreibtisch verwahrte und die heute in einer Schuhschachtel unter Ninis Bett lagern. Das hier wird mein neuntes. Meine Nini glaubt, die Aufzeichnungen könnten mir nützlich sein, wenn ich irgendwann eine Psychoanalyse mache, weil sich darin die Anhaltspunkte fänden, um das Kuddelmuddel meiner Persönlichkeit zu entwirren; hätte sie die Tagebücher gelesen, dann wüsste sie, dass lauter Hirngespinste drinstehen, mit denen man Freud persönlich aufs Glatteis führen könnte. Eigentlich misstraut meine Großmutter Menschen, die nach Stunden bezahlt werden, weil denen nicht an zügigen Erfolgen gelegen ist, aber bei Psychiatern macht sie eine Ausnahme. Einer hat sie nämlich von ihrer Depression und aus den Fängen der Magie befreit, als sie meinte, sie müsse mit den Toten in Verbindung treten.
Ich steckte das Heft in meinen Rucksack, weil ich sie nicht kränken wollte, und hatte eigentlich nicht vor, es zu benutzen, doch vergeht die Zeit hier wirklich zäh, und mit Schreiben lassen sich die Stunden füllen. Diese erste Woche im Exil ist mir lang geworden. Ich sitze auf einer winzigen Insel, auf der Landkarte kaum zu erkennen, und hier ist es wie im Mittelalter. Ich tue mich schwer, über mein Leben zu schreiben, weil ich nie weiß, woran ich mich erinnere und was ich mir bloß einbilde; strikt bei der Wahrheit zu bleiben kann einen anöden, deshalb verändere oder überzeichne ich sie oft und merke es gar nicht, aber diesmal habe ich fest vor, das bleiben zu lassen, und ich werde fortan so wenig wie möglich lügen. Obwohl heutzutage selbst die Yanomami am Amazonas Computer benutzen, schreibe ich jetzt also mit der Hand in dieses Heft. Das ist mühsam, und meine Schrift sieht aus wie Kyrillisch, jedenfalls kann ich sie selbst kaum entziffern, was aber bestimmt mit jeder Seite besser wird. Schreiben ist wie Fahrradfahren: Man verlernt es nicht, auch wenn man es jahrelang nicht tut. Ich will versuchen, der Reihe nach zu erzählen, an irgendwas muss man sich ja orientieren, und das scheint mir das Einfachste, selbst wenn ich zuweilen den Faden verliere, mich verzettele, mir Wichtiges erst später wieder einfällt und ich es dann nicht nachträglich dazwischenquetschen kann. Meine Erinnerung bewegt sich in Kreisen, Spiralen und waghalsigen Sprüngen.
Ich bin Maya Vidal, neunzehn Jahre alt, weiblich, ledig, ohne festen Freund, weil es mir an Gelegenheiten mangelt und nicht, weil ich zickig wäre, bin im kalifornischen Berkeley geboren, besitze einen US-amerikanischen Pass und bin vorübergehend auf eine Insel im Süden der Welt geflohen. Maya heiße ich, weil meine Nini eine Schwäche für Indien hat und meinen Eltern kein anderer Name eingefallen ist, obwohl sie neun Monate Zeit gehabt hätten, darüber nachzudenken. Auf Hindi bedeutet Maya »Zauber, Illusion, Traum«. Was mit mir nicht mal entfernt zu tun hat. »Attila« würde besser passen, jedenfalls wächst, wo ich hintrete, kein Gras mehr. Meine Geschichte beginnt mit meiner Großmutter, meiner Nini, in Chile, lange vor meiner Geburt, denn wäre sie nicht ausgewandert, dann hätte sie sich nicht in meinen Pop verliebt, sie wäre nicht nach Kalifornien gezogen, mein Vater hätte meine Mutter nicht kennengelernt, und ich wäre nicht ich, sondern eine junge Chilenin und völlig anders. Wie bin ich? Eins achtzig groß, achtundfünfzig Kilo, wenn ich Fußball spiele, und etliche mehr, wenn ich bloß rumhänge, muskulöse Beine, ungeschickte Hände, blaue oder graue Augen, kommt auf die Tageszeit an, und wahrscheinlich bin ich blond, habe allerdings meine natürliche Haarfarbe seit Jahren nicht gesehen. Ich habe nichts von der Exotik meiner Großmutter geerbt, nicht ihren olivgrün angehauchten Teint oder die dunklen Augenringe, die ihr etwas Verruchtes geben, auch nichts von meinem Vater, der gutaussehend ist wie ein Torero und genauso eitel; meinem wunderbaren Pop sehe ich ebenfalls nicht ähnlich, weil der Ninis zweiter Ehemann war und leider gar nicht mein leiblicher Großvater.
Ich komme nach meiner Mutter, jedenfalls in Größe und Farbton. Sie war keine Prinzessin aus Lappland, wie ich glaubte, bevor ich denken konnte, sondern eine dänische Flugbegleiterin, in die sich mein Vater, Pilot bei einer Frachtfluggesellschaft, in der Luft verliebte. Er war zu jung zum Heiraten, hatte aber die fixe Idee, sie sei die Frau seines Lebens, und verfolgte sie beharrlich, bis sie vor Erschöpfung nachgab. Oder vielleicht, weil sie schwanger wurde. Jedenfalls heirateten die beiden, bereuten es vor Ablauf einer Woche, blieben jedoch zusammen, bis ich zur Welt kam. Wenige Tage nach meiner Geburt packte meine Mutter, während ihr Mann in der Luft war, die Koffer, wickelte mich in eine Kinderdecke und fuhr im Taxi zu ihren Schwiegereltern. Meine Nini demonstrierte gerade in San Francisco gegen den Golfkrieg, aber mein Pop war zu Hause und nahm das Bündel entgegen, das sie ihm ohne große Erklärung reichte, bevor sie zu dem wartenden Taxi zurücklief. Die Enkelin war federleicht und passte in eine Hand des Großvaters. Kurz darauf schickte die Dänin die Scheidungsunterlagen und als Dreingabe den Verzicht auf das Sorgerecht für ihre Tochter. Meine Mutter heißt Marta Otter, und ich habe sie in dem Sommer kennengelernt, als ich acht war und meine Großeltern mit mir nach Dänemark reisten.
Jetzt bin ich in Chile, dem Land meiner Großmutter Nidia Vidal, wo der Ozean Stücke aus dem Festland beißt und der südamerikanische Kontinent in Inselchen ausperlt. Genauer gesagt bin ich in Chiloé, was zum Seengebiet gehört, zwischen dem 41. und 43. südlichen Breitengrad liegt, etwa neuntausend Quadratkilometer umfasst und von zweihunderttausend Menschen bewohnt wird, die alle kleiner sind als ich. »Chiloé« bedeutet in der Sprache der Ureinwohner, dem Mapudungun, »Land der Cáhuiles«, das ist eine kreischende Möwe mit schwarzem Kopf, aber »Land des Holzes und der Kartoffeln« wäre passender. Neben der Isla Grande, auf der es ein paar größere Ansiedlungen gibt, gehören jede Menge kleinere Inseln zu Chiloé, viele davon unbewohnt. Manchmal liegen drei, vier davon so dicht beieinander, dass sie bei Ebbe zusammenwachsen, aber ich hatte nicht das Glück, auf so einer zu landen: Von hier braucht man bei ruhiger See fünfundvierzig Minuten mit dem Boot bis zur nächsten Siedlung.
Meine Reise aus dem Norden Kaliforniens nach Chiloé begann im treuen gelben VW meiner Großmutter, der seit dem Jahr 1999 siebzehn Unfälle überstehen musste, aber nach wie vor tuckert wie ein Ferrari. Aufgebrochen bin ich im tiefsten Winter, an einem dieser windigen, regnerischen Tage, wenn die Bucht von San Francisco alle Farbe verliert und aussieht wie eine grauschattierte Tuschezeichnung. Meine Großmutter fuhr wie üblich mit röhrendem Motor, hielt das Lenkrad umklammert wie einen Rettungsring und den Blick mehr auf mich als auf die Fahrbahn gerichtet, weil sie mir letzte Anweisungen geben musste. Sie hatte mir noch nicht erklärt, wo genau sie mich hinschickte; »Chile«, mehr hatte sie über ihren Plan, mich verschwinden zu lassen, bisher nicht gesagt. Im Auto eröffnete sie mir jetzt Genaueres und drückte mir einen billigen kleinen Reiseführer in die Hand.
»Chiloé? Wie ist es da?«, wollte ich wissen.
»Alles, was du wissen musst, steht da drin.« Sie zeigte auf das Buch.
»Ziemlich weit weg …«
»Je weiter, desto besser. In Chiloé habe ich einen Freund, Manuel Arias, und abgesehen von Mike O’Kelly, ist er der einzige Mensch auf der Welt, bei dem ich mich traue zu fragen, ob er dich für ein, zwei Jahre versteckt.«
»Ein, zwei Jahre! Bist du noch bei Trost, Nini!«
»Hör zu, Kleine, es gibt Momente im Leben, da hat man keine Macht über das, was mit einem geschieht, es geschieht einfach. Das hier ist so ein Moment.« Und während sie das sagte, hing sie mit der Nase an der Windschutzscheibe und versuchte planlos, im Gewirr der Autobahnen einen Weg zum Flughafen zu finden.
Wir kamen gerade noch rechtzeitig und verabschiedeten uns ohne rührseliges Tamtam; ich habe dieses letzte Bild von ihr vor Augen: ihr VW, der sich röhrend im Regen verliert.
Ich flog einige Stunden nach Dallas, wurde von einer dicken, nach gerösteten Erdnüssen riechenden Frau ans Fenster gedrückt und saß danach noch einmal zehn Stunden in einer anderen Maschine nach Santiago, wach und hungrig, hing meinen Erinnerungen und Gedanken nach und las in dem Buch über Chiloé, das die Lieblichkeit der Landschaft, die Holzkirchen und das ländliche Leben pries. Mir ging der Arsch auf Grundeis. Der 2. Januar 2009 brach an, ein orangefarbener Himmel über den violetten Gipfeln der unverrückbaren, ewigen, gewaltigen Anden, und der Pilot sagte etwas von Landung. Wenig später tauchte eine grüne Ebene auf, Baumreihen, Äcker und in der Ferne Santiago, wo meine Großmutter und mein Vater geboren sind und ein Teil meiner Familiengeschichte im Verborgenen liegt.
Ich weiß sehr wenig über die Vergangenheit meiner Großmutter, sie erwähnte sie kaum, ganz als hätte ihr Leben erst begonnen, als sie meinen Pop kennenlernte. Ihr erster Mann, Felipe Vidal, starb 1974 in Chile, einige Monate nachdem das Militär gegen die sozialistische Regierung von Salvador Allende geputscht und im Land eine Diktatur errichtet hatte. Die junge Witwe wollte unter der Militärherrschaft nicht leben und wanderte mit ihrem Sohn Andrés, meinem Vater, nach Kanada aus. Der konnte mir zu der Geschichte wenig sagen, weil er sich nicht gut an seine Kindheit erinnert, vergöttert aber noch heute seinen Vater, von dem nur drei Fotos erhalten sind. »Wir gehen nie mehr zurück, oder?«, hat Andrés im Flugzeug nach Kanada gesagt. Es war keine Frage, sondern ein Vorwurf. Er war neun Jahre alt, in den letzten Monaten schlagartig reifer geworden, und er verlangte nach Erklärungen, weil er spürte, dass seine Mutter ihn mit Halbwahrheiten und Lügen in Sicherheit zu wiegen versuchte. Dass sein Vater einem plötzlichen Herzanfall erlegen sei, hatte er mit Fassung aufgenommen, ebenso die Behauptung, man habe den Toten schnell beigesetzt, weshalb er ihn auch nicht sehen und sich nicht von ihm verabschieden konnte. Wenig später fand er sich in diesem Flugzeug nach Kanada wieder. »Natürlich gehen wir zurück, Andrés«, versicherte ihm seine Mutter, aber er glaubte ihr nicht.
In Toronto nahmen sich ehrenamtliche Mitarbeiter vom Flüchtlingskomitee ihrer an, statteten sie mit passender Kleidung aus und übergaben ihnen die Schlüssel zu einer möblierten Wohnung mit gemachten Betten und gefülltem Kühlschrank. In den ersten drei Tagen gingen Mutter und Sohn nicht vor die Tür, lebten von den Vorräten und bibberten in ihrer Einsamkeit, aber am vierten Tag kam eine Frau vom Sozialdienst, die gut Spanisch sprach und ihnen erklärte, welche Sozialleistungen und Rechte sie als Einwohner Kanadas in Anspruch nehmen konnten. Zunächst sollten beide einen Englisch-Intensivkurs besuchen, und der Junge wurde in der Schule angemeldet; später nahm Nidia dann eine Stelle als Fahrerin an, weil sie es demütigend fand, von staatlicher Unterstützung zu leben, obwohl sie arbeiten konnte. Der Job war so ziemlich das Letzte, wofür sie sich eignete, sie ist noch heute eine miserable Fahrerin, ganz zu schweigen von damals.
Auf den kurzen kanadischen Herbst folgte ein bitterkalter Winter, für Andrés, der jetzt Andy hieß, der siebte Himmel, weil er Spaß am Eislaufen und Skifahren fand, aber für Nidia unerträglich, denn sie fror unentwegt und kam über den Verlust ihres Mannes und ihrer Heimat nicht hinweg. Ihre Stimmung besserte sich auch nicht mit dem ersten zaghaften Frühlingshauch und nicht, als über Nacht wie hingezaubert überall Blüten hervorbrachen, wo noch am Tag zuvor eine Schneeschicht gewesen war. Sie fühlte sich entwurzelt und saß auf gepackten Koffern, wollte nach Chile zurück, sobald die Diktatur gestürzt wäre, und machte sich keine Vorstellung, dass bis dahin sechzehn Jahre ins Land gehen würden.
Nidia Vidal verbrachte ihre ersten zwei Jahre in Toronto damit, Tage und Stunden zu zählen, aber dann begegnete sie Paul Ditson II, meinem Pop, Professor an der University of Berkeley und nach Toronto gekommen, um eine Reihe von Vorträgen über einen scheuen Planeten zu halten, dessen Existenz er mit poetischen Berechnungen und phantastischen Gedankensprüngen zu beweisen versuchte. Mein Pop war einer der wenigen Afroamerikaner in der astronomischen Forschung, die ansonsten fest in weißer Hand ist, hatte sich auf seinem Gebiet einen Namen gemacht und etliche Bücher geschrieben. Als junger Mann hatte er ein Jahr die Megalithe am Turkana-See in Kenia erforscht und aufgrund seiner archäologischen Erkenntnisse die These entwickelt, dass es sich bei diesen Basaltsäulen um frühe Anlagen zur Himmelsbeobachtung handelte und man mit ihrer Hilfe dreihundert Jahre vor Christus den Borana-Mondkalender entwickelt hatte, den die Hirten in Äthiopien und Kenia noch heute benutzen. In Afrika lernte er, den Himmel völlig unvoreingenommen anzuschauen, und hier kam ihm auch der Verdacht, es könne diesen unsichtbaren Planeten geben, nach dem er später vergeblich mit den stärksten Teleskopen der Erde suchte.
Die Universität von Toronto brachte ihn in einem Gästehaus unter und buchte ihm über eine Agentur ein Auto mit Fahrer; so kam es, dass Nidia Vidal ihn während seines Aufenthalts begleitete. Als er hörte, seine Fahrerin stamme aus Chile, erzählte er ihr von seinem Forschungsaufenthalt an der chilenischen Sternwarte La Silla, wo wegen der klaren Nächte und der trockenen Luft die Bedingungen zur Himmelsbeobachtung oft ideal sind und man Sternbilder und Galaxien betrachten kann, die auf der Nordhalbkugel nicht zu sehen sind, wie etwa die kleine und die große Magellanische Wolke. Hier habe man auch entdeckt, dass die Anordnung der Galaxien aussieht wie ein gewaltiges Spinnennetz.
Durch einen romanhaft anmutenden Zufall endete sein Besuch in Chile am selben Tag des Jahres 1974, an dem Nidia mit ihrem Sohn nach Kanada aufbrach. Ich stelle mir vor, wie sie zur selben Zeit am Flughafen auf ihren jeweiligen Flug gewartet haben, auch wenn sie selbst behaupten, das sei ausgeschlossen, weil meinem Pop diese schöne Frau sicher aufgefallen wäre und sie ihn ebenfalls gesehen hätte, denn ein Schwarzer erregte damals in Chile Aufsehen, zumal wenn er so stattlich und gutaussehend war wie mein Pop.
Nidia genügte eine vormittägliche Fahrt durch Toronto mit ihrem Passagier im Fond, um zu wissen, dass es sich bei diesem Mann um eine seltene Mischung aus brillantem Denker und phantasievollem Träumer handelte, dem allerdings jeglicher Sinn für das Praktische fehlte, den sie sich zugutehielt. Meine Nini hat mir nie erklären können, wie sie am Steuer und im dicksten Verkehrsgewühl zu diesem Schluss gelangte, traf damit den Nagel aber auf den Kopf. Der Astronom war in der Welt so verloren wie der Planet, nach dem er den Himmel absuchte; er konnte im Handumdrehen ausrechnen, wie lang ein Raumschiff bis zum Mond braucht, wenn es 28.286 Kilometer in der Stunde zurücklegt, stand aber vor einer elektrischen Kaffeemaschine wie der Ochs vorm Berg. Sie hatte den Flügelschlag der Liebe seit Jahren nicht gespürt, doch weckte dieser Mann, der so anders war als alle, denen sie in ihren dreiunddreißig Jahren begegnet war, ihre Neugier und zog sie an.
Mein Pop war zwar über ihren tollkühnen Fahrstil erschrocken, aber ebenfalls neugierig und fragte sich, wie die Frau wohl ohne die zu große Uniform und die Bärentöterkappe aussehen mochte. Er war kein Mann, der jedem Gefühl gleich nachgibt, und sollte er mit dem Gedanken gespielt haben, Nidia zu verführen, dann verwarf er ihn jedenfalls als zu umständlich. Meine Nini hingegen hatte nichts zu verlieren und beschloss, dass sie dem Astronomen entgegenkommen würde, ehe dessen Vortragsreihe zu Ende war. Sie mochte seine auffällige Mahagonifarbe – sie wollte ihn von Kopf bis Fuß sehen – und spürte, dass sie viel gemeinsam hatten: Er die Astronomie und sie die Astrologie, was nach ihrem Dafürhalten auf dasselbe hinauslief. In ihren Augen waren sie beide von weit her gekommen, um einander an diesem Punkt auf dem Erdball und auf ihrem Lebensweg zu begegnen, weil die Sterne das so für sie bestimmt hatten. Schon damals war meine Nini süchtig nach Horoskopen, überließ jedoch nicht alles dem Wirken der Gestirne. Ehe sie ihren Überraschungsangriff startete, fand sie heraus, dass der Mann unverheiratet war, wirtschaftlich unabhängig, gesund und auch nur elf Jahre älter als sie, obwohl man die beiden, hätten sie dieselbe Hautfarbe gehabt, auf den ersten Blick für Vater und Tochter hätte halten können. Jahre später sollte mein Pop mir lachend erzählen, wenn sie ihn nicht auf Anhieb k.o. geschlagen hätte, wäre er noch immer nur in die Sterne verliebt.
Am zweiten Tag nahm der Professor auf dem Beifahrersitz Platz, um seine Fahrerin besser in Augenschein nehmen zu können, und sie drehte etliche unnötige Runden durch die Stadt, um ihm Zeit dafür zu geben. Am selben Abend zog Nidia, nachdem sie mit ihrem Sohn zu Abend gegessen und ihn ins Bett gebracht hatte, ihre Uniform aus, duschte sich, malte sich die Lippen an und machte sich auf den Weg zu ihrer Beute, weil sie ihm eine Mappe zurückgeben wollte, die er im Auto vergessen hatte und die dort gut bis zum nächsten Tag hätte liegen können. Nie zuvor war sie in Belangen der Liebe so waghalsig vorgeprescht. Im eisigen Wind erreichte sie das Appartementhaus, nahm den Aufzug hoch zu der Wohnung, bekreuzigte sich, um sich Mut zu machen, und klingelte an der Tür. Es war halb zwölf in der Nacht, als sie unwiderruflich in das Leben von Paul Ditson II trat.
Meine Nini hatte in Toronto wie im Kloster gelebt. Nachts sehnte sie sich nach einer männlichen Hand auf ihrer Hüfte, aber sie musste sich ums Überleben und um ihren Sohn kümmern in einem Land, in dem sie ewig fremd sein würde; sie hatte keine Zeit für romantische Träumereien. Der Mut, mit dem sie sich an jenem Abend gewappnet hatte, um bis an die Tür des Astronomen zu gelangen, war im Nu verflogen, kaum dass er ihr im Pyjama und mit verschlafener Miene öffnete. Einen Moment sahen die beiden einander an und wussten nicht, was sie sagen sollten, er hatte nicht mit ihr gerechnet und sie keinen Plan, wie es weitergehen sollte, dann bat er sie herein. Er staunte, wie anders sie ohne die Uniformmütze aussah, betrachtete ihr dunkles Haar, ihre unregelmäßigen Gesichtszüge und ihr etwas schräges Lächeln, das er zuvor nur von der Seite hatte sehen können. Sie wiederum staunte über den Größenunterschied zwischen ihnen, der im Auto weniger aufgefallen war: Auf Zehenspitzen würde sie knapp am Brustbein des Riesen schnüffeln können. Als Nächstes fiel ihr Blick in die kleine Suite, in der es aussah, als hätte eine Bombe eingeschlagen, woraus sie schloss, dass der Mann sie wirklich brauchen konnte.
Paul Ditson II hatte die meiste Zeit seines Lebens damit zugebracht, den rätselhaften Lauf der Himmelskörper zu erforschen, vom weiblichen Körper wusste er hingegen recht wenig und von den Launen der Liebe nichts. Wirklich verliebt war er nie gewesen, seine letzte Beziehung war die zu einer Kollegin von der Fakultät, mit der er sich zweimal im Monat traf, eine attraktive Jüdin, die sich für ihr Alter gut gehalten hatte und stets darauf bestand, dass sie die Restaurantrechnung teilten. Meine Nini hatte nur zwei Männer in ihrem Leben geliebt, ihren Ehemann und einen Liebhaber, den sie vor zehn Jahren aus ihrem Kopf und ihrem Herzen verbannt hatte. Ihr Mann war ruhelos gewesen, von seiner Arbeit und dem politischen Engagement völlig in Anspruch genommen, immer unterwegs und zu abgelenkt, um ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, und die Beziehung zu dem anderen hatte ein jähes Ende gefunden. Nidia Vidal und Paul Ditson II waren bereit für eine Liebe, die sie vereinen sollte bis zum Ende.
Ich habe die bestimmt etwas rosarot gefärbte Geschichte von der Liebe meiner Großeltern viele Male gehört und könnte sie Wort für Wort wiedergeben wie ein Gedicht. Was in jener Nacht hinter geschlossenen Türen geschah, weiß ich natürlich nicht in allen Einzelheiten, kann es mir aber vorstellen, schließlich kenne ich die beiden. Ob mein Pop, als er dieser Chilenin die Tür öffnete, geahnt hat, dass er an einem Scheideweg stand und die Richtung, die er einschlug, sein weiteres Leben bestimmen würde? Nein, ein so kitschiger Gedanke wäre ihm gewiss nicht in den Sinn gekommen. Und meine Nini? Ich sehe, wie sie traumverloren über die Kleiderhaufen am Boden und die vollen Aschenbecher steigt, das kleine Wohnzimmer durchquert, das Schlafzimmer betritt und sich dort aufs Bett setzt, weil Sessel und Stühle unter Papieren und Büchern begraben sind. Er wird vor ihr auf die Knie gegangen sein, um sie in den Arm zu nehmen, und eine Weile verharren sie so und versuchen, sich in dieser plötzlichen Nähe zurechtzufinden. Vielleicht ist meiner Nini wegen der aufgedrehten Heizung zu heiß geworden, und er hat ihr aus dem Mantel und den Stiefeln geholfen; sie haben sich tastend berührt, einander erkannt, ihre Seelen erforscht, um sicherzugehen, dass es kein Irrtum war. »Du riechst nach Tabak und Nachtisch. Und du bist glatt und schwarz wie ein Seehund«, wird meine Nini gesagt haben. Den Satz habe ich oft von ihr gehört.
Den letzten Teil der Legende muss ich mir nicht ausdenken, den haben sie mir erzählt. Nach dieser ersten Nacht kam meine Nini zu dem Schluss, dass sie den Astronomen aus früheren Leben und anderen Epochen kannte, es sich um eine Wiederbegegnung handelte und ihre Sternzeichen und ihre Arkana im Tarot einander ergänzten. »Zum Glück bist du ein Mann, Paul. Stell dir vor, bei dieser Reinkarnation hättest du meine Mutter sein müssen …«, seufzte sie und setzte sich auf seinem Schoß zurecht. »Da ich nicht deine Mutter bin, was würdest du davon halten, wenn wir heiraten?«, antwortete er.
Zwei Wochen später kam sie nach Kalifornien, hatte ihren Sohn im Schlepptau, der nicht zum zweiten Mal auswandern wollte, und ein Verlobtenvisum für drei Monate, nach deren Ablauf sie heiraten oder das Land verlassen musste. Sie heirateten.
An meinem ersten Tag in Chile streifte ich mit dem Stadtplan in der Hand ziellos durch die trockene Hitze von Santiago und schlug die Zeit bis zum Abend tot, wenn der Bus in den Süden abfahren würde. Die Stadt ist modern, sie hat nichts Exotisches oder Malerisches, keine Indios in bunten Trachten oder kolonialen Viertel in gewagten Farben, wie ich sie mit meinen Großeltern in Guatemala und Mexiko gesehen habe. Ich fuhr mit einer Drahtseilbahn hoch auf einen Hügel, was jeder Tourist getan haben soll, und bekam eine Vorstellung von den Ausmaßen der Stadt, die kein Ende zu nehmen scheint, und vom Smog, der als trübe Dunstglocke darüber liegt. Am Abend stieg ich in einen apricotfarbenen Bus in Richtung Süden, nach Chiloé.
Eingelullt vom Schaukeln des Gefährts, dem Schnurren des Motors und dem Schnarchen der anderen Fahrgäste, versuchte ich zu schlafen, was mir nicht gelang, denn schlafen ist mir nie leicht gefallen und fällt mir heute, mit den Überresten meines früheren Lebenswandels im Blut, schwerer denn je. Im ersten Morgenlicht hielten wir an einer Raststätte, konnten auf die Toilette gehen und einen Kaffee trinken, und dann fuhren wir durch liebliche Landschaften stundenlang weiter, grüne Hügel und Kühe rechts und links, bis zu einem schlichten Parkplatz, wo wir unsere tauben Glieder strecken und von ein paar Frauen in weißen Krankenschwesternkitteln Empanadas mit Käse und Meeresfrüchten kaufen konnten. Der Bus fuhr auf eine Fähre, die uns über den Kanal von Chacao bringen sollte: eine stille halbstündige Fahrt über ein glitzerndes Meer. Zusammen mit den anderen Fahrgästen, die nach dem langen eingepferchten Sitzen genauso steif waren wie ich, verließ ich wieder den Bus und lehnte mich an die Reling. Den schneidenden Wind im Gesicht, sahen wir den Schwalben zu, die in Schwärmen am Himmel gaukelten wie Taschentücher, und den Weißbauchdelfinen, die manchmal ganz nah an das Boot herankamen.
Der Bus brachte mich in die zweitwichtigste Stadt des Archipels, nach Ancud auf der Isla Grande. Dort hätte ich umsteigen und weiter in das Dorf fahren sollen, wo Manuel Arias mich erwartete, musste jedoch feststellen, dass mein Geldbeutel verschwunden war. Meine Nini hatte mich vor den chilenischen Taschendieben und ihren Zaubertricks gewarnt: In aller Freundlichkeit rauben sie dir die Seele. Zum Glück steckten das Foto meines Großvaters und mein Pass noch in der anderen Tasche meines Rucksacks. Ich war allein, ohne einen Centavo, in einem unbekannten Land, aber wenn ich durch meine unseligen Abenteuer des letzten Jahres etwas gelernt habe, dann, mich nicht von kleineren Widrigkeiten umhauen zu lassen.
In einer der Buden mit Kunsthandwerk am Marktplatz, wo chilotische Wollsachen verkauft wurden, saßen drei Frauen zusammen, strickten und unterhielten sich, und ich dachte, wenn sie wären wie meine Nini, dann würden sie mir helfen, jedenfalls behauptet sie immer, Chileninnen würden jedem beispringen, der in der Klemme steckt, vor allem wenn er fremd ist. In meinem tastenden Spanisch erklärte ich den dreien meine Lage, und gleich legten sie ihr Strickzeug weg und boten mir einen Stuhl an und brachten mir eine Orangenlimonade und beratschlagten unterdessen, was zu tun sei, wobei sie einander ständig ins Wort fielen. Nach mehreren Telefonaten mit dem Handy hatten sie einen Cousin aufgetrieben, der in meine Richtung fuhr und mich mitnehmen konnte; er würde in zwei Stunden aufbrechen und hätte nichts dagegen, einen kleinen Umweg zu machen, um mich zu meinem Treffpunkt zu bringen.
Ich nutzte die Wartezeit, sah mir den Ort an und ging in ein Museum, in dem die Holzkirchen von Chiloé erklärt werden, die vor dreihundert Jahren von jesuitischen Missionaren entworfen und von den Chiloten, meisterhaften Zimmerleuten und Schiffsbauern, Brett für Brett errichtet worden waren. Die Kirchen sind ohne einen Nagel gebaut, mit einem findigen System vom Verzapfungen, und die Deckengewölbe sind umgedrehte Schiffe. Am Ausgang des Museums traf ich den Hund. Er war mittelgroß, hinkte, hatte drahtiges, grauschattiertes Fell und einen erbärmlich struppigen Schwanz, tat aber würdevoll wie ein Tier von astreiner Abstammung. Ich bot ihm die Empanada an, die ich noch im Rucksack hatte, er nahm sie behutsam zwischen seine großen gelben Zähne, legte sie auf den Boden und sah mich an, womit er mir deutlich zu verstehen gab, dass es ihn nicht nach Brot, sondern nach Gesellschaft hungerte. Meine Stiefmutter Susan hat Hunde ausgebildet und mir beigebracht, dass man ein Tier nicht anfassen soll, ehe es sich nähert und damit zeigt, dass es sich nicht fürchtet, aber wir verzichteten auf das protokollarische Vorgeplänkel, weil wir uns auf Anhieb gut verstanden. Wir gingen zusammen auf Besichtigungstour, und zur vereinbarten Uhrzeit kehrte ich zu den Strickerinnen zurück. Der Hund blieb draußen vorm Laden, mit einer Pfote auf der Türschwelle. Sehr artig.
Der Cousin tauchte erst eine Stunde später als verabredet auf, mit seiner Frau und einem Säugling in einem bis obenhin vollgestopften Minibus. Ich bedankte mich bei meinen Wohltäterinnen, die mir auch ihr Handy geliehen hatten, damit ich mich mit Manuel Arias in Verbindung setzen konnte, und sagte dem Hund Lebewohl, der aber hatte anderes im Sinn. Er setzte sich vor meine Füße, fegte mit dem Schwanz über den Boden und grinste mich an wie eine Hyäne; er war so freundlich gewesen, mir seine Aufmerksamkeit zu schenken, und jetzt durfte ich mich glücklich schätzen, sein Mensch zu sein. Ich änderte die Taktik. »Shoo! Shoo! Fucking dog!«, schrie ich ihn an. Er rührte sich nicht, der Cousin sah mir eine Weile mitfühlend zu und meinte dann: »Keine Sorge, Señorita. Wir kriegen Ihren Fákin schon unter.« So kam das aschgraue Tier zu seinem neuen Namen, auch wenn es in einem früheren Leben vielleicht »Prinz« geheißen hat. Wir zwängten uns mühsam in das bepackte Gefährt und erreichten eine Stunde später das Dorf, wo ich den Freund meiner Großmutter treffen sollte, mit dem ich vor der Kirche verabredet war, direkt am Meer.
Das Dorf wurde 1567 von den Spaniern gegründet, es gehört zu den ältesten des Archipels und hat etwa zweitausend Einwohner, ich weiß aber nicht, wo die steckten, man sah jedenfalls mehr Hühner und Schafe als Menschen. Ich wartete lange auf Manuel, saß zusammen mit Fákin auf den Stufen vor der weiß-blau bemalten Kirche und ließ mich aus einiger Entfernung von vier stummen und ernsten Kindern beobachten. Über Manuel wusste ich bloß, dass er ein Freund meiner Großmutter war, die beiden sich seit den siebziger Jahren nicht mehr gesehen, aber sporadisch Kontakt gehalten, sich erst Briefe, später E-Mails geschrieben hatten.
Manuel Arias tauchte schließlich auf und erkannte mich anhand der Beschreibung, die meine Nini ihm am Telefon gegeben hatte. Was sie wohl gesagt hat? Wahrscheinlich: Bohnenstange, Haare in vier Knallfarben, Ring in der Nase. Er gab mir die Hand und musterte mich mit einem raschen Blick, verharrte kurz bei den Resten von blauem Nagellack auf meinen abgekauten Nägeln, dem Obama-T-Shirt, das meine Nini mir zu Weihnachten geschenkt hat und das mir nur bis zum Bauchnabel geht, den verschlissenen Jeans und den rosa besprühten Militärstiefeln, die ich in einem Laden der Heilsarmee bekommen hatte, als ich auf der Straße lebte.
»Ich bin Manuel Arias«, stellte er sich vor. Er sprach Englisch.
»Hi. Hinter mir sind das FBI, Interpol und eine Verbrecherbande aus Las Vegas her«, sagte ich gleich, um Missverständnissen vorzubeugen.
»Glückwunsch.«
»Ich habe keinen umgebracht und glaube auch eigentlich nicht, dass sie sich die Mühe machen, mich am Arsch der Welt zu suchen.«
»Danke.«
»Entschuldige, nichts gegen dein Land, echt. Eigentlich ja ganz hübsch hier, viel Grün und viel Wasser, aber halt so weit weg!«
»Wovon?«
»Von Kalifornien, der Zivilisation, dem Rest der Welt. Meine Nini hat nichts davon gesagt, dass es hier kalt ist.«
»Es ist Sommer.«
»Sommer im Januar! Wo gibt’s denn so was!«
»Auf der Südhalbkugel.«
Zu dumm, dachte ich, der Typ ist humorfrei. Er lud mich zu einem Tee ein, weil wir noch auf einen Lieferwagen warten mussten, der ihm einen Kühlschrank bringen und eigentlich seit drei Stunden hier sein sollte. Vor einem Haus flatterte ein weißes Tuch an einem Pfahl, als wollte sich da jemand ergeben, zeigte aber an, dass dort frisches Brot verkauft wurde; wir gingen hinein. Drinnen standen vier einfache Tische mit Wachstuchdecken, ein Sammelsurium von Stühlen, außerdem ein Tresen und ein Holzofen mit einem rußgeschwärzten Teekessel. Eine beleibte, fröhlich wirkende Frau begrüßte Manuel Arias mit einem Kuss auf die Wange und betrachtete mich etwas unschlüssig, ehe sie sich einen Ruck gab und mich ebenfalls küsste.
»Amerikanerin?«, wollte sie von Manuel wissen.
»Sieht man das nicht?«, sagte er.
»Und was ist auf ihrem Kopf passiert?« Sie zeigte auf meine gefärbten Haare.
»Ich bin so zur Welt gekommen«, sagte ich säuerlich.
»Die Gringuita spricht ja, dass man’s versteht!«, rief sie begeistert. »Setzt euch, setzt euch, der Tee kommt sofort.«
Sie packte mich am Arm und zog mich energisch auf einen Stuhl, während Manuel mir erklärte, dass jede englischsprachige Person mit hellem Teint in Chile ein »Gringo« und die Koseform »Gringuito« oder »Gringuita« nett gemeint ist.
Die Wirtin brachte uns Teebeuteltee und eine Pyramide duftender Hefebrötchen, frisch aus dem Ofen, dazu Butter und Honig, und dann setzte sie sich zu uns und wachte darüber, dass wir nichts verkommen ließen. Kurz darauf hörten wir das Keuchen des Lieferwagens, der mit einem schwankenden Kühlschrank auf der Ladefläche über die unbefestigte Straße mit den vielen Schlaglöchern heranrumpelte. Die Frau trat vor die Tür, pfiff durch die Zähne, und im Nu waren ein paar Jugendliche da, die halfen, den Kühlschrank abzuladen, ihn zum Ufer trugen und über einen Steg aus Bohlenbrettern weiter auf Manuels Motorboot schafften.
Das Boot ist ungefähr acht Meter lang, aus Fiberglas, weiß, blau und rot bemalt in den Farben der chilenischen Nationalflagge, die am Bug flatterte und fast genauso aussieht wie die texanische. Auf der Seite stand der Name: Cahuilla. Der Kühlschrank wurde so gut es ging vertäut, und jemand half mir an Bord. Der Hund kam in seinem jämmerlichen Trott hinter mir her. Er hatte die eine Pfote halb angezogen und lief seitwärts.
»Und der?« Manuel sah mich fragend an.
»Der gehört mir nicht, er ist mir in Ancud nachgelaufen. Angeblich sollen die chilenischen Hunde ja sehr intelligent sein, und der hier hat Rasse.«
»Deutscher Schäferhund und Foxterrier, wenn du mich fragst. Der Körper von einem großen Hund und die Pfoten von einem kleinen.«
»Ich bade ihn, dann wirst du sehen, er ist ein schickes Tier.«
»Wie heißt er?«
»Fucking dog auf Chilenisch.«
»Wie bitte?«
»Fákin.«
»Ich kann nur hoffen, dass dein Fákin sich mit meinen Katern verträgt. Nachts musst du ihn anbinden, nicht dass er abhaut und Schafe jagt.«
»Das wird nicht nötig sein, er schläft bei mir.«
Fákin lag platt auf den Boden des Bootes gedrückt, hatte die Schnauze zwischen den Vorderpfoten, rührte sich nicht und sah mich unverwandt an. Er ist nicht verschmust, aber wir verstehen uns in der Sprache von Flora und Fauna, in telepathischem Esperanto.
Vom Horizont rollte eine Lawine dicker Wolken heran, und es wehte ein kühler Wind, aber das Meer war ruhig. Manuel lieh mir einen Wollponcho, und dann redete er nicht mehr, konzentrierte sich aufs Steuer und auf die Geräte, den Kompass, ein GPS, das Seefunkgerät und was er da sonst noch hat, während ich ihn verstohlen ansah. Meine Nini hatte mir erzählt, er sei Soziologe oder so, aber auf seinem Boot konnte man ihn gut für einen Seemann halten: mittelgroß, schmal, kräftig, sehnig und muskulös, das Gesicht von der Salzluft gegerbt, mit markanten Falten und kurzen, störrischen Haaren, im selben Grau wie seine Augen. Bei alten Leuten kann ich das Alter nicht schätzen; von weitem hat Manuel sich gut gehalten, er geht noch zügig und hat nicht diesen krummen, greisenhaften Rücken, aber aus der Nähe merkt man, dass er älter ist als meine Nini, also muss er über siebzig sein. Ich bin wie eine Bombe in seinem Leben eingeschlagen. Ich muss behutsam sein, sonst tut es ihm noch leid, dass er mich bei sich aufgenommen hat.
Nach fast einer Stunde Fahrt, vorbei an etlichen Inseln, die unbewohnt aussahen, obwohl sie es nicht sind, zeigte Manuel auf eine Erhebung, die aus der Ferne kaum mehr war als ein dunkler Strich am Horizont und sich beim Näherkommen als ein Hügel entpuppte, gesäumt von einem Strand aus schwärzlichem Sand und Felsen, wo vier Holzboote kieloben zum Trocknen lagen. Manuel fuhr die Cahuilla seitlich an einen schwimmenden Anleger heran und warf den Kindern, die zahlreich angerannt kamen, dicke Taue zu, mit denen sie das Boot gekonnt an ein paar Pfosten festmachten. »Willkommen in unserer Metropole«, sagte Manuel und deutete auf das Dorf aus Holzhäusern auf Stelzen am Ufer. Mich überlief es kalt, denn das würde von nun an meine gesamte Welt sein.
Ein Grüppchen Leute näherte sich dem Strand, um mich in Augenschein zu nehmen. Manuel hatte angekündigt, er hole eine Amerikanerin ab, die ihm bei seinen Forschungsarbeiten helfen werde; falls man hier mit jemand Seriösem gerechnet hatte, muss die Enttäuschung bei meinem Anblick groß gewesen sein.
Um den Kühlschrank aufrecht vom Boot zu schaffen, bedurfte es etlicher Helfer, die einander lachend Dampf machten, weil es schon dunkel zu werden begann. In einer Prozession ging es dann hoch zum Dorf, vorneweg der Kühlschrank, dahinter Manuel und ich, gefolgt von einem Dutzend lärmender Kinder und einer buntscheckigen Nachhut von Hunden, die meinen Fákin wütend anbellten, sich aber nicht an ihn herantrauten, weil sein grenzenlos überhebliches Gebaren keinen Zweifel daran ließ, dass jeder, der es wagte, die Konsequenzen zu spüren bekäme. Fákin ist offenbar nicht leicht einzuschüchtern und lässt keinen an seinem Hinterteil schnüffeln. Wir kamen am Friedhof vorbei, wo ein paar Ziegen mit prallem Euter zwischen Gräbern mit Plastikblumen und Miniaturhäuschen weideten, von denen einige sogar für die Toten möbliert sind.
Die Pfahlbauten im Dorf sind durch Holzstege miteinander verbunden, und auf der Hauptstraße, wenn man die so nennen will, sah ich Esel, Fahrräder, einen Jeep mit dem Emblem der chilenischen Polizei, zwei gekreuzten Gewehren, und drei oder vier alte Autos, die in Kalifornien Sammlerstücke wären, hätten sie nicht so viele Beulen. Manuel erklärte mir, das Gelände sei hier unwegsam und im Winter der Matsch oft tief, deshalb transportiere man schwere Lasten zumeist mit dem Ochsenkarren und leichtere mit dem Maultiergespann und die Leute seien ansonsten zu Pferd oder zu Fuß unterwegs. Verblichene Schilder wiesen auf kleine Läden hin, zwei Lebensmittelgeschäfte, eine Apotheke, mehrere Kneipen, zwei Restaurants, die aus ein paar Metalltischen vor einer Fischtheke bestehen, außerdem ein Internetcafé, in dem es auch Batterien, Limo und Krimskrams zu kaufen gibt für die Besucher, die einmal in der Woche von einer Agentur für Ökotourismus hierher gebracht werden, um das beste Curanto von Chiloé zu essen. Darüber muss ich später schreiben, bisher habe ich es noch nicht gekostet.
Einige Leute kamen aus den Häusern und sahen mich scheu und schweigend an, bis sich ein plattnasiger Mann, wuchtig wie ein Kleiderschrank, ein Herz fasste und mich begrüßte. Er wischte sich die Hand an der Hose ab, ehe er sie mir hinhielt, und schenkte mir ein in Gold gefasstes Lächeln. Das war Aurelio Ñancupel, Nachfahr eines berühmten Piraten und auf der Insel unentbehrlich, weil man in seiner Kneipe anschreiben lassen kann, er Zähne zieht und einen Fernseher mit Flachbildschirm hat, vor dem seine Stammkundschaft sich schart, wenn es Strom gibt. Die Kneipe heißt »Taverne zum lieben Toten«; da sie günstig in der Nähe des Friedhofs liegt, ist sie Pflichtstation der Trauernden, die dort den Kummer der Beisetzung ertränken.
Ñancupel sei Mormone geworden, weil er mehrere Frauen heiraten wollte und nicht mitbekommen habe, dass die Mormonen wegen einer neuen Prophezeiung, die der US-Verfassung besser entspricht, der Vielweiberei abgeschworen haben, stellte Manuel mir den Mann vor, der sich dazu im Chor mit den Umstehenden vor Lachen bog. Manuel machte mich noch mit anderen Leuten bekannt, deren Namen ich nicht behalten konnte, die mir aber alle zu alt schienen, um die Eltern der Horde von Kindern hier zu sein; inzwischen weiß ich, es sind die Großeltern, denn die Generation dazwischen arbeitet nicht auf der Insel.
Dann kam eine Frau in den Fünfzigern die Straße entlang auf uns zu, sie hatte etwas Gebieterisches, war füllig und schön und hatte das beigefarbene Haar einer grau gewordenen Blondine im Nacken nachlässig hochgesteckt. Das war Blanca Schnake, die Rektorin der Schule, zu der die Leute respektvoll Tía Blanca sagen. Sie begrüßte Manuel mit dem hier üblichen Kuss auf die Wange und hieß mich im Namen der Gemeinde willkommen; das nahm allen die Anspannung, und der Kreis der Neugierigen um mich rückte näher. Tía Blanca bot an, mir am nächsten Tag die Schule zu zeigen, wo ich die Bibliothek, zwei Computer und ein paar Videospiele benutzen kann, vorerst bis März, dann sind die Ferien vorbei, und es wird nur noch zu bestimmten Zeiten möglich sein. Sie sagte auch, dass samstags im Schulhaus dieselben Filme gezeigt werden wie in Santiago, nur muss man hier keinen Eintritt zahlen. Dann löcherte sie mich mit Fragen, und ich fasste in meinem Anfängerspanisch meine zweitägige Anreise aus Kalifornien zusammen und erzählte, dass mir der Geldbeutel geklaut worden war, was die Kinder zum Lachen brachte, die aber sofort verstummten, als Tía Blanca ihnen einen frostigen Blick zuwarf. »Morgen mache ich euch Trogmuscheln mit Parmesan, damit die Gringuita die chilotische Küche kennenlernt. Um neun bei mir«, sagte sie zu Manuel. Inzwischen weiß ich, dass die Höflichkeit gebietet, mit einer Stunde Verspätung zu erscheinen. Hier wird sehr spät zu Abend gegessen.
Wir beendeten die kleine Dorfbesichtigung, kletterten auf einen Karren mit zwei Maultieren, auf dem schon der Kühlschrank stand, und ließen uns vom Kutscher und einem Begleiter im Schneckentempo über einen von Gras fast völlig überwucherten Weg fahren. Fákin lief hinterher.
Manuel wohnt ungefähr anderthalb Kilometer vom Dorf entfernt direkt am Meer, man kann aber wegen der Klippen dort nicht mit dem Boot anlegen. An seinem Haus könne man gut sehen, wie in der Gegend früher gebaut wurde, sagte er nicht ohne Stolz. In meinen Augen unterschied sich das Haus nicht sehr von denen im Dorf: Es steht ebenfalls auf Stelzen und ist aus Holz, aber er erklärte mir, dass die Pfosten und Balken noch mit der Axt behauen wurden, man die Rundschindeln, mit denen es verkleidet ist, heute nicht mehr bezahlen kann, und das Holz von Patagonischen Zypressen stammt, die es hier früher reichlich gab, heute aber kaum noch. Diese Zypressen können über dreitausend Jahre alt werden, sie sind nach den Baobabs in Afrika und den Redwoods in Kalifornien die langlebigsten Bäume der Welt.
Das Haus hat einen zentralen Wohnraum mit Galerie, in dem sich das Leben um einen rußgeschwärzten, wuchtigen Holzofen abspielt, der zum Heizen und Kochen dient. Unten gibt es zwei Schlafzimmer, ein mittelgroßes, das Manuel gehört, und ein kleineres, in dem ich schlafe, außerdem ein Badezimmer mit Waschbecken und Dusche. Innen besitzt das Haus keine Türen, aber im Türrahmen zur Toilette hängt eine gestreifte Wolldecke, hinter der man für sich sein kann. In dem Teil des Wohnraums, der als Küche dient, stehen ein schwerer Esstisch, ein Küchenschrank und eine Kiste mit Deckel für die Kartoffeln, die in Chiloé zu jedem Essen gehören; von der Decke hängen Bündel mit Kräutern, Chilischoten und Knoblauchzöpfe, Trockenwürste und schwere Eisentöpfe, mit denen man auf dem Holzfeuer kochen kann. In die obere Etage, wo Manuel die meisten seiner Bücher und Ordner stehen hat, gelangt man über eine Leiter. Bilder, Fotos oder sonstigen Schmuck gibt es nicht an den Wänden, überhaupt nichts Persönliches, bloß Karten vom Archipel und eine schöne Schiffsuhr mit Mahagonigehäuse und Bronzeschrauben, die aussieht wie von der Titanic gerettet. Im Freien hat Manuel ein großes Holzfass zu einer Badetonne umgebaut. Werkzeug, Brennholz, Kohle, Gasflaschen, die Kanister mit dem Benzin fürs Boot und der Generator stehen im Schuppen im Hof.
Mein Zimmer ist so schlicht wie das gesamte Haus; ein schmales Bett mit einer Decke, ähnlich der vorm Klo, ein Stuhl, eine Kommode mit drei Schubladen und mehrere Nägel an der Wand für Kleider. Ausreichend Platz für meine paar Habseligkeiten, die locker in meinen Rucksack passen. Ich mag diesen Männerhaushalt, beunruhigend finde ich bloß die zwanghafte Ordnung, die Manuel hält; ich sehe das nicht so eng.
Die Männer trugen den Kühlschrank an den vorgesehenen Platz, schlossen ihn an eine Gasflasche an, und dann setzten sie sich an den Esstisch, wo Manuel ein paar Flaschen Wein und einen Lachs servierte, den er in der Woche zuvor in einer Metalltrommel über Apfelholz geräuchert hatte. Aus dem Fenster aufs Meer schauend, tranken und aßen sie stumm, prosteten sich nur zuweilen mit ausgefeilten und feierlichen Wünschen zu: »Zum Wohlsein!« »Auf dass er Ihrer Gesundheit zuträglich sei!« »Dasselbe möchte ich Ihnen wünschen!« »Ihnen ein langes Leben!« »Mögen Sie zu meiner Beerdigung kommen!« Manuel warf mir verstohlene Blicke zu, fühlte sich offenbar unbehaglich, bis ich ihn zur Seite nahm und ihm sagte, er könne beruhigt sein, ich würde schon nicht über die Flaschen herfallen. Sicher hat meine Großmutter ihn vorgewarnt, und er wollte den Alkohol aus meinem Blickfeld räumen; aber das wäre absurd, schließlich liegt es nicht an dem Zeug, sondern an mir.
Unterdessen schlichen Fákin und die beiden Kater argwöhnisch umeinander herum und teilten das Revier untereinander auf. Der getigerte heißt Dusselkater, weil er leider einen Dachschaden hat, der karottenrote ist der Literatenkater, weil er am liebsten auf dem Computer liegt; Manuel behauptet, er kann lesen.
Die Männer beendeten das Essen, tranken ihren Wein aus und verabschiedeten sich. Mich wunderte, dass Manuel keine Anstalten machte, sie zu bezahlen, so wenig wie die anderen, die ihm beim Transport geholfen hatten, aber es wäre mir taktlos erschienen, ihn danach zu fragen.
Manuel zeigte mir sein Arbeitszimmer auf der Galerie, wo zwei Schreibtische stehen, ein Aktenschrank mit Ordnern, Bücherregale, ein ziemlich neuer Rechner mit zwei Bildschirmen, ein Faxgerät und ein Drucker. Es gibt einen Internetanschluss, aber er erinnerte mich (unnötigerweise) daran, dass ich keine Mails schreiben soll. Dann meinte er noch etwas verlegen, er habe seine gesamte Arbeit auf diesem Rechner und sähe es lieber, wenn niemand außer ihm dort dranginge.
»Was arbeitest du?«
»Ich bin Anthropologe.«
»Anthropophage?«
»Ich erforsche die Menschen, ich esse sie nicht.«
»Himmel, das sollte ein Scherz sein. Euch Anthropologen geht doch langsam das Material aus; heutzutage hat auch der letzte Wilde ein Handy und einen Fernseher.«
»Ich bin nicht auf Wilde spezialisiert. Ich schreibe ein Buch über die Mythologie von Chiloé.«
»Und kriegst Geld dafür?«
»Wenig.«
»Man sieht, dass du nicht viel hast.«
»Ja, aber es reicht mir zum Leben.«
»Ich will dir nicht auf der Tasche liegen.«
»Du wirst arbeiten, um die Mehrkosten zu decken, Maya, das ist mit deiner Großmutter abgesprochen. Du kannst mir mit dem Buch helfen, und ab März arbeitest du bei Blanca in der Schule.«
»Ich warne dich: Ich habe von nichts Ahnung, null.«
»Was kannst du?«
»Kekse und Brot backen, Schwimmen, Fußball spielen und Samurai-Gedichte schreiben. Du solltest meinen Wortschatz sehen! Ich bin ein wandelndes Wörterbuch, allerdings ein englisches. Ich glaube kaum, dass du damit was anfangen kannst.«
»Wir werden sehen. Die Kekse haben Zukunft.« Mir kam es vor, als verkniffe er sich ein Lächeln.
»Hast du schon andere Bücher geschrieben?«, fragte ich und musste gähnen; die lange Reise steckte mir in den Knochen, und die fünf Stunden Zeitverschiebung zwischen Kalifornien und Chile machten mich schwer wie einen Sack mit Steinen.
»Nichts, womit ich berühmt werden könnte«, sagte er und zeigte auf einige Bücher auf seinem Schreibtisch: Traumwelt der australischen Ureinwohner, Initiationsriten der Stämme am Orinoco, Schöpfungsmythen der Mapuche in Südchile.
»Meine Nini sagt, Chiloé sei magisch.«
»Die ganze Welt ist magisch, Maya.«
Wenn man Manuel Arias glauben will, dann hat sein Haus eine sehr alte Seele. Meine Nini sagt ebenfalls, dass Häuser Erinnerungen und Empfindungen aufbewahren, sie kann ihre Schwingungen spüren. Sie weiß, ob die Luft in einem Raum mit schlechten Energien getränkt ist, weil sich dort Verhängnisvolles zugetragen hat, oder ob die Kraftfelder wohltuend sind. Ihr Haus in Berkeley besitzt eine gute Seele. Wenn wir wieder dort einziehen, muss einiges renoviert werden (es stürzt bald ein vor Altersschwäche), aber dann möchte ich darin wohnen bis ans Ende meiner Tage. Ich bin dort aufgewachsen, oben auf der Kuppe eines Hügels, wo der Blick über die Bucht von San Francisco eindrucksvoll wäre, stünden nicht zwei ausladende Kiefern davor. Mein Pop wollte sie nie fällen lassen, er sagte, Bäume würden leiden, wenn man sie verstümmelt, und mit ihnen litte die Vegetation im Umkreis von tausend Metern, weil unterirdisch alles miteinander verbunden sei; es wäre ein Verbrechen, zwei Kiefern zu töten wegen des Blicks auf eine Pfütze Wasser, die man ebenso gut vom Highway aus betrachten kann.
Der erste Paul Ditson kaufte das Haus im Jahr 1948, kaum dass Nichtweiße in Berkeley das Recht zum Erwerb von Grundbesitz bekamen. Die Ditsons waren die ersten Schwarzen im Viertel und blieben zwanzig Jahre die einzigen, dann zogen noch ein paar andere hin. Gebaut hat das Haus 1885 ein Orangen-Magnat, der sein gesamtes Vermögen nach seinem Tod der Universität vermachte und die eigene Familie mittellos zurückließ. Lange Zeit stand das Haus leer, wechselte dann häufig den Besitzer und verfiel zusehends, bis die Ditsons es erwarben und wieder instand setzen konnten, denn die Bausubstanz und die Fundamente sind gut. Nach dem Tod der Eltern kaufte mein Pop seinen Geschwistern ihren Anteil ab und wohnte vorerst allein in diesem Relikt aus viktorianischer Zeit, das sechs Schlafzimmer und aus unerfindlichen Gründen einen Glockenturm besitzt, in dem er sein Teleskop aufstellte.
Als Nidia und Andy Vidal bei ihm einzogen, bewohnte er nur zwei Zimmer, die Küche und das Bad; das restliche Haus war ungenutzt. Meine Nini fegte wie ein Wirbelwind der Erneuerung durch die Räume, warf altes Gerümpel auf den Müll, putzte und räucherte Ungeziefer aus, aber ihre Aufräumwut blieb gegen das eingefleischte Tohuwabohu ihres Ehemanns ohne Chance. Nach vielen Reibereien kamen die beiden überein, dass sie im Haus tun und lassen konnte, was sie wollte, solange sie um das Arbeitszimmer und den Sternguckerturm einen Bogen machte.
In Berkeley blühte meine Nini auf, in dieser verdreckten, radikalen, flippigen Stadt mit ihrer Mischung aller Hautfarben, wo mehr Genies und Nobelpreisträger wohnen als irgendwo sonst auf der Welt, es edle Absichten zuhauf gibt, ein intolerantes Weltverbesserertum. Meine Nini veränderte sich; als junge Witwe muss sie zurückhaltend und verantwortungsbewusst gewesen sein und hatte nicht auffallen wollen, doch in Berkeley trat ihr wahres Ich zutage. Hier musste sie keine Chauffeursuniform tragen wie in Toronto und nicht den gesellschaftlichen Schein wahren wie in Chile; hier kannte sie niemand, sie konnte sich neu erfinden. Sie übernahm den Stil der Hippies, die auf der Telegraph Avenue herumhingen und inmitten von Räucherstäbchen- und Marihuanaschwaden selbstgebastelten Schmuck verkauften. Sie trug Gewänder, Sandalen und billige Halsketten aus Indien, war aber alles andere als ein Hippie: Sie arbeitete, kümmerte sich um den Haushalt und um ihre Enkelin, engagierte sich im Viertel, und ich habe nie erlebt, dass sie bekifft Gesänge in Sanskrit angestimmt hätte.
Zum Entsetzen der Nachbarn, fast alles Kollegen ihres Ehemanns, die in düsteren, efeuüberwucherten, vage englisch anmutenden Häusern lebten, ließ meine Nini die Ditson-Villa in psychedelischen Farben streichen, wie sie das in der Castro Street in San Francisco gesehen hatte, wo sich die Schwulen damals niederließen und die alten Häuser aufpeppten. Wegen der violetten und grünen Fassade, der gelben Friese und Blumengirlanden aus Stuck kam es zu Gerede, und sie wurde ein paarmal aufs städtische Bauamt zitiert, aber dann druckte eine Architekturzeitschrift ein Foto von dem Haus, es avancierte zu einer Sehenswürdigkeit der Stadt und wurde alsbald kopiert von pakistanischen Restaurants, von Läden für junge Leute und Künstlerateliers.
Auch der Inneneinrichtung drückte meine Nini ihren Stempel auf. Die wuchtigen Möbel, Standuhren und grausigen Ölschinken in Goldrahmen, die der erste Ditson angeschafft hatte, bekamen einen künstlerischen Touch durch Unmengen von Lampen mit Troddeln, verschlissene Teppiche, türkische Diwane und Spitzengardinen. Mein Zimmer war mangofarben gestrichen, hatte einen indischen Baldachin mit kleinen, umstickten Spiegelchen überm Bett, und in der Mitte hing ein geflügelter Drache, der mich hätte erschlagen könne, wäre er runtergefallen; an die Wände hatte sie Fotos von unterernährten afrikanischen Kindern gepinnt, damit ich sah, wie diese armen Geschöpfe vor Hunger starben, und aufhörte, das Essen zu verweigern. Mein Pop meinte allerdings, der Drache und die Hungerkinder würden mich um den Schlaf bringen und mir den Appetit rauben.
Meine Gedärme sind einem Frontalangriff chilenischer Bakterien ausgesetzt. Am zweiten Tag auf dieser Insel fiel ich mit Magenkrämpfen ins Bett, und ich habe noch immer Schüttelfrost und sitze stundenlang mit der Wärmflasche auf dem Bauch am Fenster. Meine Großmutter würde sagen, ich gebe meiner Seele Zeit, mir nach Chiloé zu folgen. Sie hält Flugreisen für nicht ratsam, weil die Seele den Körper so schnell nicht begleiten kann, ihm hinterherhechelt und manchmal auf der Strecke bleibt; das wird wohl der Grund sein, weshalb viele Piloten, wie mein Vater, nie richtig anwesend sind: Sie warten auf ihre Seele, die noch in den Wolken unterwegs ist.
Hier kann man keine DVDs oder Videospiele leihen, Filme gibt es nur einmal in der Woche in der Schule. Mein einziger Zeitvertreib sind die schwülstigen Liebesromane von Blanca Schnake und Bücher über Chiloé, alle auf Spanisch, was sehr gut ist, um die Sprache zu lernen, aber das Lesen fällt mir schwer. Manuel hat mir eine batteriebetriebene Stirnlampe gegeben; mit den Lampen sitzen wir da wie Grubenarbeiter und lesen, wenn der Strom ausfällt. Über Chiloé kann ich noch nicht viel sagen, ich habe das Haus fast nicht verlassen, dagegen könnte ich seitenlang über Manuel Arias, die Katzen und den Hund schreiben, die jetzt meine Familie sind, über Tía Blanca, die ständig hier vorbeischaut, weil sie mich angeblich besuchen will, dabei sieht ein Blinder, dass sie wegen Manuel kommt, und über Juanito Corrales, einen Jungen, der uns auch täglich besucht, um mit mir zu lesen und mit Fákin zu spielen. Der Hund ist sehr wählerisch, was seinen Umgang betrifft, lässt den Jungen aber gewähren.
Gestern habe ich Juanitos Großmutter kennengelernt. Wir sind uns nicht früher begegnet, weil sie in Castro war, der Hauptstadt von Chiloé, wo ihr Mann im Krankenhaus liegt; dem wurde im Dezember ein Bein amputiert, und die Wunde will nicht heilen. Eduvigis Corrales hat eine Hautfarbe wie Terrakotta, ein heiteres, faltiges Gesicht, einen breiten Rumpf und kurze Beine, eine typische Chilotin. Ihr Haar trägt sie, zu einem dünnen Zopf geflochten, um den Kopf festgesteckt, und sie zieht sich an wie eine Missionarin: dicker Wollrock und Holzfällerschuhe. Man könnte sie für sechzig halten, dabei ist sie nicht älter als fünfundvierzig; hier altern die Leute früh und leben lange. Sie hatte einen Eisentopf dabei, schwer wie eine Kanone, wuchtete ihn in der Küche auf den Herd und redete dabei überstürzt auf mich ein, wovon ich ungefähr mitbekam, dass sie sich mit dem gebührenden Respekt vorstellen wolle, sie sei die Eduvigis Corrales, die Nachbarin des Herrn und kümmere sich um den Haushalt. »Heihei! Was ein hübsches Dingelchen, diese Gringuita! Schütz sie Gott! Der Herr hat sie ja erwartet, wie alle hier auf der Insel, ja hoffentlich schmeckt ihr das Hühnchen mit den Kartoffeln, das ich ihr gebracht hab.« Was sie sprach, war nicht ein Dialekt aus der Gegend, wie ich erst dachte, sondern ein sehr überhastetes Spanisch. Ich reimte mir zusammen, dass mit »der Herr« Manuel Arias gemeint sein musste, von dem Eduvigis in der dritten Person sprach, obwohl er daneben stand.
Mir gegenüber schlägt Eduvigis inzwischen denselben Befehlston an wie meine Großmutter. Die gute Frau kommt zum Putzen, nimmt die schmutzige Wäsche mit und bringt sie sauber zurück, hackt Holz mit einer Axt, die ich nicht mal hochheben kann, beackert ihr Stück Land, melkt ihre Kuh, schert Schafe und versteht sich aufs Schweineschlachten, hat mir aber erklärt, dass sie nicht mehr zum Fischen und zum Krabbenfang rausfährt wegen ihrer Arthritis. Sie sagt, ihr Mann sei nicht von Natur aus böse, wie die Leute im Dorf glaubten, doch habe die Diabetes seinem Charakter arg zugesetzt, und seit er das Bein verloren habe, wolle er nur noch sterben. Von ihren fünf Kindern, die am Leben sind, wohnt bloß ihre dreizehnjährige Tochter Azucena noch bei ihr, und sie hat ihren Enkel Juanito bei sich, der zehn ist, aber jünger wirkt, weil er von Geburt an »von den Geistern berührt« ist, wie sie mir erklärt hat. Das kann bedeuten, dass der Betreffende geistig zurückgeblieben ist oder dass er mehr Geist besitzt als Materie; bei Juanito muss es Letzteres sein, er ist nämlich alles andere als dumm.
Eduvigis lebt von dem, was ihr Land hergibt, was sie bei Manuel verdient und was ihre Tochter, Juanitos Mutter , die in einer Lachsfabrik im Süden der Isla Grande arbeitet, an Unterstützung schickt. Die industrielle Zucht von Lachsen in Chiloé war nach der norwegischen die zweitgrößte der Welt und hat die Gegend wirtschaftlich vorangebracht, jedoch den Meeresboden verseucht, die kleinen Fischer ruiniert und viele Familien auseinandergerissen. Mittlerweile ist die Industrie am Ende, sagt Manuel, man hat zu viele Fische in die Käfige gepfercht und ihnen Unmengen von Antibiotika verabreicht, deshalb konnte man sie, als ein Virus grassierte, nicht retten. Zwanzigtausend Leute, die meisten davon Frauen, verloren ihre Arbeit bei den Lachsfarmen, aber die Tochter von Eduvigis hat ihre Stelle noch.
Wir setzten uns bald zu Tisch. Als der Deckel gehoben wurde und mir der Duft in die Nase stieg, fühlte ich mich wie als kleines Kind in der Küche meiner Großeltern und bekam feuchte Augen vor Heimweh. Eduvigis’ Hühnereintopf war meine erste feste Nahrung seit Tagen. Dieses Kranksein ist peinlich gewesen, in einem Haus ohne Türen konnte ich die Spuckerei und den Durchfall unmöglich verheimlichen. Ich fragte Manuel, was mit den Türen passiert sei, und er sagte, er lebe lieber in offenen Räumen. Ich habe mir an den Trogmuscheln mit Parmesan und dem Guavenkuchen von Tía Blanca den Magen verdorben, da bin ich mir sicher. Manuel tat erst, als bekomme er nicht mit, was auf der Toilette geschah, konnte das aber nicht lange durchhalten, denn ich sah aus wie meine eigene Leiche. Ich hörte, wie er über Handy mit Blanca sprach und sich Rat holte, dann kochte er mir Reissuppe, wechselte meine Bettwäsche und brachte mir die Wärmflasche. Er behält mich verstohlen im Auge, sagt keinen Ton, ist aber zur Stelle, wenn ich etwas brauche. Auf meine leisen Versuche, mich zu bedanken, antwortet er mit Grummeln. Außerdem hat er Liliana Treviño angerufen, die Krankenschwester im Ort, eine junge, kleine, stämmige Frau mit ansteckendem Lachen und einer nicht zu bändigenden Mähne krauser Haare, und sie hat mir ein paar riesige, raue Kohletabletten vorbeigebracht, die man kaum schlucken kann. Weil sie überhaupt nicht halfen, lieh Manuel sich den kleinen Lieferwagen vom Gemüseladen und brachte mich ins Dorf zum Arzt.
Donnerstags kommt das Boot vom staatlichen Gesundheitsdienst auf seiner Rundreise zu den Inseln hier vorbei. Der Arzt sah aus wie vierzehn, ein Milchgesicht mit Brille, hatte meinen Zustand aber auf den ersten Blick erfasst: »Chilenitis, das kriegen alle Ausländer, die nach Chile kommen. Das geht wieder weg.« Und er gab mir ein paar Tabletten in einem Papiertütchen. Eduvigis brühte mir einen Kräutertee auf, weil sie den Medikamenten aus der Apotheke nicht vertraut, das sei bloß Geldschneiderei von den amerikanischen Herstellern, sagt sie. Ich habe ihren Tee brav getrunken, und langsam geht es mir besser. Eduvigis Corrales gefällt mir, sie redet wie ein Wasserfall, genau wie Tía Blanca; die übrigen Leute hier sind wortkarg.