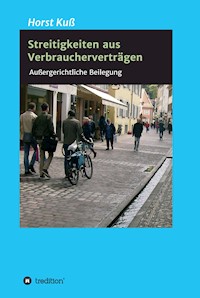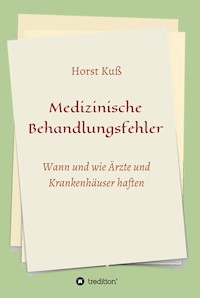
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Deutschland ereignen sich in ärztlichen Praxen und Krankenhäusern / Kliniken jährlich rd. 190.000 Behandlungsfehler. Hinzu kommen zehntausende vermutete medizinische Fehlleistungen. Lange Zeit waren das Recht medizinischer Behandlungen und das Arzthaftungsrecht nicht gesetzlich geregelt. Die entsprechenden Grundsätze ergaben sich vielmehr aus der Rechtsprechung. Durch das am 26.02.2013 in Kraft getretene "Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten", kurz: Patientenrechtegesetz (PatRG), sind mit einer Ergänzung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) um die Paragrafen 630a bis 630h gesetzliche Regelungen für den beonderen Typ des medizinischen Behandlungsvertrages geschaffen worden. Neben der ausführlichen Erläuterung der neuen BGB-Vorschriften gibt das Werk in allgemeinverständlicher Sprache (sämtliche unvermeidlichen Fachausdrücke werden erläutert) zunächst einen Überblick über die fachlichen Grundlagen des ärztlichen Handelns. Breiten Raum nehmen Beschreibungen der beiden Arten von Behandlungsfehlern (einfache und grobe) mit zahlreichen Beispielen aus der Rechtsprechung ein. Sodann werden die zivilrechtlichen Haftungsgrundlagen in Gestalt der beiden Haftungsordnungen "Vertragshaftung" und "Haftung aus unerlaubter Handlung" (Deliktshaftung) vorgestellt. Weiterhin werden die Ansprüche von Patienten nach festgestellten Behandlungsfehlern in Form von Schadensersatz und Schmerzensgeld detailliert beschrieben. Letztlich wird auf die Verjährung der Ansprüche von Patienten eingegangen. Im Anhang werden die Behandlung durch Heilpraktiker und die Leistungen von Hebammen auch unter Haftungsgesichtspunkten dargestellt. Es folgt eine Zusammenfassung der wichtigsten zitierten Gesetzesvorschriften. Den Abschluss bildet ein ausführliches Stichwortverzeichnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
www.tredition.de
Horst Kuß
Medizinische Behandlungsfehler
Wann und wie Ärzte und Krankenhäuser haften
www.tredition.de
© 2015 Horst Kuß
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7323-4657-8
Hardcover:
978-3-7323-4658-5
e-Book:
978-3-7323-4659-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
.Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Vorwort
Kapitel 2: Abkürzungsverzeichnis
Kapitel 3: Einführung
Kapitel 4: Grundlagen für medizinische Behandlungen
1. Begriffsbestimmung
2. Allgemein anerkannte fachliche Behandlungsstandards
3. Allgemein anerkannter Standard der medizinischen Erkenntnisse
4. Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)
5. Leitlinien ärztlicher Fachgremien und Verbände
Kapitel 5: Abweichende Behandlungen
Kapitel 6: Zur medizinischen Behandlung befähigte Ärzte
1. Allgemeines
2. Facharzt für Humanmedizin
3. Zahnarzt
Kapitel 7: Mangelnde Befähigung des Behandelnden
Kapitel 8: Organisation des Behandlungsgeschehens
Kapitel 9: Die einleitenden Schritte für eine medizinische Behandlung
1. Anamnese
2. Untersuchungen
3. Befunde
4. Diagnose
Kapitel 10: Aufklärung des Patienten
1. Anforderungen an sämtliche Aufklärungen
2. Therapeutische Aufklärung (Sicherungsaufklärung)
2.1 Sinn und Zweck
2.2 Art und Umfang
2.3 Schwangerschaftsabbruch nach der Fristenregelung
2.4 Vorgeburtliche Diagnostik
2.5 Nachweis
2.6 Genetischer Beratungsvertrag
3. Wirtschaftliche Aufklärung
3.1 Umfang
3.2 Wahlleistungen im Krankenhaus
3.3 Individuelle Gesundheitsleistungen(IgeL)
3.4 Unterlassene / mangelhafte Aufklärung
4. Risikoaufklärung (Eingriffsaufklärung)
4.1 Grundlage des Anspruchs
4.2 Sinn und Zweck
4.3 Umfang
4.4 Risiken
4.5 Alternative Behandlungsmöglichkeiten
4.6 Neue Behandlungsmethoden
4.7 Wechsel von Medikamenten
4.8 Heilversuche mit neuen Medikamenten
4.9 Arten der Aufklärung
4.10 Aufklärung eines stellvertretend Berechtigten
4.11 Rechtzeitigkeit der Aufklärung
4.12 Nachweis
5. Ausnahmen von der Aufklärungspflicht
Kapitel 11: Einwilligung in die Behandlung
1. Rechtliche Grundlage
2. Inhalt
3. Wirksamkeit
4. Reichweite
5. Begrenzung
6. Mangelnde Einwilligungsfähigkeit
6.1 Minderjährige Kinder
6.2 Nicht einwilligungsfähige Volljährige
6.3 Zur Einwilligung stellvertretend Berechtigte
6.4 Einbeziehung einwilligungsunfähiger Patienten
7. Nachweis
8. Widerruf der Einwilligung
9. Mutmaßliche Einwilligung
10. Patientenverfügung
11. Andere Vorschriften
Kapitel 12: Konkrete Behandlung (Therapie)
1. Grundsätzlich Dienstleistung
2. Anforderungen
3. Überweisung des Patienten
Kapitel 13: Voll beherrschbare Risiken
1. Allgemeines
2. Koordinierung von medizinischen Leistungen
2.1 Fachärzte untereinander (horizontale Ebene)
2.2 Zusammenarbeit mit nachgeordnetem Personal (vertikale Ebene)
3. Hygiene
4. Zu verwendende Stoffe
5. Einsatz von Geräten
6. Lagerungsschaden
7. Verletzung durch Pflegepersonal
8. Vorsorgemaßnahmen für Patienten
Kapitel 14: Dokumentation der Behandlung
1. Sinn und Zweck
2. Führung einer Patientenakte
3. Zeitlicher Gleichlauf mit der Behandlung
4. Inhalt und Umfang
5. Fehlende Aufzeichnungen
6. Aufbewahrungsfristen für Patientenakten
Kapitel 15: Einsichtnahme in die Patientenakte
1. Grundsätzliches Recht des Patienten
2. Einschränkungen des Rechts des Patienten
2.1 Erhebliche therapeutische Gründe
2.2 Erhebliche Rechte Dritter
2.3 Begründung der Einschränkung
3. Zeitpunkt der Einsichtnahme
4. Ort der Einsichtnahme
5. Art und Weise der Einsichtnahme
6. Erben und nächste Angehörige
7. Durchsetzung des Anspruchs auf Einsichtnahme
Kapitel 16: Die beiden Arten von Behandlungsfehlern
1. Einfacher Behandlungsfehler
2. Grober Behandlungsfehler
3. Warum die Unterscheidung?
4. Bewertung und Einstufung eines Behandlungsfehlers
Kapitel 17: Pflicht des behandelnden Arztes zur Offenbarung von Behandlungsfehlern
Kapitel 18: Grundsätzliche Beweispflichten des Patienten bei vermuteten Behandlungsfehlern
1. Allgemeines
2. Abschluss eines Behandlungsvertrages
3. Vorliegen eines Behandlungsfehlers
3.1 Gerichtliches Verfahren
3.2 Selbständiges Beweisverfahren
3.3 Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen
3.4 Gutachten der Gesetzlichen Krankenkassen
4. Entstandener Gesundheitsschaden
5. Kausalität (Ursächlichkeit)
5.1 Haftungsbegründende Kausalität
5.2 Haftungsausfüllende Kausalität
5.3 Nachweis
6. Verschulden der Behandlungsseite
Kapitel 19: Tatsachenvermutungen zugunsten des Patienten
1. Allgemeines
2. Mangelnde Befähigung des Behandelnden
3. Voll beherrschbare Risiken
4. Unterlassene / nicht aufbewahrte Dokumentation
5. Umkehr der Beweispflicht bei groben Behandlungsfehlern
6. Unterlassene Erhebung / Sicherung medizinisch gebotener Befunde
7. Beweis des ersten Anscheins
8. Hypothetische (angenommene) Einwilligung
Kapitel 20: Zivile Haftungsregelungen
1. Zwei Haftungsordnungen
2. Vertragshaftung
2.1 Einzelpraxis
2.2 Gemeinschaftspraxis
2.3 Praxisgemeinschaft
2.4 Krankenhaus-Ambulanz
2.5 Von einem (Chef-)Arzt betriebene Ambulanz
2.6 Vom Klinikträger betriebene andere Ambulanzen
2.7 Einheitlicher Krankenhausaufnahmevertrag
2.8 Gespaltener Krankenhausaufnahmevertrag
2.9 Einheitlicher Krankenhausaufnahmevertrag mit Arztzusatzvertrag
3. Haftung aus unerlaubter Handlung (Delikt)
3.1 Eigenhaftung
3.2 Organhaftung
3.3 Geschäftsherrenhaftung
3.4 Haftungsprivileg beamteter Ärzte
Kapitel 21: Ansprüche des Patienten nach Behandlungsfehlern
1. Schadensersatz
1.1 Aufwendungen für die unmittelbare Schadensbeseitigung
1.2 Schadenfolgekosten
1.3 Fehlerhafte genetische Beratung
1.4 Fehlgeschlagene Sterilisation
1.5 Fehler bei der Empfängnisverhütung
1.6 Schwangerschaftsabbruch
1.7 Fehlerhafte vorgeburtliche Diagnostik
2. Schmerzensgeld
2.1 Sinn und Zweck
2.2 Anwendungsbereich
2.3 Verletzung des Körpers
2.4 Verletzung der Gesundheit
2.5 Schockschaden
2.6 Bemessung
2.7 Kapital und / oder Rente
Kapitel 22: Verjährung der Ansprüche des Patienten
1. Regel-Verjährungsfrist
2. Kenntnis vom Schaden
3. Grob fahrlässige Unkenntnis
4. Darlegungs- und Beweispflichten
5. Vorkehrungen gegen den Ablauf der Regel-Verjährungsfrist
6. Maximale Verjährungsfrist
Anhang 1: Behandlung durch Heilpraktiker
1. Allgemeines
2. Qualifikation
3. Tätigkeitsbereich
4. Sorgfaltspflichten
Anhang 2: Leistungen von Hebammen / Entbindungspflegern
1. Art und Umfang der Tätigkeit
2. Beleghebamme
3. Geburtshaus
Anhang 3: Die wichtigsten zitierten Gesetzesvorschriften
Stichwortverzeichnis
Kapitel 1: Vorwort
Nach einer im Januar 2014 veröffentlichten Studie des Bundesverbandes der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) ereignen sich in Krankenhäusern und medizinischen Praxen in Deutschland Jahr für Jahr rund 190.000 Behandlungsfehler. Außerdem beschweren sich jährlich zehntausende Patienten wegen des Verdachts auf ärztliche oder andere medizinische Fehlleistungen.
Nach Mitteilung der Bundesärztekammer sind im Jahr 2014 bei den Ärztekammern 12.053 Patientenbeschwerden wegen vermuteter Behandlungsfehler eingegangen. In 2.252 Fällen wurde von den bei den Ärztekammern eingerichteten Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen (Kapitel 18Ziffer 3.3) ein ärztlicher Fehler bestätigt. In 1.854 Fällen wurde Patienten ein Anspruch auf Entschädigung (Kapitel 21) zuerkannt. In 751 Fällen führten die Fehler zu einem Dauerschaden. 73 Patienten sind an den Folgen einer fehlerhaften Behandlung gestorben.
Im Jahr 2014 hat der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) (Kapitel 18Ziffer 3.4) 14.663 Gutachten über vermutete Behandlungsfehler erstellt. Dabei kamen die Gutachterinnen und Gutachter in fast 3.800 Fällen zu dem Ergebnis, dass ein Behandlungsfehler vorliegt. 1.294 Patienten haben einen Dauerschaden erlitten. Außerdem sind 155 Patienten an direkten oder indirekten Folgen eines Behandlungsfehlers gestorben.
Vor dem Hintergrund dieser Zahlen wollen die nachfolgenden Ausführungen in allgemeinverständlicher Sprache einen Überblick über die wesentlichen Gesichtspunkte bei vermutetem fehlerhaftem ärztlichem Handeln geben.
Nichts ist vollkommen. Für Anregungen und konstruktive Kritik bin ich daher dankbar.
Freiburg, im Juli 2015
Horst Kuß
Kapitel 2: Abkürzungsverzeichnis
a. a. O.
am angegebenen Ort
Abs.
.Absatz
AIDS
Acquired Immune Deficiency Syndrome (engl.); schwere Störung des menschlichen Immunsystems
Art.
Artikel
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGH
Bundesgerichtshof
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
CD
Compact Disc (engl); optischer (Daten-)Speicher
CT
Computer-Tomografie; Röntgenuntersuchungstechnik
d. h.
das heißt
DVD
Digital-Versatile Disc (engl.); optischer (Daten-)Speicher mit sehr hoher Kapazität
einschl.
einschließlich
evtl
eventuell/e/r
f.
folgende/r
ff.
fortfolgende
ggf.
gegebenenfalls
gem.
gemäß
HIV
Human Immunodeficiency Virus; AIDS-Erreger
Kfz
Kraftfahrzeug
KHEntgG
Krankenhausentgeltgesetz
km
Kilometer
MRT
Magnet-Resonanz-Tomografie (bildhafte Darstellung von Struktur und Funktion von Geweben und Organen im Körper)
Nr
Nummer
rd
rund
SGB
Sozialgesetzbuch; die römische Ziffer bezeichnet die Nummer des Buches
s . o.
siehe oben
sog
sogenannte/r
StGB
Strafgesetzbuch
StPO
Strafprozessordnung
u. a.
unter anderem
usw.
.und so weiter
u. U.
unter Umständen
vgl.
vergleiche
VVG
Versicherungsvertragsgesetz
z. B.
zum Beispiel
ZPO
Zivilprozessordnung
Kapitel 3: Einführung
Sucht eine natürliche Person eine Arztpraxis oder ein Krankenhaus zur Behandlung auf, wird sie dadurch zum Patienten. Grundlage für die dann folgenden medizinischen Maßnahmen ist ein Behandlungsvertrag, für den keine besondere Form vorgeschrieben ist. Schriftliche Vereinbarungen werden in der Regel nur bei stationären Krankenhausbehandlungen getroffen.
Lange Zeit waren Behandlungs- und Arzthaftungsrecht nicht gesetzlich geregelt. Die entsprechenden Grundsätze ergaben sich vielmehr aus dem Richterrecht. Nunmehr sind durch das am 26.02.2013 in Kraft getretene „Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten“, kurz: Patientenrechtegesetz, u. a. mit einer Ergänzung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) um die §§ 630a bis 630h, gesetzliche Regelungen für diesen besonderen Dienstvertragstyp geschaffen worden.
Die neuen Vorschriften legen Informations- und Aufklärungspflichten der Behandlungsseite gegenüber Patienten, die Verpflichtung zur Dokumentation der Behandlung, das Akteneinsichtsrecht der Patienten und die Grundzüge der Beweisverteilung bei Fehlern fest. Gleichzeitig werden Unklarheiten beseitigt, die sich aus der bisherigen Rechtsprechung ergeben haben.
Wesentliche Neuerungen sind
die in § 630c Abs. 2 Satz 3 BGB festgelegte strafprozessuale Beweismittelbeschränkung als Anreiz zur Erfüllung der Pflicht gemäß § 630c Abs. 2 Satz 2 BGB zur Offenbarung von dem Arzt selbst oder seinen nächsten Angehörigen unterlaufenen Behandlungsfehlern (Kapitel 17),
die Verpflichtung gem. § 630e Abs. 5 BGB zur stärkeren Einbeziehung von minderjährigen und einwilligungsunfähigen volljährigen Patienten in das Behandlungsgeschehen (Kapitel 11Ziffer 6.4) und
eine eindeutige Regelung in § 630g Abs. 1 BGB über das grundsätzlich uneingeschränkte Recht des Patienten auf Einsichtnahme in seine Patientenakte (Kapitel 15).
Ergänzend wird in Anhang 1 auf die Behandlung durch Heilpraktiker und in Anhang 2 auf die Leistungen von Hebammen eingegangen. In Anhang 3 sind die wichtigsten zitierten Gesetzesvorschriften zusammengefasst. Den Abschluss bildet ein ausführliches Stichwortverzeichnis.
Kapitel 4: Grundlagen für medizinische Behandlungen
1. Begriffsbestimmung
Unter einer medizinischen Behandlung ist grundsätzlich die Heilbehandlung zu verstehen. Diese umfasst jegliche heilberufliche Tätigkeit, die durch die betreffende Krankheit verursacht worden ist. Dabei muss die Art der Behandlung in den Rahmen der medizinisch notwendigen Krankenpflege fallen und auf Heilung oder Linderung der Krankheit abzielen.
2. Allgemein anerkannte fachliche Behandlungsstandards
Gem. § 630a Abs. 2, 1. Halbsatz BGB sind medizinische Behandlungen nach den zu deren Zeitpunkt bestehenden, allgemein anerkannten fachlichen Standards durchzuführen.
Begriffsbestimmung:
Die allgemein anerkannten fachlichen Behandlungsstandards umfassen jeweils
die Erfüllung aller von einem Arzt auf seinem Fachgebiet zu erwartenden Anforderungen auf der Grundlage des jeweils maßgebenden Stands von medizinischer Wissenschaft und Forschung und
eine sich an der jeweiligen Behandlung ausrichtende, sich aus dem Vertrauensschutz ergebende objektivierte (von persönlichen und gefühlsmäßigen Einflüssen freie) sorgfältige Vorgehensweise des Arztes.
Innerhalb dieses Rahmens können Ärzte sowohl beim diagnostischen Verfahren (möglichst genaue Zuordnung von Befunden zu einem Krankheitsbild oder -begriff) als auch im Therapiebereich (medizinische Maßnahmen zur Behandlung oder Heilung von Krankheiten) ihren jeweils vorhandenen Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum nutzen.
Die fachlichen Anforderungen an einen Arzt erstrecken sich auf die nachfolgend im Einzelnen aufgeführten Bereiche. Dabei gilt generell: Das medizinische Fachwissen verändert sich schnell, insbesondere im Diagnose- und Therapiebereich. Deshalb ist jeder Arzt verpflichtet, sich durch ständige Fortbildung mittels einschlägiger Fachzeitschriften und in fachspezifischen Veranstaltungen der Ärzteorganisationen, aber auch von Pharmaherstellern zum Wohl seiner Patienten auf dem neuesten Stand zu halten. Neue Erkenntnisse, die wissenschaftlich gesichert sind, muss er zeitnah im Berufsalltag umsetzen.
3. Allgemein anerkannter Standard der medizinischen Erkenntnisse
Medizinische Erkenntnisse können wegen des dazu erforderlichen fachlichen Wissens nur von der Medizin selbst gewonnen werden. Dabei werden nicht nur der diagnostische und therapeutische Nutzen, sondern auch die medizinische Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit von Behandlungsmethoden bewertet.
Allgemein anerkannt bedeutet, dass eine Behandlungsmethode von der weit überwiegenden Mehrheit der jeweiligen in- und ausländischen Fachleute und/oder Fachkreise als wirksam und sachgerecht eingestuft wird.
Standard ist, was zur Zeit der Behandlung auf dem betreffenden Fachgebiet dem gesicherten Stand der medizinischen Wissenschaft entspricht/entsprach und in der medizinischen Praxis zur Behandlung der jeweiligen gesundheitlichen Störung anerkannt ist/war.
Nach § 276 BGB schuldet ein Arzt einem Patienten vertraglich wie deliktisch (aus unerlaubter Handlung) die im Verkehr erforderliche Sorgfalt. Diese bestimmt sich weitgehend nach dem medizinischen Standard des jeweiligen Fachgebiets. Das bedeutet, dass ein Arzt diejenigen Maßnahmen ergreifen muss, die von einem gewissenhaften und aufmerksamen Mediziner aus berufsfachlicher Sicht seines Fachbereichs vorauszusetzen und zu erwarten sind. Er muss also – unabhängig von der Art der Krankenversicherung des Patienten – im konkreten Fall, d. h. unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände der Behandlung, unter Einsatz
der von ihm nach dem Standard zu fordernden sowie
seiner speziellen, darüber hinausgehenden persönlichen medizinischen Kenntnisse und Fähigkeiten
vertretbar über die diagnostisch und therapeutisch zu treffenden Maßnahmen entscheiden und diese sorgfältig durchführen. Ob ein Arzt seine berufsspezifische Sorgfaltspflicht verletzt hat, ist deshalb in erster Linie eine Frage, die sich nach medizinischen Maßstäben richtet.
4. Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)
Mit insgesamt sieben Urteilen in den 1990er Jahren hat das Bundessozialgericht (BSG) dem nach § 91 Abs. 1 SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) rechtsfähigen, aus den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen gebildeten Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) im Ergebnis ein Entscheidungsmonopol für Richtlinien sowohl zur Sicherung der medizinischen Versorgung als auch für die Einführung neuer medizinischer Verfahren und Außenseitermethoden überantwortet. Die jeweiligen Verfahren für diese Regelungen des Handelns und Unterlassens sind in den §§ 92 und 135 SGB V niedergelegt.
Richtlinien sind Handlungsregeln einer gesetzlich, berufsrechtlich, standesrechtlich oder satzungsrechtlich legitimierten Einrichtung, die für den Rechtsraum dieser Einrichtung maßgebend sind und deren Nichtbeachtung bestimmte Sanktionen nach sich ziehen kann. Die Richtlinien des G-BA als Mindeststandard gelten für die gesetzlichen Krankenkassen, deren Versicherte und die behandelnden Ärzte sowie andere Leistungserbringer und sind nach § 91 Abs. 6 SGB V für dieseverbindlich. Sie dürfen daher bei einer Behandlung beziehungsweise Betreuung nicht unterschritten, müssen – ohne Anlass – aber auch nicht überschritten werden.
Richtlinien werden gemäß § 94 Abs. 2 SGB V im Bundesanzeiger und deren tragende Gründe im Internet bekannt gemacht. Die Fundstelle der tragenden Gründe wird in der Bekanntmachung der Richtlinien jeweils angegeben.
5. Leitlinien ärztlicher Fachgremien und Verbände
Für den medizinischen Bereich werden von ärztlichen Fachgremien und Verbänden Leitlinien erstellt und fortgeschrieben. Dabei handelt es sich um systematisch entwickelte, wissenschaftlich begründete und praxisorientierte Entscheidungshilfen für die angemessene ärztliche Vorgehensweise bei speziellen gesundheitlichen Problemen. Derartige Leitlinien können jedoch kein Sachverständigengutachten ersetzen.
Leitlinien fassen das aktuelle Wissen zusammen und geben auf dieser Grundlage Handlungsempfehlungen. Dabei sollten sie sowohl den erwarteten gesundheitlichen Nutzen als auch mögliche Nebenwirkungen und Risiken der Empfehlungen so berücksichtigen, dass ein abwägender Vergleich der empfohlenen mit alternativ zur Verfügung stehenden Verfahren ermöglicht wird. Darüber hinaus muss das enthaltene Wissen fortlaufend auf Gültigkeit überprüft und ggf. auch kurzfristig aktualisiert werden. Schließlich sollte in einer Leitlinie nach Möglichkeit auch eine Frist angegeben sein, nach deren Ablauf die Leitlinie nicht mehr zuverlässig angewendet werden kann.
Im Unterschied zu den Richtlinien des G-BA sind vor der Veröffentlichung begutachtete Leitlinien wegen ihres Empfehlungscharakters rechtlich nicht verbindlich und haben deshalb weder haftungsbegründende noch haftungsbefreiende Wirkung.
Kapitel 5: Abweichende Behandlungen
Nach § 630a Abs. 2, 2. Halbsatz BGB kann eine von den allgemein anerkannten fachlichen Behandlungsstandards abweichende Behandlung vereinbart werden. Dies setzt stets voraus, dass der Arzt den Patienten zusätzlich zur normalen Risikoaufklärung (Kapitel 10Ziffer 4.) über die mit der Abweichung vom Behandlungsstandard verbundene Risikoerhöhung aufklärt. Außerdem ist erforderlich, dass die Standardabweichung sinnvoll und hinreichend begründet ist.
Ist eine vom allgemein anerkannten fachlichen Behandlungsstandard abweichende Behandlung vereinbart worden, ist grundsätzlich die getroffene Abrede maßgebend. Eine solche Vereinbarung findet ihre Grenze aber dort, wo die Gesundheit des Patienten absehbar unnötig gefährdet wird; diese Beurteilung obliegt aufgrund seines Fachwissens dem Arzt. Stets unzulässig ist jedoch eine vom jeweiligen allgemein anerkannten fachlichen Standard völlig losgelöste Art der Behandlung.
Kapitel 6: Zur medizinischen Behandlung befähigte Ärzte
1. Allgemeines
Zur ordnungsgemäßen Behandlung von Krankheiten und Verletzungen befähigt ist ein Arzt, wenn er über die dafür erforderliche fachliche Qualifikation verfügt. Er ist grundsätzlich verpflichtet, seine vertragliche Leistung persönlich zu erbringen; eine Ausführung durch Dritte kommt nur in Vertretungsfällen in Betracht.
Ein Arzt darf regelmäßig keine Tätigkeit auf einem Gebiet übernehmen, für das er nicht zugelassen ist. Dies ergibt sich aus den Heilberufsund Kammergesetzen der für diese Gesetzgebung zuständigen Bundesländer. Die entsprechenden Vorschriften legen fest, dass z. B. ein Arzt, der eine Gebietsbezeichnung führt, grundsätzlich nur in dem betreffenden Gebiet tätig werden darf. Er hat sich demzufolge auch in seiner Eigenschaft als Kassen- bzw. Vertragsarzt grundsätzlich auf das Gebiet zu beschränken, für das er zugelassen ist.
Für die körperliche (somatische) Krankheiten von Menschen behandelnden Ärzte gelten folgende Anforderungen:
2. Facharzt für Humanmedizin
Nach erfolgter Hochschulausbildung und bestandenen Prüfungen wird auf Antrag die Approbation (staatliche Zulassung zur Berufsausübung als Arzt) durch eine Urkunde erteilt. Danach arbeitet ein Arzt in der Regel als Assistenzarzt in einer von der für ihn zuständigen Landesärztekammer anerkannten Klinik oder Praxis, um praktische Erfahrungen zu sammeln und um sich auf einem oder mehreren Spezialgebieten der Medizin weiterzubilden.
Die erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Facharzt in einem Gebiet ist Voraussetzung, dass ein Arzt sich niederlassen, d. h. in einer Praxis selbständig arbeiten oder eine Tätigkeit im Anstellungsverhältnis in einem Krankenhaus selbstverantwortlich ausüben kann.
Jeder Arzt ist Pflichtmitglied der Landesärztekammer, in deren Bereich er in seinem Beruf tätig ist. Zur Behandlung von Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung (Kassenpatienten) benötigt der Arzt eine Zulassung (für die eigene Praxis) oder eine Ermächtigung (als Arzt in einem Krankenhaus oder einer Klinik). Durch die Zulassung oder Ermächtigung wird der Arzt Pflichtmitglied der für seinen Tätigkeitsort zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung.
3. Zahnarzt
Die wissenschaftliche und praktische Ausbildung des Zahnarztes umfasst ein Studium der Zahnheilkunde an einer wissenschaftlichen Hochschule. Nach Bestehen der staatlichen Prüfungen erhält der Kandidat ein Zeugnis und auf Antrag die Approbationsurkunde.
Das Studium der Zahnheilkunde weist zahlreiche Parallelen zum Studium der sonstigen Humanmedizin auf. Gleichwohl darf der Zahnarzt nur in seinem Fachbereich als Vertrags-, Privat- oder angestellter Zahnarzt tätig werden. Sein Arbeitsbereich erstreckt sich auf die Ausübung einer berufsmäßigen, auf zahnärztlich wissenschaftliche Erkenntnisse gegründete Feststellung und Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. Dabei bilden die Lippen die äußere Grenze des Mundbereichs. Zu Allgemeinanästhesien/Narkosen ist der Zahnarzt in der Regel nicht berechtigt.
Entsprechend dem gegenüber einem Arzt der sonstigen Humanmedizin eingeschränkten Behandlungsbereich sind auch die Weiterbildungsmöglichkeiten begrenzt. Möglich sind nach einer mehrjährigen Vollzeit-Weiterbildung sowie anschließender Abschlussprüfung der Erwerb der Gebietsbezeichnungen „Zahnarzt Kieferorthopädie“ und „Zahn-Oralchirurgie“. Der Titel „Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie“ erfordert ein zusätzliches Studium der sonstigen Humanmedizin und eine ebenfalls mehrjährige Weiterbildung.
Für die Behandlung von Kassenpatienten benötigt der Zahnarzt wie der Facharzt der sonstigen Humanmedizin entweder als selbständiger Zahnarzt eine Zulassung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung oder bei einer Anstellung in einer Klinik eine Ermächtigung. Durch die Zulassung oder Ermächtigung wird der Zahnarzt Pflichtmitglied der für seinen Tätigkeitsort zuständigen Kassenzahnärztlichen Vereinigung.
Kapitel 7: Mangelnde Befähigung des Behandelnden
An der erforderlichen Befähigung fehlt es dem Behandelnden, soweit er nicht über die notwendige fachliche Qualifikation verfügt. Dies kommt insbesondere bei Behandelnden in Betracht, die sich noch in der medizinischen Ausbildung befinden oder die als Berufsanfänger (im Folgenden summarisch: Neulinge) noch nicht die notwendige Erfahrung besitzen.
Ein Neuling darf erst nach Unterweisung und Einarbeitung sowie nach Feststellung seiner Zuverlässigkeit und dem Nachweis von praktischen Fortschritten selbst tätig werden. Insoweit lassen sich jedoch keine generellen Verhaltensregeln aufstellen. Ausbildende Fachärzte müssen aber, bevor sie dem Neuling die eigenverantwortliche Durchführung von medizinischen Maßnahmen übertragen, nach objektiven Kriterien prüfen und danach zu dem fachlich vertretbaren Ergebnis kommen können, dass für den Patienten dadurch kein zusätzliches Risiko entsteht. Der jeweils allgemein anerkannte fachliche Behandlungsstandard (Kapitel 4Ziffer 2.) muss stets gewährleistet sein.
Solange irgendwelche Zweifel an dem notwendigen Ausbildungsstand eines Neulings bestehen, muss dessen (eigenständiges) Handeln von einem ohne Unterbrechung anwesenden Facharzt überwacht und angeleitet werden. Dazu reicht es nicht aus, dass der Facharzt lediglich anwesend ist. Vielmehr ist entscheidend, was dieser mit dem Neuling vorher besprochen, welche Hinweise er ihm hinsichtlich der praktischen Vorgehensweise gegeben und wie im Einzelnen der Facharzt das Handeln des Neulings kontrolliert hat. Kann die ständige Eingriffsbereitschaft und -fähigkeit des Aufsichtsführenden aus behandlungstechnischen Gründen nicht sichergestellt und dieser Mangel auch nicht auf andere Weise ausgeglichen werden, muss auf diese Art der medizinischen Behandlung verzichtet werden.
Nur ein Facharzt kann die Gewähr übernehmen, dass ein Neuling richtig angeleitet und überwacht wird; nur er hat die notwendige Autorität, um erforderlichenfalls eingreifen zu können. Es genügt deshalb unter keinen Umständen, einen Neuling lediglich unter der Aufsicht eines weiteren Neulings tätig werden zu lassen. Unerheblich wäre dabei, wie lange der Aufsichtführende sich bereits in Ausbildung befindet und über welche Erfahrungen er schon verfügt.
Andererseits ist ein Neuling nicht schon deshalb von jeder haftungsrechtlichen Verantwortung für einen Gesundheitsschaden des von ihm behandelten Patienten frei, weil ihn ein weisungsberechtigter Facharzt für die selbständig durchzuführende medizinische Maßnahme eingeteilt und ihn vielleicht auch über die praktische Vorgehensweise belehrt hat. Auch hat er, wenn er einen Patienten behandelt, diesem gegenüber dieselbe Pflicht wie jeder Facharzt, mit der gebotenen Sorgfalt vorzugehen und ihn im Rahmen der von ihm zu fordernden Kenntnisse und Fähigkeiten vor Gesundheitsschäden zu bewahren.
Erkennt der Neuling oder hätte er erkennen müssen, dass der Patient, der Anspruch auf den allgemein anerkannten fachlichen Behandlungsstandard hat, bei der von ihm eigenverantwortlich durchgeführten medizinischen Maßnahme einem höheren Gesundheitsrisiko ausgesetzt ist, darf er nicht gegen sein fachliches Wissen und gegen bessere Überzeugung handeln und die Anweisungen des übergeordneten Facharztes befolgen. Vielmehr ist ihm zuzumuten, dagegen seine Bedenken zu äußern und letztlich eine Behandlung ohne Aufsicht auch abzulehnen. Ansonsten setzt er sich, wenn er die medizinische Maßnahme durchführt und dabei dem Patienten einen Gesundheitsschaden zufügt, dem Vorwurf des von ihm zu vertretenden Übernahmeverschuldens aus. Dies gilt erst recht, wenn er nicht nur seine Selbstzweifel an den konkret geforderten Kenntnissen und Fertigkeiten verschwiegen, sondern sich für die selbständige Vornahme der medizinischen Maßnahme geradezu aufgedrängt hat.
Ein Ausweg aus dem Konflikt des Neulings zwischen dem Verlangen der weisungsberechtigten Vorgesetzten auf selbständige Übernahme einer medizinischen Maßnahme einerseits und den im Interesse der Gesundheit des Patienten (erheblichen) Bedenken bezüglich des eigenen Wissens und Könnens andererseits besteht darin, den Patienten vor Beginn der Behandlung über die Sachlage zu informieren und ihm so die Gelegenheit zu geben, seine Einwilligung in die medizinische Maßnahme nach § 630d Abs. 3 BGB zu widerrufen.
Zu Tatsachenvermutungen zugunsten des Patienten bei auf mangelnde Befähigung des Behandelnden zurückzuführende Gesundheitsschäden siehe Kapitel 19Ziffer 2.
Kapitel 8: Organisation des Behandlungsgeschehens
Eine sachgerechte Organisation des Behandlungsgeschehens erfordert eine in sich schlüssige Planung der Arbeitsabläufe und des Personaleinsatzes, die Bereitstellung der notwendigen Geräte und medizinischen Apparate sowie das Bereithalten von Standardmedikamenten. Die im Einzelfall im medizinischen und pflegerischen Bereich verantwortlichen Personen müssen für ihre Aufgabe fachlich und körperlich geeignet sein; sie sind nach diesen Kriterien auszuwählen und ausreichend zu überwachen. Letzteres gilt wegen der erhöhten Gefahr schwerwiegender gesundheitlicher Beeinträchtigungen von Patienten in besonderem Maße für ärztliche Anfänger.
Die Organisation umfasst aber auch eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten, die Festlegung der Kompetenzbereiche der Mitarbeiter und Vertretungsregelungen im Krankheitsfalle oder bei Urlaub.
Die Einhaltung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) in Krankenhäusern ist zunächst Sache des jeweiligen Trägers der Einrichtung bzw. der Chefärzte. Verstöße gegen die Regelungen über Ruhe-und maximale Arbeitszeiten lassen auf ein Organisationsverschulden schließen. Dabei ist eine Unterbesetzung aufgrund des Kostendrucks im Personalbereich kein Entschuldigungsgrund. Insbesondere, dass ein Arzt ausfallen kann, ist vielmehr bereits in der Planung zu berücksichtigen.
Jedes Krankenhaus hat zu gewährleisten, dass die behandelnden Ärzte körperlich und geistig in der Lage sind, ihre Aufgaben fachgerecht wahrzunehmen. Das bedeutet, dass der Klinikträger bzw. die Chefärzte alle erforderlichen Anstrengungen für die bestmögliche medizinische Betreuung des Patienten unternehmen müssen und ihn vor unzulänglichen oder fehlerhaften Behandlungsmaßnahmen bewahren.
Zur Beweisführung bei einem Organisationsverschulden als voll beherrschbares Risiko des Krankenhausträgers siehe Kapitel 19Ziffer 3.
Bei einem Behandlungsfehler, der auf Übermüdung und dadurch bedingte Konzentrationsmängel zurückzuführen ist, kommt aber auch ein Übernahmeverschulden des Arztes in Betracht. Dies ist dann der Fall, wenn der Arzt durch die Überschreitung der zulässigen Arbeitszeit objektiv nicht in der Lage war, die Behandlung fachgerecht durchzuführen.
Ein Arzt ist nicht verpflichtet, seine Arbeitszeit entgegen den gesetzlichen Vorgaben zu überschreiten; eine entsprechende Weisung des Arbeitgebers ist grundsätzlich (Ausnahme: Notfälle) unwirksam. Ob der Arzt dennoch unter Missachtung der Vorschriften des ArbZG und in Kenntnis seiner darauf beruhenden Müdigkeit Behandlungsmaßnahmen übernimmt, entscheidet er in eigener Verantwortung. Dann setzt er sich jedoch dem Risiko aus, für einen dadurch bedingten Gesundheitsschaden verantwortlich gemacht zu werden.
Allein der bewusste Verstoß gegen die Regelungen des ArbZG reicht regelmäßig nicht für eine Haftung des Arztes aus. Hinzu kommen müssen von einem geschädigten Patienten konkret darzulegende Anhaltspunkte dafür, dass der Arzt übermüdet war und sich deshalb nicht mehr konzentrieren konnte. Erst dann ist es im Wege des Beweises des ersten Anscheins (Kapitel 19Ziffer 7.) möglich, die Ursächlichkeit des Gesetzesverstoßes für den durch einen Behandlungsfehler verursachten Gesundheitsschaden nachzuweisen.
Kapitel 9: Die einleitenden Schritte für eine medizinische Behandlung
Unerlässliche Voraussetzung für eine zielgerichtete medizinische Behandlung sind – soweit möglich auch bei Notfällen – die nachstehend aufgeführten Maßnahmen:
1. Anamnese
Begriffsbestimmung:
Anamnese ist die gezielte Befragung durch den Arzt, mit der dieser vom Patienten Aufschluss über dessen aktuelle Beschwerden, die gesundheitliche Vorgeschichte, Besonderheiten wie etwa Allergien (Überempfindlichkeiten) und die Lebensumstände erhalten will.
Ist der Patient zu diesen Auskünften nicht in der Lage, können auch Angehörige befragt werden.
Auf der Grundlage der bei der Anamnese gewonnenen Erkenntnisse finden durch den Arzt
2. Untersuchungen
in Form von Funktionsprüfungen (Atmung, Blutdruck) sowie durch Abtasten, Abklopfen und Abhören des Körpers statt mit dem Ziel, die geschilderten Gesundheitsbeeinträchtigungen aufzuklären.
Die von einem Arzt durchzuführenden Untersuchungen richten sich in aller Regel maßgeblich danach, aus welchen Gründen der Patient einen Arzt oder oder ein Krankenhaus aufsucht und über welche Beschwerden er im Einzelfall klagt. Dabei besteht keine Verpflichtung, Maßnahmen durchzuführen, die nicht zur Ermittlung der konkreten Beschwerden des Patienten bzw. der aktuellen Erkrankung erforderlich sind oder hierfür dienlich sein können; dies gilt auch dann, wenn diese zusätzlichen Untersuchungen schnell und leicht durchführbar sind.
Der Arzt darf sich nicht mit einer möglicherweise nahe liegenden Erklärung für bestimmte Beschwerden des Patienten begnügen. Können Symptome (Krankheitszeichen) auf mehrere verschiedene Krankheiten hindeuten, so ist, wenn – wie in der Regel – die Behandlung eine sichere Festlegung erfordert, durch weitere abgrenzende diagnostische Untersuchungsmaßnahmen Aufschluss der Grund für die konkret vorliegende Erkrankung zu ermitteln.
Das Wohl des Patienten ist oberstes Gebot und Richtschnur jeden medizinischen Handelns. Deshalb verpflichten die Behandlungsseite auch die Ergebnisse solcher Untersuchungen zur Einhaltung der berufsspezifischen Sorgfalt, die medizinisch nicht verlangt waren, aber trotzdem – beispielsweise aus besonderer Vorsicht – veranlasst wurden. Auf diese Weise gewonnene Erkenntnisse dürfen von einem Arzt nicht deshalb ignoriert werden, weil keine Verpflichtung zur Durchführung der entsprechenden Untersuchung bestand.
Weigert sich ein schwer verletzter Patient, eine dringend erforderliche Untersuchung zur Befunderhebung vornehmen zu lassen, darf sich der Arzt nicht einfach damit zufrieden geben. Vielmehr muss er zumindest zeitnah erneut auf den Patienten einwirken oder den Nachbehandler darauf hinweisen, dass eine notwendige Untersuchung bisher an der Weigerung des Patienten gescheitert sei und dass man das nicht auf sich beruhen lassen dürfe.
Beispiele für einfache und grobe Untersuchungsfehler siehe Kapitel 16Ziffern 1. und 2.
Das Ergebnis von Untersuchungen mündet in die Erhebung der
3. Befunde
Begriffsbestimmung:
Ein Befund ist die Zusammenfassung der Ergebnisse der von einem Arzt insgesamt oder in Teilbereichen für erforderlich erachteten körperlichen sowie ggf. durch Geräte gestützten und labortechnischen Untersuchungen.
Der für die Auswertung eines Befundes im konkreten Fall verantwortliche Arzt hat aufgrund der ihm obliegenden Fürsorgepflicht gegenüber dem Patienten alle Auffälligkeiten zur Kenntnis und zum Anlass für die gebotenen Maßnahmen zu nehmen. Maßstab sind dabei die aus berufsfachlicher Sicht des jeweiligen Fachbereichs vorauszusetzenden Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die Behandlungssituation. Auch vor in diesem Sinne für ihn erkennbaren „Zufallsbefunden“ darf der Arzt nicht die Augen verschließen.
Kommt ein Arzt bei der Behandlung eines Kindes zu dem ernstzunehmenden Verdacht einer Kindesmisshandlung, ist die Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht durch Information des Jugendamtes und der Polizei entsprechend § 34 StGB gerechtfertigt. Dabei muss weder die Misshandlung erwiesen sein, noch ist ein hinreichender Tatverdacht erforderlich. Es ist nicht ärztliche Aufgabe, eine mögliche Straftat „auszuermitteln“, d. h. abschließend zu klären, welche Ursache eine Verletzung hat. Es reicht vielmehr aus, dass Verletzungen typischerweise durch Kindesmisshandlungen hervorgerufen werden und somit ein „begründeter Verdacht“ sowie Wiederholungsgefahr besteht; denn der ärztliche Heilauftrag umfasst auch die Vermeidung von künftigen Gesundheitsgefährdungen.
Irrtümer bei der Befunderhebung sind in der medizinischen Praxis nicht ungewöhnlich und können nicht ohne Weiteres als Folge eines vorwerfbaren Verhaltens des Arztes angesehen werden. Die Symptome (Krankheitszeichen) von Beschwerden sind oft mehrdeutig und lassen so auf die verschiedensten Ursachen schließen. Liegt eine Ursache nahe, kann das den Blick auf andere Umstände verstellen.
Ein Befunderhebungsfehler liegt vor, wenn der Arzt die Erhebung medizinisch gebotener Befunde unterlässt. Dies gilt gleichermaßen, wenn der Arzt sich darauf beschränkt, bereits vorliegende Befunde auszuwerten, obwohl er aus berufsfachlicher Sicht weitere Befunde hätte erheben müssen, um einen bestehenden Verdacht auf das Vorliegen einer schwerwiegenden Erkrankung mit den hierfür üblichen Befunderhebungen entweder zu erhärten oder auszuräumen.
Beispiele für einfache und grobe Befunderhebungsfehler siehe Kapitel 16Ziffern 1. und 2.
Die Abgrenzung, ob der Fehler des Arztes als unterlassene Befunderhebung oder als Diagnoseirrtum (unten Ziffer 4.) zu bewerten ist, erfolgt nach dem Schwerpunkt der ärztlichen Pflichtverletzung.
Kein Befunderhebungsfehler liegt z. B. vor, wenn ein Hautarzt ein nach intensiver Untersuchung als gutartig beurteiltes Muttermal eines bis dahin hinsichtlich etwaiger Hauterkrankungen unauffälligen Patienten per Laser (gebündelte Lichtstrahlung) beseitigt, statt es mit dem Skalpell (chirurgisches Messer) zu entfernen und so eine histologische (gewebliche) Untersuchung zu ermöglichen.
Weist der Arzt den Patienten nach Feststellung eines abklärungsbedürftigen Befundes auf die Notwendigkeit einer weiteren Untersuchung hin und nennt dafür einen bestimmten Zeitraum, ist er nicht verpflichtet, den Patienten an die Wahrnehmung des Termins zu erinnern. Anders liegt der Fall, wenn sich nach der (Erst-)Untersuchung nachträglich weitere Erkenntnisse ergeben und der Patient darüber nicht unterrichtet wird.
Untersucht ein Arzt eine Person im Auftrag eines Dritten,
Beispiel:
Eine Versicherung will sich mit Einverständnis eines Antragstellers über dessen Gesundheitszustand informieren,
und stellt er dabei einen Verdachtsbefund fest, muss ein solcher je nach Art und Schwere bereits dem Arzt Veranlassung geben, selbst medizinische Maßnahmen zur Abwehr der für die Gesundheit des Antragstellers drohenden Gefahr zu ergreifen. In weniger schwerwiegenden Fällen hat der Arzt den Antragsteller zumindest unter Angabe der Gründe davon zu unterrichten, dass er sich in Behandlung begeben müsse, um Schaden abzuwenden, oder sicherzustellen, dass der Antragsteller über den Befund vom Versicherer unterrichtet wird. Der Umstand, dass die Untersuchung im Auftrag und Interesse eines Dritten und damit ohne vertragliche Beziehungen zwischen Arzt und Antragsteller erfolgt ist, kann nicht dazu führen, dass der Arzt bei Feststellung eines Befundes gleichsam die Augen davor verschließen darf.
Befunde sind die Grundlage für die
4. Diagnose
Begriffsbestimmung:
Diagnose bedeutet die möglichst genaue Zuordnung von Befunden zu einem Krankheitsbild oder -begriff.
Vorläufige Diagnosen, wie sie etwa alsbald zum Zweck der Entscheidung darüber gestellt werden müssen, ob der Patient eine Spezialbehandlung benötigt, sind mit hohen Unsicherheitsfaktoren belastet. Das entbindet den Arzt jedoch nicht von der Verpflichtung, sein Können und Wissen sorgfältig einzusetzen und die Risiken für den Patienten gewissenhaft abzuwägen. Hat er insoweit etwas versäumt, muss er für die Folgen seines dann möglicherweise vorwerfbaren Irrtums ebenso einstehen wie bei anderen Behandlungsfehlern.
Liegen Verdachtsmomente für eine ernst zu nehmende, keineswegs zu bagatellisierende Erkrankung des Patienten vor, ist eine diagnostische Abklärung erforderlich, bei der ein Arzt – auch ein Notarzt – alle ihm zu Gebote stehenden Erkenntnisquellen nutzen muss. Dies gilt umso mehr, wenn dem Arzt eine sichere Zuordnung nicht möglich ist oder eine Diagnose nicht mehr aufrecht erhalten werden kann und deshalb Spezialisten einer anderen Fachrichtung hinzugezogen werden müssen.
Ein Diagnoseirrtum liegt vor, wenn der Arzt erhobene oder sonst vorhandene Befunde falsch interpretiert und deshalb nicht die aus berufsfachlicher Sicht seines Fachgebiets gebotenen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen ergreift.
Beim Diagnoseirrtum werden drei Arten unterschieden:
Die weder als einfacher noch als grober Behandlungsfehler einzustufende „vertretbare“ oder „noch vertretbare“ Diagnose.