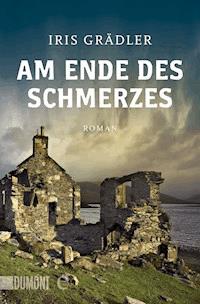8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Cornwall-Krimi-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein düsteres Geheimnis, eine unheilvolle Lüge, eine teuflische Rache In der Bucht eines kleinen Küstenortes in Cornwall werden innerhalb kurzer Zeit ein toter Hund und die Leiche eines Mannes angespült, beide grausam verstümmelt. Der Mordfall bringt die Welt des friedlichen Dorfes empfindlich ins Wanken und verlangt Detective Inspector Collin Brown alles ab. Seine geliebte Bildhauerei und auch seine Familie kommen jetzt zu kurz. Er findet heraus, dass der Tote ein schottischer Millionär war, über den niemand Genaueres zu sagen weiß. Eine Spur führt zu Anthony Polodny, dem kürzlich verstorbenen Sohn eines polnischen Einwanderers. Doch welche Verbindung bestand zwischen den so ungleichen Männern? Der Detective erhofft sich Hilfe von Elizabeth Polodny, die für die Beerdigung ihres Bruders aus Australien in die englische Heimat gereist ist. Bald wird klar, dass der Schlüssel zur Lösung des Falls in der Vergangenheit der Familie Polodny liegt. Eine blutige Tragödie, die jetzt, nach zwanzig Jahren, noch viel mehr Menschen das Leben kosten könnte … Cornwall-Krimi mit Detective Inspector Collin Brown: Band 1: Meer des Schweigens Band 2: Am Ende des Schmerzes Band 3: Das Wüten der Stille
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
In der Bucht eines kleinen Küstenortes in Cornwall werden innerhalb kurzer Zeit ein toter Hund und die Leiche eines Mannes angespült, beide grausam verstümmelt. Der Mordfall bringt die Welt des friedlichen Dorfes empfindlich ins Wanken und verlangt Detective Inspector Collin Brown alles ab. Seine geliebte Bildhauerei und auch seine Familie kommen jetzt zu kurz. Er findet heraus, dass der Tote ein schottischer Millionär war, über den niemand Genaueres zu sagen weiß. Eine Spur führt zu Anthony Polodny, dem kürzlich verstorbenen Sohn eines polnischen Einwanderers. Doch welche Verbindung bestand zwischen den so ungleichen Männern? Der Detective erhofft sich Hilfe von Elisabeth Polodny, die für die Beerdigung ihres Bruders aus Australien in die englische Heimat gereist ist. Bald wird klar, dass der Schlüssel zur Lösung des Falls in der Vergangenheit der Familie Polodny liegt. Eine blutige Tragödie, die jetzt, nach zwanzig Jahren, noch viel mehr Menschen das Leben kosten könnte … Iris Grädler wurde 1963 in Halle, Westfalen geboren. Sie veröffentlichte Gedichte und Kurzgeschichten und hat mehrere Anthologien herausgegeben. Iris Grädler lebt in Swakopmund, Namibia. ›Meer des Schweigens‹ ist ihr erster Roman.
Iris Grädler
MEER DES SCHWEIGENS
Roman
Originalausgabe
eBook 2015
© 2015 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Getty Images/Lee Frost
Satz: Silvia Cardinal, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook: 978-3-8321-8831-3
www.dumont-buchverlag.de
Meinem Gefährten am Feuer der Geschichten
DAS ERSTE GEBOT
Es gibt keinen Gott. Keinen neben ihr.
Sie ist seine Tochter. Ohne sie ist sie nicht.
Ein Niemand.
Einen Niemand will niemand.
Ihr Wille geschieht. Nichts sonst.
Sie ist die Herrin.
Der Wahrheit und der Strafe.
Die Peitsche. Das Eiswasser. Der Raum ohne Fenster.
Die Sühne. Auge um Auge.
Ihr Auge sieht.
Diene ihr.
1
Die Weiße Dame hatte ein narbiges Gesicht und Augen wie Einschusslöcher. Faustgroße Höhlen. Die Seeschwalben liebten es, darin zu nisten. Sie stand aufrecht, auf ihrem stolzen Kopf ein schmaler, hoher Hut. Wie der Nofretetes.
An diesem Morgen war ihr Kleid nebelgrau. Jeden Tag sah sie anders aus. Als würde sie sich den Jahreszeiten, dem wechselnden Wetter und den Stimmungen anpassen.
Der Stein war kühl und feucht unter seiner Hand. Welche Geschichten würde er erzählen, wenn er sprechen könnte?
DI Collin Brown riss sich von dem Felsen los und ging zum Fundort zurück. Über dem Kadaver schwirrte eine Wolke kleiner Fliegen. Die Aasgeier der Küste. Es stank nach nassem Fell und Verwesung.
»Und? Kennst du ihn?«
Feighlan, der Tierarzt, erhob sich mühsam, zog ein Stofftaschentuch heraus und schnäuzte sich ausgiebig. Er war mit seinen fünfundsiebzig Jahren eigentlich schon zu alt, um noch zu praktizieren. Aber er liebte seinen Beruf. Außerdem hatte sich bislang kein Nachfolger gefunden.
»Nicht, dass ich wüsste. Keine Marke. Aber vielleicht ein Chip. Werd ich prüfen. War so was wie ’ne ziemlich scharfe Axt. Denke ich. Er liegt da schon ’ne Weile im Wasser rum. Aufgegangen wie Hefe.«
Feighlan knipste die Taschenlampe aus.
Niemand hier hatte so etwas schon einmal gesehen.
Es war ein junger Hund. Ein Golden Retriever. Davon gab es viele in der Gegend. Es waren friedliche Hunde, Familientiere, kinderlieb. So viel wusste Collin. Wer erschlug einen Hund kaltblütig und schmiss ihn anschließend ins Meer?
Die beiden Männer der freiwilligen Feuerwehr packten den Kadaver auf eine Bahre und begannen den langen Aufstieg zum Parkplatz. Sie wollten später noch einmal wiederkommen. Jetzt, kurz nach Sonnenaufgang, lag alles im Schatten. Collin glaubte nicht, dass sich Spuren des Täters finden würden. Es war wahrscheinlicher, dass der Hund in die Bucht gespült worden war.
Aber wer weiß?, dachte er.
Ein junger Mann, der mit seinem achtjährigen Sohn am Tag zuvor in die Bucht geklettert war, hatte den Hund zwischen zwei Felsen nahe am Strand gefunden und am Abend die Polizei verständigt. Sein Sohn stand unter Schock. Sie würden schnellstmöglich mit der Familie zurück nach Cambridge fahren.
Lappalie, hatte Collin gedacht. Normalerweise hätte er einen seiner Mitarbeiter geschickt. Aber keiner der drei war da.
Letztlich war es jedoch keine Lappalie. Jemand, der einen Hund so grausam tötet, sollte bestraft werden, fand Collin. Wenn es nach ihm ginge, so massiv wie möglich. Wer grausam zu Tieren ist, ist es auch zu Menschen. Es gab genügend Beispiele in der Kriminalgeschichte von Tierquälern, die auch gegenüber Menschen zu Gewalt neigten. Und warum sollte das Leben eines Tieres weniger wert sein? Aber diese Gedanken behielt er lieber für sich. Und zum Glück war er kein Richter.
»Na, dann«, sagte Feighlan. »Zeit für was Warmes.«
Collin wollte ihn unterhaken, doch Feighlan schüttelte ihn ab und stieß seinen Stock in den Boden.
»Bin zwar ein alter Knochen, aber laufen tu ich noch selbst«, knurrte Feighlan. »Verdammt lange her, dass ich in der White Bay war. So hab ich sie noch mal gesehen, bevor ich abnippel.« Die Bucht hatte ihren Namen White Bay wegen der Kalkfelsen erhalten, die wie von einem Bildhauer gemeißelt auf Muschelsand standen.
Sie war ein beliebter Ausflugsort für Küstenwanderer und Badegäste. Oberhalb der Bucht hatte die Gemeinde einen großzügigen Parkplatz mit zwei Picknicktischen, einem Münzfernrohr und einer Informationstafel errichtet. Eine Treppe mit Geländer erleichterte auf den ersten fünfzig Yards den Abstieg. Ab dann musste man trittfester sein.
Dort oben konnte man zwischen hügeligem Grasland und Heidekraut Cornwalls beliebten Küstenweg entlangwandern. Man hatte grandiose Ausblicke auf Buchten und das im Sommer türkisblau schimmernde Meer.
Collin mied die White Bay seit Langem. Seit der Parkplatz vor fünf Jahren eingeweiht worden war, hatte sich die Zahl der Besucher sprunghaft erhöht. Damit war es vorbei gewesen mit der Ruhe.
Er liebte die Felsen, die es nur in dieser Bucht gab. Er sah in ihnen eine Gruppe Gestrandeter. Halb verhungerte, von Leid gebeugte Gestalten, die aneinandergeklammert mit letzter Kraft den tobenden Wellen entstiegen, aber zu schwach, um sich aus der Bucht zu retten. So standen sie wie zu Salzsäulen erstarrt am Strand.
Die Weiße Dame mit ihrem bauschigen Kleid war etwas abseits von den anderen Figuren. Als Collin sie zum ersten Mal gesehen hatte, war etwas mit ihm geschehen. Etwas tief in ihm hatte sich gerührt und war kurz darauf in seine Hände geflossen. Kein Ort an der Küste bedeutete ihm mehr als die Bucht mit der Weißen Dame.
Der erschlagene Hund war eine Entweihung.
Würden die Seeschwalben auch in diesem Jahr zurückkehren?
Ich werde das Schwein finden, schwor er sich.
* * *
»Feighlan will dich sprechen.«
Sandra lehnte in der Tür, knipste auf einem Kugelschreiber herum und trommelte mit der freien Hand an den Türrahmen. Sie trug einen ihrer knappen Röcke und die üblichen High Heels, war wie zum Ausgehen geschminkt, und es umwehte sie eine Wolke Parfüm. Sie war eine der effektivsten Mitarbeiterinnen, die Collin je gehabt hatte. Wenn sie nicht gerade mit ihrem Liebesleben beschäftigt war. Derzeit schien sie aber keinen Lover zu haben, der sie von der Arbeit abhielt.
»Warst du nicht gestern noch blond?«
»Merkst du das jetzt erst?« Sandra drückte mit der flachen Hand an ihrem Hinterkopf herum. »Und kürzer ist es auch. Männer …«
»Rot steht dir gut. Aber das Piercing da in der Nase …«
»Du hast weder Geschmack, noch weißt du, was angesagt ist. Also, was ist jetzt mit Feighlan?«
»Du erreichst auch mal die vierzig. Dann sprechen wir uns wieder. Stell durch.«
»Okay, du konservativer Langweiler.« Sandra rollte die Augen. »Mach mich dann gleich auf den Weg. Hab einen Massagetermin. Schließt du später ab? Ach, und Johnny hat sich gemeldet. Röchelt immer noch wie ein Kohleofen. Er versucht, übermorgen wieder fit zu sein.«
Sandra stöckelte zum Vorzimmer zurück. Kurz darauf klingelte Collins Telefon.
Es waren drei Tage vergangen, seit sie den Hund aus der Bucht geborgen hatten. An der Küste brauchte alles seine Zeit. Es gab keine Eile. Das hatte Collin gelernt. Niemanden konnte man antreiben, keine Ungeduld verhalf, schneller an ein Ziel zu gelangen, welches auch immer.
Gemütsruhe oder Bequemlichkeit, wie man es drehte oder wendete, das Ergebnis war das Gleiche. Man musste das Warten lernen, es ertragen, es als Selbstverständlichkeit hinnehmen.
Manche Tage verstrichen so langsam, dass Collin gegen die Langeweile kämpfen musste, gegen die sinnlose Verschwendung wertvoller Lebenszeit in dieser verschlafenen Polizeistation von St Magor am Ende der Welt.
Doch wollte er niemals mehr in sein vorheriges Leben zurück. Schlanker war er damals gewesen, all seine Bewegungen schneller, sein Denken ein einziges Feuerwerk. So viele Fälle hatten sich auf seinem Schreibtisch getürmt, dass er sich wie ein Jongleur vorgekommen war, einer, der zugleich auf einem über einer tiefen Schlucht gespannten Drahtseil Saltos schlägt.
Hier bestimmten die Gezeiten den Rhythmus seiner Tage. Die Brandung und Felsen darin, die sich ihr entgegenstemmten. Und er war selbst behäbig geworden wie ein Stein. Das hatte ihm am Abend zuvor Kathryn an den Kopf geworfen. Den Satz und eine Tüte Salzstangen. Danach noch ihr Negligé.
Collin schob die Szene beschämt beiseite, griff zum Telefon und lauschte Feighlans Stimme.
»Vergiftet, dann Schädel zertrümmert. Und damit er auch ganz tot ist, ins Meer geschmissen. Ganze Arbeit.«
Collin hörte Feighlan husten.
»Vergiftet? Womit?«
»Strychnin. Hatte der vielleicht noch irgendwo rumstehen. Intravenös. Das Zeug stinkt ja wie die Pest. Würde ein Hund nicht anrühren. Ich mein, im Futter.«
»Kannst du was über die Todeszeit sagen?«
»Tja. Eine Woche oder zwei, höchstens drei. Länger nicht, denk ich. Bin mir aber nicht sicher. Und keine Knochenbrüche. Heißt, ist nicht aus großer Höhe aufs Wasser geknallt.«
»Chip?«
»Fehlanzeige. Hat sich auch keiner wegen eines vermissten Retrievers gemeldet. Jedenfalls nicht bei mir. Ich leg dir einen schönen Bericht auf dieses Ding, dieses Fax. Hoffe, du findest den Schlächter.«
Sie legten auf.
Collin beschloss, eine Nachricht über den toten Hund im »Coast Observer« zu schalten. Das kostenlose Anzeigenblatt lag überall aus, die ganze Küste runter, in jedem Pub, bei allen Geschäften und Apotheken. In manchen Dörfern wurde es an die Haushalte verteilt. Irgendwer würde sich vielleicht an den Hund erinnern.
Passierte es nicht immer wieder, dass Tierbesitzer ihre Haustiere loswerden wollten und die grausamsten Wege wählten, statt sie in ein Tierheim zu bringen? Inwieweit machten sich diese Tiermörder überhaupt strafbar?
Collin fühlte sich überfragt. Er hatte mit Unfällen durch angefahrenes Wild zu tun gehabt. Hatte einmal zweiunddreißig Katzen aus einer Hochhauswohnung befreit, nachdem die Besitzerin, eine verwirrte und wohl sehr einsame alte Dame, verstorben war und die Nachbarn die Polizei gerufen hatten. Eine Zeit lang ging in der Grafschaft Kent ein Pferdemörder um, der es auf wertvolle Zuchttiere abgesehen hatte. Als man ihn gefasst hatte, stellte sich heraus, dass er der Sohn eines Pferdezüchters war und einen tiefen Hass gegen Gäule entwickelt hatte.
Mit einem Rattern kündigte sich Feighlans Fax an.
Collin setzte sich an Johnnys Schreibtisch, der seinem gegenüberstand, zog die zwei Seiten aus der Faxmaschine und machte eine Tüte Chips auf. Davon lagen immer welche in Johnnys oberster Schublade.
Sie teilten sich eins der engen Büros, sehr zum Unmut Collins, der am liebsten allein arbeitete. Doch das Gebäude, ein zugiger Bau aus dem Mittelalter, stand unter Denkmalschutz. Umbauten oder eine Erweiterung waren nicht erlaubt. Die Holzfenster waren undicht, der Parkettboden knarzte und brauchte dringend einen neuen Schliff. Das Mobiliar war unmodern und nicht gerade rückenfreundlich. Dennoch mochte Collin das Büro. Vom Fenster aus sah man einen Zipfel vom Meer, man roch es zu jeder Jahreszeit.
Und zum Glück war Johnny ein umgänglicher Geselle. Seine Marotten waren erträglich.
Collin schob Aktenordner, einen Stapel aufeinandergeworfener Papiere, Kaugummipackungen und leere DVD-Hüllen beiseite. Niemand außer Johnny fand sich in dem Durcheinander zurecht. Collin hatte bislang keine Lust gehabt, einen Blick darauf zu werfen. Johnnys Arbeit musste liegen bleiben, bis er wieder da war. Er lag noch immer mit einer Bronchitis flach. Auf seinem Computer klebte ein Spruch. Tritt mir bloß nicht in den Arsch, wenn ich sitze. Die Flagge von Schottland, dem Land seiner Vorfahren, steckte in einer leeren Whiskyflasche. Daneben verstaubte die goldene Katze, die eine Zeit lang gewunken hatte, bis die Batterie versagte. Sie war eins der albernen Reisemitbringsel, die Johnny mit einem auf Singles spezialisierten Anbieter unternahm. Bislang ohne Erfolg.
Johnnys Uhr mit der Elefantenherde statt Zahlen tickte zu laut. Collin hätte im Augenblick alles dafür gegeben, wenn Johnny jetzt da wäre.
Die beiden jungen Kollegen vermisste er weniger. Bill war auf einer Fortbildung, und Anne verbrachte ihre Flitterwochen in Venedig.
Collin las den tierärztlichen Bericht über den Hund und knabberte mit einer Mischung aus Genuss und schlechtem Gewissen die scharf-sauren Chips. Kathryn würde sie ihm wie einem unartigen Kind wegnehmen und ihm eine Schüssel Pistazienkerne oder getrocknete Aprikosenschnitzer hinstellen.
Mit einer Gesundheitsfanatikerin möchte ich nicht verheiratet sein, dann bleibe ich lieber Single, hatte Johnny nach einem Abendessen bei ihnen gesagt.
Kathryn hatte Dinge wie gebratenen Tofu und Spinatbrötchen serviert.
Collin beschloss, früher Feierabend zu machen.
Er fasste auf knapp zwei Seiten den mageren Ermittlungsstand über den toten Hund zusammen, mailte einen Text an den »Coast Observer«, fuhr den Computer um kurz nach 15Uhr runter und machte seine Runde, bedächtig und zögernd, mit dem Gefühl, etwas Wichtiges versäumt zu haben. Er wollte gerade zur Tür hinaus, als das Telefon klingelte. Die Küstenwache. Ein Angler hatte einen Toten gefunden. Am Red Cliff Point.
Eine Wasserleiche. Mit zertrümmertem Schädel.
Collin dachte an den Hund. Eben noch war der tote Retriever der schlimmste Fall, der ihn in Monaten beschäftigt hatte. Und jetzt das. Er spürte, wie er Sodbrennen bekam. Warum musste ausgerechnet, wenn alle ausgeflogen waren, so etwas passieren?
»Sind Sie vor Ort?«, fragte Collin.
»Unterwegs.«
»Krankenwagen?«
»Haben wir verständigt. Auch den Helikopter.«
»Gut. In spätestens einer halben Stunde bin ich da.«
Collin warf einen Blick auf die Landkarte hinter seinem Schreibtisch. Der Red Cliff Point lag circa dreiunddreißig Meilen von seinem Haus entfernt.
Kathryn würde warten müssen. Die Versöhnung mit ihr. Alles, erkannte Collin, würde warten müssen.
Er verständigte per Funk die Kollegen von der Spurensicherung und Rechtsmedizin in Truro und machte sich mit Blaulicht und Vollgas auf den Weg.
* * *
»Seltsam ist, dass er nackt ist«, sagte Douglas Hampton.
Er hatte den Spitznamen Doughnut. Den genauen Grund dafür wusste Collin nicht. Vielleicht waren die süßen Küchlein seine Leibspeise, oder es hatte etwas mit Hamptons Aussehen zu tun. Er hatte ein teigiges Gesicht mit einem ausgeprägten Doppelkinn, graues Stoppelhaar und einen ausladenden Bauch.
»Reißen die Wellen die Kleidung nicht weg?«
»Kann sein. Aber alle anderen von meinen Wasserleichen hatten noch was an. Schuhe vielleicht weg oder die Jacke, aber ganz nackt? Und der hier wurd ja noch nett eingepackt. Vermutlich deshalb. Von allen Beweismitteln entledigt. Na ja, ich würd sagen, man lernt ja nie aus.«
Die Bucht ragte wie eine lange Zunge ins offene Meer hinein. Für Segler war es eine berüchtigte Ecke, drehte sich doch der Wind sprunghaft, und die Strömung war unberechenbar. Vor der Küste lagen tückische Felsen unter der Wasseroberfläche. Jedes Jahr gab es hier besonders unter unerfahrenen Hobbyseglern Unglücke. Die meisten gingen glimpflich aus, weil die Küstenwache den Red Cliff Point äußerst gut beobachtete.
»Wie lange liegt der hier?«, fragte Collin.
»Tja. Schon ’ne Weile. Der Tatort ist das nicht. Die Flut hat ihn angespült.«
Collin wandte sich von dem Toten ab. Es war ein entsetzlicher Anblick. Der blasse Körper war leicht aufgedunsen und voller Wunden. Die Haut war wie mit Sandpapier geschmirgelt. Kleine Muscheln, Seegras und Algen hingen zwischen den Gliedmaßen. Das Gesicht war eine unkenntliche Fleischmasse.
Es war fast nichts Menschliches mehr an dem Mann, fand Collin. Er sah aus wie ein Ungeheuer, das an Land geschwemmt worden war.
Der Angler, der den Toten gefunden und dann mit seinem Funkgerät die Küstenwache informiert hatte, war ein alter Mann aus dem nächstgelegenen Dorf, der fast täglich am Red Cliff Point Wolfsbarsche fischte. Jetzt hockte er etwas entfernt auf einem Stein und ließ den Kopf hängen. Er hatte von oben gesehen, wie ein schwarzer Gegenstand immer wieder in einer Felsenmulde an die Oberfläche schwappte, hatte den Feldstecher rausgeholt und dann deutlich eine Plane erkannt, in die etwas eingewickelt und mit Stricken zugebunden war. Das hatte ihn misstrauisch gemacht. Er war in die Bucht hinuntergestiegen und auf den glitschigen Steinen mehrmals ausgerutscht, als er erfolglos versuchte, das schwere Ding an Land zu ziehen.
»Das ist ein Kopf, da vorn, hab ich gleich gedacht«, sagte der Alte zu Collin. »Unsereins war im Krieg. Da weiß man, was das ist. Und wie schwer.«
Hampton zog sich die Handschuhe aus und deutete mit einer knappen Geste Richtung Hubschrauber. Der Leichnam sollte nun abtransportiert werden. Sie stapften durch den nassen Sand in Richtung der Felswand, um dem Wirbel der Rotorblätter auszuweichen.
»Mann, Mann, Mann!«, rief Hampton und stemmte eine Hand ins Kreuz.
»Rückenschmerzen?«
»Ischias, Niere, irgendwas ist da. Na ja, kann man nix machen.«
»Was heißt, er hat ’ne Weile da gelegen? Ein paar Tage oder Wochen?«, fragte Collin.
Er hatte keine Lust, auf eine von Hamptons Krankheitsgeschichten einzugehen. Immer klagte er über irgendein Zipperlein oder vermutete eine schwere, unheilbare Krankheit zu haben.
»Länger als ein paar Tage schon, würd ich sagen, so auf den ersten Blick. Muss erst mal ins Labor. Schlückchen?«
Hampton hielt Collin eine kleine Schnapsflasche hin, die in einem Handystrumpf mit Mickymaus-Gesicht steckte. Es war allen bekannt, dass Hampton ein Säufer war, der sich nicht um Dienstgesetze scherte und auch während der Arbeitszeit trank. Machte der Beruf des Rechtsmediziners einen zum Trinker?
Collin wischte die Flaschenöffnung ab und nahm einen Schluck. Whisky, stellte er fest. Kurz genoss er das Gefühl von Wärme im Hals und im Bauch.
»Die wievielte ist es denn?«
»Wie?«
»Die wievielte Wasserleiche in deiner Laufbahn?«
»Als ob ich die zähle. Die meisten sind ja Ertrunkene. Der da nicht.«
»Sein Gesicht – Hammer oder Axt? Was meinst du?«
»Was Scharfkantiges. Axt kann sein. Haben sich die Fischchen drüber gefreut. Kann froh sein, dass hier keine Haie sind. Aber hätt er eh nicht mehr mitgekriegt.«
Hampton lachte. Ein aus dem Bauch rollendes, trockenes Bellen.
Collin schaute auf die Uhr und wünschte, der Helikopter käme jetzt in diesem Augenblick zurück. Mit manchen Kollegen würde er nie warm werden. Hampton gehörte eindeutig dazu.
»Wann kann ich mit den ersten Ergebnissen rechnen?«
»Na ja, morgen fang ich dann mal an. Oder gleich noch. Wenn sonst nichts anliegt. Im Frühjahr wird mehr gestorben.«
»Ist das so?«
»Wintersünden. Ist wie mit Rosen. Deckst du die im Winter nicht richtig zu oder machst den Sack zu früh weg, zack, gehen sie ein, wenn noch mal Frost kommt.«
Collin dachte an die Rosenstöcke, die Kathryn gepflanzt hatte. Sie hatte einen grünen Daumen und bislang war noch keiner eingegangen. Ich muss ihr das erzählen, nahm er sich vor und hörte erleichtert das Motorgeräusch des Hubschraubers. Kein Wunder, dass alle Hampton mieden. Er strömte etwas wie den Leichengeruch aus, von dem er tagtäglich umhüllt war. Unangenehm und negativ. Ja, man glaubte in seiner Gegenwart gleich krank zu werden. Collin kam zu dem Schluss, dass positives Denken, von dem Kathryn wie aus der Bibel predigte, doch letztlich etwas für sich hatte.
Er half dem alten Angler in den Helikopter und hielt den Blick zum Meer gerichtet, als sie aufstiegen. Die Flut war wild. Eine schäumende Bestie. Der tote Mann hatte keinen Schiffbruch erlitten. Aber er war vielleicht über Bord geworfen worden. Dann müsste das Boot irgendwo herumschwimmen. Oder war es an einem der unter Wasser liegenden Felsen zerschellt? Hatte es eine blutige Auseinandersetzung auf dem Boot gegeben? War es Totschlag oder Mord? Alles sprach auf den ersten Blick dafür, dass der unbekannte Mann Opfer eines kaltblütigen Mordes geworden war. Der nackte gemarterte Körper. Die mit einem stabilen Seil fachmännisch verknotete Plane.
Das Meer sollte sein Grab sein. Aber es hatte ihn wieder ausgespuckt. Vor Collins Füße. Als würde es nicht jedem gönnen, die letzte Reise in die Weiten des Ozeans anzutreten.
Und ich habe keine Wahl, dachte Collin.
2
Elisabeth stellte den Koffer ab und sank aufs Bett.
Ihr Rücken schmerzte, besonders der Nacken, die Beine waren bleischwer, sie war durchgeschwitzt und so erschöpft wie seit jenen vier schlaflosen Nächten nicht mehr, als sie an Mervins Krankenhausbett gewacht hatte. Ihr Kopf fühlte sich noch immer an wie mit Nebel gefüllt. Von den Reisetabletten hatte sie gleich acht geschluckt, um ihre Flugangst zu bezwingen.
Verkehrslärm drang in das enge Zimmer des Zweisternehotels. Sie wünschte, Mervin oder Olivia anrufen zu können, sehnte sich nach einer vertrauten Stimme, die ihr Mut und Trost zusprechen würde. Doch in Australien war es jetzt zwei Uhr morgens und sie wollte niemanden wecken.
Sie rappelte sich auf und ging duschen. Man muss wach bleiben, dann vergeht der Jetlag schneller, hatten ihr erfahrene Überseereisende erklärt.
An ihren bislang einzigen Vierundzwanzig-Stunden-Flug, der sie vor rund zwanzig Jahren von England fortgeführt hatte, konnte sie sich nicht mehr erinnern.
Die Knochen waren damals eben jünger gewesen. Eine andere war sie gewesen. Und als eine andere war sie jetzt zurückgekehrt.
Zu spät, wie sie wusste, seit sie die Nachricht erhalten hatte. Immer war sie für das Wichtige im Leben zu spät gekommen.
Sie zog sich um und fuhr die fünf Stockwerke zum Hotelrestaurant hinunter. Es war geschlossen. Sie ärgerte sich. Ihr Magen knurrte, sie hatte Durst und spürte eine Unruhe, die sie hinaustrieb.
Elisabeth zog den Schal fester.
Die Hitze Australiens glühte noch auf ihrer Haut nach, doch die letzten Monate hatte sie sich von einer Erkältung zur nächsten geschleppt.
Das Immunsystem, hatte der Arzt gesagt. Alles nur Stress. Lockern Sie sich.
Alles locker sehen. Das hatte sie Hunderte Male gehört. Jazz’ Lieblingsspruch. Sie hatte sich darin einlullen lassen wie in die staubige, salzige dunkelblaue Sonnenglut seiner Heimat.
Sie erkundigte sich bei einem Passanten nach dem nächstbesten Restaurant.
Wie in Trance nahm sie alles wahr: die stattlichen viktorianischen Bauten mit den schmiedeeisernen Toren und Balkongittern, die dicken Knospen an den Rhododendronbüschen in den Vorgärten. Abgasgestank und der erste Dufthauch von Kirschblüten und Hyazinthen.
Sie kam auf die belebte Kensington High Street, an der sich Shoppingcenter aneinanderreihten, aus denen Reklamegekreisch und der zu schnelle und zu laute Beat dieser Zeit drangen. Die Bürgersteige zu beiden Seiten der Straße waren ein einziges wogendes Leibermeer.
Leiber bewaffnet mit Handys, überdimensionalen Kopfhörern und Einkaufstüten. Dazwischen wälzte sich vierspuriger Verkehr von einer Ampel zur nächsten.
Elisabeth lehnte sich an ein Schaufenster. Ihr war übel.
Sie war Jahre nicht mehr in einer Großstadt gewesen, weder in Sydney noch in Melbourne. Sie hatte die Erinnerung an die Geräusche und Gerüche einer Metropole wie London vergessen.
War es damals genauso gewesen? War London genauso groß, eine nicht endende Betonlandschaft, über die sie an diesem Morgen eine halbe Stunde lang hinweggeflogen war? War es damals auch so ohrenbetäubend laut gewesen? Hatte man den Himmel vor Smog nicht sehen können?
Als Teenager war London das Ziel ihrer Träume gewesen.
Jetzt, zwei Jahrzehnte später, hatte sie keine Freude verspürt, es wiederzusehen. Nein. Kein Kribbeln, keine aufgeregte Erwartung hatte sie empfunden, als die heimatliche Insel nach vielen Stunden Martyrium auf einem zu engen Flugzeugsitz endlich unter den Wolken aufgetaucht war.
Die Insel, die ihr einst zu eng, zu dunkel, zu kalt erschienen war, auf der sie geglaubt hatte, ganz allmählich zugrunde zu gehen.
Panik. Ja. Panik hatte sie gespürt, gedämpft nur durch die sedierenden Reisetabletten.
Und Panik befiel sie nun wieder in dieser belebten Einkaufsstraße. Sie atmete tief durch und fragte einen der Bodyguards vor dem Geschäft nach einem Restaurant. Er empfahl eine Pizzeria, gleich in der nächsten Seitenstraße.
Dort saß Elisabeth drei Stunden wie gelähmt erst vor einer vegetarischen Pizza, die sie halb verzehrt zurückgab, dann vor Espresso und Leitungswasser.
Wie, so dachte sie in einem Gefühlschaos aus Mutlosigkeit und Verzweiflung, wie kann ich dieser mir fremden Familie gegenübertreten? Wer bin ich anderes als eine aus ferner Vergangenheit und vom anderen Ende der Welt angereiste Unbekannte?
Welches Recht habe ich, etwas einzufordern, das mir gar nicht zusteht, nur weil ich keinen Ausweg weiß? Weil es eine Fügung des Schicksals ist, dass gerade im Moment der Ausweglosigkeit ein Rettungsring geworfen wurde, zumindest ein Strohhalm Hoffnung.
Was sollte sie sonst als Entschuldigung vorbringen?
Dass sie schließlich die genetische Schwester war? Sie die offizielle Nachricht eines Notars erhalten hatte? Dass sie unschuldig an den Ereignissen war und dennoch ein Recht auf Mitsprache hatte?
Für eine Auseinandersetzung, welcher Art auch immer, fühlte sie sich so wenig gewappnet wie für eine Enttäuschung.
Die lange Reise durfte nicht umsonst sein. Davor hatte sie Angst.
Tief in ihr aber lauerte eine andere Angst, eine, die auch am anderen der Welt, in der Ödnis und Stille des Outbacks, nie vertrieben werden konnte. Oft verschafften sich die Angstgespenster gerade dort besonders deutlich Gehör.
Elisabeth schleppte sie wie einen alten Koffer mit sich. Mochte sie sich noch so stark fühlen, sie konnte ihn nicht loswerden. Wie ihren Schal trug sie jene dunkle Angst, seit sie in Heathrow gelandet war, und er schnürte ihr die Kehle zu.
Sie zahlte, fand zum Hotel zurück und bestellte sich für den nächsten Morgen ganz früh ein Taxi zum Bahnhof Paddington. Dann hängte sie das schwarze Kleid zum Lüften an die Garderobe, nahm eine Schlaftablette und legte sich hin.
Einschlafen konnte sie lange nicht. Anthonys Gesicht verfolgte sie. Das Gesicht eines Fünfundzwanzigjährigen.
Wäre er ihr auf der Straße begegnet, hätte sie ihn erkannt? Vermutlich nicht.
Sie hätte ihn womöglich nicht einmal identifizieren können.
* * *
Erst beim sechsten Klingeln schrak Elisabeth aus tiefem Schlaf auf. Es war Mervin.
»Ich wollte nur wissen, ob alles in Ordnung ist.«
Elisabeth horchte besorgt, doch meinte nur Hast in seiner Stimme wahrzunehmen.
»Ja, alles bestens. Mervin, das kostet …«
»Ich weiß. Aber da ich dich nicht begleiten konnte …«
»Ist MrsTumber bei dir? Bist du gut versorgt?«
»Wie ein Baby. Die alte Glucke würde am liebsten mit mir im Bett schlafen. Du kennst sie doch. Ich wollte dir nur schnell alles Gute für die nächsten Tage wünschen und so. Du weißt schon.«
»Danke, mein Schatz. Es tut gut, deine Stimme zu hören.«
Elisabeth glaubte das Geräusch eines Kusses zu hören, bevor Mervin auflegte. Hatte nicht auch Sam, ihr Bordercollie, im Hintergrund gebellt?
Ein Anflug von Heimweh überfiel sie.
Sie stellte sich vor, jetzt auf der Holzveranda zu stehen, über den Hof zu blicken, die Hühner in ihrem Verschlag scharren zu sehen, wie der Wind in dem großen Baum rauschte, dessen Namen sie noch immer nicht wusste und der die Veranda beschattete, und ganz in der Nähe Olivias Schafe, das Quietschen eines Windrades und Mervins dunkle Stimme, die fordernd nach ihr rief.
Was war er doch für ein guter Mensch. Ja, im Grunde seines Herzens war er das. Seine Launen, seine Wutanfälle, den blanken Hass, den er auf das Leben hatte und somit auch auf sie, all das vermochte sie fern von ihm vergessen. Alles an ihm erschien ihr jetzt weich und warm wie roter Sand, in den sie sich betten wollte, um tief auszuatmen.
Wenn sie die Wahl hätte, wäre sie jetzt lieber bei Mervin, würde sich auch die schlimmsten Flüche anhören, seinem gesunden Arm nicht ausweichen, mit dem er um sich schlug, und jede einzelne seiner Tränen trocknen, die er letztlich wegen ihr vergoss. Auch die kaputte Bandscheibe, die sie ihm zu verdanken hatte, erschien ihr erträglich.
Es war das erste Mal, dass sie getrennt waren. Getrennt durch ein endloses Meer und Landmassen, die sich zwischen sie und ihr gemeinsames Schicksal schoben. Sie war niemand ohne ihn, wurde ihr klar. Litt auch er unter ihrer Abwesenheit? Sein Anruf schien ihr der Beweis dafür.
Ganz leise jedoch meldete sich in ihrem Hinterkopf eine Stimme, die ihr zuflüsterte, dass es womöglich einmal ganz gut war, wenn Mervin ohne sie zurechtkommen musste.
Vielleicht würde dann, sobald sie zurück wäre, sein Hass in Liebe verwandelt sein.
* * *
Am nächsten Morgen stand sie im ungewohnten Nieselregen vor dem Hotel und wartete auf das Taxi. Sie hatte Olivias Regenhut aufgesetzt. Ein unförmiges, aber praktisches Ding, mit dem sie vermutlich lächerlich und unmodern wirkte. Jeder konnte ihr ansehen, wie hinterwäldlerisch sie war. Zwanzig Jahre in einem Dreitausend-Seelen-Kaff hatten ihre Spuren hinterlassen.
Als rebellische junge Frau, die auf ihr Äußeres Wert gelegt hatte, war sie einst nach Australien gegangen. Nun kam sie als eine Frau zurück, der es nicht mehr wichtig war, um jeden Preis aufzufallen.
Die rote Erde macht dich schön, hatte ihr Olivia einmal gesagt. Sie hinterlässt wie die Sonne, der Regen, die Stürme Spuren in dir, die von innen nach außen strahlen. Du wirst irgendwann selbst ein bisschen wie die Erde und der Himmel.
Olivias Hut gab ihr jetzt eine gewisse Sicherheit. Wie der schwarze Tweedmantel, den sie für den heutigen Tag gebraucht gekauft hatte.
In Australien war sie sich darin fremd und elegant vorgekommen. Für London hatte er entschieden zu wenig Chic.
Aber für neue Kleidung war kein Geld da gewesen. Alles, was sie besaß, war aus zweiter Hand. Schon immer. Gebrauchtes, Gefundenes, Geliehenes. Das sollte sich nun ändern. Darum war sie hergekommen.
Aber wenn sie mit leeren Händen zurückfliegen würde? Was dann? Wie sollte sie ihre Schulden zurückzahlen? Die Reisekosten hatte ihr Olivia vorgestreckt.
Elisabeth versuchte ihre Sorgen zu verdrängen und setzte sich mit gespielt großstädtischer Lässigkeit ins Taxi. Als sie später im Zug nach Southampton saß, der in eine vom Regen niedergedrückte graue Landschaft aus verstreuten Dörfern, modrigen Feldern und kahlen Baumreihen fuhr, krampfte sich ihr Magen vor Nervosität zusammen.
Sie erinnerte sich an die Male, als sie damals nach der Schule diese Strecke mit dem Zug oder dem Bus gefahren war. Auf der Hinreise gen London hatte sie sich mit jeder Meile freier gefühlt. Auf der Rückreise genau das Gegenteil. Alles hatte sich verdüstert und auf den Magen gedrückt, genau wie jetzt. Ein Gefühl, als hätte sie Steine verschluckt.
Sie hatte sich Anthony all die Zeit immer in London vorgestellt. Warum war er an den Ort ihrer Kindheit zurückgekehrt? Womöglich wurde er im Grab ihrer Eltern beigesetzt. Es würde Kraft kosten, und sie wusste nicht, ob sie diese aufbringen würde. Heute die Beerdigung und am nächsten Tag der Termin beim Notar in London.
Sie hatte keine Ahnung, wo sie in den sechs Wochen bleiben sollte. Sie war sich nicht einmal sicher, ob sie bereit war, etwas über Anthonys Leben zu erfahren. Aber war sie nicht deshalb hier?
Elisabeth versuchte sich abzulenken und schaute aus dem Fenster. Sie erkannte nichts wieder. Die kleineren Orte schienen gewachsen zu sein. Mehr Häuser, mehr Autos, mehr Menschen. Siedlungen zerschnitten Wiesen. Straßen, Brücken, Strommasten, Industriegebäude hatten Wunden gerissen. Das Beschauliche, Puppenhaus-Kleine, das Grüne und Hügelige, die steinernen Zeugen von Jahrhunderten – alte Mauern und Kirchen, Kopfsteinpflaster und windschiefe Cottages – all das, was sie in Australien manchmal wie eine schwarze Welle des Heimwehs nach England vermisst hatte, sah sie nicht.
Es kam ihr vor, als fahre sie durch ein komplett fremdes Land.
Vielleicht würde sie die Orte ihrer Kindheit und Jugend gar nicht wiederfinden? Waren sie dem Erdboden gleichgemacht worden?
Sie hatte sich vorgenommen, den nötigen Mut aufzubringen, sich allem zu stellen. Sie wollte die Straße aufsuchen, in der sie mit ihrer Familie gelebt hatte. Ihre alte Schule, das College, den Hafen, wo ihr Vater gearbeitet hatte. Das kleine Eckgeschäft, wo MrsCai Yan, die runzelige Chinesin mit einem nie erlöschenden Lächeln, ihr oft Schokolade zugesteckt hatte. Durch den Park mit dem Spielplatz wollte sie laufen, ihr Umweg von der Schule. Auf die Schaukel wollte sie sich setzen, auf der sie jedes Mal so hoch wie möglich hinaufgeschwungen war, bis es im Bauch gekitzelt und sie für Augenblicke alles vergessen hatte, was sie zu Hause erwartete.
Sie wollte mindestens eine Woche in London verbringen. Anthonys erste WG-Wohnung aufsuchen, die Kellerkneipe, in der sie Jazz kennengelernt hatte, das Unigelände, den Hyde Park, all die Orte, wo sie einst glücklich gewesen war, die sie zumindest mit einer gewissen Leichtigkeit verband, mit der Zeit, bevor alles zerstört worden war. Vielleicht würde sie auch die Energie aufbringen, alte Freunde von damals zu suchen.
Es war Olivias Idee gewesen. Stell dich den Dämonen, um sie endlich zu vertreiben oder ihnen wenigstens mit einem Achselzucken zu begegnen. Elisabeth hatte es Olivia versprechen müssen. Im Moment traute sie sich nicht zu, das Versprechen zu halten.
Viel zu früh erreichte Elisabeth Southampton, gönnte sich einen Kaffee an einem Bahnhofskiosk und ließ sich dann mit einem Taxi zum Friedhof fahren.
Die Stadt erschien ihr erschreckend vertraut und gleichzeitig fremd, so als sähe sie sie zum ersten Mal. Der verfallene Glanz einer Stadt am Meer, die harten Fassaden einer Hafenstadt, die wie Kraken um alte Viertel gewachsenen Neubausiedlungen, ein Geruch nach Abfall, Fisch und Feuchtigkeit. Die verschlossenen und unfreundlichen Gesichter von Menschen, die in Eile sind, die frieren, die vergebens Wärme suchen oder das kleine Glück.
Hätte sie nicht ihr halbes Leben hier verbracht, wäre es eine Stadt, wie es sie überall auf der Welt gibt. Zu groß, um ihren Reizen und Fallstricken nicht zu entkommen, und zu bedeutungslos, um sie nicht verlassen zu wollen.
Elisabeth schloss die Augen. Es wäre ihr lieber gewesen, wenn man sie nicht am anderen Ende der Welt aufgespürt hätte. Ob man einen Detektiv auf sie angesetzt hatte? Oder standen ihr Name und Aufenthaltsort in einer internationalen Datenbank, die bei Todesfällen angezapft wurde?
Der Luftpostbrief mit der Nachricht von Anthonys Tod steckte vom vielen Lesen schon leicht zerknittert in ihrer Handtasche. Der Briefkopf eines Notars und dessen schnörkellose Wortwahl, mit der er ihr als einzige direkte Verwandte nahelegte, ihn zu einer festgelegten Zeit in seinem Büro aufzusuchen, zusammen mit entfernten Verwandten. Sie würden auch bei der Beisetzung sein, fiel ihr ein, als das Taxi vor dem Friedhofstor hielt.
Nur einmal war sie hier gewesen. Die hohen Ulmen, Buchen und Koniferen waren auch damals einschüchternd gewesen. Das Tor hatte genauso gequietscht, der Kies unter ihren Schuhen geknirscht und jeder Schritt hatte sich so angefühlt wie jetzt.
Es war ein großer Friedhof. Ein Labyrinth aus Wegen mit verwitterten Grabsteinen, vermoosten Engelsfiguren, feuchten Bänken, hohen Hecken und Buchsbäumen. Irgendwo in dem Gewirr der Wege waren die Gräber ihrer Eltern. Sie würde Tage brauchen, sie zu finden. Und sie war sich nicht sicher, ob sie die Gräber überhaupt finden wollte.
Sie wünschte sich, ihre Vergangenheit wäre wie ein Tintenklecks gelöscht worden. Und somit auch ihre Pflicht als Anthonys Schwester. Stattdessen schluckte sie schnell eine weitere Beruhigungstablette und lief einer Gruppe Fremder hinterher, die wie sie dem Wegweiser zur Kapelle folgten. Mit jenem verschrammten Koffer in der Hand, in den sie zwei Jahrzehnte zuvor ihre wenigen Habseligkeiten für eine Reise ins Unbekannte gepackt hatte, um alles hinter sich zu lassen.
Zwei Männer drehten sich zu ihr um und sahen sie neugierig an. Sie stellte den Koffer ab und streckte die Hand aus.
»Elisabeth Polodny. Anthonys Schwester.« Es gelang ihr ein Lächeln.
»Anthony wie aus dem Gesicht geschnitten. Angenehm. Phil. Und das ist Richard. Anthonys Klubfreunde.«
»Klubfreunde?«
»Ja, ganz sündige Gesellen.« Phil lachte mit einem offenen, sympathischen Gesichtsausdruck. »Wir haben uns jede Woche zum Bowling getroffen. Anthony fehlt jetzt. Sogar sehr. Darf ich Ihnen den Koffer abnehmen? Haben Sie eine weite Reise hinter sich?«
»Australien.« Elisabeth versuchte mit den beiden Schritt zu halten.
»Australien? Hat Anthony nie erzählt, dass er eine Schwester in Australien hat und noch dazu eine so hübsche«, sagte Richard. »Da erfährt man ja allerhand Geheimnisse, kaum ist er unter der Erde.«
»Wie meinen Sie das?«
Richard blickte Phil kurz an, bevor er antwortete. »Na ja, was man so erzählt und hört. Hier entlang.«
Sie bogen in den Vorplatz zur Kapelle ab, auf dem sich weitere Trauergäste versammelt hatten, im Ganzen nicht mehr als ein Dutzend. Einige hatten Schirme aufgespannt. Wäre sie an Anthonys Stelle, dachte Elisabeth, kämen wohl nicht einmal eine Handvoll.
Fragende Gesichter wendeten sich ihr zu. Keins war ihr bekannt. Sie schaute vage in die Runde, stellte sich vor, schüttelte Hände.
»Welch schöne Überraschung!«
Eine groß gewachsene Frau um die sechzig mit Fuchspelz um den Hals umarmte Elisabeth. Sie verströmte eine Wolke blumigen Parfüms.
»Anthony wird sich so freuen, dass Sie gekommen sind«, sagte sie mit rauchiger Stimme. »Wissen Sie, ich denke, der liegt da gemütlich in seinem Sarg und späht durch irgendein kleines Astloch. Er will ja sehen, was los ist an seinem Ehrentag, oder? Ach, entschuldigen Sie. Ich bin Martha. Martha Fridge. Das ist mein Mädchenname. Habe ich wieder angenommen. Polodny klang natürlich vornehmer. Wer heißt schon freiwillig Kühlschrank? Allerdings liebe ich den Inhalt von Kühlschränken. Leider. Tun Sie mir bitte den Gefallen und nennen Sie mich Martha. Da fühle ich mich jünger und schlanker.«
Sie klopfte sich auf den korpulenten Bauch und zog an ihrer silbernen Zigarettenspitze.
»Mutter, nun mach mal halblang. Du bringst die Dame ganz durcheinander«, unterbrach sie ein nicht minder beleibter Mann.
Er verbeugte sich, lüftete einen breitkrempigen Hut und küsste Elisabeths Hand.
»Mistwetter hat sich Anthony ausgesucht!« Er zog eine kleine Dose aus der Jackettjacke. Schnupftabak. »Verzeihen Sie bitte, meine Gute. Meine Mutter ist nicht ganz frisch hier oben.« Er tippte sich an die Stirn. »Besonders wenn sie auf Beerdigungen geht. Und ich bin leider ihr Sohn. Fynn ist mein Name. Daran ist sie schuld. Fynn Fridge. Fürchterlich. Sie können sich vorstellen, wie ich gefoppt wurde. Anthony sagte immer, er hätte mich Hannibal getauft, doch er konnte sich nicht durchsetzen.«
»Hannibal hätte besser zu dir gepasst«, sagte Martha. »Schauen Sie sich nur mal diese Fäuste an. Hat sich als Kind immer nur geprügelt.«
»Zum Boxprofi hat’s dann doch nicht gereicht«, erwiderte Fynn und gab seiner Mutter einen Knuff auf den Oberarm. »Aber für eine schiefe Nase.« Fynn lachte und entblößte einen abgebrochenen Schneidezahn.
Elisabeth musste bei seinem Anblick an die typischen Darsteller von anrüchigen Mexikanern in alten Cowboyfilmen denken. Ein schmaler, lang gewachsener Schnauzbart umrahmte volle Lippen. Buschige Brauen, ein Geäst an Lachfalten und spöttische dunkle Augen. Er sog den Schnupftabak geräuschvoll ein, bekam eine Niesattacke und wischte sich mit dem Jackenärmel über die Nase.
»Sie sind Anthonys Sohn?« Elisabeth starrte auf die gelbe Narzisse in seinem Knopfloch. Sie hätte sich gern gesetzt. Ihr war kalt. Alles entglitt ihr, und sie konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen.
»Na ja, kann man so oder so sehen. Knödel halb und halb kennen Sie sicher. Also damit vergleiche ich das gerne. Meine Mutter hat nämlich in der Hinsicht eine Erinnerungslücke. Stimmt’s, Paul? Oder weißt du, wer von den beiden liebsten Bettgenossen deiner Mutter dein Erzeuger ist? Anthony oder der verrückte Professor?«
»Wir stammen doch sowieso alle von Sternschnuppen ab. Das Huhn fragt auch nicht, wer das Ei befruchtet hat, das du in die Pfanne haust«, sagte Martha.
Ein schlanker, hochgewachsener Mann gesellte sich zu ihnen. Hellbraune Augen sahen Elisabeth forschend an.
»Elisabeth, Anthonys reizende Schwester. Und das ist mein Bruderherz Paul«, erklärte Fynn. »Kaum zu glauben, oder? Der hat meines Erachtens nichts zu essen gekriegt. Strafmaßnahme. Ist nämlich ein extrem nerviger Zeitgenosse. Journalist. So einer mit Stift in der Hemdtasche. Stellt immer die falschen Fragen zur falschen Zeit. Da hilft nur Essenentzug. Stimmt’s?«
Fynn legte den Kopf in den Nacken und öffnete den Mund zu einem lauten Lachen.
»Was will man mit einem Sohn machen, der nur Gemüse isst?«, fragte Martha. »Aus einer Bohne wächst ’ne Bohne, hab ich recht? Wo bleibt eigentlich der Pfaffe?«
»Haben Sie bitte Nachsicht mit meinen verrückten Blutsverwandten. Das ist vielleicht unsere Art, mit Trauer umzugehen. Nochmals herzlich willkommen.« Paul streckte Elisabeth die Hand hin, die sie zögernd ergriff. »Wir waren Anthony sehr zugetan. Er war wie unser Vater.«
»Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen«, sagte Elisabeth. »Ich habe ja all die Jahre keinen Kontakt zu Anthony gehabt. Ich weiß …«
»Sie wissen nichts. Darüber bin ich mir im Klaren. Wir alle. Es spielt keine Rolle. Heute so wenig wie gestern oder morgen. Sie sind da. Das rechnen wir Ihnen hoch an. Lassen Sie uns reingehen. Sie sehen ganz durchgefroren aus.«
Die Glocken begannen zu läuten.
Elisabeth ging mit weichen Knien inmitten der seltsamen Trauergemeinde in die Kapelle hinein, wollte sich erst allein nach hinten setzen, wurde aber in die erste Reihe gebeten. Alles kam ihr falsch vor. Als sei sie Statistin in einem Film oder hätte sich auf die falsche Beerdigung verirrt. Sie hatte sich eine verbissene, herablassende, keifende Familie vorgestellt, die ihr mit Misstrauen und Ablehnung begegnen würde. Und nun sah sie sich einer Gruppe Verrückter ausgesetzt. Sie hätte nicht sagen können, was schlimmer war. Alles war anders als erwartet.
Als der erste Gitarrenriff von »Tuesday’s Dead« erklang, wandte sie den Blick von dem rot lackierten Sarg ab, auf dem eine einzelne gelbe Narzisse auf einem weißen Tuch lag.
Elisabeth schloss die Augen und kämpfte gegen Tränen.
Anthony hatte Cat Stevens im Gegensatz zu ihr immer geliebt. Und vor allem diesen Song. Sie wusste, warum. Sie wollte aber nicht daran denken. Nicht hier. Nicht jetzt. Hatte Anthony ein Drehbuch für seine Beerdigung hinterlassen? Hatte er gewusst, dass sie kommen würde? Wollte er sie noch im Tod quälen? Wer unter den Trauergästen wusste Bescheid? Wer ahnte, warum Anthony sich einen blutroten Sarg gewünscht hatte, und konnte die gelbe Narzisse in Verbindung mit seinem Leben bringen? Wusste die Fridge-Familie etwas? Hatte Anthony sich ihnen anvertraut?
Sie wagte einen Blick zur Seite, wo Fynn mit einem in sich gekehrten Lächeln saß. Er hatte die Narzisse aus dem Knopfloch genommen und zwirbelte sie zwischen den Fingern. Ihr lief ein Schauer über den Rücken.
Sie konnte sich kaum auf die Trauerrede konzentrieren. Der Pastor hatte Anthony mit Sicherheit nicht gekannt, so allgemein waren seine Worte. Und Anthony hatte nichts von der Kirche gehalten. Oder war er irgendwann gläubiger Anglikaner geworden? Erst am Ende der Trauerrede horchte Elisabeth auf.
»Ein Mann ist von uns gegangen, der voller Lebenslust war. Farbenfroh, so nannten ihn alle, mit denen ich über den Verstorbenen gesprochen habe. Ein Mann, der Farben so sehr liebte, dass er mit ihnen zu Gott gehen wollte. Und Sie, verehrte Trauergemeinde, haben mich und unsere Kirche überzeugt, dem Verstorbenen ein Fest der Farben zu gewähren.«
Er schwenkte den Arm in Richtung Sarg und über die Anwesenden.
Farbenfroh? Lebenslustig? Nein, dachte Elisabeth, ich hätte ihn nicht so genannt. Das ist alles falsch, falsch, falsch.
Oder hatte sich Anthony um hundertachtzig Grad gedreht? Was mochte ihn so stark beeinflusst haben, dass er lebenslustig geworden war und seine schwarze Kleidung gegen farbenfrohe ausgetauscht hatte?
Erst jetzt nahm Elisabeth wahr, dass sie fast als Einzige Schwarz trug.
Martha hatte unter ihrem cremefarbenen Mantel ein weinrotes Kleid an. Auf ihren Hut hatte sie gelbe Narzissenblüten gesteckt. Paul trug verwaschene Jeans und einen hellen Cordblazer, Fynn unter der Anzugsjacke ein Hemd mit grellem Muster.
Ja, dachte Elisabeth, im Grunde passte all das Unziemliche ganz und gar zu Anthony. Er hatte immer das Gegenteil von dem gemacht, wie alle anderen es gemacht hatten. Er hatte sich nie an eine Etikette gehalten, an Vorschriften oder gesellschaftliche Zwänge.
Einen Moment ärgerte sie sich, nicht daran gedacht zu haben. Sie wünschte, sie hätte ein Kleidungsstück an, das zu ihr gehörte.
Sollte Anthony sie jetzt sehen, so würde er ein ganz und gar falsches Bild von ihr haben.
Zu den Klängen von »Morning Has Broken« schritten sie hinter dem Sarg her. Elisabeth war erleichtert, dass sie nicht zur Grabstätte ihrer Eltern gingen. Das hatte sie eigentlich erwartet, eine Beisetzung im Familiengrab. Aber vielleicht existierte es gar nicht mehr? Gab es nicht etwas wie eine Liegefrist? Sie hatte sich nie darum gekümmert.
Was weiß ich von dir?, dachte sie, als sie eine Handvoll Erde auf den roten Sarg warf, der schon von Narzissen bedeckt war.
Und was hast du dir vorgemacht, Anthony?
3
Als Elli die fremde Frau sah, wusste sie, dass Gott eine Strafe geschickt hatte. Sie wusste nur nicht, wofür.
Ein Unglück geschah meistens an einem Donnerstag. Dafür hatte Elli statistische Beweise. Sie hatte ihr Knie letzten Donnerstag aufgeschürft, als sie vom Fahrrad gefallen war. Und das Fahrrad war danach verbeult, und es war nicht einmal ihr eigenes gewesen, sondern Su-Annes.
Ellis letzte Mathearbeit, die reinste Katastrophe, hatte sie vorletzte Woche donnerstags zurückbekommen. Micey, der Dackel von MrsWinterson, war an einem Donnerstag angefahren worden und seinen Verletzungen erlegen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!