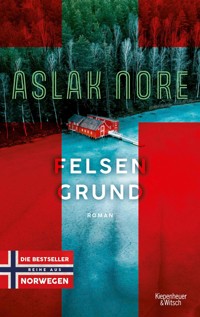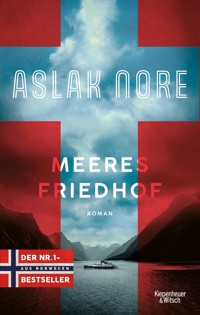
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Falck-Saga
- Sprache: Deutsch
Der Auftakt zur neuen international erfolgreichen Thriller-Reihe aus Norwegen: die Falck-Saga Während des Zweiten Weltkriegs wird ein Hurtigrutenschiff mit norwegischen Zivilisten und deutschen Soldaten an Bord von einer englischen Mine getroffen und sinkt. Hunderte Menschen kommen ums Leben, so auch der Unternehmer und Reeder Thor »Store« Falck. Seine Frau, die junge Schriftstellerin Vera Falck, und ihr kleiner Sohn Olav werden wie durch ein Wunder gerettet. Fünfundsiebzig Jahre später geht Vera im Meer schwimmen und kehrt nicht mehr zurück. Mit ihr verschwindet auch das Testament, das sie sich kurz vor ihrem Tod hat aushändigen lassen. Ihr Sohn Olav, der Patriarch der Familie und Vorsitzender der einflussreichen SAGA-Stiftung, macht sich Sorgen: Hat seine Mutter das Testament in letzter Sekunde geändert und den verarmten Zweig der Familie bedacht? Und was hat es mit Veras Memoiren auf sich, die nach Fertigstellung in den 70er-Jahren vom norwegischen Staatsschutz beschlagnahmt wurden? Olavs Tochter Sasha, die bisher immer auf seiner Seite war, ist fest entschlossen, die Wahrheit herauszufinden, auch wenn sie sich gegen ihren mächtigen Vater stellen muss. Ein literarischer Thriller über Familie und Macht, Reichtum und Vertuschung in der Tradition Stieg Larssons oder Joël Dickers. Die Falck-Saga erscheint in folgender Reihenfolge: - Meeresfriedhof - Felsengrund - Schattenfjord (erscheint im Februar 2026) Die Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Aslak Nore
Meeresfriedhof
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Aslak Nore
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Aslak Nore
Aslak Nore, geboren 1978 in Oslo, studierte an der Universität Oslo und an der New School for Social Research in New York. Er war Soldat im norwegischen Elitebataillon Telemark in Bosnien und arbeitete als Journalist im Nahen Osten und in Afghanistan. In Norwegen hat er mehrere Sachbücher und vier Romane veröffentlicht. »Meeresfriedhof« ist der erste Band einer literarischen Thriller-Serie rund um die Familie Falck und wurde in vielen Ländern ein Bestseller. Nore lebt mit seiner Familie in der Provence, Frankreich.
Dagmar Lendt ist Skandinavistin und übersetzt aus dem Norwegischen, Schwedischen und Dänischen. Bisher hat sie rund neunzig Bücher ins Deutsche übertragen, u.a. von Jon Fosse, Kjetil Try, Karin Alvtegen und Liza Marklund. Sie lebt in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Während des Zweiten Weltkriegs wird ein Hurtigrutenschiff mit norwegischen Zivilisten und deutschen Soldaten an Bord von einer englischen Miene getroffen und sinkt. Hunderte Menschen kommen ums Leben, so auch der Unternehmer und Reeder Thor »Store« Falck. Seine Frau, die junge Schriftstellerin Vera Falck, und ihr kleiner Sohn Olav werden wie durch ein Wunder gerettet.
Fünfundsiebzig Jahre später geht Vera im Meer schwimmen und kehrt nicht mehr zurück. Mit ihr verschwindet auch das Testament, das sie sich kurz vor ihrem Tod hat aushändigen lassen. Ihr Sohn Olav, der Patriarch der Familie und Vorsitzender der einflussreichen SAGA-Stiftung, macht sich Sorgen: Hat seine Mutter das Testament in letzter Sekunde geändert und den verarmten Zweig der Familie bedacht? Und was hat es mit Veras Memoiren auf sich, die nach Fertigstellung in den 70er-Jahren vom norwegischen Staatsschutz beschlagnahmt wurden? Olavs Tochter Sasha, die bisher immer auf seiner Seite war, ist fest entschlossen, die Wahrheit herauszufinden, auch wenn sie sich gegen ihren mächtigen Vater stellen muss.
Ein literarischer Thriller über Familie und Macht, Reichtum und Vertuschung in der Tradition Stieg Larssons oder Joël Dickers.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Havets kirkegård
© 2021 by Aslak Nore and Aschehoug forlag, Norway
Published by agreement with Winje Agency A/S, Norway
All rights reserved
Aus dem Norwegischen von Dagmar Lendt
© 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: buxdesign | Lisa Höfner
Covermotiv: © plainpicture/ Terje Rakke (Fjord), © Sverresborg Trøndelag Folkemuseum (Schiff) und © Adobe Stock
ISBN978-3-462-31100-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Anmerkung des Autors
Stammbaum der Familie Falck
Prolog
Teil 1 Stupet – Die Steilklippe
Kapitel 1 Ein flugbereiter Falke
Kapitel 2 Wenn das Ei klüger sein will als …
Kapitel 3 Niemandsland
Kapitel 4 Was für eine Prosa ist das?
Kapitel 5 Wir reden hier von beträchtlichen Werten
Kapitel 6 Haben wir eine Abmachung?
Kapitel 7 Lass uns anstoßen, auf Mutter
Kapitel 8 Kriegskreuz mit zwei Schwertern
Kapitel 9 Die warmen Arzthände
Kapitel 10 Wer sind wir?
Teil 2 Das Rosettenfenster
Kapitel 11 Es ist das Nachhausekommen, das schwierig ist
Kapitel 12 Wir haben Schiffsuntergänge und Familienspaltungen überlebt
Kapitel 13 Die Vormundschaft
Kapitel 14 La séduction
Kapitel 15 Von Frau zu Frau
Kapitel 16 Wir brauchen einen Scharfschützen
Kapitel 17 Sie müssen vernichtet werden
Kapitel 18 Papa hat zu lange am Ruder gestanden
Kaptel 19 Ich bin unfassbar stolz auf dich
Kapitel 20 Der Friedhof der ausrangierten Grabmäler
Kapitel 21 Es bleibt unter Freunden
Kapitel 22 Du heißt Falck
Kapitel 23 Passive Sterbehilfe
Meeresfriedhof
Erster Teil
Bergen
Bergen–Florø
Bergen–Florø
Florø–Måløy
Måløy
Ålesund–Molde
Kristiansund–Trondheim
Trondheim
Teil 3 Gefährliche Verbindungen
Kapitel 24 Finse 1222
Kapitel 25 Wir haben uns zu Göttern erhöht
Kapitel 26 Falck Ponyclub!
Kapitel 27 Sie sind alle tot
Kapitel 28 Jemand hat diese Dokumente entfernt
Kapitel 29 Russisch auf dem Funkkanal
Kapitel 30 Das hört jetzt auf, du kranker Mistkerl
Kapitel 31 Blut und Erde
Kapitel 32 Sie hatten recht
Kapitel 33 Gott schütze König und Vaterland, Bruder
Kapitel 34 Sensed-presence effect
Kapitel 35 Der Nachruhm ist alles, was nach deinem Tod von dir bleibt
Meeresfriedhof
Zweiter Teil
Trondheim–Bessaker
Bessaker–Rørvik
Rørvik–Brønnøysund
Brønnøysund–Sandnessjøen
Sandnessjøen–Bodø
Bodø–Stamsund
Teil 4 Kong Olavs Vei
Kapitel 36 Kåken
Kapitel 37 Johnny ist kein verdammter Verräter
Kapitel 38 Ein nicht steuerpflichtiger Einmalbetrag
Kapitel 39 Das Meer ist ein Mysterium
Kapitel 40 Es war eine Explosion im Inneren
Kapitel 41 Kabine 31
Kapitel 42 Schwimm hinein ins Schiff
Kapitel 43 Die Erkennungsmarke
Teil 5 Versunkene Seelen
Meeresfriedhof
Epilog
Kapitel 44 Bezeugung
Testament
Kapitel 45 Es handelt sich um einen Notfall
Kapitel 46 Afghanischer Luftraum
Kapitel 47 Ich habe viel falsch gemacht
Epilog Die Reederkabine
Danksagung des Autors
Dank für Übersetzungsförderung
Leseprobe »Felsengrund«
Dies ist ein Roman. Orte, Ereignisse und Personen sind fiktional – mit einigen wichtigen Ausnahmen, auf die in der Danksagung näher eingegangen wird. Alles, was mit den äußeren Umständen des Untergangs des Hurtigrutenschiffes DS »Prinsesse Ragnhild« am 23. Oktober 1940 zu tun hat, basiert auf historischen Quellen.
Dazu gehören die Planskizzen des Schiffes, auf die ich mithilfe eines freundlichen Helfers im Hurtigrutenmuseum in Stokmarknes gestoßen bin. Die Darstellung basiert außerdem auf der Seeunfalluntersuchung vor dem Bezirksgericht Salten und nicht zuletzt auf der Zeugenaussage von Kapitän Knut Indergård aus Batnfjordsøra, die der Öffentlichkeit bisher unbekannt war. Sein Bericht, der mir von der Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre zur Verfügung gestellt wurde, erzählt eine neue Geschichte der Ereignisse.
Zusammen mit seiner Mannschaft – Steuermann Petter Søholt aus Molde, Maschinist Johan Brevik aus Smøla, Maschinenassistent Hans Lie aus Kristiansund und Zahlmeister Oskar Mortensen – unternahm Indergård aus eigener Initiative eine der größten Rettungsaktionen in Norwegen während des Zweiten Weltkrieges, ohne jemals Anerkennung dafür zu erhalten.
Dieses Buch ist der heldenhaften Mannschaft des Frachters MK »Batnfjord« gewidmet, die an jenem Tag mehr als 140 norwegische Zivilisten und deutsche Soldaten aus dem eisigen Meer geborgen hat, und all denen, die sie nicht retten konnten und die ihr Grab auf dem Meeresfriedhof fanden.
Prolog
DN, 4. August 2006
Hans Falck rettete Tausende von Menschenleben.
Um den Preis, dass er oft den Geburtstag seiner Kinder vergisst.
Von John O. Berg
Libanon, September 1982. Ein junger Arzt geht mit schnellen Schritten durch das verdunkelte Flüchtlingslager Schatila in Beirut. In der einen Hand hat er eine große rote Erste-Hilfe-Tasche. In der Armbeuge des anderen Arms trägt er einen Säugling, eingehüllt in eine Decke.
Hans Falck kennt den Geruch von Schießpulver und Exkrementen, ein Gestank, der ihm in den Jahrzehnten danach viele Male wieder begegnen und den Abend in Schatila heraufbeschwören wird. An eben diesem Abend ist eine Miliz aus christlichen Falangisten in das Lager eingedrungen. Angeblich, um militante Palästinenser aufzuspüren, die sich dort verstecken. Jetzt ist das Abschlachten im Gange, und die Falangisten verschonen niemanden. Um ihn sind vereinzelte Stimmen zu hören, Schreie und Schusssalven.
Eine Rakete zischt über den Himmel, und im nächsten Moment werden die Gebäude von einem silbergrauen, unwirklichen Farbfilter erhellt. Hans bleibt stehen. Zwischen den Haufen von Abfall, Essensresten und Schnapsflaschen liegen die Toten: junge Männer mit abgeschlagenen Geschlechtsteilen, schwangere Frauen mit aufgeschlitzten Bäuchen, Kinder, Babys. Am linken Rand seines Blickfelds, etwa zwanzig Meter entfernt, sieht er eine ganze Gruppe: Frauen, ihre Kinder schützend an sich gepresst, Männer in enger Umarmung, alle mit kleinen Einschusslöchern in der Stirn. Die Menschen wurden mit Schüssen aus nächster Nähe hingerichtet.
Die Rakete erlischt und das Bild verschwindet, als hätte man einen Schalter umgelegt. Am Südausgang des Lagers erkennt er die Umrisse der niedrigen Gebäude, die weggesprengt wurden, und hinter den Grundmauern steht ein eiserner Ring aus Milizsoldaten.
Da hört er das leise, durchdringende Weinen des Säuglings. Hans sucht Schutz hinter einem Abfallbehälter, geht in die Hocke und versucht, das Neugeborene zu beruhigen.
Kann ihn jemand sehen? Nein, er ist in Deckung.
Etwas muss er tun, sonst werden sie ihm das Kind wegnehmen. Hans öffnet den Reißverschluss der Tasche mit der Erste-Hilfe-Ausrüstung. Er zerrt die Plastikflaschen mit Kochsalzlösung und Alkohol heraus, ebenso die faltbare Trage, die zu viel Platz wegnimmt, sowie Katheter, das Stethoskop und das Blutdruckmessgerät. Die Instrumente haben spitze Ecken, die den Kopf des Kindes verletzen könnten.
In einer Seitentasche steckt eine Whiskyflasche der Marke Johnnie Walker, Black Label. Ein Geschenk der palästinensischen Anführer, die er getroffen hat. Er weiß es auch ohne Beleg: Sie sind alle tot.
Hans Falck nimmt die Tasche in die Hand und geht auf die Milizsoldaten zu. Sein Charme ist allseits bekannt, nach den Worten eines Kollegen kann er »alles und jeden verführen, vom Steuereintreiber bis zu Spitzenpolitikern und Frauen im Niqab«. An diesem furchtbaren Abend im Jahr 1982 steht Doktor Falck vor seiner größten Herausforderung: Er muss ein neugeborenes Kind vor einem Massaker in Sicherheit bringen.
Libanon, Sommer 2006. Fast fünfundzwanzig Jahre sind vergangen, seit die Massaker in den palästinensischen Flüchtlingslagern die ganze Welt erschütterten. Viel Wasser ist seit damals ins Meer geflossen. Etwas ist jedoch unverändert: Im Libanon herrscht Krieg; Hans Falck ist noch genauso sonnengebräunt, faltenlos, leichtfüßig und »jungenhaft« charmant wie in den Siebzigerjahren, als der Schiffsreedersohn aus Bergen die Damen als selbst ernannter Proletarier umgarnte und behauptete, er werde die Reedereien seines Vaters nach der Revolution zwangskollektivieren.
»Aber das hat das Gericht bereits erledigt, bevor es dazu kommen konnte«, sagt Falck und verneigt sich in Richtung einer bekannten palästinensischen Schauspielerin, die in der Bar des Mayflower auf ihn zukommt, dem legendären Hotel, in dem er für gewöhnlich absteigt, wenn er in Beirut ist.
»Wir nennen ihn nur Hans Saqr«, sagt die junge Palästinenserin errötend. »Das heißt Falke auf Arabisch.«
Wie immer bestellt Hans zwei Johnnie Walker ohne Eis: »Wir müssen einen PLO-Schnaps trinken.«
»Skål«, fährt er fort und hebt das Kristallglas. »Auf die Lebenden, die Toten und die Unterdrückten.«
Letzteres ist eine Gesellschaftsschicht, von der niemand behaupten kann, dass Hans ihr angehört. Er entstammt der mächtigen Falck-Sippe, die das ganze zwanzigste Jahrhundert hindurch eine zentrale Rolle in der norwegischen Gesellschaft gespielt hat, als Schiffsreeder, Wohltäter und Politiker. Sein Großvater Thor »der Große« Falck war ein berühmter Reeder, der während des Krieges beim Untergang eines Hurtigrutenschiffes ums Leben kam und dem post mortem das Kriegskreuz mit Schwertern verliehen wurde, für seinen Einsatz bei der Organisation des Widerstands entlang der Küste.
Seit damals hat sich die Familie Falck in zwei Hauptzweige geteilt. Die Bergenser, zu denen Hans gehört, bewohnen ein Anwesen südlich von Fana. Böse Zungen behaupten, diesem Teil der Sippe sei Unrecht geschehen, als das Vermögen der Familie aufgeteilt wurde. Sehen wir da einen künftigen Erbstreit zwischen den Falcks in Oslo und denen in Bergen auf uns zukommen?
»Oh nein, wir würden das niemals anfechten«, ruft Hans aus. »Als Kommunist bin ich grundsätzlich gegen das Erbschaftsrecht. Nichts verstärkt Ungleichheit so sehr wie eine Erbschaft.«
»Außerdem«, fügt er lächelnd hinzu, »dass wir unseren Besitz verloren haben, ist unser Vorteil. Das ist unser Glück. Das Problem der Reichen ist, dass sie ihr Leben lang Angst haben, ihnen könnte eines Tages alles genommen werden. Erst wenn du alles verloren hast, bist du frei.«
Das kann man von dem anderen Zweig nicht behaupten, der sogenannten Oslo-Phalanx des Falck-Imperiums. Der Onkel von Hans heißt Olav Falck, ehemals Verteidigungsminister und heute Konzernchef der einflussreichen SAGA-Gruppe mit Hauptsitz auf Rederhaugen, dem »Reederhügel« vor den Toren der Hauptstadt. Er ist ein medien- und öffentlichkeitsscheuer Patriarch, angeblich zehn Milliarden schwer, und hat ein Netzwerk, das sich nicht in Geld messen lässt.
Hören wir das leise Echo des klassischen Schismas der norwegischen Geschichte, zwischen der Gründerkultur entlang der Küste und der administrativen Elite in Oslo?
»Wir Bergenser halten ja nicht gerade viel von den Hauptstädtern«, antwortet Hans lachend. »Um es mal so zu sagen: Wenn ich auf den Kontinent oder in den Nahen Osten fliege, mache ich nur eine Zwischenlandung in Oslo, wenn ich unbedingt muss.«
Bergen-Patriot, idealistischer Radikaler, Salon-Linker. Auf Hans Falck treffen viele Charakteristika zu. Ganz gleich, worum sich das Gespräch dreht, er hat immer eine gute Antwort und ein verschmitztes Lächeln parat. Aber laut derer, die ihn kennen, ist Hans eine russische Matroschkapuppe: Mit jeder Schicht, die freigelegt wird, kommt eine neue Version zum Vorschein. Er ist mit dem halben Nahen Osten per Du, vom Spitzenpolitiker bis hin zum Taxifahrer in der Hamra Street, aber seinen Nächsten ist er ein Rätsel. Der Mann mit dem ansteckenden Lachen, das durchs Foyer schallt, hat mehr Leid gesehen als irgendein anderer Norweger seiner Generation und scheint davon unberührt. Der Arzt, der weit über medizinische Fachkreise hinaus berühmt dafür ist, Tausende Schutzloser in den schlimmsten Konfliktgebieten der Welt gerettet zu haben, hat mehr als einmal die Geburtstage seiner Kinder vergessen. Der Feminist, der bei der 8.-März-Demo an der Spitze mitmarschiert, hat nonchalant alle seine Frauen betrogen. Aber auch darauf hat Hans Falck eine Antwort: »Um es frei nach Hemingway zu sagen: Ich mag Kommunisten, wenn sie Ärzte sind, aber ich hasse sie, wenn sie Priester sind. Ich bin nur ein fehlbarer Mensch wie alle anderen.«
Gibt es nichts, was ihn aus der Fassung bringen kann?
Doch, das gibt es.
Es ist die Frage, ob Hans Falck eigentlich jemals jemand anderes als die Unterdrückten der Welt und sein eigenes Spiegelbild geliebt hat. Zum ersten Mal wird sein Blick unsicher, und er windet sich auf seinem Stuhl. Er antwortet nicht direkt darauf, gibt aber vielleicht dennoch eine Antwort.
Libanon, September 1982. Die Milizsoldaten stinken meilenweit nach Schnaps. Lieber so als nach Tod, denkt Hans. Die Augen der jungen Männer sind glasig, sie sind vermummt und richten die Gewehrläufe auf ihn. Hinter ihm ertönen mehrere Schusssalven, vereinzelte Schreie, dann Stille.
»Wir führen eine Operation gegen palästinensische Terroristen durch«, sagt ein Leutnant. »Als Ausländer hattest du die Möglichkeit, das Lager vor Beginn der Operation zu verlassen.«
Der Falangist zündet sich eine Zigarette an. »Dass du die Chance nicht genutzt hast, ist ein Zeichen, dass du den militanten Gruppen angehörst.«
Einige der jüngsten Soldaten, sie müssen Teenager sein, laden durch und machen drohend einen Schritt vorwärts.
»Ich musste bei einer Geburt helfen«, antwortet Hans.
»Die Säuglinge von heute sind die Terroristen von morgen«, sagt der Leutnant, als würde er die Worte ausspucken. »Wo ist das Kind?«
Hans merkt, dass seine Handflächen so verschwitzt sind, dass ihm die Tasche aus den Händen zu rutschen droht. Ein Mucks von dem Kind oder eine Durchsuchung der Tasche und sie sind beide tot.
»Weiß ich nicht«, antwortet Hans. »Das Letzte, was ich gesehen habe, war, dass die Geburtsklinik gestürmt wurde.«
»Aus welchem Land bist du?«
»Norwegen … ein christliches Land … Israel-freundlich … eng verbunden.«
Der Leutnant verzieht den Mund und wechselt ein paar Worte mit seinem Nebenmann. Dann nickt er Hans zu. »Du kannst gehen.«
Hans seufzt erleichtert auf.
»Nachdem wir die Tasche kontrolliert haben.«
Was macht er jetzt? Hans stellt die Tasche langsam auf den Boden. Öffnet vorsichtig den Reißverschluss. Die Milizsoldaten beugen sich über ihn. Das Gesicht des Säuglings ist verdeckt, aber Hans merkt, dass sich das Tuch durch das Atmen des Kindes ein klein wenig bewegt.
Sieht das außer ihm noch jemand?
Hans nimmt die Flasche Johnnie Walker heraus und hält sie dem Leutnant hin.
»Ihr braucht den Schnaps mehr als ich«, sagt er.
Der Libanese mustert das Etikett. Zum Glück erscheint ihm die Tasche nicht verdächtig. Der Offizier reißt die Flasche an sich. »Get lost«, sagt er.
Hans’ Hände zittern so sehr, dass er es nicht schafft, den Reißverschluss zuzuziehen; beim Spießrutenlauf fühlt er sich gewichtslos und betäubt und tröstet sich damit, dass die Soldaten, sollten sie jetzt schießen, sich gegenseitig umbringen. Hans Falck fährt zurück ins Hotel, dasselbe Hotel, in dem er fünfundzwanzig Jahre später auf einem dunkelbraunen Chesterfield-Sofa sitzt und ein Schatten über sein selbstbewusstes Gesicht fliegt.
»Was ist mit dem Kind passiert?«
»Ich habe es in der Obhut von anderen gelassen. Ich hatte der Mutter versprochen, seine Identität niemals zu verraten, und dieses Versprechen werde ich halten. Aber ich hoffe, dass es ein besseres Leben bekommen hat als sie.«
Teil 1Stupet – Die Steilklippe
Kapitel 1Ein flugbereiter Falke
Von jeher hatte Großmutter vorausgesagt, dass der Familienbesitz noch vor ihr zugrunde gehen würde. Was sie damit meinte – ob sie sich für unsterblich erklärte oder die Nachfahren verfluchte –, wusste keiner so genau. Vera Lind war nicht umsonst Schriftstellerin, aber von allen Geschichten, die sie jemals erzählt hatte, gab es keine, die Sasha mehr Angst machte.
Eigentlich war sie auf den Namen Alexandra Falck getauft, es war Großmutter, die darauf bestanden hatte, sie Sasha zu nennen, oder als kleines Kind Sashenka – kleine Sasha –, nach dem russischen Urgroßvater, von dem keiner auch nur ein Foto gesehen hatte.
Von Schlaflosigkeit gequält, war sie früh aufgestanden und hatte sich einen marineblauen Rollkragenpullover und einen Tweedblazer angezogen. Bei unangenehmen Terminen war es wichtig, korrekt gekleidet zu sein. Am Tag zuvor hatte sie herausgefunden, dass einer der Doktoranden am Archiv, das sie leitete, sich Zugang zu den Dateien des Geschäftsberichts der Stiftung aus dem Jahr 1970 verschafft hatte. Das war ein Verstoß gegen die schriftliche Verschwiegenheitserklärung, die er unterschrieben hatte, und Wortbruch war etwas, das sie nicht auf die leichte Schulter nahm.
Die Schnüffelei des Doktoranden war schlimm genug, aber vor allem war sie ein Symptom. Sie konnte es fühlen wie die Luftveränderung, wenn eine Jahreszeit eine andere ablöste. Gut gehütete Geschichten würden jetzt an die Oberfläche kommen.
Was hatte Großmutter damit gemeint, dass Wahrheit und Familienloyalität miteinander in Konflikt standen?
Sasha schloss das Pförtnerhaus, das sie mit ihrer Familie bewohnte, hinter sich ab. Zurzeit war sie allein, die Mädchen waren bei einem befreundeten Paar im Ferienhaus. Mads war auf Geschäftsreise in Asien. Zu Beginn der Ehe hatte er angedeutet, dass es vielleicht ein wenig beengt sein könnte, auf einem Anwesen zu wohnen, das sowohl als Hauptsitz des Familienunternehmens fungierte als auch mehrere Familienmitglieder beherbergte. Sasha war wütend geworden, so wie man es wird, wenn jemand eine offenkundige Wahrheit über etwas anspricht, das man liebt.
Umziehen kam nicht infrage.
Rederhaugen lag eine kurze Bootsfahrt westlich der Hauptstadt. Sasha lief die Ahornallee hinunter zum Wendeplatz. Über Nacht hatte leichter Raureif die Welt in einen blassen Schimmer gehüllt. Ein eisiger Wind strich ihr übers Gesicht und blies direkt durch die Jacke. Sie schüttelte sich unwillkürlich.
Obwohl sie ihr ganzes Leben hier verbracht hatte, wurde sie immer noch oft von Hingabe und Liebe zu diesem Ort überwältigt. Das war ihre Welt. Anwesen und Familie waren eine Einheit, eine Verlängerung von ihr; die glatt geschliffenen, flachen Felsen an der Westseite, wo sie als Kind gebadet hatte, die Stege und Bootshäuser an der Südspitze, die sorgfältig angelegten Rasenflächen, die sich im Sommer smaragdgrün färbten und vom dichten, leise rauschenden Nadelwald abgelöst wurden, der an der Ostseite an einer senkrechten Klippe endete, auf der sich Veras Schreibstube befand.
Vom stillgelegten Springbrunnen auf dem Wendeplatz ging sie einen Kiesweg hinauf zu einem dreistöckigen cremeweißen Steinhaus, das auf einer grasbewachsenen Anhöhe über dem Grundstück thronte, mit Säulengängen, Erkern, verschnörkelten schmiedeeisernen Balkonen und einem runden, burgähnlichen Turm mit Schießscharten als oberem Abschluss.
Von Natur aus war sie konservativ. Veränderungen erfüllten sie mit Angst und Widerwillen. Bei einem Streit hatte Mads ihr zugestanden, dass jemandem mit ihrem Hintergrund – eines Tages würden Sasha und ihre beiden Geschwister die vielleicht schönste Privatimmobilie des Landes, einen Milliardenkonzern und eine humanitäre Stiftung erben – revolutionäre Umwälzungen wenig bringen würden. Das stimmte, aber ihr Konservatismus reichte tiefer: Letztendlich war es nur die Familie, die zählte.
Die Loyalität zu ihr ging Sasha über alles, und wenn die stärksten Familienmitglieder in Konflikt miteinander standen – Großmutter und der dominante Vater wohnten zum Beispiel seit einem halben Jahrhundert auf demselben Anwesen, redeten aber kaum miteinander –, war es ihre Aufgabe, einen Ausgleich zwischen den Extremen zu finden.
Sie schloss die Tür im Sockelgeschoss auf der Rückseite des Hauptgebäudes auf. Von dort ging sie in die Bibliothek, wo sich ihr Büro befand. In ihrem Postfach lag eine Karte mit dem Aufdruck Finse 1222 und der handschriftlichen Nachricht: Vergiss nicht die Tour über den Hardangerjøkul. Liebe dich. M.
Solche kleinen Überraschungen waren typisch Mads. Dass er sich tatsächlich eine Ansichtskarte aus Finse besorgt und sich die Mühe gemacht hatte, sie vor seiner Abreise einzuwerfen, erfüllte sie mit Zärtlichkeit. In jüngeren Jahren hätte sie das sicher als einen zynischen Versuch abgetan, ihr zu imponieren. Jetzt glaubte sie, dass es Liebe war.
Sie setzte sich auf den braunen Eames-Stuhl.
Als Museumsdirektorin der SAGA-Stiftung hatte sie die Personalverantwortung für die fest angestellten Mitarbeiter und die angegliederten, mit einem Stipendium geförderten Doktoranden. Sie schlug den Kalender auf. Besprechung: 08.00–08.10. Sasha sah auf die Uhr. Noch eine Viertelstunde. Ihr grauste.
Im letzten Jahr hatte sie die Vorbereitungen für ein ambitioniertes Gemeinschaftsprojekt mit dem deutschen Bundesarchiv in Freiburg geleitet, Abteilung Militärarchiv. Wenn sie mit Außenstehenden über das Projekt sprach, passierte es nicht selten, dass deren Blicke abschweiften. Archive waren nicht sexy, aber das kümmerte Sasha nicht im Geringsten. Für sie war es Geschichte an sich, die in Briefen und knappen Telegrammen zutage trat. Es war eine Aufräumarbeit, die ganz nach ihrem Geschmack war. Großmutter behauptete zwar immer, die Geschichtswissenschaft sei genauso objektiv wie ein Roman, aber das war nur eine ihrer vielen Übertreibungen.
Bei der Zusammenarbeit mit den deutschen Archiven ging es darum, Informationen über die Hunderttausenden von deutschen Soldaten zusammenzutragen, die während des Krieges in Norwegen stationiert gewesen waren. Ins elektronische System konnten Angehörige, Historiker und andere Interessierte Namen, Daten von Erkennungsmarken oder Ähnliches eingeben und Zugang zu den vorhandenen Informationen erhalten. Die logistischen Herausforderungen waren enorm, aber Vaters Leitgedanke war, die Stiftung in Deutschland besser bekannt zu machen.
Es klopfte an der Tür, und dann klopfte es wieder, aber erst als ihre Uhr Punkt acht anzeigte, rief sie:
»Ja?«
Sindre Tollefsen trat vorsichtig ein. Seine Kleidung war abgetragen, die Geheimratsecken hatten den Haaransatz nach hinten geschoben und sich zu einer Stirnglatze vereinigt, in deren Mitte ein struppiges Haarbüschel saß. Er betrachtete sie unsicher, mit sanftem, leicht ausweichendem Blick. Der Mann mochte ungefähr in ihrem Alter sein.
»Setzen Sie sich«, sagte sie, und er gehorchte. Sie dachte an all die Menschen, die ihr Vater gefeuert hatte.
Wie hatte er das fertiggebracht, wenn es für sie so unangenehm war?
»Wie Sie wissen«, begann sie mit einem unsicheren Räuspern, »arbeitet die SAGA-Stiftung seit Langem mit der Universität zusammen, um es Doktoranden zu ermöglichen, für ihre Dissertation unsere Archive zu nutzen. Eine Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert. Sie haben wertvolle Beiträge zur Aufarbeitung des Krieges geleistet und waren ein wichtiger Mitwirkender im Kooperationsprojekt mit den Deutschen.«
Er schluckte, der spitze Adamsapfel bewegte sich auf und ab. Sasha war von Tollefsens Promotionsprojekt begeistert gewesen. Er forschte über den Widerstand innerhalb der bewaffneten Streitkräfte des Dritten Reichs auf norwegischem Boden. Sein Schwerpunkt war die vollkommen unbekannte Geschichte von zwei deutschen Wehrmachtsangehörigen, die bei Kriegsende in Kristiansand hingerichtet worden waren. Das Projekt war geeignet, den Forschungsstand voranzubringen.
»Aber eine unabdingbare Voraussetzung«, fuhr Sasha fort, »die Sie übrigens unterschrieben haben, als Sie Zugang zu unseren Archiven erhielten, ist die Verschwiegenheitspflicht, sowohl in Bezug auf die deutschen Soldaten als auch auf Umstände, die die SAGA und Angelegenheiten meiner Familie berühren.«
Erst jetzt schien der Doktorand den Ernst der Situation zu begreifen. »Woher wissen …«
»Auf unsere internen Sicherheitsmaßnahmen kann ich nicht eingehen«, erwiderte sie.
In Wirklichkeit war es eine Vorkehrung, die der Sicherheitschef auf Rederhaugen nach dem Modell des Patientenaktensystems im Gesundheitswesen getroffen hatte und die ersichtlich machte, wer von welcher Stelle aus auf die Archive zugriff. Am Tag zuvor, nach dem unangenehmen Gespräch mit Vera, hatte Sasha einige digitalisierte Dokumente aufgerufen, und beim Einloggen hatte sie den Usernamen des Doktoranden gesehen. Es gefiel ihr nicht, dass jemand der Familie so dicht auf den Pelz rückte. Da war sie ganz wie ihr Vater.
»Sie haben die Vorstandsberichte der SAGA von 1969 und 1970 geöffnet«, sagte sie. »Das sind interne Unterlagen, völlig irrelevant für Ihre Forschung oder die Öffentlichkeit.«
»Irrelevant für die Öffentlichkeit!« Jetzt wurde der Doktorand laut.
»Richtig«, sagte Sasha. »Wie Sie vielleicht wissen, ist unsere Familie sehr restriktiv in Bezug auf die Öffentlichkeit. Sie haben noch nie eine Homestory über uns gelesen und werden es auch nie tun. Loyalität und Diskretion sind unser oberstes Gebot.«
Sie klopfte mit dem Kugelschreiber auf die lederne Schreibtischunterlage.
»Jedenfalls haben Sie unser Vertrauen missbraucht, und deshalb verlieren Sie mit sofortiger Wirkung Ihre Stelle und den Zugang zu den Archiven.«
Seine Unterlippe zitterte. »Sie feuern mich?«
Sie nickte. »Tut mir leid.«
Anders als sie erwartet hatte, erhob er sich nicht, sondern blieb sitzen, sprachlos und mit verzerrtem Lächeln.
»Wissen Sie, warum ich die beiden Jahresberichte gelesen habe?«
»Nein, und es interessiert mich auch nicht.«
»Weil Vera Linds Geschichte auch mit meinem Forschungsthema zu tun hat. Es geht um die verlogene Geschichte, die Ihre Familie immer über sich erzählt.«
Sie holte Luft und widerstand der Versuchung, ihm auf die gleiche Weise zu antworten. »Unsere Zeit ist um«, sagte sie kurz und nickte in Richtung Tür.
Der Doktorand stand auf und marschierte hinaus, blieb jedoch in der Türöffnung stehen und drehte sich zu ihr um. »Ich dachte, Sie wären vielleicht nicht wie die anderen, Sasha Falck. Aber Sie sind genauso feige, wenn nicht noch mehr. Ich will nicht für eine Stiftung arbeiten, die sich die Wahrheit auf die Fahnen schreibt und das Gegenteil praktiziert. Fragen Sie Ihre Großmutter, was 1970 tatsächlich in der SAGA-Stiftung passiert ist.«
Die Tür schlug hinter ihm zu.
Sasha saß da und starrte an die Decke. Vera, schon wieder. Wahrheit und Loyalität? 1970? Ihrem Charakter entsprechend – nach ihrer Auffassung rücksichtsvoll und diplomatisch, den Geschwistern zufolge selbstzerstörerisch und konfliktscheu –, stattete Sasha ihrer Großmutter allwöchentlich einen Besuch in Stupet ab, Veras Schreibstube auf der Klippe.
Am Vortag war sie noch dort gewesen.
Wie immer hatte Sasha frisches Gebäck dabei und wie immer tranken sie ein Glas Rotwein und rauchten eine Zigarette, während Sasha ihrer Großmutter ein Kapitel aus Veras Lieblingsroman vorlas. So weit war alles wie sonst gewesen, aber danach hatte das Gespräch eine neue Wendung genommen.
»Der Untergang jährt sich in diesem Jahr zum fünfundsiebzigsten Mal«, hatte Sasha vorsichtig begonnen. »Um den Tag zu begehen, haben wir ein Hurtigrutenschiff gechartert und fahren an die Stelle, wo es passiert ist.«
Die Großmutter drehte sich langsam zu ihr um. »Ich brauche noch eine Zigarette, Sashenka.«
»Ich denke, es würde dir guttun, wenn du mitkommst«, fuhr Sasha fort. »Und vielleicht kannst du auch davon erzählen, was wirklich vorgefallen ist.«
»Davon erzählen?«
»Du hast nie ein Wort darüber verloren.«
Vielleicht war es typisch für Großmutters Generation, dass über Traumata nicht gesprochen wurde. Das Unglück hatte ihr den Mann und beinahe den neugeborenen Sohn genommen.
»Schon möglich, dass es mir guttäte«, sagte Vera. »Aber ich bin mir nicht so sicher, dass ihr hören möchtet, was ich zu sagen habe.«
»Selbstverständlich möchten wir das. Der Krieg ist lange her, wir halten die Wahrheit aus.«
Großmutter hatte sie lange durch den Rauch angesehen. »Wir«, sagte sie und schüttelte den Kopf. »Du bist immer loyal gegenüber der Familie gewesen, Sashenka. Das ist gut. Aber manchmal stehen Loyalität und Wahrheitssuche im Gegensatz zueinander. Auf ein gechartertes Hurtigrutenschiff gehe ich nicht, das steht fest. Willst du hören, was ich zu sagen habe?«
Sasha hatte genickt.
»In dem Fall musst du darauf gefasst sein, dass alles zusammenbrechen kann.«
»Dann brauche ich auch noch eine Zigarette.«
Vera hatte geschwiegen, aber als Sasha aufbrechen wollte, bat Großmutter sie, ein Taxi zu rufen und sie durch den Wald zum Wendeplatz zu begleiten, wo es auf sie warten würde.
»Aber du gehst doch gar nicht mehr aus, Großmutter«, hatte sie gesagt.
»Nun, jetzt tue ich es, liebe Sashenka«, erwiderte Großmutter scharf. »Und ich stehe ja wohl, verdammt noch mal, nicht unter Vormundschaft!«
Da musste Sasha schlucken, sie war es nicht gewohnt, so von Vera zurechtgewiesen zu werden. Es machte ihr auf dem Weg durch den Wald und den Rest des Tages zu schaffen.
Wo Vera nach ihrem gestrigen Gespräch hingefahren war, wusste sie immer noch nicht, aber es wurde Zeit, es herauszufinden.
Draußen vor dem Sockelgeschoss stand Jazz, der Wachhund. Als er Sasha entdeckte, sprang er an ihr hoch.
»Was ist los?«, murmelte sie und kraulte ihn hinter den Ohren. Jazz bellte ungeduldig. Er war ein Belgischer Schäferhund vom Typ Malinois, kaffeebraun, mit einer langen, schwarz maskierten Schnauze wie ein Deutscher Schäferhund, aber kürzerem Fell, leichterem Körperbau und geraderem Rücken als sein deutscher Verwandter. Jazz war verschmust wie ein Welpe und mutig wie ein Wolf. Diese Rasse konnte zu allen möglichen Zwecken ausgebildet werden. Jazz kletterte Bäume hinauf wie eine Katze. Wenn Präsidenten beschützt und Terroristen geschnappt wurden, ging immer ein Malinois an der Spitze.
Sasha trabte hinter dem Hund in die Wildnis. Sie kannte jede Wurzel und jeden Stein, die ganze Geografie des Anwesens lag ihr im Blut: zuerst ein dunkler, weich federnder Pfad durch den Fichtenwald eine kleine Anhöhe hinauf, die rutschig wurde, wenn es regnete, danach über eine Reihe nackter Baumwurzeln um einen kleinen Teich voller Seerosen herum, zwischen zwei Felsen hindurch, die wie Axtklingen geformt waren und eine Kluft bildeten. Als sie Kinder waren, hatte man ihnen natürlich verboten, in den Teufelswald hineinzugehen.
Plötzlich öffnete sich die Landschaft und die Vegetation endete abrupt an einer steil abstürzenden, natürlichen Festungsmauer, mit Großmutters kleiner Hütte wenige Meter links davon.
Sie spürte einen Windhauch und den Höhenschwindel wie einen leichten Stoß in der Brust. Jazz lief die Steinstufe hinauf zur Eingangstür, stellte sich auf die Hinterbeine und bellte.
Sasha klopfte vorsichtig mit dem Hufeisen an die Tür.
Keine Antwort.
»Großmutter?«
Sie öffnete die Tür, die leicht knarrte.
»Vera, bist du da?«
Ein ungelüfteter Geruch schlug ihr entgegen. Sasha warf einen Blick auf die überfüllten Bücherregale, ohne die Titel auf den Buchrücken wahrzunehmen. Der Parkettboden federte leicht, als sie zum Schlafraum ging. Sie öffnete die Tür. Über dem Bett hing ein Foto mit Großmutter und Vater als Neugeborenem auf dem Hurtigrutenschiff. Es berührte sie jedes Mal, gab ihr irgendwie das Gefühl, dass die Welt und die Zeit zusammenhingen.
Als sie jünger war, kam es manchmal vor, dass alte Leute in Tränen ausbrachen, sobald sie sie sahen, so ähnlich war sie ihrer Großmutter. Sie sah es auch selbst. Die Oberlippe zog sich an den Mundwinkeln ein ganz kleines bisschen nach unten, das gab ihnen beiden einen natürlich-melancholischen, aristokratischen Zug, den viele als Arroganz auslegten. Die perlenblasse, makellose Haut stand im Kontrast zum Haar, das ebenso wie Großmutters mahagonibraun mit einem Anflug von Rot war. Auch die Augen waren die gleichen: eingerahmt von hohen Wangenknochen und dichten dunklen Augenbrauen, von der Nasenwurzel leicht schräg aufwärts zeigend. Die Iris darin leuchtete azurblau. Sie war Anfang dreißig, »in dem Alter, in dem Frauen am allerschönsten sind«, um Doktor Hans Falck zu zitieren. Man konnte über den Verführer und Chauvinisten aus Bergen sagen, was man wollte, aber auf dem Gebiet kannte »Onkel Hans« sich aus.
Vorsichtig zog sie die Schlafzimmertür zu und ging zur Küchenecke. Alles war sauber und aufgeräumt. Im Kühlschrank lagen die Sachen, die sie selbst am Vortag gekauft hatte. Sasha öffnete einen Schrank über der Spüle.
Sie wollte ihn gerade wieder schließen, als sie bemerkte, wie das Licht durch eine Reihe von Stielgläsern schien, die auf dem obersten Regal standen. Drei davon waren beschlagen. Sasha nahm eines herunter und strich mit der Fingerspitze darüber. Einige Tropfen hingen noch am Glas und der Rand war feucht, als wäre es gerade abgespült worden. Jazz winselte und drückte seinen starken Hals gegen ihre Hüfte.
Sie ging nach draußen. Der Hund rannte auf den Abgrund zu, wo er jäh abbremste und auf der Klippe einen halben Schritt vorwärts machte, mit gesenkter Schnauze, als wollte er auf etwas zeigen.
Weil die Felswand überhing und teils mit Wacholder und Büschen bedeckt war, konnte man nur schwer erkennen, was sich unten am Fuß verbarg. Etwa zehn Meter tiefer lag eine kleine, vorgelagerte Schäre, die durch einen schmalen Streifen Sand, Geröll und Schilf mit dem Ufer verbunden war, sodass man bei Niedrigwasser trockenen Fußes hinübergehen konnte, und die das Wasser in eine seichte Bucht voller Muscheln, Tang und Schlamm leitete.
Sasha lehnte sich vor, um etwas sehen zu können. Ging in die Hocke, die Arme um Jazz’ Hals gelegt. Die niedrig stehende Sonne brannte in den Augen, sie kniete sich hin, suchte mit den Händen den rauen Felsvorsprung ab, die Fichtennadeln stachen ihr in die Handflächen, auf dem Wasser waren kleine Wellen.
Großmutter lag mit dem Kopf im Wasser, der Körper schaukelte leicht an der Oberfläche, wie eine Boje, wie ein vergessenes aufblasbares Gummitier, das auf dem Wasser dümpelte; die Kleider durchnässt, dunkel im Farbton. Ein flacher Sonnenstrahl fiel auf ihre Gestalt und ließ das Wasser glitzern. Sie war umgeben von einem Strauß roter Feuerquallen. Zombiekotze, wie Großmutter sie genannt hatte. Die grüne Steppweste trug das SAGA-Wappen auf dem Rücken, ein flugbereiter Falke mit dem Wahlspruch der Familie darunter, und durch die unruhige Wasseroberfläche war es, als würden sich die ausgebreiteten Flügel bewegen.
Kapitel 2Wenn das Ei klüger sein will als …
Olav Falck warf den Bademantel auf eine Bank und ging nackt über den Steg. Es war ungewöhnlich kalt für die Jahreszeit. Der Raureif auf den Planken klebte unter den Fußsohlen. Die Luft war minus sieben Grad kalt, das Wasser hatte zwei, vielleicht drei Grad. Der Steg lag in einer Bucht, die auf beiden Seiten von niedrigen, Axtklingen-förmigen Felsnasen überdacht wurde, direkt neben einem rot gestrichenen Bootshaus. Wie üblich überzeugte er sich davon, dass keine Quallen in der Nähe waren. Dann sprang er kopfüber hinein.
Die Blutgefäße zogen sich zusammen, um die lebenswichtigen Organe des Körpers zu schützen. Er legte sich auf den Rücken, wobei der geschrumpfte Winterpimmel an die Wasseroberfläche trieb, bis er seinen Atem unter Kontrolle gebracht hatte und in den klaren blauen Himmel starren konnte. Olav war ein Ganzjahresschwimmer, seit er denken konnte, lange bevor es in Mode gekommen war. Dass Säuglinge unter Wasser automatisch die Luft anhielten, war eine Tatsache, aber es war auch eine heroische Anekdote, die gut zu der Geschichte passte, die er gern über sich erzählte. Für Olav Falck war das Leben ein Kräftemessen. Selbstverständlich hatte er von Anbeginn seines Lebens dafür gekämpft, der Bessere zu sein.
Das Leben hatte es gut mit ihm gemeint. In seinem fünfundsiebzigsten Lebensjahr war er immer noch nicht auf regelmäßige Medikamente angewiesen. Der Kardiologe hatte ihm eingeschärft, nicht ohne Aufsicht in kaltem Wasser zu schwimmen.
Er gab nichts darauf, denn wenn er schon sterben musste, dann sollte es im Wasser sein.
Das Eisbaden war sein einziges Laster. Es gab Herausforderungen, etwa wer nach ihm übernehmen sollte, wenn er einmal abtrat. Aber im Großen und Ganzen war es mit dem Familienunternehmen wie mit dem Land, in dem er lebte. Es ging nicht mehr darum, aufzubauen, sondern darum, zu verwalten.
Erst nach einer ganzen Weile kletterte er die Badeleiter hinauf und spürte das leichte Kribbeln, als das Blut zurück in Finger und Zehen floss, wie die Wärme eines Kamins, die sich in einem winterkalten Zimmer verbreitet.
Auf dem Steg schlug Olav ein paar rhythmische Schwinger und geduckte Uppercuts in die Luft. Er mochte die klassischen Sportarten. Wenn Olympische Spiele oder Leichtathletik-Weltmeisterschaften stattfanden, sagte er schon mal Sitzungen ab, um wichtige Wettkämpfe zu verfolgen. Am meisten liebte er das Boxen. Er war neunzehn, als Ingemar Johansson sich 1959 Floyd Patterson zur Brust nahm; er verfolgte die goldenen Jahre in den 1960ern und -70ern mit Argusaugen und hatte bei Titelkämpfen in Las Vegas am Ring gesessen.
Es gab nicht viel, was ihn mehr ärgerte als das Verbot des Profiboxens und andere norwegische Bevormundungen. Ja, es bestand vielleicht ein gewisses Risiko, aber was blieb noch vom Leben übrig, wenn man nur auf Nummer sicher ging? Das Leben war gut, weil es wehtat. Ohne Schmerz keine Freude.
Er ging eilig den Pfad durch das frostige kleine Waldstück, das die Bucht vom Garten trennte, und weiter über den Rasen auf die Büste seines Vaters zu, gegossen aus einer Legierung aus Kupfer und Zinn, auf einen Sockel aus unbehandeltem Granit gehoben, geschaffen von einem der besten Bildhauer des Landes. Ein glühender Widerschein erleuchtete die Stirn, mit einem eingravierten Epigramm am Sockel darunter: Weiterzuleben in den Herzen, die wir zurücklassen, heißt, nicht zu sterben. Thor S. Falck 03.11.1903–23.10.1940. Obwohl Olav gerade eben geboren war, als er seinen Vater verlor, und keine Erinnerung an ihn hatte, erfüllte es ihn mit Demut, von dieser Linie abzustammen.
Er betrat das Haus durch den Sockeleingang auf der Rückseite des Rosenturms. Nach einer kochend heißen Dusche im Umkleideraum ging er die Wendeltreppe im Rosenturm hoch, schloss das Büro auf und warf einen Blick in seinen Kalender. Keine Termine für den Rest des Tages, das war gut, er konnte den Vortrag schreiben, den er sich seit Langem überlegt hatte. Er sollte vom Vater handeln und trug den Arbeitstitel »Pionier des Widerstandes«. Als Direktor einer großen Bergenser Reederei mit Verantwortung für mehrere Hurtigrutenschiffe hatte »Store-Thor« Spionage gegen die Deutschen betrieben, er hatte Fischerboote über die Nordsee geschickt und Funksender zurückbekommen.
Der Vortrag sollte auch auf die Verminung der norwegischen Küste durch die Briten eingehen. Dass der Vater sein Leben durch eine englische Unterseemine und nicht durch deutsche Waffen verloren hatte, war schon ein Paradox.
Olav hatte begonnen, einige Sätze zu formulieren, als es an der Tür klopfte.
»Sverre?«, sagte Olav. »Was machst du hier?«
Olavs ältester Sohn war Ende dreißig, und mit zunehmendem Alter ließ sich kaum mehr leugnen, dass Sverre ihm äußerlich immer ähnlicher wurde. Wie er selbst war sein Sohn groß gewachsen und athletisch, und das längliche bronzefarbene Gesicht mit den schmalen, forschenden Augen wurde dominiert von einer Hakennase, die böse Zungen als »Falkenschnabel« bezeichneten.
Heute hatte sein Sohn das übliche konservative Tweedjackett aus der Savile Row im Schrank gelassen und ein auffälliges schwarzes, mit einem Blumenmuster besticktes Hemd angezogen. In das Unterwürfige im Gesicht seines Sohnes mischte sich ausnahmsweise ein Anflug von Munterkeit.
»Kann ich dich kurz sprechen?«, fragte Sverre.
»Keine walk-ins bitte, ich habe vor, den Ausblick auf den Fjord und den terminfreien Tag zu genießen und dabei den Vortrag über Vater zu schreiben.«
»Es geht um die Tauchexpedition zum Schiffswrack während der Konferenz«, fuhr Sverre fort, »hier ist jemand, den ich dir vorstellen möchte.«
Sverre war der Projektleiter der »SAGA Arctic Challenge«, die später im Jahr stattfinden sollte. Er hatte gute Arbeit geleistet, was die Konferenz betraf. Ein Hurtigrutenschiff zu chartern und mit einer Gruppe internationaler Geistesgrößen an der Unglücksstelle von 1940 vorbei durch die Lofoten und die Vesterålen zu schippern, erfüllte alles, was die SAGA-Stiftung nach außen hin verkörpern wollte. Das war urnorwegisch und gleichzeitig verlockend für die Ausländer.
»Ah«, seufzte er. »Dann kommt mal rein.«
Sverres Begleiter trug einen zweireihigen weinroten Samtblazer, der Olavs Blickfeld wie ein rotes Tuch dominierte.
»Ist schon wieder Weihnachten?«, fragte er.
Er sah natürlich sofort, wer der Besucher war. Olav verachtete die Emporkömmlinge nicht, die in den letzten Jahren auf der Liste der reichsten Norweger aufgetaucht waren, im Gegenteil, eigentlich amüsierte es ihn, wie die eingesessenen Gutbetuchten die Nase über ihre Geschmacklosigkeit rümpften. Und keiner war geschmackloser als Ralph Rafaelsen.
Während Olav Kaffee bestellte, versuchte er, das Machtverhältnis zwischen seinem Sohn und Rafaelsen abzuschätzen. In den letzten Jahren hatten die Medien Rafaelsen oft als umtriebigen und risikofreudigen Typen beschrieben. Er hatte eine riesige Lachszucht an seinem Heimatort aufgebaut und das Unternehmen seitdem vergrößert.
»Ihr wollt also übers Wracktauchen sprechen?«, fragte Olav und blickte von einem zum anderen. »Sie sind derjenige mit dem Taucheranzug?«
Geplant war, dass sich nach Ankunft des Hurtigrutenschiffes an der Untergangsstelle ein Taucher in einem speziell angefertigten Anzug zum Wrack in dreihundert Metern Tiefe hinunterlassen und die Aktion live zu den Konferenzteilnehmern an Bord übertragen werden sollte.
»Das ist richtig.« Rafaelsen sah ihn an. »Obwohl, es einen Taucheranzug zu nennen, ist, als würde man ein Linienflugzeug mit einer Raumfähre vergleichen.«
»Oder so zutreffend wie die Vermarktung Ihrer Fischprodukte als Atlantiklachs?«, konterte Olav. »Ihre schlappen Geschöpfe haben mit dem stolzen Atlantiklachs ebenso viel gemein wie ein Pudel mit einem Wolf.«
Rafaelsen schmunzelte. »Der Exosuit ist eine Revolution. Er ist atmosphärisch, sodass wir Probleme mit der Taucherkrankheit in großen Tiefen vermeiden. Für den Piloten, denn dies ist eigentlich ein Einmann-U-Boot, entfällt die Dekompression. Es gibt nur einen solchen Anzug in Norwegen, und der gehört mir. Sein Einsatz wird ein Highlight der Konferenz.«
Rafaelsen fuhr fort, die Technik des Wunderwerks darzulegen, ohne dass Olav besonders aufmerksam zuhörte. Er war ein Generalist. Die manische Detailversessenheit der Nerds war ihm seit jeher fremd.
Zu seinem großen Ärger benahm sich Sverre, der sicher zehn Jahre älter war, als sei er Rafaelsens Untergebener, indem er über die Witzeleien des Nordnorwegers lachte und zu allem, was dieser sagte, übereifrig nickte.
Die Probleme mit Sverre waren der Hauptgrund, dass Olav in seinem fünfundsiebzigsten Lebensjahr immer noch Konzernchef der SAGA-Gruppe war, einem Unternehmen, das die Zeitschrift Kapital auf zwölf Milliarden Kronen taxierte. Obwohl es die Einnahmen aus der Immobiliengesellschaft und der Vermögensverwaltung waren, die für den Cashflow der Familie sorgten, hatte er nur Geringschätzung für Merkantilisten, Krämer und Kleinkaufleute übrig. Stattdessen versuchte er immer, über die SAGA-Stiftung zu sprechen, deren Vorstandsvorsitzender er war. Gelder sollten hereinkommen, ja, aber SAGAs Credo war ein anderes. SAGAwürde die Geschichte des Landes erzählen. Manche hatten Milliarden auf dem Konto, andere besaßen kulturelles Kapital. Nur SAGA hatte beides.
Trotzdem hätte Olav kaum Lust gehabt, bis weit über das Rentenalter hinaus Vorstandsvorsitzender zu bleiben, wenn die SAGA sich wie die meisten gemeinnützigen Stiftungen dieses Typs mit Konferenzen und Stipendienvergaben begnügt hätte. Schon seit den ersten Nachkriegsjahren waren die Firmen der Familie in die geheimdienstlichen Aktivitäten des Landes verstrickt, zuerst als antikommunistischer Besatzungswiderstand namens Stay behind, dann als … Nein, das war eine lange und komplizierte Geschichte. Geld brachte dieser Geheimdienst nicht ein, auch keine öffentliche Anerkennung. Im Gegenteil, er konnte die übrigen Unternehmen gefährden. Aber er gab Olav etwas Wichtigeres: das Gefühl, relevant zu sein. Und bevor er an Rücktritt denken konnte, musste er seinen möglichen Nachfolger – der oder die laut Satzung eines der Kinder sein würde – in diesen Sachkomplex einweihen.
Das waren gute Gründe, das Ruder nicht aus der Hand zu geben.
»Hört sich gut an.« Olav unterbrach Rafaelsen mitten in seiner Ausführung über die speziell angefertigte Unterwasserkamera. »Dann machen wir das so.«
»Da ist noch etwas«, sagte Sverre und sah aus, als nähme er innerlich Anlauf.
»Ich habe Zeit«, lächelte Olav.
»Wie du vielleicht weißt«, begann Sverre, und Olav fiel auf, dass er zögerte, »haben sich viele hochrangige Leute für die Konferenz angemeldet. Alle haben zugesagt, alle wollen zu den Lofoten. Wir sind immer noch attraktiv. Manche haben Milliarden auf dem Konto, andere haben kulturelles Kap…«
»Komm zur Sache«, sagte Olav.
»Ich habe gerade die Bestätigung erhalten, dass die saudische Königsfamilie vertreten sein wird«, sagte Sverre, »möglicherweise reist der Kronprinz persönlich mit seinem Privatjet an.«
»Bodø hat die längste Landebahn des Landes«, fügte Rafaelsen hinzu. »Die U2 ist 1960 dort gelandet, also wird es für einen Privatjet sicher reichen.«
Sverre sah seinen Begleiter an. »Ralph und ich haben überlegt, den jüngeren VIPs ein kleines Extra anzubieten. Ralph hat gute Kontakte zur Hubschrauberstaffel und könnte ein paar Maschinen organisieren. Sie landen am Nachmittag auf dem Schiff, fliegen die Leute über die Lofoten und zu Ralphs Anwesen auf den Vesterålen, und am nächsten Morgen bringen wir sie zurück an Bord.«
»Ein zusätzliches Leckerli, um es mal so zu sagen«, ergänzte Rafaelsen.
Saudische Majestäten … privat organisierte Hubschrauber … Rafaelsens Anwesen … Die Worte verzwirbelten sich in Olavs Gehirn wie die Albträume, die ihn als Kind manchmal heimgesucht hatten.
Er schwieg eine ganze Weile, den Kopf leicht schräg gelegt, ehe er den Mund öffnete.
»Kann ich dazu was sagen?«
»Deshalb sind wir hier«, antwortete Sverre.
Olav räusperte sich. »Als ich das letzte Mal im Hotel Dorchester in London war, kam ich mit dem Portier ins Gespräch. Er fragte mich, ob ich nicht die Suite nehmen wolle, wie The Falcks es immer getan hätten.«
Als er den Namen des Hotels aussprach, bemerkte er, dass sein Sohn sich auf die Unterlippe biss, als ob er ahnte, was gleich käme. Olav lächelte und fuhr fort: »›Oh‹, sagte ich zum Portier, ›ich ziehe die gewöhnlichen Zimmer vor, sofern die Aussicht gut ist, obwohl ich …‹«
Er machte eine Pause, als müsse er nach Worten suchen. »… ›ein reicher Mann bin.‹ ›Aber Ihr Sohn nimmt immer die Suite‹, wandte der Portier ein. ›Ja‹, erwiderte ich, ›aber er ist der Sohn eines reichen Mannes.‹«
Er sah seinen Sohn lange an, der mit offenem Mund und beschämtem Blick dasaß. Ralph Rafaelsen brach in ein vorsichtiges Lachen aus.
»Norwegen ist ein gutes Land, um reich zu werden und zu bleiben. Der Norweger an sich hat nichts gegen Leute mit Geld, im Gegenteil, der Norweger bewundert Leute mit Mut und Tatkraft. Unsere Gesetze schützen unsere Interessen gut. Aber das ist eine fragile Balance. Genauso wie wir Fleiß und Tüchtigkeit bewundern, verabscheuen wir Dekadenz und Verfall. Einen Adel haben wir uns kaum geleistet und mit dem Adelsgesetz von 1821 ganz abgeschafft, inklusive aller Titel und Privilegien. In Norwegen Wohlstand zu verwalten, zumindest wenn man größere Ambitionen als ein Finanzinvestor hat, wenn man am Gemeinwesen mitbauen will, bedeutet nicht, gegen Gewerkschaften zu kämpfen und unterbezahlte Polen anzuheuern, die unsere Häuser in Schwarzarbeit hochziehen.«
Olav blickte Ralph an, der aussah wie ein Schuljunge, den man im Süßwarenladen auf frischer Tat ertappt hat. Es war viel über die Arbeitsbedingungen geschrieben worden, als er seine riesige Villa auf den Vesterålen gebaut hatte.
»In Norwegen Wohlstand zu verwalten, heißt, das norwegische Modell zu verstehen«, sagte Olav. »Es heißt, die Dreiparteienkooperation zu begreifen, es heißt, die Vorteile der komprimierten Lohnstruktur zu verstehen, es bedeutet, sich mit Betriebsräten und Gewerkschaftsbossen zu betrinken. Denn das ist das eigentliche norwegische Modell. Wir sorgen dafür, dass normale, anständige Leute ein gutes Leben haben, wir zahlen ihnen Löhne, damit sie in den Süden reisen und ein neues Auto kaufen und einen Kredit für ein Eigenheim aufnehmen können. Im Gegenzug bekommen wir ein Volk, das uns respektiert, das keine Aufwiegler wählt oder unsere Grundstücke stürmt. Und alles, was ihr über eure Ideen zur Hurtigrutentour erzählt, zu den verdammten Saudis, den Hubschraubern und der After-Show-Party auf Ihrem Anwesen, ist ein Bruch mit diesem Prinzip.«
»Wenn das Ei klüger sein will als …«, platzte Rafaelsen heraus.
Er wurde durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen.
»Jetzt nicht!«, rief Olav.
Die Sekretärin steckte trotzdem den Kopf herein.
»Hören Sie schlecht?«, fuhr er sie an.
»Tut mir wirklich leid, aber es ist wichtig.«
»Das will ich hoffen.«
Er wollte gerade nach der Kaffeetasse greifen, aber der Blick der Sekretärin – weit geöffnet und tot zugleich – ließ ihn innehalten.
»Ende der Besprechung«, sagte er zu Sverre und Rafaelsen, die sich wegen des plötzlichen Abbruchs verwirrt ansahen, sich erhoben und hinausgingen.
»Was gibt’s?«, fragte Olav, als er mit der Sekretärin allein war. Aber insgeheim ahnte er die Antwort bereits.
Kapitel 3Niemandsland
Als Johnny Berg zwischen zwei Wachen in einen hell erleuchteten Raum geführt wurde, erinnerte er sich daran, was sein Mentor, der alte Offizier, den man nur unter seinen Initialen HK kannte, ihm einmal eingeschärft hatte: Folter ist nicht in erster Linie der Schmerz an sich, sondern vor allem die Erwartung, was kommt.
Er hatte keine Ahnung, wo er war. Die Wochen und Monate, seit die kurdische Miliz ihn aufgegriffen hatte, waren verhangen wie die Sicht auf ein Fjellplateau im Schneesturm, wenn man nicht weiß, wo der Berg aufhört und der Himmel anfängt, wenn Minuten wie Stunden sind und umgekehrt.
Sie hatten ihn von einem Gefangenenlager ins nächste verlegt, bis er im Gewahrsam der Amerikaner gelandet war.
Die Wachen hatten ihm die Sturmhaube abgenommen, bevor sie ihn in den Raum schoben, wohl damit er sehen sollte, was ihn erwartete. Das Licht der Neonröhre an der Decke stach ihm in die Augen. Aus den Lautsprechern brüllte Hardrock in voller Lautstärke.
Mitten im Raum stand eine leicht gekippte Bank, mit Lederriemen an beiden Seiten, darauf lagen eine schwarze Kapuze aus Wolle und ein ordentlich gefaltetes Handtuch. Dahinter warteten zwei Männer mit Sturmhauben, grauen Fleecejacken und tarngefleckten Militärstiefeln. An der Wand standen zwei Wasserkannen.
Die Musik verstummte.
Nein, dachte Johnny, während sein Herz hämmerte, sagt, dass dies eine Übung ist, ein Traum, irgendwas, nur lasst mich raus hier, das ist schlimmer als der Tod.
»Yahya Sayyid Al-Jabal?«, sagte der eine mit breitem amerikanischem Akzent. »Ist das dein Name?«
Johnny schwieg.
»Ich habe dich was gefragt«, sagte der Mann eine Idee lauter.
»No, Sir«, antwortete Johnny, »mein Name ist John Omar Berg.«
»Nationalität?«
»Norwegisch.«
»Okay«, sagte der Mann durch die Sturmhaube, immer noch ohne Aggression in der Stimme, »wir haben ein paar Fragen, auf die wir Antwort brauchen.«
Der andere Mann, der kräftiger gebaut war, ergriff das Wort. Sein Ton war beiläufig, als spräche er über die Reparatur einer Waschmaschine, mit dem singenden Akzent, wie er typisch für Leute aus den Südstaaten ist.
»Es gibt zwei Wege, das zu erreichen. Du wirst den ersten vorziehen.«
Johnny starrte auf die raue, graue Steinwand.
»Du bist in den Irak und nach Syrien unter dem Namen Al-Jabal eingereist«, sagte der Kräftige. »Der Grenzübertritt wurde nach Angaben der kurdischen Selbstverwaltung am 12. September letzten Jahres in Erbil registriert. Aber jetzt sagst du, dass Al-Jabal nicht dein richtiger Name ist?«
Johnny kniff die Augen zusammen, legte den Kopf zurück und schlug sich die Hände vors Gesicht.
»Ich kann auf die Details meiner Mission nicht eingehen«, sagte er. »Aber meine Vorgesetzten können alles bestätigen.«
Den Amerikanern reichte das nicht. »Was wolltest du hier?«
Was brachte ihm die Verschwiegenheitspflicht hier und jetzt? Nichts. »Ich sollte, ähm, einen norwegischen Fremdkämpfer ausschalten.«
»Name?«
»Abu Fellah, und die norwegischen Behörden können bestätigen, was ich sage.«
Im vergangenen Jahr waren westliche Islamisten scharenweise in die Region geströmt, um das gerade ausgerufene »Kalifat« aufzubauen. Das hatte die westlichen Sicherheitsdienste alarmiert. Der Westen fürchtete, dass diese kriegserfahrenen und kampflustigen Söldner sich entschlossen, in ihre Heimatländer zurückzukehren.
Die Gestalt schüttelte langsam den Kopf, die Gesichtszüge waren unter der Haube kaum zu erkennen. »Wir haben uns erkundigt. Weder Norwegen noch andere Alliierte können deine kreative Geschichte bestätigen.«
Johnny merkte, wie sich sein Hals zuschnürte, so als bekäme er keine Luft. Alles hat ein Ende, auch das Glück, das ihn am Leben gehalten hatte. Zehn Jahre hatte er für den Geheimdienst gearbeitet, an den gefährlichsten Orten der Welt, in Afghanistan, Libyen und im Irak. Auszeichnungen hatte er jede Menge erhalten. Viele Male wäre es beinahe schiefgegangen, aber Gott ist Norweger, sagte man nicht so?
Bullshit.
»Ich frage noch einmal«, fuhr der Verhörleiter fort. »Was war dein Auftrag?«
Nach all den Jahren im Dienst war er ausgebrannt und desillusioniert. Der Nahe Osten war geliefert, ob der Westen nun eingriff oder nicht. Die Anstrengungen waren sinnlos oder machten alles nur noch schlimmer.
Vor einem knappen Jahr hatte ihn ein Offizier kontaktiert, es ging um einen Auftrag außerhalb der offiziellen Kanäle. Ein Auftrag von größter nationaler Relevanz, für dessen Ausführung es keinen politischen Rückhalt in der Friedensnation Norwegen geben würde. Der Job bestand darin, nach Kurdistan zu reisen, eine amerikanische Waffe abzuholen, gekauft auf dem Waffenbasar in der Hauptstadt, Verbindung zu einem ehemaligen Soldaten der amerikanischen Spezialkräfte aufzunehmen, der dort unten gegen den IS kämpfte, und durch das Niemandsland, das die Frontlinie bildete, in den vom IS kontrollierten Ort zu gelangen, in dem sich der Norweger Fellah aufhielt. Davon, dass er auch ohne die Zustimmung der Regierung reiste, war keine Rede gewesen.
Bruchstückhaft meldeten sich die Erinnerungen an das, was passiert war, in Form von Schweiß, Herzklopfen und kurzen Flashbacks auf der Netzhaut. Das niedrige Haus, vom Nachtsichtgerät grün gefärbt. Die klimatisierten Räume, die staubigen Teppiche, die schallgedämpften Schüsse, der Blick zu dem kleinen Jungen im Flur davor.
Nein, Johnny schaffte es nicht, das Bild auszuhalten, er drängte die Gedanken zurück.
Sie wurden entdeckt, unmittelbar bevor sie das hohe Gras erreichten, das im Niemandsland wuchs. Der Auftrag war zwar ausgeführt, aber der Amerikaner erschossen worden. Johnny war geflohen, doch kaum war er zurück auf der kurdischen Seite, schnappte ihn die kurdische Miliz. Was genau passiert war, ließ sich unmöglich sagen, aber er vermutete, dass der IS über Funk das Gerücht verbreitet hatte, einer ihrer Männer sei verschwunden. Das war die Rache für das, was er getan hatte, und dafür, dass er entkommen war. An der Front war allseits bekannt, dass die streitenden Parteien sich gegenseitig abhörten.
Die Kurden hatten ihn in ein Internierungslager für Terroristen gebracht, bevor sie ihn den Amerikanern überließen. Deshalb war er hier, in einem fensterlosen Raum mit Leuten, die ihm seine Geschichte nicht abkauften.
Ihm dämmerte, wie hoffnungslos seine Lage war. Der Auftrag war inoffiziell gewesen, deniable, und diejenigen, die ihn auf norwegischer Seite eventuell hätten entlasten können, schwiegen. Schlimmer, er war ein schwarzhaariger Norweger mit goldbrauner Haut und arabischen Wurzeln, der nachweislich den Glauben an die westliche Kriegsführung verloren hatte.
Norwegische Behörden mochten ihm Medaillen für Tapferkeit verleihen. Generäle, Minister und Majestäten mochten ihm die Hand schütteln. Tief im Inneren wusste er, dass er für sie immer ein Fremder bliebe. Alle POC-Norweger wussten das. Warst du ein tapferer Soldat oder ein Torschütze in der Nationalmannschaft, warst du hundert Prozent Norweger. Aber wenn es hart auf hart kam, warst du nichts als der kleine Marokkaner, der Schwarze, der Kanake, der Muslim, der Ausländer, der Vierzehnjährige, der vor Neonazis wegrennen musste und sich zitternd vor Angst in der Hecke versteckte. Norweger liebten eingenordete, sich anbiedernde Ausländer, die im Winter Ski liefen, am Nationalfeiertag Landestracht trugen und am Heiligabend Rippchen aßen, aber sie sahen auch gern ihre Vorurteile bestätigt: Wir hätten wissen müssen, dass man ihm nicht trauen kann.
Er war der perfekte Sündenbock.
Die Amerikaner zogen ihm eine schwarze, eng sitzende Haube über den Kopf und packten ihn. Er wurde auf den Rücken gelegt, und der eine spannte Gurte über die drei diagonalen Narben auf seiner Brust, sodass er sich nicht bewegen konnte.
Bis auf das Plätschern in den Wasserkannen, die hochgehoben wurden, war es still. Alles war schwarz. Er spürte, wie das lauwarme Wasser über sein Gesicht gegossen wurde, es durchtränkte die schwarze Haube und füllte langsam seine Nasenlöcher. Es war nass, es gluckerte.
Er hielt die Luft an, hielt sie so lange an, dass die Lunge schrie und die Eingeweide vor Schmerzen Saltos schlugen. Schließlich wurde ihm schwarz vor Augen.
Er dachte an Ingrid. Seitdem er Vater geworden war, waren es immer die Gedanken an seine Tochter gewesen, die ihn am Leben gehalten hatten, wenn es besonders schlimm kam. Manchmal war sie ihm so nah, dass er ihr über das schulterlange dunkle Haar streichen konnte. Sie saß neben ihm zwischen den orange gekleideten Gefangenen auf der metallenen Bettkante und ließ die kurzen Beine baumeln, mit Schürfwunden an den Knien und Dreck unter den Zehennägeln, oder sie setzte ihre Puppen in komplizierten Reihen an die Zellenwand, kämmte oder ermahnte sie. Sie war ihm so nahe, wenn sie mit ihren leichten Kinderschritten hinüber zum Waschbecken tapste, um sich mit der rosa Zahnpasta die Zähne zu putzen, bis das Bild verschwand, so wie eine Luftspiegelung an einem lang gestreckten Wüstenweg plötzlich verschwindet. Sie war sein Fleisch und Blut, hatte seine Züge, diese Mischung aus Norwegischem und etwas Fremdem, dessen Ursprung er nicht kannte.
Der menschliche Instinkt, kein Wasser einzuatmen, ist so stark, dass er die Angst zu ersticken übersteigt.
Als er endlich nachgab, wusste er nicht, ob er ein- oder ausatmete, nur dass die Luftwege sich mit Wasser füllten und er ertrank, hilflos wie ein Mensch, der in einem sinkenden Schiff gefangen ist. Der Instinkt, der ihn vom Atmen unter Wasser abhielt, machte ihn bereit, alles Erdenkliche zuzugeben, absolut alles, damit es aufhörte.
Niemand hatte etwas dagegen.
Wer war verantwortlich dafür, dass er hier lag? Der Auftrag war schiefgegangen, das war die eine Sache, aber dass die Auftraggeber keinen Finger gerührt hatten, war unverzeihlich. Falls er die Verantwortlichen jemals finden sollte, würde er nicht eher ruhen, bis ihnen dasselbe passierte, bis sie hier lägen, auf einer Holzbank in einem schalldichten Keller, und fühlten, wie das Wasser die Atemwege flutete.
»Ich … ich …«
Zwei Männer zogen ihn hoch in Sitzstellung. Johnny schnappte nach Luft und brüllte vor Angst und Schmerz.
»Ich heiße John Omar Berg und habe eine Vergangenheit als Kampfschwimmer und Geheimagent. Unter … dem Namen … Yahya Al-Jabal … war ich unterwegs, um mich dem Islamischen Staat anzuschließen.«
»Ausgezeichnet. Bringt ihn zurück zu den Kurden«, sagte der Amerikaner.
Kapitel 4Was für eine Prosa ist das?
Olav stand nackt in der Umkleide, mit einem Fuß auf der Bank, und rieb sich die Innenseiten seiner Schenkel mit Spenol ein.
An dem Morgen, als er die Todesnachricht bekam, hatte er sofort begriffen, was passiert war. Insgeheim hatte er immer gewusst, dass seine Mutter dem Ganzen ein Ende machen würde. Er wusste es seit fünfundsiebzig Jahren. Hatte darauf gewartet. Hatte nachts ihre Schreie gehört, als er klein war. Hatte gehofft, dass es aufhörte. Seine Mutter hatte ihr Leben im Wasser beendet, genau wie sein Vater.
Es waren nur noch vier Tage bis zur Beisetzung, und es gab vieles zu regeln. Er musste die Kontrolle behalten, den Status quo aufrechterhalten. Es war Vera, die Rederhaugen etabliert und den Grundstein für den Erfolg der SAGA gelegt hatte. Ihr Tod konnte neue Fragen aufwerfen, die eventuell in die dunklen Jahre zurückreichten, die wiederum die Büchse der Pandora des Krieges öffnen konnten.
Nein. Er holte Luft.
Eins nach dem anderen, dachte Olav. Er musste die Fragen rund um den Tod seiner Mutter so angehen, wie er Probleme immer löste: mit Ruhe und Systematik.
Er hatte der Anwältin der Familie, Siri Greve, Vollmacht erteilt, Veras Testament beim Amtsgericht abzuholen.
Sie wurde jeden Moment zurückerwartet, und er fürchtete sich vor dem, was es beinhalten mochte.
In den letzten Jahren hatte er nur einmal jährlich mit seiner Mutter gesprochen, an seinem Geburtstag Ende Juli, und da hatte sie immer geweint. Olavs Meinung nach hatte der Konflikt mit seiner Mutter eine offensichtliche Ursache. Während ihm die Familie am wichtigsten war, hatte Vera sich selbst immer über die Familie gestellt.
Er wurde jäh aus seinen Gedanken gerissen, als die Tür hinter ihm aufging. Er erkannte Sverre im beschlagenen Spiegel. Je älter sein Sohn wurde, desto ähnlicher wurde er ihm auf alten Bildern, aber es lag etwas Kraftloses und Ausweichendes in seiner Persönlichkeit, das ein Foto nicht enthüllte, wie der Unterschied zwischen einer echten Rolex und einer gut gemachten Kopie.
»Du hier?«, fragte er und cremte weiterhin seine Haut ein. Er hatte oft gedacht, das Militär sei der richtige Ort, um den Sohn auf Vordermann zu bringen und bereit für die Aufgaben zu machen, die ihn in der SAGA erwarteten. Das hatte nicht funktioniert: Sverre war blass und zitternd vom Auslandseinsatz zurückgekehrt.
Sein Sohn nickte, wirkte peinlich berührt angesichts seiner Nacktheit.
»Die Pfarrerin hat mir gestern Abend eine E-Mail mit dem Entwurf für die Trauerrede in der Kirche geschickt. Ich hab sie ausgedruckt.«
Olav band sich ein Handtuch um die Hüfte, nahm den Ausdruck und begann zu lesen.
»Vera Lind ist heimgegangen«, las er. »Sverre?« Er wedelte mit dem Blatt. »Was zum Teufel ist das?«
Sein Sohn starrte auf den nassen Fußboden.
»Sie hat den Wanderstab endgültig niedergelegt … Was für eine Prosa ist das? Das ist doch hohles Gewäsch, Sverre! Mutter war Schriftstellerin. Sprache war ihr Werkzeug. Sie hätte sich lieber die Hand abgehackt, als so etwas zu schreiben.«
»Schriftstellerin hin oder her«, wandte Sverre ein. »Sie hat doch seit fast fünfzig Jahren nichts mehr veröffentlicht. Und das sind die Worte der Pfarrerin, nicht meine.«