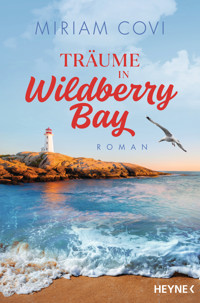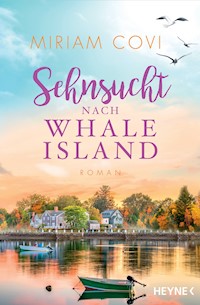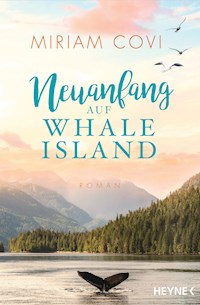4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Feelings
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Humorvoller, chaotischer Liebesroman in der romantischen Stadt Rom von Miriam Covi! Mika ist ein westfälisches Landei und hatte nie vor das Dörfchen Elmendorf bei Gütersloh zu verlassen. Doppelhaushälfte, Familie und Bürojob - mehr brauchte es nicht für Mikas Glück. Bis ihr Verlobter sie kurz vor der Hochzeit sitzen lässt, ihr Arbeitgeber Insolvenz anmeldet und unverhofft ihr gutaussehender, weltgewandter Exfreund Sebastian in Elmendorf auftaucht... und sie während eines One-Night-Stands schwängert. Dumm nur, dass Sebastian in Rom lebt. Kurz entschlossen packt Mamma Mika ihre Koffer und folgt ihm in die Ewige Stadt. Das Chaos kann beginnen, denn Schwangerschaftshormone, Eifersucht und das römische Dolce Vita machen Mika ganz schön zu schaffen... »Mein Ex, die Ewige Stadt & ich« von Miriam Covi ist ein eBook von feelings*emotional eBooks. Mehr von uns ausgewählte erotische, romantische, prickelnde, herzbeglückende eBooks findest Du auf unserer Facebook-Seite. Genieße jede Woche eine neue Geschichte – wir freuen uns auf Dich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Ähnliche
Miriam Covi
Mein Ex, die Ewige Stadt & Ich
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Humorvoller, chaotischer Liebesroman in der romantischen Stadt Rom von Miriam Covi!
Mika ist ein westfälisches Landei und hatte nie vor, das Dörfchen Elmendorf bei Gütersloh zu verlassen. Doppelhaushälfte, Familie und Bürojob – mehr brauchte es nicht für Mikas Glück. Bis ihr Verlobter sie kurz vor der Hochzeit sitzen lässt, ihr Arbeitgeber Insolvenz anmeldet und unverhofft ihr gutaussehender, weltgewandter Exfreund Sebastian in Elmendorf auftaucht … und sie während eines One-Night-Stands schwängert. Dumm nur, dass Sebastian in Rom lebt. Kurz entschlossen packt Mamma
Inhaltsübersicht
Dieses Buch ist für Emilia, die mich zum ersten Mal zu einer Mamma gemacht hat –
und für ihre kleine Schwester Matilda, die es so eilig hatte, dass sie beinahe in einem römischen Taxi geboren worden wäre.
Vi amo di tutto cuore!
Und natürlich ist dieses Buch auch für meine geliebten Eltern, die die wildeste Taxifahrt ihres Lebens mit Bravour gemeistert haben, für meine entspannte Hebamme Gabriella – und für den Taxifahrer, der sein Bestes gegeben hat, um mich gerade noch rechtzeitig im Krankenhaus abzuliefern. Grazie!
Obwohl ich selbst zwei römische Schwangerschaften erleben durfte und so manch eine autobiografische Erfahrung in diese Seiten geflossen ist, sind die Handlung dieses Romans und alle darin vorkommenden Personen frei erfunden.
Prolog
Tutto bene, Signora?«, fragt der Taxifahrer und wirft einen panischen Blick in den Rückspiegel, bevor er hupend zum nächsten Überholmanöver ansetzt.
»Nein, gar nichts ist bene!«, stoße ich schrill hervor. Dann lege ich meinen Kopf in den Nacken und gebe den nächsten lauten Urschrei zum Besten, der den Fahrer einen erschrockenen Schlenker fahren und beinahe einen Motorroller auf der Gegenspur rammen lässt.
Hätte mir gestern jemand gesagt, dass ich in der Gegenwart eines mir völlig fremden Taxifahrers derartig schreien und die Beherrschung verlieren würde, hätte ich diesen Jemand für bekloppt erklärt. Aber gestern wusste ich auch noch nicht, wie schmerzhaft Wehen sind. Ich finde, dass der Begriff »Wehe« eine verharmlosende Untertreibung ist.
»Die Bezeichnung Wehe kommt von wehtun«, habe ich in irgendeinem superschlauen Internetforum für Schwangere gelesen. Dass ich nicht lache. Wehtun? Soll das ein Scherz sein? Wenn ich nach einem Pfund Kirschen einen halben Liter Wasser trinke, dann tut mein Bauch weh. Das, was mein Bauch jetzt gerade durchmacht, erinnert stark an das Ergebnis mittelalterlicher Foltermethoden. Jawohl, ich werde gefoltert. Und das in einem Taxi, mitten im chaotischen Verkehr Roms.
»Verdammt noch mal, das ist so beschissen schmerzhaft, das glaubst du nicht!«, stoße ich hervor, als die Wehe nachlässt. Keuchend lehne ich meinen Kopf an die Kopfstütze.
Eigentlich war ich immer fest entschlossen, nie einer anderen Schwangeren Angst vor der Geburt zu machen – so wie meine Sandkastenfreundinnen Hanna und Steffi mir Angst gemacht haben mit ihren Horrorgeschichten aus dem Kreißsaal. Nein, ich hatte mir vorgenommen, meine schlimmen Geburtserlebnisse diskret für mich zu behalten und weder Jule noch andere schwangere Bekannte mit sadistischem Genuss zu quälen. Aber ich kann schließlich nichts dafür, dass Jule und ihr gigantischer Bauch ebenfalls in diesem Taxi stecken, das versucht, sich wild hupend einen Weg in Richtung Krankenhaus zu bahnen.
Jule kann natürlich auch nichts dafür. Sie wollte mich eigentlich nur besuchen, um mit mir einen gemütlichen Nachmittag bei einem kühlen Fußbad auf unserem Sofa zu verbringen. Wer konnte auch ahnen, dass es mein Baby so eilig haben würde?
Nun ist Jule mit von der Partie und sitzt links von mir auf der Rückbank des Taxis. Ich throne in der Mitte und halte mich bei jeder Wehe an den Kopfstützen von Fahrer- und Beifahrersitz fest, während rechts meine Hebamme Valeria beruhigend auf mich einredet. Auf dem Beifahrersitz hat meine Beinahe-Schwiegermutter Gila Platz genommen, die zufällig auch noch bei mir zu Besuch war, als meine Fruchtblase geplatzt ist.
»Ich versuche es noch einmal bei Sebastian«, höre ich Gila vorn noch sagen, bevor die nächste Wehe mich erneut schreien lässt. Unser Taxifahrer hupt wie ein Irrer und beschimpft aus dem offenen Fahrerfenster die Autos vor uns.
»Every minute now«, stellt Valeria mit einem sachlichen Blick auf ihre Armbanduhr fest.
Pro Minute eine Wehe. Als der Schmerz nachlässt, schaffe ich es zu fragen: »Is that bad?«
Valeria tätschelt mir das Knie. Während ich mit einem Ohr höre, wie Gila schon wieder eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter in Sebastians Büro hinterlässt (»Hier ist wieder deine Mutter. Wir sind im Taxi auf der Viale Regina Margherita, du solltest wirklich zusehen, dass du dich sobald wie möglich zum Krankenhaus bewegst, Junge!«), höre ich mit dem anderen Ohr, wie Valeria den Taxifahrer etwas auf Italienisch fragt.
»Was hat sie gesagt?«, frage ich Jule keuchend. Sie spricht wesentlich besser Italienisch als ich, schließlich lebt sie bereits seit mehr als zwei Jahren in der Ewigen Stadt, ich erst seit einem halben.
»Sie hat Luigi gefragt, ob er schon mal eine Geburt in seinem Taxi erlebt hat«, antwortet Jule.
Ich sehe erst Valeria, dann Jule entgeistert an. »Soll das ein Witz sein?«
Erneut tätschelt mir meine Hebamme das Knie und lacht. Sie hat manchmal einen merkwürdigen Sinn für Humor. »No problem, no problem«, sagt sie.
Ich bin mir nicht sicher, ob sie damit meint, dass ich es noch bis ins Krankenhaus schaffen werde oder dass es kein Problem sei, ein Baby im Taxi zu gebären.
Der Taxifahrer, der Luigi zu heißen scheint (das habe ich nicht mitbekommen, aber das wundert mich auch nicht wirklich, ich habe schließlich gerade andere Sorgen), ist offensichtlich nicht davon überzeugt, dass es »no problem« ist, in seinem Taxi ein Kind zu bekommen. Auf jeden Fall fängt er nun an, zusätzlich zum Warnblinklicht auch noch die Lichthupe zu betätigen, und wirft gleichzeitig ein weißes Papiertaschentuch in Richtung Beifahrersitz. Gila, die das Telefonat mit dem Anrufbeantworter ihres Sohnes beendet hat, fängt das Taschentuch auf und nickt, als Luigi ihr hektisch italienische Anweisungen gibt, die ich mal wieder nicht verstehe. Auch Gilas Italienisch ist sehr viel besser als meines – kein Wunder, sie ist schließlich die österreichische Botschafterin in Rom und kommuniziert regelmäßig bei irgendwelchen wichtigen Abendessen mit wichtigen Persönlichkeiten wie dem römischen Bürgermeister. Ich will fragen, was das mit dem Taschentuch soll, doch ich komme nicht mehr dazu, da die nächste Wehe mich so gewaltig überrollt, dass ich wie eine Irre auf die Rückenlehne des Beifahrersitzes einschlage, was die österreichische Botschafterin gehörig durchschüttelt. Natürlich erträgt diese das mit Contenance und hält währenddessen stoisch das Taschentuch aus dem Fenster, wo es im Fahrtwind flattert.
»Breathe! Breathe!«, ruft Valeria irritierend fröhlich ihr Mantra.
Als die Wehe nachlässt, frage ich schwer atmend: »Was soll denn das mit dem Taschentuch?«
»Das ist ein Zeichen für einen Notfall«, erwidert die Oma meines ungeborenen Kindes (nicht mehr lange ungeboren, fürchte ich!) knapp. »Damit die anderen Autofahrer einen durchlassen.«
»Echt?«, frage ich matt. Das wusste ich bisher gar nicht. Aber in Elmendorf, meinem ostwestfälischen Heimatort, braucht man so etwas auch nicht. Dort gibt es nur zwei Ampeln und nie Stau. Wären in Elmendorf vor einer Stunde meine Wehen losgegangen, läge ich jetzt längst im Kreißsaal des Gütersloher Krankenhauses.
Aber ich bin nicht in Ostwestfalen, ich bin in Rom. Draußen ist es über dreißig Grad heiß, obwohl wir schon Anfang September haben. Meine stark geschwollenen Füße erinnern an die Fesseln einer trächtigen Elefantenkuh, wie bereits seit Wochen.
Kurz muss ich daran denken, dass ich in einem anderen superschlauen Internetforum für Schwangere gelesen habe, man solle sich vor der Geburt unbedingt Zeit für eine Pediküre nehmen, weil im Kreißsaal »die Füße im Mittelpunkt stehen«. Also habe ich meinen gewaltigen Bauch und mich letzte Woche noch in einen Kosmetiksalon geschleppt, weshalb meine Fußnägel nun hübsch in Knallrot lackiert sind.
Und was bringt mir das jetzt? Interessiert es in diesem Taxi irgendjemanden, dass meine Füße gut aussehen? Würde sich in diesem Moment in einem Kreißsaal jemand mit der Dicke der Hornhaut an meinem Ballen beschäftigen? Auch mir selbst war es selten so egal, wie meine Füße oder der Rest meines Körpers aussehen, wie in diesem Augenblick. Ich möchte einfach nur, dass diese irren Schmerzen vorbei sind. Ich will eine Rückenmarkspritze haben! Aber dafür muss ich wohl erst einmal das Krankenhaus auf der Tiberinsel erreichen. Das jedoch ist – so gut kenne ich mich inzwischen aus in dieser verwirrenden Stadt – noch sehr weit weg. Langsam, aber sicher bekomme ich wirklich Panik.
Hat Valeria das ernst gemeint mit der Geburt im Taxi? Das überlebe ich nicht! Und schon gar nicht ohne Sebastian, den Vater des ungeduldigen Kindes, der ausgerechnet heute sein Handy zu Hause vergessen hat und nicht an sein vermaledeites Bürotelefon geht!
Eine weitere Wehe lässt mich kurz alles um mich herum vergessen – alles, außer den irren Schmerzen. Warum, um alles in der Welt, verzichten Frauen während der Geburt freiwillig auf Schmerzmittel, wenn sie sich an einem für eine Entbindung geeigneten Ort wie einem Krankenhaus befinden? Was würde ich jetzt darum geben, diese blöde PDA gelegt zu bekommen!
Als ich wieder aufnahmefähig bin, höre ich, wie Gila vorn mit jemandem am Telefon spricht. Kurz bin ich erleichtert, weil ich glaube, dass sie endlich Sebastian erreicht hat. Als sie das Gespräch beendet, schaut sie nach hinten und erklärt: »Das war die Abteilungssekretärin.« Ich will schon enttäuscht meinen Kopf gegen die Rückenlehne sacken lassen, als sie hinzufügt: »Sebastian ist auf dem Weg. Er hat längst eine meiner ersten Nachrichten abgehört, sich das Handy einer Kollegin geliehen und ist gleich mit seinem Motorroller losgefahren. Er ist auf dem Weg zu eurer Wohnung, weil er nicht mehr mitbekommen hat, dass wir inzwischen im Taxi sind. Ich werde jetzt versuchen, ihn auf dem Handy der Kollegin zu erreichen und ihm zu sagen, wo genau wir sind.«
Und genau das scheint sie nun zu tun, auf jeden Fall beginnt sie eilig, auf ihrem Telefon herumzutippen.
Eine Kollegin hat ihm das Handy geliehen? Sofort denke ich an Mercedes. Und an das Foto von Sebastian und ihr, eng umschlungen vor der Freiheitsstatue. Wäre ich nicht gerade so damit beschäftigt, ein Kind auf die Welt zu bringen, würde ich erneut in Rage geraten.
Doch an Eifersucht ist jetzt wirklich nicht zu denken, denn mit einem Mal überkommt mich ein ganz eigenartiges Gefühl.
»Scheiße«, sage ich und schließe kurz die Augen. Dann öffne ich sie wieder und sehe Valeria an. Sie scheint sofort zu verstehen und greift nach meiner Hand.
»Push?«, fragt sie. Ihre Englischkenntnisse, die im Geburtsvorbereitungskurs noch ganz passabel waren, scheinen mit meinen fortschreitenden Wehen immer rudimentärer zu werden. Auch sie ist also nervös, will es aber nicht zeigen. Das wiederum macht mich noch nervöser, als ich eh schon bin. Denn, ja, ich muss pressen. Ganz eindeutig: Dieses Baby will raus. Jetzt. Sofort.
»Yes«, sage ich, und im nächsten Moment kralle ich mich mit einer Hand an der Kopfstütze des Fahrersitzes fest und zerquetsche mit der anderen die Finger meiner Hebamme. Ich gebe einen gewaltigen Schrei von mir, während ich der Presswehe nachgebe.
Wie durch einen Nebel hindurch bekomme ich mit, dass Valeria, Gila und Jule ein paar rasche Worte teils auf Englisch, teils auf Italienisch wechseln, während Luigi das Taxi am rechten Straßenrand anhält und immer wieder »Mamma mia!« von sich gibt. Jule schiebt sich und ihren dicken Bauch aus dem Auto hinaus, um Platz zu machen. Valeria kniet sich auf die Rücksitzbank und bugsiert meine Beine so, dass ich liege und sie zwischen meinen Knien hockt.
Ich werde auf YouTube enden, denke ich, als Valeria meine Unterhose herunterzieht und mein Kleid zurückschlägt. Luigi verlässt sein Taxi fluchtartig.
»Jule, sorg dafür, dass mich niemand mit seinem verdammten Smartphone filmt!«, schreie ich noch nach draußen, bevor ich wieder pressen muss.
»I see head, I see head!«, ruft Valeria.
Oha, man kann schon den Kopf sehen? »Scheiße, scheiße, scheiße!«, schreie ich.
Nicht im Taxi, nicht ohne Sebastian! Außerdem wollte ich eine verdammte Rückenmarkspritze haben!
»Ganz ruhig, ich habe Sebastian gerade erreicht«, höre ich Gilas Stimme von vorn. »Er ist ganz in der Nähe und kommt jetzt hierher. Bleib ruhig, Mika, du schaffst das.«
Dann verlässt auch sie das Auto. Nun sind nur noch Valeria und ich im Taxi. Und eine kleine Person, die es höchst eilig zu haben scheint, auf diese Welt zu kommen.
Valeria wühlt in ihrer Hebammentasche herum und streift sich ein paar weiße Latexhandschuhe über. Ich muss wieder pressen und untermale dies akustisch mit gellenden Schreien. Ob sich um das Auto herum schon eine Menschenmenge gebildet hat? Kann man mir zwischen die Beine gucken?
Jules Kopf taucht zwischen den Vordersitzen auf. »Alles wird gut«, sagt sie in beruhigendem Tonfall. »Luigi hat einen Krankenwagen gerufen, er müsste jeden Moment hier sein. Und niemand kann dich filmen, Luigi schirmt die Autofenster hinter Valeria ab, und ich hänge jetzt die hier hinter deinen Kopf, dann kann auch da niemand reingucken.« Und sie beginnt beherzt, ihre gigantische Schwangerschafts-Strickjacke hinter meinem Kopf vor dem Fenster zu drapieren. Gut, dass Jule so empfindlich auf die Klimaanlagen in Geschäften und Taxen reagiert und daher auch bei dreißig Grad Außentemperatur nie das Haus ohne Jacke verlässt.
Ich will Jule danken, doch da kommt schon die nächste Presswehe.
»Sebastian, ich hasse diiiiiich!«, schreie ich aus Leibeskräften, als ich erneut pressen muss. Warum ist er nicht bei mir? Wut überkommt mich, Wut auf ihn und auf diese Frau, die sich permanent in unser Leben drängelt – und auf sein Handy, das zu Hause liegt, und überhaupt auf diese ganze bescheidene Situation.
Und an allem ist bloß dieser Mistelzweig schuld.
Kapitel 1
Neun Monate früher
Der Mistelzweig fällt mir bereits kurz nach meinem Eintreffen in der Dorfkneipe »Zur Linde« unangenehm auf. Und das nicht nur, weil ich mit meinen fast dreißig Jahren nach wie vor Single bin und deshalb niemanden habe, der mich unter diesem Mistelzweig küssen könnte. Nein, das wirklich Ärgerliche ist, dass mein Exverlobter sehr wohl jemanden hat, den er im Türrahmen unter diesem blöden Grünzeug an sich zieht – und zwar die Frau, mit der er mich vor zwei Jahren betrogen hat.
Diana Terling-Kleinebecker kichert und windet sich in aufgesetzter Verlegenheit, als Jonas sie nach hinten biegt, sich über sie beugt und ihr einen filmreifen Kuss auf die rot geschminkten Lippen drückt. Mich hat er nie so theatralisch geküsst. Vielleicht deshalb, weil ich nicht so hollywoodreif aussehe wie Diana mit ihren langen schwarzen Haaren und den hellgrauen Augen mit den dichten Wimpern.
»Das sind doch künstliche Wimpern, oder?«, frage ich Steffi und nippe schlecht gelaunt am Glühwein, der am 23. Dezember stets reichlich in der »Linde« fließt. Jahr für Jahr trifft sich fast ganz Elmendorf in der einzigen Kneipe des Ortes und läutet bei zu viel Glühwein den Heiligen Abend ein. Es ist in den vergangenen Jahren durchaus vorgekommen, dass unser Pfarrer im Gottesdienst am folgenden Abend wegen starker Kopfschmerzen gequält die Augen zusammengekniffen hat, wenn das Blasorchester zu »Stille Nacht, heilige Nacht« ansetzte.
Auch heute scheint unser Pastor bereits sehr fröhlich zu sein, als er mir mit seiner Tasse Glühwein zuprostet. »Auf ein schönes Weihnachtsfest, Michaela!«
»Ebenso, Herr Pastor«, sage ich und nehme einen großen Schluck. Wenn ich so weitermache, werde ich morgen Abend beim Klang der Posaunen auch gequält die Augen schließen, denke ich, als ich meine leere Tasse über die Theke schiebe, um sie mir von Lissy, der Tochter des Kneipenbesitzers, erneut auffüllen zu lassen. Aber egal. Ich habe heute gleich mehrere Gründe, mich mit Glühwein volllaufen zu lassen, und einer dieser Gründe schiebt gerade seine Zunge zwischen zwei hellrot bemalte Lippen.
»Hey, Steffi«, sage ich ungeduldig und stoße meiner Freundin leicht den Ellbogen in die Seite.
»Wer soll künstliche Wimpern haben?«, fragt Steffi zerstreut und tippt auf ihrem Smartphone herum. Fynn-Henri ist heute Abend zum ersten Mal in seinem sechsmonatigen Leben bei einem Babysitter, und Steffi scheint fest davon überzeugt zu sein, dass ihr kleiner Liebling zu Hause gerade einen qualvollen Tod stirbt.
»Du«, sage ich spöttisch und nehme dankbar die dampfende Tasse entgegen, die Lissy mir reicht.
Verdutzt sieht Steffi von ihrem Smartphone auf. »Was? Warum sollte ich denn falsche Wimpern haben? Spinnst du?«
Ich seufze und puste in meine Tasse hinein. »Die Rede war eigentlich von Diana. Ich wollte bloß sichergehen, dass du mir richtig zuhörst und nicht nur versuchst, durch Anstarren deines Smartphones herauszubekommen, ob es Fynny-Boy gut geht.«
Beleidigt schiebt Steffi ihr Telefon ein Stück zur Seite, nimmt einen Schluck Kinderpunsch (sie stillt noch) und sagt: »Ich habe nur kontrolliert, ob ich hier drinnen ausreichend Empfang habe und ob der Ton laut genug eingestellt ist. Was meinst du, wie viele Anrufe ich schon in Kneipen verpasst habe?«
»Na ja, nicht während der letzten sechs Monate, schätze ich. Schließlich warst du seit Fynns Geburt nicht mehr aus. Also, entspann dich und genieß den Abend.«
»Das sagt die Richtige«, kontert Steffi spöttisch und schaut bedeutungsschwer zu dem Ecktisch hinüber, an dem Jonas und Diana gerade Platz genommen haben – natürlich ist es der Tisch der Freiwilligen Feuerwehr Elmendorf, zu der auch mein Ex gehört. »Als ob du dich entspannen und den Abend genießen könntest, während du darüber nachdenkst, ob Dianas Wimpern echt sind.«
»Sind sie nicht«, knurre ich. »Genauso wenig wie ihre Brüste.«
Das kann ich leider sehr genau einschätzen, schließlich habe ich besagte Oberweite bereits in ihrer ganzen unnatürlichen Pracht gesehen – wie der Schönheitschirurg sie geschaffen hat. Ein Erlebnis, das ich sehr gern aus meinem Gedächtnis streichen würde. Ich vergesse doch sonst so viel – den PIN meiner EC-Karte, das Passwort meines Facebook-Accounts, den Geburtstag meines älteren Bruders Thomas –, wieso also sehe ich ausgerechnet diese Szene, die sich vor zwei Jahren im Schlafzimmer meiner Ex-Doppelhaushälfte abgespielt hat, noch so genau vor mir?
An jenem Donnerstag vor ziemlich genau zwei Jahren kehrte ich gut gelaunt in eben diese Doppelhaushälfte zurück, und zwar früher als sonst. Mein Chef hatte mir gesagt, ich solle doch vor Weihnachten noch ein paar Überstunden abfeiern, was mir sehr recht war, schließlich würde ich in nur neun Tagen heiraten, und es gab noch so viel vorzubereiten.
Wie immer, wenn ich unsere Haustür aufschloss, wurde mir bewusst, was für ein Glück ich hatte, weil dies unser halbes Haus war. Nun gut, streng genommen gehörte das halbe Haus Jonas beziehungsweise Jonas’ Vater. Als Friedhelm Kleinebecker erfahren hatte, dass auf der Wiese hinter dem Kirchplatz ein Dutzend Doppelhäuser gebaut werden sollte, war er sofort Feuer und Flamme gewesen.
»Jonas«, hatte sein Vater gesagt, »das ist die Gelegenheit. Immobilien sind heutzutage die einzig sinnvolle Art und Weise, sein schwer verdientes Geld anzulegen. Bevor die Inflation dein Erbe frisst, baue ich dir lieber ein Haus.«
Dass Jonas vorhatte, mit mir in dieses Haus zu ziehen, sah Friedhelm Kleinebecker allerdings überhaupt nicht gern. Schließlich war ich nicht zur Uni gegangen, so wie sein Goldjunge, sondern hatte »nur« eine Ausbildung zur Bürokauffrau bei »Grotjohann & Möller«, einer Gütersloher Stahlbau-Firma, gemacht. Dort arbeitete ich nach wie vor, als Sekretärin des Leiters der Exportabteilung. Mir machte meine Arbeit Spaß, doch das war Jonas’ Vater natürlich wurscht. Er fragte mich bei fast jedem unserer Treffen: »Und wieso hast du eigentlich nicht studiert, obwohl du Abitur gemacht hast?«
›Weil ich nicht wollte!‹, hätte ich gern gebrüllt. Doch ich setzte wie immer mein allerliebstes Grübchen-Lächeln auf und sagte: »Mir gefällt mein Job sehr gut, Herr Kleinebecker.«
Im Gegensatz zu Jonas’ Vater überschlug sich meine Mutter beinahe vor Begeisterung, als sie hörte, dass Jonas und ich gemeinsam in ein halbes Haus mit schicker Einbauküche und handtuchgroßem Garten ziehen würden. Mein Vater reagierte eher zurückhaltend, doch das hieß nicht viel, denn Papa war in der Regel so emotional wie einer der Buchsbäume, die er in seiner Baumschule hegte und pflegte. Mein Vater war Landschaftsgärtner und Inhaber von Elmendorfs einziger Gärtnerei, wo Mama als Floristin ihre blumigen Wunderwerke vollbrachte. Mein Bruder Thomas würde die Gärtnerei einmal übernehmen und arbeitete bereits seit Jahren tatkräftig mit. Er war genauso schweigsam und menschenscheu wie Papa, beide waren am liebsten von Bäumen und Büschen umgeben, mit denen sie mehr Worte wechselten als mit ihren Mitmenschen. Was erklärte, warum Thomas mit seinen zweiunddreißig Jahren nach wie vor bei meinen Eltern wohnte und noch nie eine Freundin gehabt hatte. Zum Glück kam ich eher nach meiner Mutter – wobei ich (meiner Meinung nach) nicht ganz so redefreudig war wie sie. Mama musste die spärliche Konversation, die sie zu Hause mit »ihren Männern« führte, durch ausführliche Unterhaltungen mit ihrer Kundschaft ausgleichen.
Eigentlich hätte mir an jenem Donnerstag vor zwei Jahren die fremde Daunenjacke an unserem Garderobenständer auffallen müssen – und ebenso die auberginefarbenen Lack-Stiefeletten, die achtlos in der Ecke der Diele lagen. Als könnte man auberginefarbene Lack-Stiefeletten übersehen. Nun ja, ich konnte es, und ich tat es, denn ich war mit meinen Gedanken bei der schwierigen Frage, ob Mama cremefarbene oder doch lieber zartrosa Rosen für meinen Brautstrauß verwenden sollte, der mich in neun Tagen ins Gütersloher Standesamt und danach in die Elmendorfer Kirche begleiten würde.
Als meine Eltern von Jonas’ und meiner Verlobung erfahren hatten, war meine Mutter vor Begeisterung in lauten Jubel ausgebrochen. »Wie schön! Endlich Enkelkinder! Erst gestern hat mir Elli Dorstenkötter wieder neue Fotos von ihren VIER Enkelinnen gezeigt. Ich kann es nicht erwarten, endlich Fotos von deinen Kindern im Laden aufzuhängen, damit sie jeder sehen kann! Denn bei dir, Thomas, kann ich ja wohl noch ewig auf Nachwuchs warten.«
»Hmm«, machte mein Bruder, ohne seinen Blick vom Fernseher zu lösen, wo gerade »Bauer sucht Frau« lief.
»Mama, ich bin verlobt und nicht schwanger«, erinnerte ich meine Mutter ein wenig gereizt. Das Enkel-Thema bekam ich mit zunehmendem Alter in immer kürzeren Abständen aufgetischt. Meine Mutter ließ mit Vorliebe Bemerkungen wie »Die Fruchtbarkeit einer Frau nimmt bereits nach der Pubertät rasant ab« fallen, woraufhin ich gern spitz konterte: »Ja, ich weiß, ich hätte mich schon während der Schulzeit schwängern lassen sollen.«
Als wir Jonas’ Eltern die große Neuigkeit erzählten, verkündete seine Mutter theatralisch: »Jetzt darfst du mich ›Ulla‹ nennen, Kind!« Friedhelm starrte uns fassungslos an und sagte: »Aber ihr macht einen Ehevertrag!«
In diesem Ehevertrag sollte festgehalten werden, dass bei einer Scheidung das halbe Haus ganz an seinen Sohn übergehen würde. Ich konnte nur müde darüber lächeln, schließlich liebte ich Jonas über alles, und er liebte mich. Ich war davon überzeugt, einen ganz wunderbaren Verlobten zu haben, einen wahren Glücksgriff auf dem schwer umkämpften Markt der Singles, und ich verschwendete keinen Gedanken an Eheverträge und Scheidung.
Bis ich an jenem Donnerstagnachmittag, ein Jahr nach unserer Verlobung, an der halboffen stehenden Tür zu unserem Schlafzimmer vorbeikam und fast tot umfiel vor Schreck.
Ich weiß, eigentlich hätte ich schon Böses ahnen müssen, als ich von meinem Chef unerwartet früher nach Hause geschickt worden war. So etwas kann schließlich nur übel enden, das sieht man doch immer wieder in Hollywoods einschlägigen Liebeskomödien, die ich so gern schaue. Wenn Frauen früher nach Hause kommen als geplant, erwischen sie ihren Partner IMMER in flagranti. Ich hätte meinem Chef sagen sollen: »Nee, lassen Sie mal, ich mache lieber noch ein bisschen Ablage und gehe wie gewohnt um siebzehn Uhr dreißig.«
Aber das hatte ich nicht gesagt, und somit hatte ich nun den Schlamassel und durfte mit eigenen Augen sehen, wie untreu mein ach so perfekter Verlobter war.
»Jonas?«, fragte ich in die Richtung des mir wohlbekannten nackten Hinterns, der zwischen den weihnachtlichen Bettbezügen ziemlich eindeutige Bewegungen machte. Jonas schaute über seine Schulter und fragte fassungslos: »Mika? Was machst du denn schon hier?«
»Ich feiere Überstunden ab«, sagte ich tonlos. Es kann nur der Schock gewesen sein, der mich so ruhig bleiben ließ. »Und was machst du da?«
»Äh … ich … äh …«, stammelte Jonas und versuchte, möglichst elegant von der Dame abzusteigen, deren Gesicht ich immer noch nicht hatte erkennen können.
Als ich es sah, schnappte ich hörbar nach Luft.
»Diana?«
»Hallo, Mika«, sagte Diana Terling und verschränkte ihre Arme so langsam vor ihren nackten Brüsten, dass ich ausreichend Gelegenheit hatte, ihre Silikonoberweite zu bewundern.
Diana Terling war in meiner Klasse gewesen. Wir waren nie befreundet, aber auch nie verfeindet gewesen. Bis jetzt.
Sie arbeitete als Rechtsanwältin in der Kanzlei »Kleinebecker & Grabheinrich«, die meinem Schwiegervater in spe und seinem Kompagnon gehörte. Oder eher meinem ehemaligen Schwiegervater in spe. Sicher hatte Friedhelm Akademiker-Diana auf seinen Sohn angesetzt, um ihn vor den ehelichen Fängen einer schlichten Sekretärin zu bewahren, die nie einen Hörsaal von innen gesehen hatte.
Doch all diese Gedanken kamen mir erst später. In diesem Moment konnte ich nicht viel denken, während ich ungläubig auf die Szene vor mir starrte wie auf einen schrecklichen Unfall und versuchte, zu begreifen, was dort gerade geschehen war.
»Schöne Bettwäsche«, sagte Diana und tätschelte einem der Rentiere den Kopf.
Diese abgebrühte Bemerkung verdrängte endlich die starre Fassungslosigkeit und brachte meine Wut in Wallung. Neun Tage vor unserer Hochzeit ließ er sich von mir erwischen! Zehn Tage bevor wir ins Flugzeug gestiegen und in die Flitterwochen nach Florida geflogen wären. Nach Florida! Ich war noch nie außerhalb Deutschlands gewesen. Meine Urlaubserfahrungen beschränkten sich auf die ostfriesischen Inseln, auf Städtewochenenden in Hamburg und Berlin sowie auf stolze zehn Tage Wandern in Bayern. Und so, wie es aussah, würde mein nagelneuer Pass, der in der obersten Kommodenschublade im Flur lag, weiterhin jungfräulich bleiben.
»Du kannst die Bettwäsche haben«, hörte ich mich sagen. »Und den Scheißtypen neben dir dazu. Den brauche ich nicht mehr.«
Mit diesen Worten verließ ich unsere Haushälfte und meinen Verlobten.
Noch im Hinuntergehen riss ich die Tannengirlande vom Treppengeländer und nahm den von Mama liebevoll gesteckten Haustürkranz mit. Wenn Jonas schon mit dieser Schlampe in unserem Doppelhaus Weihnachten feiern würde, dann, bitte schön, ohne die von mir sorgfältig aufgehängte Deko. Außerdem entdeckte ich beim Verlassen meines Exheims endlich die dämlichen Stiefeletten und die Daunenjacke und stopfte alles in die Mülltonne neben unserer Garage, direkt auf den Fischabfall vom Vorabend.
Ich fuhr zu meinen Eltern und erzählte ihnen schluchzend von der Szene in unserem Schlafzimmer.
Mein Vater sagte: »Der Blödmann hat dich nicht verdient«, was mich noch mehr zu Tränen rührte, denn so etwas hatte Papa, der sich grundsätzlich aus Beziehungssachen heraushielt, noch nie gesagt. Meine Mutter seufzte bekümmert: »Aber ihr hattet doch so eine schöne Einbauküche!« – als zeugte das von einer intakten Beziehung, fern von Schlafzimmerszenen mit fremden Silikonbrüsten.
Thomas sagte: »Oha.« Und nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »Im Januar ziehe ich in die Wohnung über dem Laden. Dann kannst du meine Bude im Dachgeschoss haben.«
Das waren erstaunlich viele Worte für meinen Bruder. Noch viel erstaunlicher allerdings war die Entscheidung, sein Elternhaus endlich zu verlassen, um in das Obergeschoss der Gärtnerei zu ziehen, das er im Laufe der letzten zwei Jahre selbst ausgebaut hatte. Mit Anfang dreißig würde Thomas also endlich flügge werden, während ich mit Ende zwanzig wieder ins elterliche Nest heimkehrte.
Bis zum Auszug meines Bruders quartierte ich mich in meinem alten Kinderzimmer ein, wo inzwischen Mamas Nähmaschine stand. Ich hatte das Zimmer, dessen pinkfarbene Blümchentapete immer noch vom schlechten Geschmack meiner Pubertät zeugte, erst drei Jahre zuvor verlassen, als ich gemeinsam mit Jonas unsere erste Wohnung angemietet hatte. Nun igelte ich mich während der Weihnachtsfeiertage dort ein, heulte, schaute in Endlosschleife die von mir heiß geliebten »Gilmore Girls« und aß viel zu viele Marzipankartoffeln. Mir war alles egal, vor allem meine hart umkämpfte Größe 42. Sollten sich die Pfunde doch wieder an Hüfte und Bauch ansiedeln, ich musste schließlich in kein Brautkleid mehr hineinpassen!
Vermutlich hätte ich endlos so weiter geheult und gegessen, doch ich hatte die Rechnung ohne Steffi und Hanna gemacht. Wir waren seit dem Kindergarten befreundet und hatten schon so manch schwere Zeit gemeinsam überstanden: Die Scheidung von Steffis Eltern, als wir siebzehn waren. Mein schlimmer Liebeskummer wegen Sebastian kurz vor unserem Abi. Hannas und Tills bislang unerfüllter Kinderwunsch.
Also würden wir auch diese Katastrophe gemeinsam meistern, nahmen die beiden sich vor und ließen sich nicht davon abbringen, mich an Silvester auf eine Party zu schleppen. Zunächst wollte ich mich strikt weigern. Dann jedoch dachte ich daran, dass Jonas um Mitternacht sicherlich mit Dirty Diana auf irgendeiner Silvesterfeier herumknutschen würde, und meine weinerliche Selbstmitleidsstimmung verwandelte sich in heilsamen Zorn. Ich warf mich in Schale und feierte mit Steffi und Hanna und ihren besseren Hälften Christopher und Till ins neue Jahr.
Am nächsten Morgen schnappte ich mir Thomas und fuhr mit ihm in die Neubausiedlung hinter der Kirche. Wozu hat man schon einen älteren Bruder, wenn man ihn nicht dazu benutzen darf, seinen Ex einzuschüchtern? Und tatsächlich machte sich Thomas ganz gut darin, Jonas wütend zu mustern, während ich meine Sachen zusammensuchte und in die mitgebrachten Umzugskartons stopfte. Zum Glück war Diana nicht anwesend, das hätte mir seelisch den Rest gegeben.
Als Thomas den letzten Karton aus dem Haus getragen hatte, blieb ich vor Jonas stehen und fragte ihn: »Warum, Jonas?«
Mein Beinahe-Ehemann schaute zerknirscht auf seine Füße. »Es liegt nicht an dir, Mika«, sagte er leise. »Ich glaube, ich bin einfach noch nicht bereit für die Ehe.«
»Das fällt dir aber früh ein«, sagte ich voller Verachtung und warf ihm meinen Haustürschlüssel und den Verlobungsring vor die Füße. »Übrigens hasse ich Gelbgold«, sagte ich beim Hinausgehen. »Vielleicht passt er ja Diana.«
Niemals hätte ich gedacht, dass er genau das tun würde: Diana passen. Dass mein Exverlobter tatsächlich der Frau, mit der er mich betrogen hatte, einen Heiratsantrag machen und ihr denselben Ring auf den Finger schieben würde wie mir. Und das nur vier Monate nach unserer Trennung.
So viel zu: »Ich bin noch nicht bereit für die Ehe.«
Jonas und Diana heirateten anderthalb Jahre nach unserer geplatzten Hochzeit an einem zum Glück verregneten Augusttag. Um möglichst wenig von der Hochzeit meines Ex mitbekommen zu müssen, machte ich eine Woche Urlaub. Im Sauerland. Noch dazu allein, denn Steffi hatte gerade Fynn-Henri bekommen, und auch Hanna war dank In-vitro-Fertilisation endlich im vierten Monat schwanger und übergab sich am laufenden Band.
Ich kehrte nach Elmendorf zurück, sobald Jonas und seine frisch angetraute Ehefrau in die Flitterwochen abgereist waren. Nach Florida. In das Hotel, das ich damals für uns im Internet rausgesucht hatte. Ehrlich, ich hatte Jonas ein wenig mehr Kreativität zugetraut. Diana hatte nicht nur meinen Verlobungsring bekommen, nein, sie machte auch noch den von mir geplanten Urlaub. Bloß gut, dass ich diesen unsensiblen Kerl nicht geheiratet hatte! Ich wünschte den Flitternden einen fetten Hurrikan (so was kam in Florida ja nicht selten vor) und beschloss, mir von nun an mein Leben schön zu machen, Single hin oder her.
Kapitel 2
Das versuche ich nun, fast fünf Monate später, immer noch, als ich am 23. Dezember an der Theke der »Linde« sitze und auf Lissy warte, um einen weiteren Glühwein zu bestellen. Allerdings macht es mir das Leben mit dem Schönsein nicht ganz so leicht. Meine beinahe dreißigjährigen Eizellen fragen mich zunehmend übel gelaunt, wann ich denn gedenke, sie endlich zu nutzen. Aber ein potenzieller Papa meines zukünftigen Kindes lässt sich in Elmendorf nicht so leicht finden. In der weihnachtlich dekorierten Kneipe sind ungefähr zwanzig Männer anwesend, die vom Alter her theoretisch als Partner infrage kämen, doch von denen sind zwölf in mehr oder weniger festen Händen (darunter mein idiotischer Ex Jonas). Von den restlichen acht Singles ist einer schwul, einer ein unsympathischer Vollidiot, der dem schwulen Sören gern Schläge androht, und einer mein Bruder. Bleiben also noch fünf. Und mit einem dieser fünf – Peter Hennig, eine Sandkastenfreundschaft – bin ich tatsächlich mal ausgegangen (außerdem mit Frank Husemann, der jetzt mit der blonden Bäckereiverkäuferin liiert ist und daher zu der Gruppe der zwölf vergebenen Männer gehört). Ich habe Peter sogar geküsst, allerdings nur, weil ich eine Weißweinschorle zu viel intus hatte. Aber weder bei ihm noch bei Frank Husemann hat es Schmetterlingsflügel-Flattern in meinem Bauch gegeben. Noch nicht einmal das Zittern eines Mottenflügels. Verliebt war ich in meinem Leben bisher nur in zwei Männer. Der eine sitzt gerade mit seinen Feuerwehrkumpels und Silikon-Diana an einem Ecktisch.
Und der andere betritt in diesem Moment die Kneipe.
»Scheiße«, sage ich zu Steffi, die schon wieder auf ihr Smartphone starrt.
»Was denn?«, fragt sie.
»Sebastian.«
»Oh je.«
Sie folgt meinem Blick zum Eingang. Dort begrüßt besagter Mann gerade ein paar alte Kumpels, schlägt ihnen lachend auf den Rücken und umarmt die rothaarige Melanie, die in seiner Stufe gewesen ist.
Sebastian Hoffmann. Meine erste große Liebe.
»Steffi?« Christopher taucht neben uns an der Theke auf und wedelt mit seinem Smartphone vor dem Gesicht seiner Frau herum. »Tanja hat gerade angerufen.«
»Wer ist Tanja?«, fragt Steffi verwirrt. »Ach, du meinst Anja? Unsere Babysitterin?« Mit einem Satz springt sie vom Barhocker und greift nach ihrer Handtasche. »Was ist passiert?«
»Nichts ist passiert«, beschwichtigt Christopher in seiner gutmütigen Art. »Fynn ist aufgewacht und schreit, wahrscheinlich hat er Hunger. Er …«
Weiter kommt Christopher nicht. »Bin schon unterwegs. Sorry, Mika, vielleicht komme ich nachher noch einmal vorbei. Ciao!«
Resigniert starre ich Steffis in der Menge verschwindendem Pferdeschwanz nach.
Christopher sieht mich entschuldigend an und zuckt mit den Schultern. »Wir haben es schon so oft mit dem Abpumpen versucht, aber der kleine Mann mag nun einmal Mamas Brust am liebsten und nicht so ein olles Fläschchen.«
Sein verklärtes Lächeln lässt darauf schließen, dass Christopher das ziemlich gut nachempfinden kann.
Ich nicke mit einem missmutigen Seufzen. »Schon okay.«
Dabei fühle ich mich ganz und gar nicht okay. Es hat Zeiten gegeben, da waren Steffi, Hanna und ich von keiner Weihnachtsparty in der »Linde« wegzudenken. Mehr als einmal haben wir zu dritt auf der Theke zu »Last Christmas« getanzt. Und jetzt?
Steffi ist zur Übermutti mutiert, bei der man vergessen haben muss, die Nabelschnur zu Fynny-Boy richtig zu kappen. Dabei war sie bis vor einem halben Jahr mit Herz und Seele Lehrerin an einer Realschule in Gütersloh gewesen und vertraute Hanna und mir in einem schwachen Schwangerschaftsmoment an, dass sie sich vor der Pause vom Beruf und von ihrem Dasein als Vollzeit-Mami fürchtete. Zwar hatte Steffi immer Kinder haben wollen, aber eigentlich nicht so früh. Mitte dreißig wäre für sie völlig in Ordnung gewesen. Doch als Hanna und Till auch beim dritten Versuch In-vitro-Fertilisation keinen Nachwuchs erwarteten und zunehmend verzweifelten, überredete Christopher seine Frau, vorsorglich schon einmal die Pille abzusetzen.
»Du siehst doch, wie lang das Ganze noch dauern kann«, sagte er besorgt, denn er wünschte sich von ganzem Herzen ein Baby. Schließlich gab Steffi nach, weil auch sie überzeugt davon war, nicht gleich schwanger zu werden. Einen Monat später jedoch war sie genau das. Sie nahm es Christopher bis zu Fynns Geburt übel, dass er sie so gedrängt hatte, schließlich war sie zum ersten Mal Klassenlehrerin und wollte nicht gerade jetzt ihre Karriere an den Nagel hängen. Dann wurde Fynn-Henri geboren, und alles änderte sich. Neulich hat Steffi sogar davon gesprochen, nach dem ersten Jahr Elternzeit noch ein zweites dranzuhängen. Hanna und ich können nicht glauben, dass ein kleiner Junge mit kahlem Kopf unsere ehrgeizige Freundin so verändern konnte.
Als auch Hanna beim vierten In-vitro-Versuch endlich schwanger wurde, war Steffi so erleichtert, dass sie in Tränen ausbrach (das letzte Mal hatten wir sie heulen sehen, als sich ihre Eltern hatten scheiden lassen). »Ich kam mir so schäbig vor«, hat sie geschluchzt. »Ich wollte gar nicht so schnell schwanger werden, und du hast alles getan, und es klappte einfach nicht!«
Hanna liegt heute Abend mit einem gewaltigen Babybauch zu Hause. Ihr kleiner Junge soll kurz vor Silvester geboren werden, und Hanna kann nach eigenen Angaben keine drei Schritte mehr gehen – schon gar nicht nach zwanzig Uhr. Die Tatsache, dass meine zwei besten Freundinnen verheiratet sind und ihre Eizellen besser nutzen als ich, macht mich traurig. Natürlich gönne ich den beiden ihr Familienglück. Aber wenn man selbst Single und kein passender Mann in Sicht ist, tut es besonders weh, dabei zuzusehen, wie sich andere glücklich paaren und vermehren.
»Darf ich dir einen Glühwein spendieren?«, fragt Christopher, dem anscheinend nicht entgangen ist, dass bei mir eine Stimmungsflaute herrscht. Was nicht nur mit Steffis Stilleinsatz zu tun hat.
»Mhhm. Gern.«
Während Christopher Getränkenachschub bei Lissy bestellt, versuche ich angestrengt, nicht in Sebastians Richtung zu schauen. Vergeblich.
Mann, was sieht der gut aus. Noch besser als damals, ganz eindeutig.
»Hey, Christopher!«, höre ich eine mir nach wie vor verflucht vertraute Stimme und erstarre auf meinem Barhocker. Jonas ist neben Christopher getreten und legt einen Arm um seine Schultern. Christopher wendet mir gerade den Rücken zu, sodass Jonas mich nicht bemerkt.
»Hast du schon die tollen Neuigkeiten gehört?«, fragt er.
Christopher schüttelt den Kopf. Ich merke, dass ihm meine Anwesenheit sehr wohl bewusst und ziemlich unangenehm ist. Jonas und er spielen in derselben Fußballmannschaft des »Elmendorfer F.C.«, aber seit Jonas mich so unsensibel abserviert hat, hat Steffi ihrem Christopher verboten, privaten Umgang mit meinem Ex zu pflegen. Und Christopher tut fast immer das, was Steffi will.
»Diana ist schwanger!«, sagt Jonas, und ich kann das Strahlen an seinem Tonfall hören. Seine Stimme hat mir immer so viel verraten. Wenn ich ihn angerufen habe, hat mir die Art, wie er »Hallo?« sagte, genügt, um zu wissen, ob er gut gelaunt oder besorgt oder müde oder wütend oder gelangweilt oder genervt war. Jetzt ist er glücklich.
»Herzlichen Glückwunsch«, höre ich Christopher sagen. Ich merke, dass er einen nervösen Blick über seine Schulter wirft, doch da rutsche ich schon vom Barhocker. Ich will mich unbemerkt an Jonas vorbeischieben und das Weite suchen, aber leider trete ich meinem Ex im Vorbeigehen mit der Spitze meines Stiefels auf den Schuh. Er dreht sich um und starrt direkt in mein Gesicht.
»Oh, ähm, hallo«, sagt Jonas.
»Hallo«, sage ich und will mich für den Tritt entschuldigen, verkneife es mir jedoch. Stattdessen sage ich gezwungen lässig: »Herzlichen Glückwunsch! Ein Baby. Toll.«
Jonas tritt verlegen von einem Fuß auf den anderen. Er grinst ziemlich dämlich und murmelt: »Hmm, ja. Danke. Wir freuen uns auch.«
»Na dann«, sage ich und will schnell abhauen, als Jonas hinzufügt: »Hey, tut mir leid, das mit deinem Job. Meine Mutter hat es gestern in der Gärtnerei von deiner Mutter gehört.«
Ich schlucke. Mitleid von meinem Ex, der nun auch noch Vater wird, ist das Letzte, was ich heute gebrauchen kann. Dankbar greife ich nach der Tasse Glühwein, die Christopher mir mit zerknirschtem Blick reicht.
»Danke«, sage ich und puste in die Tasse. Dann füge ich in Jonas’ Richtung kühl hinzu: »Dir muss überhaupt nichts leidtun. Ich wollte mich beruflich ohnehin verändern, daher ist es nicht schlimm, dass ›Grotjohann & Möller‹ Insolvenz anmelden mussten.«
Diese Lüge geht mir nur schwer über die Lippen, und ich muss rasch einen großen Schluck Glühwein nehmen, um den bitteren Geschmack loszuwerden, der sich beim Gedanken an die bevorstehende Arbeitslosigkeit in meinem Mund ausgebreitet hat.
»Na, wenn das so ist …«, sagt Jonas und wirkt nicht sehr überzeugt. Natürlich weiß er ganz genau, dass ich vorgehabt habe, bis zu meiner Rente bei »Grotjohann & Möller« zu bleiben. Berufliche Veränderung hat nie auf meiner Agenda gestanden, denn ich mag keine Veränderungen. Veränderungen machen mir Angst. Daher wohne ich auch nach wie vor in meinem Geburtsort und habe nicht vor, daran jemals etwas zu ändern. Die Vorstellung, in eine fremde Stadt zu ziehen und dort niemanden zu kennen und nicht zu wissen, in welchem Supermarkt ich einkaufen soll, ist für mich der pure Albtraum.
Diese Angst vor Veränderungen ist auch der Grund, warum der gut aussehende Mann, der eben die Kneipe betreten hat, und ich kein Paar mehr sind. Wo ist Sebastian überhaupt? Ich schaue mich unauffällig um, als Jonas noch etwas sagt. Warum unterhalte ich mich überhaupt noch mit meinem blöden Ex?
»Entschuldige, was hast du gesagt?«, frage ich und zwinge mich dazu, wieder in die blauen Augen meines Gegenübers zu sehen. Irre ich mich, oder hat Jonas erheblich zugenommen, seit er mich verlassen hat? Vermutlich sind das die solidarischen Schwangerschaftspfunde. Schwanger. Diana wird ein Baby bekommen. Jonas’ Baby. Ich schlucke.
»Ich habe gesagt, dass du ganz schön nach einer neuen Stelle wirst suchen müssen bei der momentanen Situation auf dem Arbeitsmarkt«, wiederholt Jonas und mustert mich mit hochgezogenen Augenbrauen, wie immer, wenn er glaubt, etwas besser zu wissen. Wie ich diesen Gesichtsausdruck hasse! Er hat ihn regelmäßig aufgesetzt, wenn er mir eine Predigt zur richtigen Pflege von Teflon-Pfannen oder zur besten Einräummethode der Spülmaschine gehalten hat. Ich bin ihm nie ordentlich genug gewesen. Ob Diana immer daran denkt, die Messer mit dem Griff nach oben in den Besteckkasten der Spülmaschine in der wunderschönen Einbauküche des halben Hauses zu stecken?
»Ach, weißt du«, höre ich mich sagen, bevor ich mich bremsen kann. »Ich schaue gar nicht unbedingt in Gütersloh nach einer neuen Stelle. Vielleicht ziehe ich in eine andere Stadt.« Ich mache eine effektvolle Pause und füge hinzu: »Oder ins Ausland.«
»Ins Ausland?« Jonas starrt mich ungläubig an. »Du? Warst du überhaupt schon einmal im Ausland?«
»Das tut doch nichts zur Sache!«, schnaube ich. Langsam werde ich wütend. Und ein wenig schwindelig ist mir auch. Vielleicht sollte ich lieber keinen Glühwein mehr trinken. Ach was, ist doch eh alles egal. Entschlossen nehme ich einen weiteren großen Schluck und sage dann so würdevoll wie möglich: »Außerdem geht es dich überhaupt nichts mehr an, wo ich arbeite, du Idiot.«
Mit diesen Worten drehe ich mich schwungvoll um. Und schütte dem anderen Ex meines kümmerlichen Liebeslebens meinen Glühwein über das hellblaue Hemd. Mit einem leisen Aufschrei weicht Sebastian zurück und starrt mich aus seinen dunkelbraunen Augen an, zunächst verblüfft, dann amüsiert.
»Hallo, Mika.«
»Scheiße! Es tut mir leid, Sebastian! Hast du dich verbrannt?«
Sebastian schüttelt den Kopf. Dann verziehen sich seine Mundwinkel zu diesem leichten Schmunzeln, das mich schon immer um den Verstand gebracht hat.
»Jetzt ist mir wenigstens richtig warm«, sagt er und hört nicht auf, mich zu mustern. Ich spüre, wie ich unter seinem Blick rot werde. Plötzlich wird mir bewusst, dass ich zwischen den beiden Männern meines Lebens stehe. Zwischen den einzigen ernsthaften Beziehungen, die ich mit meinen fast dreißig Jahren hatte. Zwischen den beiden Typen, die mir das Herz gebrochen haben. Der eine blond und blauäugig, der andere mit braunem Haar, das sich ganz leicht lockt, und diesen wahnsinnig dunklen Augen, die bei mir schon immer Herzrasen auslösen konnten.
Ich muss hier weg.
»Schön, dich gesehen zu haben, Sebastian«, sage ich und schiebe meine leere Tasse auf den Tresen. »Sorry wegen des Hemdes – bring mir die Rechnung für die Reinigung vorbei. Du weißt ja, wo ich wohne. Wobei – vielleicht auch nicht. Also: Ich wohne wieder bei meinen Eltern. Seit …« Ich halte inne und drehe mich zu Jonas um, der meinen hektischen Monolog interessiert verfolgt. »Seit mich dieses Arschloch mit Silikon-Diana betrogen hat. In unserem Ehebett. Na ja, was unser Ehebett hätte werden sollen, denn ich habe die beiden neun Tage vor unserer Hochzeit in flagranti erwischt. Gerade rechtzeitig also. Puh, Glück gehabt, was?«
Ich sehe wieder Sebastian an. Sein Schmunzeln ist verschwunden, als er erst mich und dann Jonas wortlos mustert. Jonas ist erfreulicherweise knallrot geworden und schaut betreten zu Boden.
Sebastian und er kennen sich aus der Schule, sie waren in derselben Stufe. Ich überlege, ob Sebastian gewusst hat, dass Jonas und ich ein Paar gewesen sind, sogar fast geheiratet hätten. Hat er schon davon gehört, dass ich kurz vor meiner Hochzeit meinen Verlobten beim Fremdgehen erwischt habe?
Vielleicht hat sein Vater es ihm erzählt – obwohl, nein, das ist unwahrscheinlich. Sehr viel bekommt Heinrich Hoffmann vom Leben in Elmendorf schließlich nicht mit, da er ständig in seine Manuskripte vergraben ist. Und oft war Sebastian nicht zu Besuch in Elmendorf, seit er nach dem Abi mit einem Rucksack losgezogen ist, um Südamerika kennenzulernen.
Ich überlege, wann ich das letzte Mal mit meinem Exfreund gesprochen habe, seit wir uns damals im Streit getrennt haben. Ich erinnere mich hauptsächlich daran, dass ich mich mehr als einmal vor ihm versteckt habe, wenn er in den Jahren nach dem Abi seinen Vater besucht hat. Einmal saß ich eine Stunde lang auf einer Bank auf dem Kinderspielplatz und traute mich nicht, zu Fuß durchs Dorf zurück zu meinem Elternhaus zu gehen, da ich Sebastian im Ortskern erblickt hatte. Ich hatte Angst davor, in Tränen auszubrechen, sollte er mich ansprechen. Ich hatte Angst davor, wieder in seine dunklen Augen zu schauen und zu wissen, dass ich immer noch Gefühle für ihn hatte.
Erst als Jonas und ich zusammengezogen waren, hörte ich auf, Sebastian aus dem Weg zu gehen. Ja, jetzt fällt es mir ein: Einmal habe ich kurz mit ihm gesprochen, ebenfalls zu Weihnachten, auf dem Elmendorfer Weihnachtsmarkt. Ich hatte gerade eine Tüte Vanillekipferl beim Kindergartenstand gekauft und lief buchstäblich in meinen Ex hinein. Das tue ich anscheinend gern – aber immerhin hatte ich damals keinen Glühwein in der Hand. Einen kurzen, verkrampften Wortwechsel später wusste ich, dass Sebastian in den Niederlanden »Internationale Beziehungen« studierte, und auch er war über meine Stelle bei »Grotjohann & Möller« informiert. Ob ich ihm von Jonas erzählt habe, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich auch damals das dringende Bedürfnis verspürt hatte, zu fliehen.
Genau wie jetzt. Und zwar, bevor mir Sebastian wieder gefährlich werden kann.
»Also, Jungs, war toll, euch beide wiedergesehen zu haben«, sage ich und kämpfe gegen einen leichten Schwindel an. Der Glühwein beginnt, mir die Sinne zu vernebeln. Höchste Zeit, das Weite zu suchen. »Trotz allem bin ich mehr als froh, euch zwei los zu sein. Frohe Weihnachten!«
Habe ich das gerade wirklich laut gesagt? Oh Gott. Bloß weg hier, bevor ich noch mehr Wahrheiten zum Besten gebe. Hastig schiebe ich mich an Sebastian vorbei und weiche beharrlich seinem Blick aus. So elegant wie möglich versuche ich, den Ausgang zu erreichen.
Mit der Eleganz ist das natürlich immer so eine Sache. Vor allem, wenn man ungewohnt viel Glühwein getrunken und ihn über seine verflossene große Liebe geschüttet hat. Tapfer kämpfe ich mich durch die feiernden Dorfbewohner und bemühe mich um einen geraden Gang, doch meine hochhackigen Stiefel machen dieses Unterfangen nicht unbedingt leichter.
Dann bemerke ich zu allem Überfluss, dass der Glühwein dringend zur Toilette gebracht werden will. Leicht schwankend erreiche ich das stille Örtchen, wo ich meine Blase erleichtere und anschließend aufgewühlt mein Spiegelbild mustere. Ausgerechnet heute laufe ich zum ersten Mal seit Jahren wieder Sebastian über den Weg. Ausgerechnet heute, mit mäßiger Frisur und – oh nein! – verschmiertem Kajal unter dem rechten Auge.
Ich zupfe eine Weile an meinem hellblonden Haar herum, das wie immer viel zu glatt und schlaff auf meine Schultern fällt. Da hilft kein Volumenshampoo dieser Welt. Als ich die Waschbär-Schminke unter meinem Auge entfernt habe, trage ich noch ein wenig Lippenstift auf und verlasse einigermaßen gefestigt die Toilette.
Kapitel 3
Ich kann den Mistelzweig im Türrahmen des Ausgangs schon sehen, als ich hinter mir diese eine Stimme höre, die mich nach wie vor im Traum verfolgt.
»Mika, warte mal.«
Ohne mich umzudrehen, sage ich entschlossen: »Lass mich in Ruhe, Sebastian.«
Seine Hand fasst nach meinem Arm. Ich schiebe sie weg, hastig, bevor ich die Wärme seiner Haut durch den Wollstoff meines weinroten Kleides spüren kann. Sie können mir schnell gefährlich werden, seine Hände, daran erinnere ich mich leider noch zu deutlich.
»Mika …«
Ich bleibe stehen und drehe mich zu Sebastian um. Er hat wohl nicht damit gerechnet, dass ich so plötzlich haltmachen würde, denn er läuft frontal in mich hinein.
»Hoppla«, sagt er mit einem leisen Lachen und weicht einen halben Schritt zurück. Aber wirklich nur einen halben. Viel zu nah bleibt er vor mir stehen und sieht mich an.
Verdammt. Das Kribbeln in meinem Bauch verheißt nichts Gutes. Ich versuche, den Duft seines Aftershaves zu ignorieren, der sich mit dem Geruch nach Glühwein mischt, den sein nasses Hemd ausdünstet.
»Sebastian«, beginne ich und hole tief Luft, bevor er irgendetwas sagt, was mich um den kümmerlichen Rest meines alkoholvernebelten Verstandes bringen kann. »Es ist nett, dich zu sehen, aber mir ist gerade nicht nach Small Talk zumute. Ich bin mir sicher, du wohnst derzeit wieder mal an irgendeinem spannenden Ort, irgendwo auf dieser Welt, von dem ich bisher noch nicht einmal gehört habe, und du würdest mir provinzieller Dorf-Drossel sicherlich gerne davon erzählen, um meinen beschränkten Dorf-Horizont zu erweitern. Aber ich möchte meinen Horizont heute gern so beschränkt halten, wie er ist. Gute Nacht, Sebastian. Und nochmals frohe Weihnachten.«
Mit diesen Worten will ich mich wieder umdrehen, doch diesmal hält er mich entschlossen am Oberarm fest, sodass ich meine Drehung auf halbem Wege abbrechen muss.
»Was soll …?«
»Halt bitte mal still, Mika«, unterbricht er mich ruhig, und bevor ich weiß, wie mir geschieht, bückt er sich und greift hinter mich. Ich spüre eine Bewegung unter meinem Kleid, als Sebastian an irgendetwas zieht.
Oh Gott! Fassungslos starre ich auf das, was er in der Hand hält: Toilettenpapier. Und zwar nicht nur ein Stück. Entgeistert folgt mein Blick der langen Schleppe aus Klopapier, die sich über den Kneipenboden schlängelt. Ich muss beim Hochziehen meiner Strumpfhose das Ende der Toilettenpapierrolle eingeklemmt haben. Beim Verlassen der Toilette habe ich das Papier anscheinend meterlang abgewickelt und hinter mir hergezogen. Und Sebastian hat das gesehen. Deshalb ist er mir gefolgt.
Wie peinlich. Wie entsetzlich peinlich! Ich schaffe es nicht, meinem Ex ins Gesicht zu sehen, während ich panisch mit den Händen über meine Rückseite fahre, um sicherzustellen, dass ich nicht auch noch mein Kleid im Bund meiner Strumpfhose eingeklemmt habe oder sonst etwas an mir hängt. Dieser verdammte Glühwein!
»Keine Sorge, jetzt ist alles wieder tipptopp«, sagt Sebastian leise.
»Ähm, wem gehört denn diese Klopapier-Girlande?«, höre ich Paul Breitkämper, den Dorfmetzger, rufen. Lachend hält er den langen Streifen Papier in die Höhe. Hoffentlich hat niemand außer Sebastian mitbekommen, dass ich den Papierstreifen hinter mir hergezogen habe!
Da fällt mein Blick auf Silikon-Diana. Sie mustert mich mit unverhohlener Belustigung, dann beugt sie sich zu den Feuerwehr-Jungs hinüber, die ihr eifrig in den Ausschnitt starren, während sie etwas sagt. Gelächter brandet auf, als alle zu mir herübersehen.
»Hey, Mika!«, ruft Lars Müller, der mich in der sechsten Klasse beim Flaschendrehen geküsst hat. »Schneiderst du dir das nächste Brautkleid aus Klopapier? Die Schleppe hast du ja schon fast fertig!«
Gelächter folgt seinen Worten, aber es gibt auch einige wütende Blicke, die in Lars’ Richtung fliegen. Unter anderem von meinem Bruder Thomas, der neben seinem Kumpel Jupp an der Wand neben der Theke gelehnt hat und nun mit geballten Fäusten zum Feuerwehr-Tisch hinübersieht.
»Ich hätte mein erstes Brautkleid aus Klopapier schneidern sollen!«, höre ich eine Stimme rufen und stelle zu meinem großen Erstaunen fest, dass es meine eigene ist. Der Alkohol lässt mich weitaus vorlauter sein als im nüchternen Zustand. Was ganz gut ist. Genug ist genug. »Das hätte schließlich wunderbar zu meinem Scheiß-Verlobten gepasst!«
Allgemeines Gegröle ist die Antwort, ich höre Kommentare wie »Stimmt, Mika!« und »Lass dir nichts gefallen, Mädchen!«. Irgendjemand ruft: »Heirate mich, du wirst es nicht bereuen!«, aber da bin ich schon auf dem Weg zum Ausgang.
»Hey, du Dorf-Drossel«, höre ich wieder Sebastians Stimme hinter mir, bevor ich es geschafft habe, die Kneipe zu verlassen.
»Was?«, frage ich irritiert und lasse meine Hand auf dem Türgriff ruhen. Ich drehe mich halb zu Sebastian um und sehe ihn an.
»Das wollte ich eigentlich dich fragen. Was um alles in der Welt ist eine Dorf-Drossel?«
Ich versuche, das Schmunzeln auf seinen Lippen zu übersehen. Es wäre wohl besser, seine Lippen ganz zu übersehen, wenn ich mir Ärger ersparen will.
»Keine Ahnung«, muss ich zugeben. »Der Ausdruck kam mir eben einfach so in den Sinn.«
»Rom«, sagt er dann.
»Was?«, frage ich erneut verdutzt und schaffe es endlich, meinen Blick von seinem Mund zu lösen. Wobei seine Augen, so nah vor meinem Gesicht, auch nicht viel ungefährlicher sind.
»Ich wohne momentan in Rom. Die Hauptstadt Italiens. Pasta, Pizza, Papst. Davon hast du sicherlich schon gehört. Trotz deines beschränkten Dorf-Horizonts. Von dem ich bisher übrigens gar nichts mitbekommen habe. Aber wir haben uns ja auch schon länger nicht gesprochen.«
»Stimmt«, erwidere ich. »Wir haben uns schon sehr lange nicht gesprochen, Sebastian. Und dabei würde ich es gern belassen, auch wenn du mich aus der Klopapier-Misere gerettet hast, wofür ich dir natürlich ewig dankbar sein werde. Das Wesentliche hast du eben ja quasi im Vorbeigehen erfahren: Mein Exverlobter hat die Frau geschwängert, mit der er mich betrogen und die er inzwischen geheiratet hat, ich verliere bald meinen Job und mache mich außerdem gern zum Gespött der Leute.«
»Hmm«, macht Sebastian und wird ernst. »Zum Gespött der Leute machst du dich gar nicht. Ich kenne niemanden, der mit einer Klopapier-Schleppe so elegant aussieht.«
»Verarschen kann ich mich allein!«, zische ich und will die Tür öffnen, doch Sebastian lehnt sich dagegen und legt mir die Hände auf die Schultern.
»Im Ernst, Mika: Wenn hier einer der Depp vom Dienst ist, dann doch wohl Jonas Kleinebecker. Wieso, um alles in der Welt, wolltest du den überhaupt heiraten? Das war einer der größten Idioten meiner Stufe.«
Ich schnaube und versuche das Gefühl von Sebastians warmen Händen auf meinen Schultern zu ignorieren. Vergeblich. Mein Herzschlag beschleunigt sich.
Und dann geschieht das Unfassbare: Aus den Lautsprechern, die eben noch »Rocking Around the Christmas Tree« in die Menge der Feiernden haben dröhnen lassen, singen ABBA plötzlich ihren 70er-Jahre-Hit »Mamma Mia«.
Ich starre Sebastian groß an. Weiß er noch …?
Natürlich tut er das. Ich erkenne es sofort an diesem Funkeln in seinem Blick. An den Lachfältchen, die sich um seine Augen bilden. Sie waren damals, mit neunzehn, noch nicht da, diese Lachfältchen. Aber, verdammt, sie stehen ihm gut. Als mir bewusst wird, dass ich Sebastian anstarre wie ein hypnotisiertes Kaninchen, wende ich peinlich berührt meinen Blick ab.
Von außen drückt jemand gegen die Eingangstür, und Sebastian macht einen Schritt zur Seite. Seine Hände gleiten von meinen Schultern, und ich finde mit Mühe in den Normalmodus zurück. Reiß dich zusammen, Mika! Du weißt genau, wohin diese Gefühle für Sebastian Hoffmann führen!
Ja, Agnetha und Anni-Frid müssen mich mit ihrem Songtext über gebrochene Herzen wirklich nicht daran erinnern, wie schlimm mein Liebeskummer damals war.
Doch bevor ich es schaffe, tatsächlich durch die Eingangstür zu gehen und meinen Exfreund stehen zu lassen, ist er wieder neben mir. Sehr dicht neben mir. Sein Arm legt sich um meine Taille. Fassungslos sehe ich Sebastian an. Großer Fehler.
»Sebastian, was …?«, stammele ich, als sein Blick zu meinem Mund wandert. Innerlich klopfe ich mir auf die Schulter, weil ich eben Lippenstift aufgetragen habe. Ich mag die Klopapier-Queen sein, aber immerhin mit weinroten Lippen, passend zum Strickkleid.
Verdammt, wieso ist mir die Farbe meiner Lippen plötzlich so wichtig? Ich sollte dringend versuchen, wieder einen klaren Gedanken zu fassen. Und Sebastian auch, denn er verhält sich ganz eindeutig nicht rational.
»Mistelzweig«, murmelt er und deutet mit einem Finger über uns. Bevor ich nach oben schauen kann, ist sein Mund schon auf meinem. Ich will protestieren, will ihn wegschieben, will sagen, dass das mit uns keinen Sinn macht. Doch ich tue nichts dergleichen. Stattdessen schlingen sich meine Arme wie von selbst um seinen Hals, als ob es gestern gewesen wäre, als sie dies zum letzten Mal getan haben. Und meine Lippen scheinen auch noch sehr vertraut zu sein mit den seinen, zumindest gibt es nicht diese unbeholfenen ersten Küsse, die man mit einem Wildfremden erlebt. Sebastian und ich küssen uns, als wären wir in den letzten zehn Jahren keinen einzigen Tag getrennt gewesen. Meine Hände fahren durch sein Haar, das noch so voll und leicht gelockt ist wie früher. Ich atme seinen vertrauten und doch irgendwie aufregend neuen Duft ein und bin wieder ein verknallter Teenager im Hormonrausch. Es fühlt sich an wie damals. Er fühlt sich an wie damals.
Sebastian hört nur ganz kurz auf, mich zu küssen, um die Eingangstür zu öffnen und mich aus der Kneipe zu schieben. Im winzigen Vorraum, wo es schon einige Grad kühler ist, taumeln wir rücklings gegen die Garderobenständer, die mit vielen Wintermänteln beladen sind. Den Geruch von nassen Wollstoffen in der Nase knutschen wir weiter, wie die verliebten Jugendlichen, die wir mal waren.
Als die Tür zum Schankraum aufgeht und zwei Männer, die ich zum Glück nicht kenne, an uns vorbeigehen, sagt einer von ihnen süffisant: »Nehmt euch ein Zimmer!« Lachend verschwinden sie mit ihren Zigarettenpackungen nach draußen. Sebastian und ich sehen uns an. Keiner muss etwas zum anderen sagen, es ist klar, dass wir einer Meinung sind: Der Mann hat recht.
Mein Herz schlägt mir bis zum Hals, während wir in dem Garderobendurcheinander unsere Jacken suchen und schließlich Hand in Hand die »Linde« verlassen. Eigentlich ist es nicht weit von der Dorfkneipe bis in die »Jungfernbrede«, wo die Gärtnerei meiner Eltern an das Grundstück von Sebastians Vater grenzt, doch heute Abend brauchen wir ziemlich lang für die Strecke. Als wir schließlich – erhitzt, trotz der Kälte – vor dem Hoffmann-Haus ankommen, starren wir auf das Licht der Stehlampe hinter den Wohnzimmergardinen. Ich weiß noch genau, wo in dem großen weißen Haus mit den dunkelgrünen Fensterläden welches Zimmer ist. In einem Großteil dieser Zimmer haben wir bereits Sex gehabt. Dieser Gedanke lässt so viel Hitze durch meinen Körper strömen, dass ich meine Arme um Sebastians Hals schlinge und ihn schon wieder küsse. Wir taumeln rückwärts und stoßen gegen ein Auto, das vor dem Grundstück der Hoffmanns geparkt steht.
»Ups«, murmele ich.
»Macht nichts, ist bloß mein Mietwagen«, erwidert Sebastian und zieht mich enger an sich. Die kleinen Atemwolken, die wir in die klirrend kalte Nachtluft entweichen lassen, verschmelzen vor unseren Gesichtern. Im Schein der Straßenlaterne sieht Sebastian aus wie damals, mit neunzehn.
»Ist dein Dad zu Hause?«, frage ich ohne große Hoffnung. Sebastians Vater geht nie zu den Vorweihnachtspartys in der »Linde«, schließlich ist er kein ursprünglicher Dorfbewohner und kann mit unseren ländlichen Traditionen nicht viel anfangen. Und er geht auch ansonsten selten aus, denn er ist Schriftsteller und somit, dem Klischee entsprechend, ein ziemlicher Eigenbrötler.
»Mhhm«, murmelt Sebastian resigniert gegen meine Lippen und schüttelt den Kopf. »Und deiner?«
»Ja, und meine Mutter leider auch«, seufze ich. »Mama wollte eigentlich in die ›Linde‹ gehen, hat aber eine Erkältung und ist mit einem Halswickel zu Hause vorm Fernseher geblieben.«
»Ich hatte mich schon gewundert, sie nicht gesehen zu haben«, bemerkt Sebastian. »Sie hat doch früher nie eine Feier in der ›Linde‹ verpasst.«
Ich nicke und versuche, gegen das aufsteigende Gefühl der Nostalgie anzukämpfen. Wie merkwürdig, dass Sebastian und ich uns jahrelang nicht gesehen haben, aber trotz allem noch so viel voneinander wissen. Als wäre es gestern gewesen, dass wir nachts in der feuchten Erde der Baumschule meiner Eltern gelegen und Dinge getan haben, die man in Baumschulen eigentlich nicht tut. Jahrelang bin ich rot geworden, wenn ich junge Tannen gesehen habe.
Doch unsere Baumschulen-Dates haben in lauen Sommernächten stattgefunden, wenn der Duft nach frisch gemähtem Gras und gegrillten Bratwürstchen in der Luft hing. Jetzt umweht uns der Geruch nach Glühwein, woran Sebastians Hemd schuld ist. Oder vielmehr ich.
»Wir könnten in meinem Auto …«, meint Sebastian und klopft hinter sich auf die Motorhaube. Ich stoße ihn mit einem verlegenen Lachen in die Seite.
»Dann fällt Thomas vor Schreck tot um, wenn er nach Hause kommt«, bemerke ich und schaue rasch über meine Schulter, um sicherzugehen, dass mein Bruder nicht bereits hinter uns auf dem schwach beleuchteten Gehweg auftaucht. Aber zum Glück scheint er noch ein wenig mit Jupp zu plaudern. Jupp ist die einzige Person auf dieser Erde, mit der Thomas mehr als drei Wörter wechselt.
»Meine Eltern sind bestimmt schon im Bett«, überlege ich laut und sehe auf meine Armbanduhr. »Wenn du auf der Treppe mucksmäuschenstill bist, schaffen wir es vielleicht nach oben, ohne dass sie dich bemerken.«