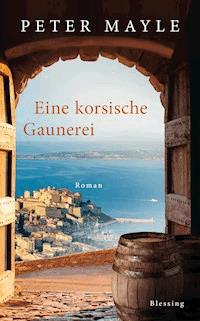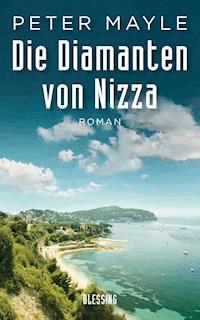8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Peter Mayle hat sich seinen großen Traum erfüllt und ist in die Provence gezogen. Doch das erste Jahr ist gar nicht einfach, und immer wieder kommt es zu Missverständnissen – nicht nur, weil man die Sprache dort einfach nicht versteht, sondern auch, weil die Lebensweise der Franzosen so merkwürdig anders als die der Briten ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Peter Mayle
Mein Jahr in der Provence
Roman
Aus dem Englischen von Gerhard Beckmann
Illustrationen von Judith Clancy
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Den Traum, den sich der britische Bestsellerautor Peter Mayle erfüllt hat, träumen viele Menschen: Er ist in den sonnigen Süden, in die Provence, gezogen. In diesem Buch beschreibt er liebevoll und mit echt britischem Humor sein erstes Jahr in der Provence: die kleinen Mißverständnisse, die sich aus den Sprachschwierigkeiten und der unterschiedlichen Lebensweise ergeben, die Liebe der Provenzalen zu einem üppigen Mahl – die der Autor bald teilt –, das Leben im Wechsel der Jahreszeiten. Ein Duft von Jasmin und Lavendel, von Olivenöl, Knoblauch und köstlichem Wein durchzieht dieses Buch und weckt im Leser die Sehnsucht, es Peter Mayle gleichzutun.
»Mein Jahr in der Provence« stand in England, Amerika und in Deutschland wochenlang ganz oben auf den Bestsellerlisten und machte seinen Autor auf einen Schlag weltberühmt.
Inhaltsübersicht
Widmung
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Eins: Die Ankunft
Zweitens: Das Eintreten
Drittens: Das rituelle Küssen
Vier: Tischmanieren
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Für Jennie,
mit Liebe und Dank
Januar
Das Jahr begann mit einem Mittagessen.
Silvester mit seinen Ausschweifungen vor Mitternacht und den vielen zum Scheitern verurteilten guten Vorsätzen war uns stets trostlos vorgekommen – besonders der Zwang zu Heiterkeit und schönen Wünschen und Küssen zum Jahreswechsel. Als wir erfuhren, daß der Eigentümer von Le Simiane im Dorf Lacoste – nur wenige Kilometer entfernt – seiner verehrten Kundschaft mittags ein Sechs-Gänge-Neujahrsessen mit Rosé-Champagner offerierte, schien uns das einen wesentlich fröhlicheren Anschub des nächsten Jahres zu verheißen.
Um halb eins war das kleine Restaurant mit den Steinwänden bereits voll. Es gab ein paar schwerwiegende Bäuche zu sehen – ganze Familien mit jener enormen Leibesfülle, die Frankreichs beliebtestem Ritual zu verdanken ist, den zwei bis drei Stunden, die Tag für Tag mit beflissentlich gesenktem Blick und aufgeschobener Unterhaltung bei Tisch verbracht werden. Der Eigentümer des Restaurants – ein Mann, der trotz seiner beachtlichen Größe die Kunst des Umherschwebens irgendwie perfekt beherrschte – trug zur Feier des Tages einen Samtsmoking mit Fliege. Sein pomadierter Schnurrbart zitterte vor Begeisterung, als er das Lob auf das Menü sang: foie gras, Hummermousse, Rindfleisch en croûte, Salate in kaltgepreßtem Öl, handverlesene Käse, traumhaft leichte Desserts, Digestifs. Was er an jedem einzelnen Tisch vortrug, war eine gastronomische Arie, bei der er ständig seine Fingerspitzen küßte und wir uns fragten, ob er nicht allmählich Blasen an den Lippen bekäme.
Das letzte »bon appétit« erstarb, und ein geselliges Schweigen ließ sich über dem Restaurant nieder, während man sich mit gebührender Aufmerksamkeit den Speisen widmete. Meine Frau und ich dachten während des Essens an frühere Silvestertage, die wir meist unter undurchdringlichem Himmel in England verbracht hatten. Wir hatten Mühe, die Sonne und den tiefblauen Himmel draußen mit dem ersten Januartag in Einklang zu bringen, aber, so wurde uns von allen Seiten bestätigt, das war völlig normal. Wir befänden uns schließlich in der Provence.
Wir waren schon vorher oft hier gewesen, als Touristen mit Hunger auf unsere Jahresration von zwei bis drei Wochen richtiger Hitze und klaren Lichts. Und wenn wir mit pellender Nase und mit Bedauern Abschied nahmen, hatten wir uns jedesmal versprochen: Eines Tages werden wir hier wohnen. Während der langen grauen Winter und der feuchten grünen Sommer hatten wir darüber diskutiert, hatten mit der Sehnsucht von Süchtigen Fotos von Dorfmärkten und Weinbergen betrachtet, davon geträumt, morgens von der Sonne geweckt zu werden, die vom Fenster her schräg ins Schlafzimmer fällt. Nun hatten wir es – zu unserer eigenen Überraschung – tatsächlich geschafft. Wir hatten uns entschieden. Wir hatten ein Haus gekauft, Französischkurse genommen, Lebewohl gesagt, unsere beiden Hunde herübergeholt und lebten nun tatsächlich im Ausland.
Eigentlich war alles ganz schnell – überstürzt beinahe – gekommen: wegen des Hauses. Wir hatten es eines Nachmittags besichtigt und waren schon am Abend innerlich eingezogen. Es stand oberhalb der Landstraße, die zwischen den beiden mittelalterlichen Bergdörfern Ménerbes und Bonnieux verläuft, am Ende eines unasphaltierten Wegs, der durch Kirschbäume und Reben führt. Es war ein Bauernhaus, ein Mas, wie die Franzosen sagen, erbaut aus dem Gestein der Gegend, das über zwei Jahrhunderte durch Wind und Sonne zu einer undefinierbaren Farbe zwischen honighell und hellgrau verwittert war. Es hatte im 18. Jahrhundert zunächst aus einem Raum bestanden und war in der planlosen Art, die für landwirtschaftliches Bauen typisch ist, erweitert worden, um Kinder, Großmütter, Ziegen und Ackergerät zu beherbergen, bis schließlich ein unregelmäßiges dreistöckiges Haus daraus geworden war. Es war durch und durch solide. Die Wendeltreppe, die vom Weinkeller bis ins oberste Geschoß führte, war aus massiven Steinplatten gehauen. Die Mauern – einige einen Meter dick – waren errichtet, um die Mistralwinde fernzuhalten, die, wie man hier sagt, einem Esel die Ohren wegblasen können. Auf der Hinterseite schloß sich ein überdachter Hof an und dahinter ein Schwimmbecken aus gebleichtem weißen Stein. Es gab dort drei Brunnen, breite, schattige Bäume und schlanke grüne Zypressen, Rosmarinhecken und einen riesigen Mandelbaum. Das Haus mit seinen halb geschlossenen Fensterläden, die wie schläfrige Augenlider aussahen, war in der Nachmittagssonne unwiderstehlich gewesen.
Es war auch, so das bei einem Haus überhaupt möglich war, immun gegen die wuchernden Greuel der Baulanderschließung. Die Franzosen haben eine Schwäche für jolies villas, die sie überall, wo die Baubestimmungen es gestatten, errichten – manchmal auch an unerlaubten Stellen, vor allem in bislang unverdorbener, schöner Landschaft. Wir hatten dieses Phänomen in der Umgebung der alten Marktstadt Apt beobachtet, in Form von Kästen aus jenem eigenartigen, schreiend rosaroten Beton, der schreiend rosarot bleibt, das Wetter mag dagegen anschleudern, was es will – sie sehen aus wie eine scheußliche Fleischwunde. Nur ganz wenige Gegenden Frankreichs sind davor sicher, sofern sie nicht offiziell unter Landschaftsschutz stehen, und ein großer Reiz unseres Hauses lag darin, daß es sich innerhalb der Grenzen eines Nationalparks duckte, der als historisches Erbe Frankreichs heilig und für Betonmixer verboten war.
Unmittelbar hinter dem Haus ragen die Berge des Lubéron bis zu einer höchsten Erhebung von fast zwölfhundert Metern auf, und sie erstrecken sich in tiefen Falten fast siebzig Kilometer von Westen nach Osten. Zedern, Kiefern und Eichengebüsch halten die Berge stets grün und bieten Wildschweinen, Kaninchen und Vögeln Deckung. Wilde Blumen, Thymian, Lavendel und Pilze wachsen zwischen den Felsen und unter Bäumen, und an einem klaren Tag ist vom Gipfel zur einen Seite ein Blick möglich auf die Basses-Alpes und zur anderen aufs Mittelmeer.
Die meiste Zeit des Jahres kann man acht oder neun Stunden lang laufen, ohne einem Auto oder einem menschlichen Wesen zu begegnen. Es sind 247 000 Morgen Naturpark, zu dem sich unser Garten erweitert, ein Paradies für unsere Hunde, eine nicht zu überwindende Barrikade gegen unerwünschte Nachbarn.
Auf dem Lande gewinnen Nachbarn, wie wir entdeckt haben, eine Bedeutung, die sie in Städten auch nicht annähernd haben. Man kann jahrelang in einer Wohnung in London oder New York leben, ohne mit den Leuten, die zwanzig Zentimeter entfernt auf der anderen Seite der Wand wohnen, je zu sprechen. Auf dem Lande mag man vom nächsten Nachbarn Hunderte von Metern entfernt sein, trotzdem ist er ein Teil des eigenen Lebens, so wie man selbst zu seinem Leben gehört.
Falls man Ausländer ist – also eine Art Exot –, wird man mit mehr als dem üblichen Interesse inspiziert. Und wenn man außerdem ein seit langem bestehendes landwirtschaftliches Arrangement übernimmt, wird einem rasch klargemacht, daß die eigenen Einstellungen und Entscheidungen einen direkten Einfluß auf das Wohlergehen einer anderen Familie haben.
Mit den neuen Nachbarn hatte uns das Ehepaar bekanntgemacht, das uns das Haus verkauft hatte, und zwar während eines fünfstündigen Abendessens, das allseits durch einen immensen guten Willen, unsererseits aber durch enorme Verständnisschwierigkeiten gekennzeichnet war. Man sprach französisch – es war aber nicht das Französisch, das wir in unseren Büchern studiert und auf den Sprachkassetten gehört hatten; es war ein reiches, suppiges patois, das von irgendwo aus dem hinteren Kehlkopf kam und durch die Nasengänge schlürfte, bevor es als Sprache ins Freie trat. Halbvertraute Laute konnten durch die Wirbel und Strudel des Provenzalischen verschwommen als Worte identifiziert werden: Demain wurde zu demang, vin wurde zu vang, Maison zu Mesong. Das allein wäre noch kein Problem gewesen, wenn die Worte im Tempo üblicher Konversation gesprochen und ohne weitere Ausschmückung geblieben wären. Sie wurden jedoch wie Kugeln aus einem Maschinengewehr abgefeuert und zum Schluß auf gut Glück oft noch mit einem zusätzlichen Vokal versehen. So kam das Angebot eines weiteren Stücks Brot – Stoff auf Seite eins für Anfänger – als ein einziges fragendes Sirren heraus. Encoredupanga?
Zu unserem Glück waren der Hunger und das freundliche Naturell unserer Nachbarn deutlich spürbar, selbst wenn das, was sie sagten, uns ein Rätsel blieb. Henriette war eine dunkelblonde, hübsche Frau mit Dauerlächeln, die wie eine Sprinterin jeden Satz in Rekordzeit hinter sich brachte. Ihr Mann Faustin – oder Faustang, wie wir seinen Namen wochenlang im Geiste buchstabiert hatten – war groß und sanft, bewegte sich bedächtig und sprach relativ langsam. Er war in diesem Tal geboren, er hatte in diesem Tal sein Leben verbracht, und er würde in diesem Tal sterben. Sein Vater, Pépé André, der gleich nebenan wohnte, hatte mit achtzig Jahren seinen letzten Eber geschossen und die Jagd aufgegeben, um Fahrradfahren zu lernen. Zweimal wöchentlich radelte er zum Einkaufen und zum Klatsch hinunter ins Dorf. Es schien eine zufriedene Familie zu sein.
Sie hatten allerdings eine Sorge, die uns betraf – nicht als Nachbarn, sondern als künftige Partner, und inmitten der Düfte von marc und im noch dichteren Nebel des Akzents kamen wir ihr schließlich auf die Spur.
Die sechs Morgen Grund, die wir mit dem Haus erworben hatten, waren größtenteils mit Reben bepflanzt und jahrelang nach dem herkömmlichen System der Métayage bewirtschaftet worden: Der Landeigentümer zahlt das Kapital für die neuen Reben und den Dünger, während der Bauer die Arbeit des Besprühens, Stutzens und Erntens übernimmt. Zum Ende der Saison erhält der Bauer zwei Drittel, der Eigentümer ein Drittel des Gewinns. Bei einem Eigentümerwechsel steht eine erneute Absprache zur Diskussion, und genau das war Faustins Sorge. Es war wohlbekannt, daß im Lubéron viele Liegenschaften als résidences secondaires für die Ferien und zum Vergnügen gekauft wurden, und der wertvolle Agrarboden wurde für kunstvoll bepflanzte Gartenanlagen zweckentfremdet. Es gab sogar Fälle der schlimmsten Form von Blasphemie – daß Reben herausgerissen worden waren, um Tennisplätzen zu weichen. Tennisplätze! Faustin zuckte ungläubig die Achseln. Schultern und Augenbrauen hoben sich einmütig beim Gedanken an die ausgefallene Idee, wertvolle Reben gegen den seltsamen Spaß zu tauschen, in der Hitze hinter einem kleinen Ball herzujagen.
Die Sorge hätte er sich sparen können. Wir liebten die Reben – die planvolle Regelmäßigkeit, mit der sie sich gegen die Hänge der Berge hoben, die Färbung von hellem zu dunklerem Grün über Gelb zu Rot, wenn Frühling zu Sommer und Sommer zu Herbst wurde, den blauen Rauch in der Stutzzeit, wenn die abgetrennten Teile verbrannt wurden, die zurückgeschnittenen Stumpen, die im Winter die nackten Felder spickten – sie gehörten hierher. Tennisplätze und Landschaftsgärten dagegen nicht. (Genausowenig wie unser Schwimmbecken, aber das hatte wenigstens keine Rebstöcke verdrängt.) Und außerdem lieferten sie uns Wein. Wir hatten die Wahl, unseren Anteil am Gewinn in bar oder in Naturalien zu erhalten; in einem durchschnittlichen Jahr betrug unser Anteil an der Ernte an die tausend Liter guten gewöhnlichen Roten und Rosé. So emphatisch, wie uns das mit unserem unsicheren Französisch möglich war, teilten wir Faustin mit, daß es uns ein Vergnügen wäre, die bestehende Abmachung weiterzuführen. Er strahlte. Ihm war klar, daß wir uns prächtig verstehen würden. Vielleicht würden wir uns eines schönen Tages sogar miteinander unterhalten können.
Der Eigentümer von Le Simiane wünschte uns ein glückliches neues Jahr und stand im Eingang, als wir in die enge Gasse hinaustraten und in die Sonne blinzelten.
»Nicht schlecht, eh?« sagte er mit einer Armbewegung – mit ihr vereinnahmte er das Dorf, hoch oben die Ruine der Burg des Marquis de Sade, die weite Aussicht zu den Bergen und den strahlen klaren Himmel. Es war eine lässige, besitzergreifende Geste, als ob er uns ein Eckchen seines Privatgrundstückes zeigte. »Man hat Glück, in der Provence zu sein.«
Durchaus, dachten wir. Das hat man. Wenn das der Winter sein sollte, so würde die ganze Schlechtwetterausrüstung – die Stiefel und Mäntel und dicken Pullover –, die wir aus England mitgebracht hatten, überflüssig sein. Wir fuhren heim, warm, wohlgenährt, schlossen Wetten ab, wann wir zum erstenmal schwimmen würden, und empfanden ein selbstzufriedenes Mitleid für die armen Seelen in rauheren Klimazonen, die richtige Winter durchmachen mußten.
Knapp zweitausend Kilometer weiter nördlich nahm unterdes der Wind, der in Sibirien eingesetzt hatte, für das letzte Stück seiner Reise Fahrt auf. Vom Mistral hatten wir so mancherlei gehört. Er macht Menschen und Tiere verrückt. Bei Gewaltverbrechen wird er als mildernder Umstand anerkannt. Er bläst oft fünfzehn Tage in einem fort, reißt Bäume aus, wirft Autos um, zerbricht Fenster, schleudert alte Damen in den Rinnstein, splittert Telegrafenmasten, heult durch Häuser wie ein kaltes und unheilvolles Gespenst, verursacht Grippe, Unfrieden im Haus, Arbeitsausfall, Zahnschmerzen, Migräne – kurzum: Alle Probleme in der Provence, die nicht den Politikern angelastet werden können, rühren vom Sâcré Vent her, von dem die Provenzalen in einer Art masochistischem Stolz sprechen.
Typisch gallische Übertreibung, dachten wir. Wenn sie mit den Stürmen fertig zu werden hätten, die vom Ärmelkanal herüberfegen und den Regen biegen, so daß er einem fast horizontal ins Gesicht schlägt, dann wüßten sie, was ein richtiger Wind ist. Wir hörten uns ihre Geschichten an und gaben uns – aus purer Höflichkeit gegenüber denen, die sie erzählten – beeindruckt.
So waren wir auf den ersten Mistral des Jahres schlecht vorbereitet, der durch das Rhônetal stürmte, nach links abbog und gegen die Westseite des Hauses toste, so stark, daß er vom Dach Ziegel ins Schwimmbecken abräumte und ein Fenster aus den Angeln riß, das leichtsinnigerweise offengestanden hatte. Die Temperatur fiel in vierundzwanzig Stunden um zwanzig Grad. Zunächst auf null, dann auf minus sechs. Messungen in Marseille zeigten eine Windgeschwindigkeit von 180 Kilometern in der Stunde. Meine Frau hatte beim Kochen einen Mantel an. Ich versuchte, mit Handschuhen auf der Maschine zu schreiben. Wir sprachen nicht mehr vom ersten Schwimmen und dachten statt dessen melancholisch an Zentralheizung. Und eines Morgens, zum Geräusch krachender Äste, platzte unter dem Druck des Wassers, das über Nacht gefroren war, ein Leitungsrohr nach dem anderen. Sie waren vom Eis blockiert und geschwollen und hingen schräg von den Wänden, und Monsieur Menicucci untersuchte sie mit dem beruflichen Scharfblick des Klempners.
»O là là«, sagte er. »O là là«. Er drehte sich nach seinem jungen Lehrling um, den er immer nur als Jeune homme oder Jeune ansprach. »Du weißt, womit wir es da zu tun haben, Jeune. Nackte Rohre. Ohne Isolierung. Côte-d'Azur-Rohre. Für Cannes, für Nizza mögen sie gut genug sein, aber hier …«
Er gab einen Gluckser der Mißbilligung von sich und wedelte Jeune mit dem Finger unter der Nase herum, um den Unterschied zwischen den milden Wintern an der Küste und der beißenden Kälte, in der wir hier standen, zu unterstreichen, und zog sich die Wollmütze fest über die Ohren. Er war klein und stämmig und zum Klempner gebaut, wie er erklärte, weil er sich in enge Räume hineinzwängen konnte, die ungehobelteren Männern gar nicht zugänglich wären. Während wir abwarteten, daß Jeune die Lötlampe aufsetzte, widmete uns Monsieur Menicucci die erste Vorlesung seiner gesammelten Pensées, denen ich dann das ganze Jahr über mit wachsendem Vergnügen zuhören sollte. An diesem Tag gab er eine geophysikalische Abhandlung über die zunehmende Härte provenzalischer Winter zum besten.
Drei Jahre schon waren die Winter spürbar härter gewesen als alle, an die man sich erinnern konnte – kalt genug, ehrlich, um uralte Olivenbäume abzutöten. Es war, um eine Wendung zu gebrauchen, die hier bei jedem Ausbleiben der Sonne auftaucht, pas normal. Aber wieso? Monsieur Menicucci ließ mir symbolische zwei Sekunden Zeit zum Nachdenken, bevor er seine Theorie explizierte und mich ab und an mit dem Finger stupste, um sicherzugehen, daß ich zuhörte.
Es sei klar, so behauptete er, daß die Winde, die die Kälte von Rußland herübertrugen, mit höherer Geschwindigkeit als früher in der Provence einträfen, also weniger Zeit brauchten, um ihr Ziel zu erreichen, und folglich weniger Zeit hätten, sich en route zu erwärmen. Und der Grund dafür – Monsieur Menicucci gestattete sich eine kurze, aber dramatische Pause – sei eine Veränderung in der Krümmung der Erdkruste. Mais oui. Irgendwo zwischen Sibirien und Ménerbes habe die Erdkrümmung sich verflacht und dem Wind somit eine direktere Südroute ermöglicht. Es war ganz und gar logisch. Leider wurde der zweite Teil dieser Vorlesung – warum die Erde flacher wird – vom Knacken eines weiteren geplatzten Leitungsrohres und meine Bildung zugunsten eines virtuosen Einsatzes der Lötlampe unterbrochen.
Die Wirkung des Wetters auf die Bewohner der Provence ist unmittelbar und offenkundig. Sie erwarten jeden Tag Sonnenschein, und ihr Wohlbefinden leidet, wenn er ausbleibt. Regen empfinden sie als persönliche Beleidigung. Sie schütteln die Köpfe und bemitleiden sich gegenseitig in den Cafés, blicken mit tiefstem Mißtrauen gen Himmel, als ob eine Heuschreckenplage drohe, und bahnen sich voller Abscheu ihren Weg durch die Pfützen auf dem Gehsteig. Wenn noch Schlimmeres als ein Regentag über sie hereinbrechen sollte – etwa ein Temperatursturz unter Null wie dieser –, so sind die Folgen erschreckend: Die Bevölkerung wird fast unsichtbar.
Da die Kälte sich bis Mitte Januar festbiß, wurde es still in den Städten und Dörfern. Die Wochenmärkte, gewöhnlich übervoll und lärmig, waren skelettartig abgemagert – reduziert auf unerschrockenes Standpersonal, das, um den Lebensunterhalt zu verdienen, sogar bereit war, Frostbeulen zu riskieren, und sich die Füße vertrat und von Flachmännern nippte. Die Kunden bewegten sich zügig, kauften, gingen, nahmen sich kaum die Zeit, das Wechselgeld nachzuzählen. In den Bars waren Türen und Fenster dicht verschlossen; man ging seinen Geschäften in beißendem Tabakqualm nach. Von dem üblichen Herumtrödeln auf den Straßen war nichts geblieben.
Unser Tal lag im Winterschlaf. Mir fehlten all die Geräusche und Laute, die den Verlauf jeden Tages fast mit der Genauigkeit einer Uhr kennzeichneten: der Morgenhusten von Faustins Hahn; das durchgedrehte Klackern – als ob Schrauben und Muttern einer Keksdose entfliehen wollten – des Citroën-Kleinlasters, mit dem mittags jeder Bauer nach Hause fährt; das hoffnungsvolle Gewehrfeuer eines Jägers auf nachmittäglicher Patrouille in den Weinbergen am Hügel gegenüber; das ferne Wimmern einer Kettensäge im Wald; das Konzert der Hofhunde in der Dämmerung. Nun herrschte Schweigen. Stundenlang lag das Tal absolut still und ausgestorben da. Wir wurden neugierig. Was machten die Menschen nur?
Faustin, das wußten wir, reiste die umliegenden Bauernhöfe ab, als Wanderschlachter, schlitzte die Kehlen und brach die Hälse von Kaninchen und Enten und Schweinen und Gänsen, damit sie zu Pasteten und Schinken und confits werden konnten. Wir meinten, das sei eine unpassende Tätigkeit für einen weichherzigen Mann, der seine Hunde verwöhnte, aber er war dabei offenbar tüchtig und fix und, wie jeder echte Landmensch, ohne sentimentale Gefühle. Wir mögen ein Kaninchen als Haustier behandeln oder für eine Gans Anhänglichkeit empfinden, aber wir waren aus der Großstadt gekommen und Supermärkte gewöhnt, wo Fleisch hygienisch jeglicher Ähnlichkeit mit lebenden Kreaturen entrückt war. Ein Schweinskotelett in Plastikfolie gibt ein sanitäres, abstraktes Bild, das aber auch gar nichts mehr mit dem warmen, verdreckten, massigen Schwein zu tun hat. Hier draußen auf dem Lande war der direkte Zusammenhang zwischen Tod und Mahlzeit nicht zu umgehen, und wir sollten für Faustins winterliche Arbeit in Zukunft oft genug Dankbarkeit empfinden.
Aber was machten die anderen? Die Erde war zugefroren, die Reben zurückgeschnitten und tot. Zum Jagen war es zu kalt. Waren alle verreist, etwa auf Urlaub? Nein, bestimmt nicht. Hier gab es keine feinen Großgrundbesitzer, die den Winter auf Skihängen verbrachten oder auf Yachten in der Karibik. Hier verbrachte man die Ferien im August daheim, wenn man sich überaß, die Siestas genoß und sich vor den langen Arbeitstagen der Weinernte ausruhte. Es war uns ein Rätsel, bis wir erkannten, wie viele Menschen hier im September und Oktober Geburtstag hatten, und damit ergab sich eine mögliche, wenngleich nicht überprüfbare Antwort: Sie waren zu Hause, um Kinder zu zeugen. In der Provence hat alles seine Saison, und die ersten beiden Monate des Jahres müssen wohl der Fortpflanzung gewidmet sein. Nachzufragen haben wir uns allerdings nie getraut.
Die kalte Witterung brachte auch Freuden, die nicht so intimer Natur waren. Abgesehen von dem Frieden und der Leere der Landschaft hat der Winter in der Provence einen ganz eigenen Geruch, der durch den Wind und die trockene, klare Luft verstärkt wird. Auf meinen Wanderungen über die Hügel war ich oft in der Lage, ein Haus zu riechen, lange bevor ich es zu erblicken vermochte, wegen des Aromas von Holzrauch aus noch unsichtbaren Kaminen. Es ist einer der ursprünglichsten Gerüche des Lebens und folglich aus den meisten Städten verschwunden, so kommunale Richtlinien und Innenausstatter offene Kamine zu überbauten Löchern oder künstlich beleuchtetem »architektonischen Beiwerk« verfremdet haben. In der Provence wird das offene Feuer noch immer praktisch genutzt – es wird drauf gekocht, man sitzt drum herum, man wärmt sich die Füße und freut sich an den Flammen. Die Feuer werden morgens in der Frühe angelegt und den ganzen Tag über am Brennen gehalten mit Krüppeleichenholz vom Lubéron oder Buche vom Fuße des Mont Ventoux. Bei Anbruch der Dämmerung bin ich auf dem Rückmarsch mit den Hunden stets stehengeblieben, um von oben aufs Tal mit dem länglichen Zickzack von Rauchbändern hinunterzublicken, die von den Höfen aufstiegen, die an der Straße nach Bonnieux verstreut liegen. Es war ein Anblick, der mich an warme Küchen und gutgewürzten Eintopf denken ließ und mich jedesmal heißhungrig machte.
Die allgemein bekannte provenzalische Küche ist Sommerkost. Melonen und Pfirsiche und Spargel, courgettes und Auberginen, Paprika und Tomaten, aïoli und Bouillabaisse und Riesensalatschüsseln mit Oliven und Sardellen und Thunfisch und hartgekochten Eiern und Scheibchen von erdigen Kartoffeln auf buntem Salatbett in glänzendem Öl, frischer Ziegenkäse – das waren die Erinnerungen gewesen, die uns jedesmal kamen und quälten, wenn wir in englischen Geschäften das Angebot schlaffer und verschrumpelter Gemüse vor uns sahen. Wir waren nie auf die Idee gekommen, daß es eine Winterküche geben könnte, die völlig anders, aber nicht weniger köstlich war.
Die Kaltwetterküche der Provence ist Landmannskost. Sie soll auf den Rippen ansetzen, warmhalten, Kraft geben und einen mit vollem Bauch zu Bett schicken. Sie ist nicht schick und schön in dem Sinn, wie die winzigen, künstlerisch garnierten Portionen schön schick sind, die in modischen Restaurants serviert werden. Doch an einem frostkalten Abend, wenn der Mistral wie ein Rasiermesser auf einen zukommt, ist sie unüberbietbar. Und an dem Abend, als unsere Nachbarn uns zum Essen einluden, war es so kalt, daß wir den kurzen Weg zu ihrem Haus im Laufschritt zurücklegten.
Wir kamen durch die Tür, und meine Brille beschlug sich mit der Hitze vom Kamin, der den größten Teil der Wand am anderen Ende des Raums beanspruchte. Als der Nebel sich klärte, sah ich den großen Tisch, der mit kariertem Öltuch überzogen und für zehn Personen gedeckt war. Freunde und Verwandte wollten uns unter die Lupe nehmen. In der Ecke zwitscherte ein Fernseher. In der Küche schnatterte das Radio. Hunde und Katzen wurden aus dem Zimmer gescheucht, wenn ein Gast eintrat, nur um sich mit dem nächsten Gast wieder einzuschleichen. Ein Tablett mit Getränken wurde hereingetragen – Pastis für die Männer, gekühlter süßer Muskatwein für die Frauen. Wir gerieten mitten in ein Kreuzfeuer von lautstarken Klagen über das Wetter. War das in England genauso schlimm? Nur im Sommer, erwiderte ich. Einen Augenblick lang nahm man das ernst, bevor mir jemand aus der Verlegenheit half, indem er lachte. Mit einem ziemlichen Gerangel um Plätze – ich war mir nicht sicher, worum es dabei ging: so nah oder so weit weg von uns wie möglich – nahmen wir am Tisch Platz.
Es war ein Mahl, das wir nie vergessen werden. Genauer gesagt: Es waren mehrere Mahlzeiten, die wir nie vergessen werden; denn sie überstiegen qualitativ wie quantitativ alle bekannten gastronomischen Grenzen.
Mit hausgemachter Pizza fing es an – nein, nicht mit einer, sondern mit dreien: mit Sardellen, mit Pilzen, mit Käse, und von jeder mußten wir ein Stück nehmen. Die Teller wurden anschließend abgewischt mit Stücken, die man von dreiviertelmeterlangen Broten herunterriß. Der nächste Gang wurde hereingetragen. Es gab Kaninchen-, Wildschwein- und Drosselpasteten. Es gab eine Schweinsterrine mit größeren Stücken, die von marc durchzogen war. Es gab saucissons mit Pfefferkörnern. Es gab winzige süße Zwiebeln in einer Marinade von frischer Tomatensoße. Und wieder wurden die Teller gewischt. Danach gab es Ente. Die Scheibchen von magret, die in Fächerformation und mit einem eleganten Klecks Soße auf den noblen Tischen der Nouvelle Cuisine auftauchen – sie waren hier nirgends zu sehen. Wir hatten ganze Entenbrust, ganze Beine in einer dunklen, stark gewürzten Soße mit wilden Pilzen.
Wir lehnten uns zurück. Wir waren dankbar, daß wir es geschafft hatten, bis zum Ende durchzuhalten. Und wir sahen mit einem Gefühl fast wie Panik, daß die Teller noch einmal blankgerieben wurden und eine riesige, dampfende Casserole auf den Tisch kam: eine Spezialität von Madame, unserer Gastgeberin – ein civet von Kaninchen, das reichste, dunkelste Fleisch –, und unsere schwachen Bitten um kleine Portionen wurden lächelnd ignoriert. Wir aßen. Wir aßen den grünen Salat mit Stückchen von Brot, das in Knoblauch und Olivenöl gebraten war. Wir aßen die fetten, runden crottins von Ziegenkäse. Wir aßen den Mandelcremekuchen, den die Tochter des Hauses gebacken hatte. Wir aßen an diesem Abend für die Ehre Englands.
Zum Kaffee wurde eine ganze Reihe unförmiger Flaschen aufgetragen – eine Auswahl lokaler digestifs. Das Herz wäre mir gesunken, wenn noch Platz gewesen wäre, wohin es hätte sinken können, doch gegen die Hartnäckigkeit des Gastgebers war nichts zu machen. Ich mußte eine ganz besondere Tinktur probieren, die nach einem Rezept eines dem Alkohol ergebenen Mönchsordens in den Basses-Alpes aus dem elften Jahrhundert hergestellt war. Ich wurde gebeten, die Augen zu schließen, während eingeschenkt wurde, und als ich sie öffnete, stand vor mir ein großes Glas mit einer faserigen gelben Flüssigkeit. Ich sah mich voller Verzweiflung am Tisch um. Alle Augen ruhten auf mir; es gab keine Chance, das Zeug dem Hund zu geben oder es direkt in den Schuh tröpfeln zu lassen. Mit einer Hand suchte ich am Tisch Halt, mit der anderen griff ich nach dem Glas, machte die Augen zu, betete zum Schutzpatron der Verstopften und kippte es hinunter.
Nichts. Ich hatte im günstigsten Fall mit einer verbrannten Zunge, schlimmstenfalls mit abgetöteten Geschmacksnerven gerechnet, doch ich kriegte nichts als – Luft. Es war ein Trickglas, und es war in meinem Leben das erste Mal, daß ich Erleichterung empfand, keinen Drink zu bekommen. Als das Lachen der übrigen Gäste erstarb, wurden uns echte Drinks angedroht. Gerettet hat uns die Katze. Von ihrem Hauptquartier auf einem riesigen Wandschrank tat sie im Flug einen Sprung nach einer Motte und machte inmitten der Kaffeetassen und Flaschen auf dem Tisch eine Bruchlandung. Es schien der geeignete Moment, sich zu verabschieden. Wir schoben auf dem Heimweg unsere Bäuche vor uns her, ohne die Kälte zu spüren, waren unfähig zu sprechen und schliefen wie die Toten.
Selbst für provenzalische Maßstäbe war das kein alltägliches Mahl gewesen. Die Menschen, die auf dem Lande arbeiten, essen wahrscheinlich eher gut zu Mittag und abends sparsamer – eine Gewohnheit, die gesund und vernünftig und für unsereins völlig unmöglich ist. Wir haben entdeckt, daß uns für den Abend nichts so viel Appetit macht wie ein richtiges Mittagessen. Es ist geradezu alarmierend. Es muß mit der neuen Situation zu tun haben, damit, daß wir inmitten all dieser guten Sachen leben, unter Männern und Frauen, deren Interesse für Nahrung an Besessenheit grenzt. So genügt es etwa den Fleischern hier nicht, bloß Fleisch zu verkaufen. Sie werden Ihnen, während sich hinter Ihrem Rücken eine Schlange bildet, in aller Ausführlichkeit erzählen, wie Sie es kochen und servieren müssen und was man dazu ißt und trinkt.
Es passierte uns das erste Mal, als wir nach Apt gefahren waren, um für ein provenzalisches Eintopfgericht namens pebronata Kalbfleisch zu kaufen. Man empfahl uns einen Fleischer in der Altstadt, der ein wahrer Meister des Fachs und überhaupt très sérieux sein sollte. Sein Laden war klein. Seine Frau und er waren groß. Zu viert waren wir ein Gedränge. Er hörte konzentriert zu, als wir erklärten, daß wir dieses besondere Gericht zubereiten wollten – vielleicht hatte er von diesem Gericht schon gehört?
Er schnaufte entrüstet und begann so energisch ein großes Messer zu wetzen, daß wir einen Schritt zurücktraten. Ob uns klar sei, sagte er, daß wir einen Experten vor uns sähen, vielleicht die größte pebronata-Autorität im Vaucluse? Seine Frau nickte bewundernd. Also, sagte er und schwang fünfundzwanzig Zentimeter scharfen Stahls gegen unsere Gesichter, er habe ein Buch darüber geschrieben – ein definitives Buch –, das zwanzig Variationen des Grundrezeptes enthielte. Seine Frau nickte erneut. Sie spielte neben diesem eminenten Chirurgen die Rolle der Operationsschwester, die vor der Operation frische Messer zum Schärfen reicht.
Wir müssen angemessen beeindruckt dreingeschaut haben, weil er dann ein anständiges Stück Kalbfleisch produzierte und einen professoralen Ton anschlug. Er schnitt das Fleisch, zerlegte es in Würfel, füllte ein Beutelchen mit zerhackten Kräutern, erklärte uns, wo wir den besten Paprika kaufen könnten – vier grüne und einen roten, der Farbkontrast hätte ästhetische Gründe –, ging das Rezept zweimal durch, um sicherzustellen, daß wir keinerlei bêtise begehen würden, und empfahl dazu einen passenden Côtes du Rhône. Es war eine gelungene Vorstellung.
Gourmets sind in der Provence dicht gesät, und gelegentlich kommen aus den unwahrscheinlichsten Ecken Perlen der Weisheit ans Licht. Wir gewöhnten uns daran, daß die Franzosen fürs Essen die gleiche Leidenschaft aufbringen wie andere Nationen für Sport oder Politik, doch trotzdem waren wir überrascht, als wir Monsieur Bagnols, den Bodenreiniger, Drei-Sterne-Restaurants begutachten hörten. Er war von Nîmes herübergekommen, um den Fußboden abzureiben, und es war von Anfang an klar, daß er nicht zu den Menschen zählte, die ihren Bauch auf die leichte Schulter nehmen. Jeden Tag pünktlich um zwölf wechselte er aus der Arbeitskluft in einen Anzug und begab sich für die nächsten zwei Stunden in eins der umliegenden Restaurants.
Er fand es nicht schlecht, aber natürlich nichts im Vergleich zum Beaumanière in Les Baux. Das Beaumanière hat drei Sterne im Michelin und im Gault-Millau 17 von 20 möglichen Punkten, und dort, so erzählte er, habe er einen wahrhaft außergewöhnlichen Seebarsch en croûte gegessen. Wohlgemerkt, sagte er, auch das Troisgros in Roanne sei ein vorzügliches Lokal, obwohl es natürlich von der Lage her, gegenüber dem Bahnhof, nicht so schön sei wie das in Les Baux. Das Troisgros hat drei Sterne im Michelin und ist im Gault-Millau mit 19 1/2 von 20 Punkten klassifiziert. Und so ging das fort, während er sich die Knieschoner zurechtrückte und den Boden abscheuerte – ein persönlicher Wegweiser zu fünf oder sechs der teuersten Restaurants in Frankreich, die Monsieur Bagnols auf seinen jährlichen Schlemmerreisen besucht hatte.
Einmal war er in England gewesen, wo er in einem Hotel in Liverpool Lammbraten gegessen hatte. Der war grau und lauwarm und ohne Geschmack gewesen. Aber, sagte er, es ist ja bekannt, daß die Engländer ihr Lamm zweimal töten; einmal beim Schlachten und das zweite Mal beim Kochen. Angesichts solch niederschmetternder Verachtung für die Kochkünste meines Landes zog ich mich zurück und überließ ihn seiner Arbeit am Boden und dem Traum von seinem nächsten Besuch bei Bocuse.
Die Witterung blieb hart, mit bitterkalten, doch herrlichen Sternennächten und spektakulären Sonnenaufgängen. Eines Morgens früh kam mir die Sonne abnorm niedrig und groß vor, und als ich ihr entgegenschritt, war alles grell oder aber in tiefstem Schatten. Die Hunde waren mir ein gutes Stück voraus, und ich hörte ihr Bellen, lang bevor ich sehen konnte, was sie gefunden hatten.
Wir hatten einen Teil des Waldes erreicht, wo das Land zu einer tiefen Mulde abfiel, in der vor hundert Jahren irgendein irrgeleiteter Bauer ein Haus gebaut hatte, das eigentlich immer nur in dem Schatten stand, den die umstehenden Bäume warfen. Ich war schon oft daran vorbeigekommen. Die Fensterläden waren stets geschlossen, und das einzige Zeichen einer Bewohnung war der Rauch, der aus dem Schornstein in die Höhe kräuselte. Im Hof draußen waren zwei große und verfilzte Schäferhunde und eine schwarze Promenadenmischung ständig auf der Lauer, jaulten und zerrten an den Ketten in ihrem Bemühen, vorübergehende Menschen anzufallen. Man wußte, daß diese Hunde bösartig waren; einmal hatte sich einer von ihnen losgerissen und Großvater Andrés Beinen eine offene Wunde zugefügt. Meine Hunde, so tapfer sie ängstlichen Katzen gegenüber sein mochten, hatten klug und weise beschlossen, diesen drei feindlichen Gebissen nicht zu nahe zu kommen, und sich angewöhnt, einen Bogen ums Haus zu machen und über einen kleinen Steilhang auszuweichen. Dort oben standen und bellten sie nun auf die nervöse Tour, die Hunde annehmen, wenn sie auf vertrautem Grund Unerwartetem begegnen.
Auf der Hügelkuppe strahlte mir die Sonne voll ins Gesicht. Ich konnte jedoch unter den Bäumen die Silhouette einer Männergestalt ausmachen, einen hellen Schein von Rauch um seinen Kopf, die Hunde, die ihn aus sicherer Entfernung unruhig umschnüffelten. Als ich zu ihm herantrat, streckte er mir eine kalte Hornhand entgegen.
»Bonjour.« Er schraubte sich einen Zigarettenstummel aus der Ecke des Mundes und stellte sich vor. »Massot, Antoine.«
Er trug Kriegsausrüstung: eine fleckige Tarnjacke, ein militärisches Dschungelkäppi, einen Patronengurt und eine Schrotflinte. Sein Gesicht hatte die Farbe und Textur eines flüchtig gebratenen Steaks, mit einem keilförmigen Nasenvorsprung über einem unregelmäßigen, nikotingefärbten Schnauzer. Blaßblaue Augen lugten durch ein wild sprießendes Gewirr rötlicher Augenbrauen, und sein zerfallenes Lächeln hätte selbst einen optimistischen Zahnarzt zur Verzweiflung gebracht. Trotzdem, er hatte irgendwas verrückt Liebenswürdiges an sich.
Ich fragte, ob er bei der Jagd Erfolg gehabt hätte. »Ein Fuchs«, sagte er. »Zum Essen war er aber zu alt.« Er zuckte die Achseln und steckte sich schon wieder eine von diesen Boyards an, Zigaretten mit gelbem Maispapier, die wie ein junges Gestrüppfeuer in der Morgenluft stanken. »Immerhin«, sagte er. »Er wird mir nachts die Hunde nicht mehr wachhalten«, und er nickte in Richtung des Hauses unten in der Mulde.
Ich sagte, daß seine Hunde gefährlich wirkten, und er grinste. Nur verspielt, sagte er. Und was sei gewesen, als einer ausgerissen war und den alten Mann anfiel? Ach, das. Bei der schmerzlichen Erinnerung schüttelte er den Kopf. Das Problem sei, meinte er – man dürfe einem spielenden Hund nie den Rücken zukehren, und den Fehler hatte der alte Mann gemacht. Une vraie catastrophe. Einen Augenblick lang nahm ich an, er bedauere die Wunde, die Großvater André zugefügt worden war; in seinem Bein war eine Vene durchgebissen worden, und wegen der Spritzen und des Nähens hatte er das Krankenhaus aufsuchen müssen. Doch da irrte ich mich sehr. Das Traurige lag für Massot darin, daß er gezwungen gewesen war, sich eine neue Kette zu kaufen, und diese Räuber in Cavaillon hatten ihm 250 Francs abgeknöpft. Das war tiefer gegangen als Hundezähne.
Um ihm weitere Qualen zu ersparen, wechselte ich das Thema und fragte, ob er tatsächlich Fuchsfleisch äße. Er schien über so eine dumme Frage erstaunt und betrachtete mich ein oder zwei Augenblicke lang, ohne zu antworten, als ob er den Verdacht hegte, ich könnte ihn zum Narren halten.
»Man ißt in England keinen Fuchs?« Ich sah die Mitglieder der Belvoir Hunt vor mir und ihre Leserbriefe in der Times und ihren kollektiven Herzkollaps angesichts einer so unfairen, typisch ausländischen Idee.
»Nein, in England ißt man Füchse nicht. Man putzt sich mit einem roten Jackett heraus und jagt ihn hoch zu Roß, mit mehreren Hunden, und dann schneidet man ihm den Schwanz ab.«
Er hob keck erstaunt den Kopf. »Ils sont bizarres, les anglais.« Und dann, mit riesigem Aplomb und einigen gräßlich eindeutigen Gesten, beschrieb er, was zivilisierte Menschen mit einem Fuchs machen.
Civet de Renard à la Façon Massot
Spüre einen jungen Fuchs auf und gib acht, ihm sauber in den Kopf zu schießen, der kulinarisch uninteressant ist. Schrotsplitter in den eßbaren Teilen des Fuchses kann ein Splittern der Zähne – Massot zeigte mir zwei seiner Zähne – und Verdauungsbeschwerden verursachen.
Häute den Fuchs und schneide seine parties ab. Hier machte Massot eine Schneidbewegung mit der Hand quer über die Leistengegend, dann drehte und zerrte er kompliziert mit der Hand, um das Ausweiden des Tieres anschaulich zu zeigen.
Den gesäuberten Tierkörper vierundzwanzig Stunden lang unter kaltfließendem Wasser lassen, um den goût sauvage zu beseitigen. Trocknen, in einem Sack bündeln und über Nacht im Freien hängen lassen, am besten bei Frost.
Den Fuchs am Morgen danach in eine gußeiserne Casserole legen und mit einer Mischung aus Blut und Rotwein bedecken. Kräuter, Zwiebel und Knoblauchzehen dazugeben und ein bis zwei Tage köcheln lassen. (Massot entschuldigte sich für die ungenauen Angaben, sagte aber, daß die Zeit je nach Gewicht und Alter des Fuchses schwanke.)
In der guten alten Zeit aß man ihn dann mit Brot und Salzkartoffeln, doch dank dem Fortschritt und der Erfindung der Friteuse könne man sich das Ganze heutzutage auch mit Pommes frites munden lassen.
Inzwischen war Massot gesprächig geworden. Er lebe, so erzählte er mir, allein und habe im Winter selten Gesellschaft. Er habe sein ganzes Leben in den Bergen verbracht, aber vielleicht sei es an der Zeit, ins Dorf zu ziehen, wo er unter Menschen sein könnte. Natürlich, es wäre eine Schande, ein so schönes, so ruhig gelegenes Haus zu verlassen, das so ideal vor dem Mistral geschützt war, in so vollkommener Lage, um Schutz vor der heißen Mittagssonne zu bieten, ein Haus, in dem er so viele glückliche Jahre gelebt hatte. Es würde ihm das Herz brechen – er sah mich scharf an, aus blassen Augen, die vor Aufrichtigkeit wäßrig waren –, außer er könnte mir einen Dienst erweisen und einem meiner Freunde ermöglichen, das Haus zu erwerben.
Ich blickte auf das baufällige Anwesen in den Schatten hinab, wo die drei Hunde an ihren rostenden Ketten ruhelos hin und her liefen, und dachte, daß sich in ganz Frankreich schwerlich ein weniger reizvoller Wohnsitz aufspüren ließe. Da gab es weder Sonne noch Aussicht, kein Gefühl der Weite und sicherlich ein feuchtes und mieses Inneres. Ich versprach Massot, ich würde dran denken, und er zwinkerte mir zu. »Eine Million Francs«, sagte er. »Ein Geschenk.« Und in der Zwischenzeit, bis er diesen kleinen Paradiesflecken verließe, würde er mir mit seinem Rat gern zur Verfügung stehen, falls ich irgend etwas über das Leben auf dem Lande wissen wolle. Er kenne jeden Zentimeter dieses Waldes, wisse ganz genau, wo die Pilze wüchsen, wo der wilde Eber zur Tränke kam, welche Flinte die richtige sei, wie man einen Jagdhund ausbilde – es gäbe nichts, was er nicht wüßte, ich brauche ihn nur zu fragen. Ich dankte ihm. »C’est normal«, sagte er und stapfte hügelabwärts zu seiner Eine-Million-Residenz.
Als ich einem Freund im Dorf erzählte, ich sei Massot begegnet, lächelte er.
»Hat er Ihnen gesagt, wie man einen Fuchs zubereitet?« wollte er wissen.
Ich nickte.
»Hat er versucht, Ihnen sein Haus zu verkaufen?«
Ich nickte.
»Der alte blagueur. So ein Windmacher.«
Mir machte das nichts. Ich mochte ihn, und ich hatte das Gefühl, daß er eine reiche Quelle faszinierender und höchst suspekter Informationen sein würde. Wenn er mich in die Freuden ländlicher Lebensweise und Monsieur Menicucci mich in die mehr wissenschaftlichen Dinge einführen würde, so fehlte mir nur noch jemand, der mich durch die trüben Gewässer der französischen Bürokratie steuerte, die mit ihren vielseitigen Subtilitäten und Unannehmlichkeiten aus einem Maulwurfshügel einen Berg von Frustrationen machen kann.
Die Komplikationen beim Kauf des Hauses hätten uns eine Lehre sein sollen. Wir wollten kaufen, der Eigentümer wollte verkaufen, der Preis war vereinbart, alles war klar. Dann aber wurden wir zu zögerlichen Teilnehmern am Nationalsport des Sammelns von Dokumenten. Da wurden Geburtsurkunden erforderlich, um zu beweisen, daß wir existierten; Reisepässe, um nachzuweisen, daß wir Briten waren; Heiratsurkunden, um zu ermöglichen, das Haus auf unser beider Namen einzutragen; Scheidungsurkunden für eine frühere Ehe, um nachzuweisen, daß unsere Heiratsurkunden gültig waren; ein Nachweis, daß wir in England eine feste Adresse hatten. (Unsere Führerscheine, die klar aussagten, wo wir wohnten, wurden für unzureichend erklärt; ob wir keinen offizielleren Nachweis unseres Wohnsitzes besäßen – etwa eine alte Elektrizitätsrechnung?) Hin und her zwischen England und Frankreich gingen Berge von Papier – jeder nur denkbare Wisch von Information bis auf Blutgruppe und Fingerabdrücke –, ehe der Notar unser beider Leben in einem Dossier gesammelt hatte. Dann erst konnte die Transaktion über die Bühne gehen.
Wir suchten nach Entschuldigungen für die Franzosen, bemühten uns um Verständnis: Wir waren schließlich Ausländer, die ein Zipfelchen von Frankreich käuflich erwarben, und die nationale Sicherheit mußte natürlich gewährleistet sein. Weniger wichtige Geschäfte würden bestimmt rascher abgewickelt werden und nicht so viel Papierkram erfordern. Wir gingen ein Auto kaufen.
Es war die Standardausführung eines Citroën Deux Chevaux, ein Modell, das sich in den vergangenen 25 Jahren kaum verändert hat. Infolgedessen waren in jedem kleinen Dorf Ersatzteile zu bekommen. Die Mechanik ist kaum komplizierter als bei einer Nähmaschine, und jeder Hufschmied, der sich auf sein Handwerk versteht, kann es reparieren. Er ist billig und hat eine beruhigend niedrige Höchstgeschwindigkeit. Abgesehen von der Tatsache, daß seine Federung aus Pudding ist, wodurch der Citroën das einzige Auto der Welt ist, das einen mit ziemlicher Sicherheit seekrank macht, handelt es sich um ein liebenswürdiges und praktisches Gefährt. Und die Garage hatte eins auf Lager.
Der Verkäufer schaute sich unsere Führerscheine an, die in allen EG