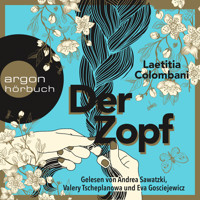Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Salis Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Im Jahr 1800 entdeckt der Novize Georg Inderbitzin im Hospiz auf dem Großen Sankt Bernhard einen verstoßenen Bernhardinerwelpen und rettet ihm das Leben. Unter widrigen Umständen wachsen Hund und Novize heran und werden untrennbare Freunde, der Bernhardiner wird schnell zum Lebensretter verschütteter Berggänger. In »Mein Leben mit Barry« lesen wir die ganze Lebensgeschichte des legendären Bernhardinerhundes und ebenso diejenige des Novizen Georg Inderbitzin, die untrennbar mit Barry zusammenhängt. Und selbst wenn dies nicht die wahre Geschichte ist, wenn diese Tagebücher von Georg Inderbitzin doch nicht existiert haben, wie der anonyme Autor in der Einleitung erklärt, so ist Barrys Leben hier fesselnd und glaubwürdig beschrieben. Der Mythos des Barry ging um die Welt und fand Eingang in den Kanon der Schweizer Legenden, wie auch Heidi oder Wilhelm Tell. Doch Barry hat es wirklich gegeben, er hat von 1800 bis 1814 gelebt und bis 1812 über 40 Menschen das Leben gerettet. Es gibt Barry-Ausstellungen, zahlreiche Bücher, Filme und TV-Serien. Aber nur hier findet sich die vielleicht wahre Geschichte über Barry. Und ganz sicher ein spannender, rührender Roman über einen heldenhaften Hund. Urteilen Sie selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein Leben mit Barry
Die Geschichte eines heldenhaften Bernhardiners
Georg Inderbitzin
Inhalt
Einleitung
Mein Leben mit Barry
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Epilog
ZUM AUTOR
Einleitung
Vor vielen Jahren, während der Recherchen zu einem historischen Thema, von dem ich hoffte, es in meiner Dissertation verwenden oder vielleicht als Buch veröffentlichen zu können, zog ich mich oft in die Schweizer Berge zurück, um ungestört arbeiten zu können. Am liebsten mietete ich mich in kleinen Pensionen ein, die sich an jenen unspektakulären Orten befanden, an die mich meine Forschung führte. Ich blieb jeweils für ein paar Tage, manchmal auch für eine Woche. Ich reiste mit dem Zug an und hatte stets einen Koffer voller Bücher dabei, die ich nach und nach durchackern wollte. Jeden Tag machte ich mindestens einen Spaziergang, um die Umgebung zu erkundschaften, in der sich die Ereignisse, mit denen ich mich beschäftigte, zugetragen hatten. Hin und wieder unternahm ich auch eine längere Wanderung. Dies hatte den angenehmen Nebeneffekt, dass ich verschiedene Gegenden der Schweiz besser kennenlernte.
So führte mich meine Arbeit auch in ein kleines, altes Gasthaus auf der Walliser Seite des Großen Sankt Bernhard. Es lag etwas abseits der Passstraße, die Gastleute waren freundlich, das Zimmer war einfach, ein Bett, ein Tisch, ein Schrank. Vom Fenster aus sah ich ins Tal hinunter. Es gefiel mir so gut, dass ich meinen Aufenthalt immer wieder verlängerte, obwohl meine Recherchen vor Ort bald abgeschlossen waren.
Im unteren Stock befand sich die Gaststube, die nicht mehr in Betrieb war. Dort saß ich oft an einem der beiden großen Tische, blätterte in alten Büchern, füllte handschriftlich meine Notizbücher oder tippte meine Erkenntnisse in den Laptop. Ich habe selten an einem Ort so gut arbeiten können wie in diesem alten Haus. Mit der Zeit lernte ich die Gastleute, ein älteres Ehepaar mit einer etwa dreißigjährigen Tochter, besser kennen und wurde fast so etwas wie ein temporäres Familienmitglied. Wir unterhielten uns in einer Mischung aus Französisch, Deutsch und Dialekt. Bald nahmen wir nicht nur das Frühstück, sondern auch das Abendessen gemeinsam in der gemütlichen Stube ein. Oft blieb ich danach mit der Tochter noch sitzen, wir tranken Wein und redeten. Sie hatte die enge Heimat als junge Frau verlassen und viele Jahre im Ausland verbracht. In Brasilien habe sie gelebt, sagte sie eines Abends, erzählte dann aber nicht weiter. Vor zwei Jahren war sie zurückgekehrt. Seither half sie den Eltern in der Pension. Doch der Betrieb lief mehr schlecht als recht, weil das Haus abseits der großen Verkehrswege lag. Es war vor sehr langer Zeit in der Nähe des alten Säumerpfades errichtet worden. Seit 1905 die Straße gebaut worden war, kamen hier nicht mehr viele Leute vorbei. Die Eltern lebten von ihrer Rente und betrieben die Pension mehr aus sentimentalen denn aus finanziellen Gründen weiter.
An einem dieser Abende, als wir wieder zu zweit am Stubentisch saßen, sagte die Tochter zu mir: »Du schreibst doch und interessierst dich für alte Geschichten. Ich glaube, ich hätte da etwas für dich.«
Ich seufzte innerlich. Vielleicht hatte ich sie beeindrucken wollen, als ich ihr sagte, dass ich ein Buch schreibe. Eine wissenschaftliche Arbeit, das klingt halt so trocken. Gibt man sich jedoch als einer zu erkennen, der Geschichten aufzeichnet, ist es unvermeidlich, dass einem, vor allem wenn getrunken wird, früher oder später jemand vertraulich näher rückt und sagt: »Weißt du was? Meine Geschichte müsste man niederschreiben! Was ich alles erlebt habe, das glaubt kein Mensch!«
Meistens glaubt man es jedoch nur zu gern, handelt es sich doch um nichts anderes als um Banalitäten, Unglücksfälle und verpasste Gelegenheiten. Je nachdem geht es auch um den Vater oder den Großvater, über den man ein Buch schreiben sollte. Nun sind darunter zweifellos auch spannende und volkshistorisch wertvolle Geschichten, aber ich war mit meinem Projekt beschäftigt. Je tiefer ich in das Material eintauchte, desto überzeugter wurde ich, dass ich das Thema meiner Doktorarbeit gefunden hatte.
Doch da die Gastleute so nett zu mir gewesen waren und ich die Tochter besonders lieb gewonnen hatte, täuschte ich Interesse vor.
»Ich habe etwas gefunden«, sagte sie. »Ich habe begonnen, den Dachboden aufzuräumen. Dort bin ich auf alte Koffer und Kisten gestoßen, die über die Jahre in diesem Haus zurückgelassen wurden.« Ihr Blick schweifte durch die Stube. »Ich spiele mit dem Gedanken, einen Teil dieser Gepäckstücke und der Dinge, die ich darin gefunden habe, im Haus auszustellen, so eine Art Museumshotel zu machen. Das ist doch heute wieder gefragt, so Gegenstände, die eine Geschichte erzählen. In einer dieser Kisten habe ich eine Bibel gefunden und ein paar lederbezogene Kladden, die mit von Hand vollgeschriebenen Papierbögen gefüllt sind. Ich kann zwar die alte Schrift nicht lesen«, sagte sie, »doch ein paar Daten konnte ich entziffern. Es handelt sich um Aufzeichnungen aus dem 19. Jahrhundert. Wahrscheinlich hat sie ein Reisender hier zurückgelassen oder zur Aufbewahrung gegeben. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, die Sachen wegzuwerfen. Als ich dich heute so dasitzen und schreiben sah, sind mir die Papiere wieder in den Sinn gekommen. Willst du sie dir einmal anschauen?«
»Ja, gerne«, sagte ich, um die schöne Gastwirtstochter nicht zu enttäuschen.
»Ich bin sehr gespannt, wovon diese Aufzeichnungen handeln«, sagte sie mir leise ins Ohr, als wir uns wenig später auf dem dunklen Dachboden über die Truhe beugten. Mir schien, dass sie sich enger an mich drückte, als nötig gewesen wäre. Vielleicht wäre das die Gelegenheit gewesen, auf die ich insgeheim gewartet hatte. Ich ließ sie verstreichen.
Stattdessen neigte ich mich über den Inhalt der Kiste und nahm die Kladden mit hinunter in mein Zimmer.
Natürlich hätte ich einfach einen Tag lang stirnrunzelnd auf die Handschriften starren und schließlich verkünden können, es handle sich um völlig uninteressante Aufzeichnungen, irgendwelche Handelsdokumente oder etwas in der Art.
Weil es mich jedoch interessierte, was darin stand, begann ich mühsam, die Schrift zu entziffern. Die Aufzeichnungen waren in einer alten deutschen Handschrift verfasst. Zwar konnte ich diese Schrift lesen, doch ich kam zu Beginn nur sehr langsam voran. Die Papiere waren teilweise in einem schlechten Zustand, es dauerte eine Weile, bis die Fragmente und Abschnitte einen Sinn ergaben. Doch nach und nach ging es flüssiger und ich kam in die Geschichte hinein.
Als ich am dritten Tag nach dem Fund nicht zum Frühstück erschien, klopfte die Tochter an meine Zimmertür und fragte besorgt, ob es mir nicht gut gehe. Ich konnte sie beruhigen. Ich hatte einfach die Zeit vergessen und die ganze Nacht gelesen. Erst in den frühen Morgenstunden war ich eingeschlafen.
Was ich in den Papieren entdeckt hatte, war die Geschichte einer Ikone, eines Wahrzeichens der Schweiz. Eine Geschichte, die man auf der ganzen Welt kennt, in unzähligen Variationen. Ich war infiziert und bat sie, die Kladden ausleihen zu dürfen. Sie vertraute sie mir an, unter der Bedingung, dass ich sie zurückbrächte, wenn ich sie nicht mehr bräuchte.
Ich versprach es.
»Du kommst auch ganz bestimmt wieder?«, fragte sie zum Abschied und küsste mich. Ich verließ das Haus ein wenig verwirrt, doch ich hatte keine Zeit für solche Dinge.
Zu Hause begann ich, die Papiere zu transkribieren. Sie waren offenbar nicht immer trocken gelagert worden, an einigen Stellen war die Tinte zerlaufen oder ausgewaschen. Es fehlten auch Teile der Erzählung, entweder waren sie im Laufe der Zeit verloren gegangen oder sie lagerten an irgendeinem anderen Ort.
Meine eigene Arbeit vernachlässigte ich, meine Dissertation verschob ich. Stattdessen machte ich es mir zur Aufgabe, die oft verworrenen, teils bruchstückhaften, dann wieder ausschweifenden Erzählstränge dieser Aufzeichnungen zu ordnen und zu bündeln. Sie sind wohl über einen langen Zeitraum hinweg entstanden. Der Verfasser scheint teilweise vergessen zu haben, was er schon niedergeschrieben hatte, es gab Stellen, die sich wiederholten, andere, die sich gar widersprachen. Mitunter wurde die Schrift über Seiten hinweg immer unleserlicher, die Tinten- und Weinflecke häuften sich, da sie vermutlich in langen, einsamen Nächten unter zunehmendem Alkoholeinfluss aufgeschrieben wurden. Viele dieser Stellen waren nicht mehr zu entziffern, andere hingegen waren gut leserlich.
Es dauerte sehr lange, bis es mir gelungen war, die verwertbaren Teile in eine chronologisch schlüssige Reihenfolge zu bringen. Die Sprache war sehr uneinheitlich, mal waren es bloße Stichwörter, dann wieder lange Sätze, teilweise mit veralteten, schweizerdeutschen, lateinischen oder italienischen Ausdrücken und Wörtern gespickt, was das Lesen sehr anstrengend machte. Ich habe versucht, Fluss in die Geschichte zu bringen, sie so niederzuschreiben, dass sie mühelos lesbar ist, nicht nur für Historiker, sondern für jedermann. Der Stil der Erzählung ist darum eher ein literarischer als ein wissenschaftlicher. Entsprechend habe ich mich entschieden, das Manuskript in Kapitel zu ordnen, was die Lektüre weiter vereinfacht. Es ist mir jedoch ein dringliches Anliegen zu betonen, dass ich nur die Form, nicht aber den Inhalt verändert habe. Die Ereignisse, die ich schildere, habe ich allesamt so in der Niederschrift gefunden und ihnen nichts hinzugefügt und nichts verändert. Es gibt Stellen, die anderen bekannten Schilderungen derselben Ereignisse widersprechen. Da es sich dabei jedoch oft um viel später entstandene Legenden handelt, die sich nicht belegen lassen, schmälern sie meiner Ansicht nach die Glaubwürdigkeit dieser Aufzeichnungen nicht.
Ob die Geschichte letztendlich der Wahrheit entspricht oder der Fantasie eines einsamen Menschen entsprang, lässt sich wissenschaftlich nicht nachweisen. Ich persönlich zweifle nicht an ihrer Authentizität und habe alles in meiner Macht Stehende unternommen, diese zu belegen, jedoch ohne Erfolg. In den Registern des Hospizes vom Großen Sankt Bernhard gibt es keinerlei Hinweise auf den Verfasser dieser Papiere. Eine mögliche Begründung dafür findet sich jedoch in der Niederschrift selbst.
Ein befreundeter Fachmann für alte Handschriften hielt die Dokumente für echt. Er war überzeugt, dass sie tatsächlich im 19. Jahrhundert verfasst wurden. Er wollte sie an einen auf dieses Zeitalter spezialisierten Kollegen zur genaueren Untersuchung weitergeben, doch ich war entschlossen, mein Versprechen einzulösen und die Kladden endlich zurückzubringen. Sie hatten mich viel länger beschäftigt, als ich geplant hatte. Sie hatten mich so sehr in den Bann gezogen, dass meine Dissertation ungeschrieben blieb und ich beruflich nicht vorwärtsgekommen war. Es war an der Zeit, mich von dieser Geschichte zu lösen und die Kladden ihrer Besitzerin zurückzugeben.
Seit meinem letzten Besuch in jenem Gasthaus waren mehrere Jahre vergangen. Es gab damals noch keine E- Mails, und obwohl ich es mir oft vorgenommen hatte, hatte ich mich nie mehr gemeldet. Ich selbst war ein paarmal umgezogen, und die Telefonnummer, die ich zurückgelassen hatte, war schon lange nicht mehr in Betrieb.
An einem schönen Frühlingstag kehrte ich also endlich auf den Großen Sankt Bernhard zurück.
Ich wurde herzlich empfangen. Die Tochter der Gastleute freute sich, dass ich mein Versprechen gehalten hatte. Sie hatte bereits daran gezweifelt, mich je wiederzusehen. In der Zwischenzeit hatte sie sich daran gemacht, die elterliche Pension umzubauen und mit möglichst vielen originalen und historischen Gegenständen auszustatten, so wie sie das damals geplant hatte. Da kein Geld für Renovierungen da war, hatte die Tochter viel Zeit und Herzblut investiert. Aus der heruntergekommenen Pension war ein gemütliches Gasthaus geworden, das außerhalb der Zeit zu stehen schien. Dieser Charme sprach sich langsam herum und die Geschäfte begannen ein bisschen besser zu laufen.
Ich erzählte ihr, was ich in den Schriften gefunden hatte, und überreichte ihr eine Kopie meines Manuskripts.
Als sie es gelesen hatte, war klar, dass die Truhe mit der Bibel und den Kladden einen Ehrenplatz erhalten würde. Es war damit zu rechnen, dass das Interesse gewaltig sein würde, wenn das Manuskript erst einmal veröffentlicht wäre. Ich plante, schon im Sommer wieder zu Besuch zu kommen, gemeinsam mit dem erwähnten Schriftexperten, der die Echtheit der Dokumente noch einmal prüfen sollte.
Doch kurz nach meiner Abreise brach in der Pension aufgrund eines technischen Defektes ein Feuer aus. Das Haus brannte fast vollständig nieder. Die Truhe und die Papiere wurden ein Opfer der Flammen. Den alten Gastleuten und ihrer Tochter ist zum Glück nichts passiert. Ich habe sie kurz nach der Feuersbrunst noch einmal besucht, sie hatten sich notdürftig bei einem Nachbarn einquartiert. Wenig später sind sie verzogen und es ist mir nicht gelungen, ihren Aufenthaltsort ausfindig zu machen.
Lange habe ich mit mir gerungen, was ich mit dem Manuskript anfangen sollte. Der Kladden beraubt, verfügte ich über keinerlei Belege für meine Geschichte. Ich widmete mich nun wieder meinem eigentlichen Beruf, doktorierte doch noch und erwarb mir ein gewisses Ansehen als Historiker. In dieser Position wurde es für mich aber immer undenkbarer, solch eine fantastische Geschichte zu veröffentlichen. Sie hätte meinem Ruf eines seriösen Wissenschaftlers unweigerlich Schaden zugefügt.
So blieben diese Seiten sehr lange liegen. Damit aber diese Geschichte nicht endgültig verloren geht nach meinem Ableben, habe ich mich entschlossen, das Manuskript unaufgefordert an einen Schweizer Verlag zu senden, in der Hoffnung, dass man dort besser weiß, was damit zu tun ist. Mich persönlich hat die Erzählung dermaßen fasziniert, dass ich es sehr begrüßen würde, wenn sie dem Publikum zugänglich gemacht würde, wobei ich es für gleichgültig erachte, ob man sie als historischen Bericht oder als Roman liest. Mein Beitrag soll der Sache und nicht meinem persönlichen Ruhm oder dem Gelderwerb dienen, weshalb ich darauf verzichtet habe, bei der Eingabe meinen vollen Namen oder meine Anschrift hinzuzufügen.
Wenn Sie dieses Vorwort in einem Buch lesen, hat sich der Verleger entschieden, sich dieser Erz&204;hlung vom ber&207;hmtesten Hund der Schweiz anzunehmen. Ihm möchte ich danken und hoffe natürlich, diesen Moment selbst noch erleben zu dürfen.
J.K.R.
Mein Leben mit Barry
1. Kapitel
Mein Name ist Georg Inderbitzin. Ich bin im Jahre des Herrn 1787 in [unleserlich] in der Innerschweiz als das achte von zehn Kindern einer armen Bergbauernfamilie zur Welt gekommen. Die Hütte, in der ich in einer kalten Februarnacht das Licht der Welt erblickte, war klein und düster. Der Wind pfiff durch die Ritzen der unverputzten Steinmauern.
Weil ich, wie mir die Mutter später oft erzählte, bei der Geburt stark untergewichtig war, rechnete niemand damit, dass ich unter diesen widrigen Bedingungen überleben würde. Doch ich überstand den Winter, blieb aber ein schwächliches Kind, das oft krank war. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist die an die Stimme meiner Mutter, die am Stubentisch betete, der Herr möge den Buben doch wieder zu sich nehmen. Ich würde ja doch nicht durchkommen und es sei eine Sünde, das Essen, das den anderen Geschwistern mangelte, an mich zu verschwenden. Sie flehte Gott an, ihr die Prüfung zu ersparen, ein Kind zu nähren, das zu zart war für diese raue Gegend.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!