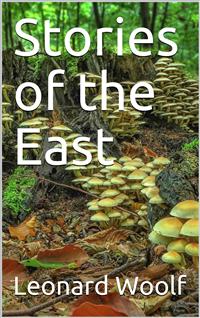21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wenn jemand mich hätte retten können, wärest Du es gewesen«, schrieb Virginia Woolf in ihrem Abschiedsbrief an Leonard Woolf, bevor sie sich 1941 das Leben nahm. Niemand ist der wohl bedeutendsten Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts so nahegekommen wie ihr Mann. Hier sind die Auszüge aus seiner Autobiografie versammelt, indenen er über die beinahe dreißig Ehejahre mit ihr berichtet. Es ist die Zeit, in der das Paar sich regelmäßig mit der Gruppe befreundeter Künstler*innen und Intellektueller trifft, die als »Bloomsbury Group« berühmt wurde. 1917 kauften die beiden sich eine Handpresse, so klein, dass sieauf dem Küchentisch Platz fand, um sich anhand einer Broschüre selbst das Drucken beizubringen - der Grundstein für ihren eigenen Verlag, die Hogarth Press, in dem Virginias große Werke erschienen. Was bedeutet es für eine Schriftstellerin, zugleich die eigene Verlegerin zu sein? Wie viel verdientendie Woolfs an heute so berühmten Romanen wie Orlando oder Mrs Dalloway? Mit großer Offenheit berichtet Leonard auch über die extremen Höhen und Tiefen im Schreibprozess seiner Frau, ihre Selbstzweifel und seine Sorge um ihren psychischen Zustand, die das Zusammenleben der Woolfs vom Beginn der Ehe an prägte. Sein Bericht offenbart,welch ein Fixpunkt Virginia in seinem Leben war;ihrem Wohlergehen widmete er sich voll und ganz, aus Liebe und auch aus tiefer Bewunderung: »Virginia ist der einzige Mensch, den ich gut gekannt habe, der die Eigenschaft hatte, die man Genie nennen muss.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
VORBEMERKUNG
Mein Leben mit Virginia
Zeittafel
Nachweis
Autor:innenporträt
Übersetzer:innenporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
VORBEMERKUNG
Leonard Woolf wurde 1880 als eines von neun Kindern des jüdischen britischen Kronanwalts Sydney Woolf geboren. Bis zum Tode seines Vaters im Jahr 1892 führte die Familie ein großes Haus in Kensington mit zahlreichen Dienstboten und Erziehern für die Kinder. Sydney Woolf ließ seine Familie ohne ausreichende Mittel zurück, sodass sich der aufwendige Lebensstil nicht fortführen ließ. Mithilfe von Stipendien besuchte Leonard Woolf die St Paul’s School und später das Trinity College in Cambridge. Hier schloss er sich dem Kreis um Lytton Strachey, Saxon Sydney-Turner und Thoby Stephen an. Diese Freunde führten ihn in die Kreise der intellektuellen Aristokratie Englands ein. Über Lytton Strachey wird Leonard Woolf zum sonntäglichen Tee bei Lady Strachey gebeten, bei Thoby Stephen trifft er dessen Vater Leslie Stephen, den eindrucksvollen Herausgeber des Dictionary of National Biography. Über Thoby Stephen lernte er auch dessen Schwestern Vanessa und Virginia, seine spätere Frau, kennen. Schon bei ihrer ersten Begegnung – Vanessa und Virginia Stephen besuchten unter der Obhut ihrer Tante Katherine ihren Bruder im College – ist er von der außerordentlichen Schönheit der Schwestern tief beeindruckt:
»Sie trugen weiße Kleider, große Hüte und Sonnenschirme in der Hand, und ihre Schönheit verschlug einem buchstäblich den Atem. Man war wie vom Blitz getroffen, und alles, einschließlich des Atems, kam für eine Sekunde ins Stocken. Vergleichen kann man das nur mit dem Moment, in dem man in einem Museum plötzlich vor einem großen Rembrandt oder Velasquez steht …«
Der Besuch von zwei jungen Damen in einem englischen College war im Jahr 1901 an sich schon nicht üblich. Selbst wenn sie nur ihren Bruder besuchten, war das ohne Anstandsdame – in diesem Fall Tante Katherine – völlig undenkbar. Leonard Woolf erkannte bei den Stephen-Schwestern die berühmte und vielfach portraitierte weibliche Schönheit der Pattle-Schwestern, ihrer Vorfahren mütterlicherseits, vereinigt mit dem charaktervollen Äußeren der Stephens:
»Als ich sie kennenlernte, waren sie junge Frauen von erstaunlicher Schönheit, aber sie hatten nichts von der Lieblichkeit einer fromm-schmachtenden Puppe an sich, die für einige ihrer weiblichen Vorfahren so typisch war. Sie waren ebenso Stephens wie Pattles. Als Mann konnte man gar nicht anders als sich in sie zu verlieben, und ich glaube, ich tat es sofort.«
Der Abschluss seiner Studien trennte Leonard Woolf für längere Zeit von seinen Freunden aus Cambridge und damit auch von den Schwestern Stephen. Seine Noten waren so mittelmäßig, dass er sich für den Staatsdienst in Ceylon bewarb. Mit den Miniaturausgaben der Oxford Press von Shakespeare und Milton in vier Bänden, einer Voltaire-Ausgabe in neunzig Bänden aus dem 18. Jahrhundert und einem Drahthaar-Foxterrier bestieg er im Oktober 1904 den Zug nach Tilbury Docks, um von dort aus nach Ceylon zu fahren. Dort lebte er sechseinhalb Jahre, während für seine Studienfreunde in London das begann, »was später Bloomsbury genannt wurde«. In seinem Roman Das Dorf im Dschungel beschrieb er seine Erfahrungen in diesen sechseinhalb Jahren.
F.G.
Am 24. Mai 1911, einem Mittwoch, verließ ich nach sechseinhalb Jahren Staatsdienst Ceylon. Ich hatte ein Jahr Urlaub. Ich reiste auf der Staffordshire, zusammen mit meiner Schwester Bella, die R.H. Lock geheiratet hatte, den Stellvertretenden Direktor des Botanischen Gartens Peradeniya. Siebzehn Tage später, am Samstag, dem 10. Juni, erreichten wir Marseille. Es war eine langweilige und ziemlich trübselige Reise gewesen. Ich mag Reisen, die in die Zukunft hinausführen, in das Unbekannte, oder zu einem erweiterten Horizont. Dadurch sind alle Heimreisen irgendwie deprimierend, selbst wenn man ein Jahr Urlaub hat und ganz ungeduldig ist, anzukommen und wieder daheim zu sein. Man kehrt zu dem zurück, was man kennt – der Horizont verengt sich. Ich glaube, dass an diesem Mittwoch, dem 24. Mai 1911, meine Jugend gewissermaßen zu Ende ging: Obwohl ich schon einunddreißig Jahre alt war, war ich ein junger Mann, als ich Colombo verließ, aber in mittleren Jahren, als ich in Marseille ankam.
Natürlich war es seltsam und aufregend, in Marseille die Straßen entlangzugehen. Was uns auf den ersten Blick an Europa am meisten verblüffte und entzückte, waren die Läden voll von Pralinen aller Art; auf der langen Zugreise nach Paris aßen wir sie unentwegt. An das Frankreich und Europa meiner Heimreise erinnere ich mich nicht, nur an diese Pralinen. Als wir in Folkestone von Bord gingen, holten uns meine Brüder Herbert und Edgar ab – sie waren in den sechseinhalb Jahren für mich Fremde geworden. Und als wir in Charing Cross ein Taxi bestiegen und über den Trafalgar Square fuhren, spürte ich sofort am Pulsieren des Straßenverkehrs, dass ich in eine veränderte Welt zurückgekehrt war. Die Welt der altmodischen Droschken und der Hansoms, die ich 1904 verlassen hatte, gab es nicht mehr. Ich kam mir in dem Augenblick wie ein Relikt aus einem langsameren Zeitalter vor, denn das Leben, in das ich eintauchte, als ich die Bahnstation Charing Cross verließ, hatte ein deutlich höheres Tempo und war lauter, als ich es gewohnt war. Ich betrachtete es mit Vorsicht, Zurückhaltung und einer gewissen Melancholie.
Wir fuhren nach Putney hinaus; es war ein Londoner Sommernachmittag mit dem herrlichsten Sonnenschein – 1911 war eins dieser seltenen Jahre: Ein endloser Sommer über Wiesen ohne Schlangen, ein Sommer, der im frühen Frühling begonnen hatte und erst im Spätherbst sanft erlosch. Als ich 1904 in Colombo gelandet und durch die Sonne zwischen fremden Sehenswürdigkeiten, Geräuschen und Gerüchen Asiens zum Sekretariat gegangen war, um meine Ankunft zu melden, war es mir vorgekommen, als ob mein ganzes vergangenes Leben in London und Cambridge plötzlich verschwunden wäre, sich in Unwirklichkeit aufgelöst hätte. Und doch waren Colombo und ich, als ich durch seine staubigen Straßen wanderte, nie ganz und gar wirklich gewesen. Damals, und während all meiner Jahre in Ceylon, fühlte ich eine gewisse Unwirklichkeit, als ob ich mich selbst aus dem Augenwinkel beobachtete, wie ich eine Rolle spielte. Das Merkwürdige an meiner Rückkehr nach England war, dass ich, als ich von Charing Cross durch das motorisierte, gepflasterte, sonnige London nach Putney fuhr, fast genau dasselbe fühlte wie sieben Jahre zuvor in Colombo. Mein Leben in Ceylon, in Jaffna, Kandy und Hambantota, verschwand in die Unwirklichkeit, aber London und ich selbst, der ich durch seine hässlichen Straßen fuhr, waren noch nicht in die sichere Realität zurückkehrt. Aus dem Augenwinkel schien ich mich wieder zu beobachten, wie ich erneut eine Rolle in demselben komplizierten Stück spielte, aber vor einem neuen Hintergrund und mit anderen Schauspielern und vor einem anderen Publikum.
Ich war als introspektiver Intellektueller geboren, und wer – ob Mann oder Frau – von Natur aus der Selbstbeobachtung verfallen ist, gewöhnt sich im Alter von fünfzehn oder sechzehn Jahren an, sich selbst oft sehr intensiv als »Ich« und gleichzeitig aus dem Augenwinkel heraus als »Nicht-Ich« zu empfinden, als einen Fremden, der auf der Bühne eine Rolle spielt. Von einem Augenblick zum anderen kommt es mir oft vor, als ob mein Leben und das Leben um mich herum unmittelbar und außerordentlich konkret wären, und als ob zugleich etwas absurd Unwirkliches daran wäre, weil ich es nicht lassen kann, mir selbst dauernd dabei zuzusehen, wie ich meine Rolle auf einer Bühne spiele. Das ist das Ergebnis, wenn man sich selbst objektiv betrachtet, und es hat eine seltsame psychologische Auswirkung; es hilft einem, glaube ich, mit einiger Gleichmut sowohl die Übel, unter denen man leidet als auch die, von denen man nichts weiß, zu ertragen. Wenn man sich selbst objektiv zu betrachten beginnt, merkt man bald, dass das, was für einen subjektiv so ungeheuer wichtig ist, für das objektive Selbst reichlich belanglos ist.
So kam es, dass ich mir, als ich am Sonntag, dem 11. Juni 1911, gegen vier Uhr nachmittags nach Putney hinausfuhr, in der Fulham Road plötzlich abermals einer Art Spaltung meiner Persönlichkeit bewusst wurde, der Spaltung in mein wirkliches Ich, das in dem Taxi saß und mit meiner Schwester Bella und meinen Brüdern Herbert und Edgar sprach, und das andere Ich, das schon eine neue Rolle im ersten Akt, erste Szene eines ziemlich neuen Stücks zu spielen begonnen hatte. Heute, einundfünfzig Jahre danach, im Juni 1962, spiele ich noch immer meine Rolle in jenem Stück.
Als wir unser Ziel, das Haus in der Colinette Road in Putney, erreichten, war diese Mischung von Wirklichkeit und Unwirklichkeit, von Vertrautheit und Fremdheit, bestürzend. Dies war das Haus, in das meine Mutter mit ihren neun Kindern vor zwanzig Jahren umsiedelte, als wir nach dem Tod meines Vaters über Nacht vergleichsweise arm geworden waren. Es war das Haus, von dem aus ich sieben Jahre zuvor nach Ceylon aufgebrochen war. Oberflächlich hatte sich in dem Haus, dem Garten und an seinen Bewohnern wenig geändert – sie waren nur älter geworden. Die Möbel im Haus, der Birnbaum im Garten, meine Mutter, meine Brüder und Schwestern und ich selbst waren alle 20 Jahre älter. Da waren wir also, alle zehn, alle um denselben Esstisch versammelt wie sieben Jahre zuvor und siebzehn Jahre zuvor. Nur die Katze und der Hund fehlten, sie lebten nicht mehr, und Agnes, das Hausmädchen, hatte sich nach fünfundzwanzig Jahren »Dienst« zur Ruhe gesetzt. Ich spürte eine leichte Klaustrophobie. Nach dem endlosen Dschungel, den großen Lagunen, dem gewaltigen Meer, das unterhalb meines Bungalows an die Küste schlug, den großen, offenen, fensterlosen Räumen in Hambantota hatte ich das Gefühl, dass die Wände des Esszimmers in Putney mich bedrängten, die Decke mich niederdrückte und die Vergangenheit und zwanzig Jahre auf mich einstürzten. Ich ging ein bisschen deprimiert ins Bett.
Während der nächsten paar Tage hielt eine leichte Niedergeschlagenheit an. Trotz einiger Befürchtungen – ich wusste nicht, was mich dort erwartete – beschloss ich, wieder in das Cambridger Leben einzutauchen.
Drei Tage nach meiner Ankunft in Putney nahm ich den Zug nach Cambridge, um Lytton Strachey zu besuchen, der eine Wohnung an der King’s Parade gemietet hatte. Es war ein großartiges Wiedersehen. Ich speiste am High Table im Trinity, ich suchte McTaggart und Bertrand Russell auf, und ich spielte Boule in Fellow Bowling Green mit G.H. Hardy, einem bemerkenswerten Mathematiker, der Professor in Oxford wurde und einer der seltsamsten und bezauberndsten Menschen war. Ich besuchte meinen Bruder Cecil, der im Trinity war und später dort Dozent wurde, und Walter Lamb, den späteren Sekretär der Royal Academy, sowie Francis Birrell. Am Samstag aß ich mit Lytton und Rupert Brooke zu Abend, und hinterher gingen wir zu einer Versammlung der »Society« …
Lytton und Rupert, Bertie Russell und Hardy, Sheppard und Goldie [G. Lowis Dickinson] in der »Society« am Samstagabend – all dies war nach drei Jahren Hambantota ein wundervolles Eintauchen. Erst im Zug zurück nach London tauchte ich atemlos und ein bisschen benommen wieder auf. Gleichzeitig spürte ich eine Art beruhigender Wärme. Ich hatte das Wochenende genossen. Cambridge und Lytton und Bertie Russell und Goldie, die Society und der Great Court von Trinity, Hardy und Bowling – all die ewigen Werte und Wahrheiten meiner Jugend –, es gab sie noch genauso, wie ich sie sieben Jahre zuvor zurückgelassen hatte. Obwohl ich frisch vom Strand von Jaffna und Hambantota und der Kiplingschen Anglo-Indischen Gesellschaft Ceylons kam, sah ich, dass ich noch immer ein Sohn von Trinity und King’s College war, ein Cambridger Intellektueller. Meine Jahre in Ceylon hatten ein Übriges zu meiner Verschlossenheit und Zurückhaltung beigetragen, aber ich hatte keine Schwierigkeiten, die Fäden der Freundschaft oder Verständigung mit Lytton und den anderen da wieder aufzunehmen, wo ich sie 1904 durchtrennt hatte.
Als ich aus Cambridge zurück war, widmete ich mich eifrig all den Vergnügungen des Londoner Lebens und den alten Freundschaften. Ich suchte Leopold Campbell auf, der jetzt Pfarrer war, und Harry Gray, inzwischen ein erfolgreicher Chirurg, und Saxon, jetzt Beamter im Finanzministerium. Ich sah mir das russische Ballett an, Shaws Fannys erstes Stück, La Traviata und die Tänzerin Adeline Genee im Coliseum. Ich ging zum Corona-Club-Dinner, wo ich viele Verwaltungsbeamte aus Ceylon traf, unter ihnen J.P. Lewis. Am nächsten Abend ging ich zum Society-Dinner, wo ich zwischen Lytton und Maynard Keynes saß und Moore und Desmond MacCarthy wiedersah. Und alles das innerhalb von vierzehn Tagen. Dann, am Montag, dem 3. Juli, nur drei Wochen, nachdem ich in England angekommen war, war ich zum Dinner bei Vanessa und Clive Bell am Gordon Square. Während des Essens war ich mit ihnen allein, aber später kamen Virginia, Duncan Grant und Walter Lamb dazu. Das war, soweit ich das beurteilen kann, der Anfang dessen, was später »Bloomsbury« genannt wurde.
»Bloomsbury« hat nie in der Form existiert, wie es die Außenwelt gesehen hat. Denn »Bloomsbury« war und wird noch immer benutzt als – meist herabsetzend gemeinte – Bezeichnung für eine im Wesentlichen imaginäre Gruppe von Leuten mit im Wesentlichen imaginären Zielen und Eigentümlichkeiten. Ich gehörte zu dieser Gruppe und auch zu der kleinen Zahl von Menschen, die schließlich tatsächlich eine Art Freundeskreis in oder um diesen Londoner Bezirk Bloomsbury herum bildeten. Auf diesen Kreis kann der Name Bloomsbury mit Recht angewendet werden, und das wird er auch auf diesen Seiten. Bloomsbury in diesem Sinne gab es 1911, als ich aus Ceylon heimkehrte, noch nicht; das entstand erst in den drei Jahren von 1912 bis 1914. Wir selbst benutzten diesen Namen für uns, bevor es die Außenwelt tat, denn in den Zwanziger- und Dreißigerjahren, als eine jüngere Generation heranwuchs und heiratete und die ersten aus unserer Generation bereits starben, pflegten wir von »Old Bloomsbury« zu sprechen und meinten damit die ursprünglichen Mitglieder unseres Freundeskreises, die zwischen 1911 und 1914 in und um Bloomsbury herum wohnten.
Old Bloomsbury umfasste folgende Personen: Die drei Stephens, Vanessa, mit Clive Bell verheiratet, Virginia, die Leonard Woolf heiratete, und Adrian, der Karin Costello heiratete; Lytton Strachey; Clive Bell; Leonard Woolf; Maynard Keynes; Duncan Grant; E.M. Forster (von dem ich in diesem Buch als von Morgan Forster oder Morgan sprechen werde); Saxon Sydney-Turner; Roger Fry. Desmond MacCarthy und seine Frau Molly wohnten zwar eigentlich in Chelsea, wurden aber von uns immer als Mitglieder von Old Bloomsbury betrachtet. In den Zwanziger- und Dreißigerjahren, als Old Bloomsbury erst schrumpfte und sich dann zu einem neueren Bloomsbury erweiterte, es verlor Lytton und Roger durch Tod, dafür kamen Julian, Quentin und Angelica Bell dazu, und David (Bunny) Garnett, der Angelica heiratete.1
An jenem Montagabend, dem 3. Juli 1911, als ich mit Vanessa und Clive Bell am Gordon Square speiste, bestand dieses Bloomsbury in Wirklichkeit noch nicht. Der Grund dafür lag in der Geografie. Zu der Zeit wohnten nur Vanessa und Clive und Saxon in Bloomsbury. Virginia und Adrian lebten am Fitzroy Square und Duncan in einer Mietwohnung in der Nähe. Roger wohnte in einem Haus außerhalb von Guildford, Lytton in Cambridge und Hampstead, Morgan Forster in Weybridge, Maynard Keynes als Dozent am King’s College in Cambridge. Ich kam aus Ceylon zu Besuch. Zehn Jahre später, als Old Bloomsbury bestand, wohnten Vanessa, Clive, Duncan, Maynard, Adrian und Lytton alle am Gordon Square, Virginia und ich am Tavistock Square, Morgan am Brunswick Square, Saxon in der Great Ormond Street, Roger in der Bernard Street. Damit wohnten wir alle in Bloomsbury, nur wenige Minuten Fußweg voneinander entfernt.
Ich will in diesem Buch nicht eine Geschichte Bloomsburys in irgendeiner seiner Gestalten oder Ausformungen, ob real oder imaginär, schreiben und werde nach diesen paar Seiten kaum noch etwas dazu sagen. Ich versuche meine Autobiografie zu schreiben, einen wahrhaftigen Bericht meines Lebens im Zusammenhang mit den Zeiten und der Gesellschaft, in denen ich lebte, mit der Arbeit, die ich tat, und mit den Menschen – engen Freunden, Bekannten, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Die zwölf, die ich als Mitglieder von Old Bloomsbury benannt habe, haben großen Einfluss auf mein Leben gehabt. Mein Bericht über die zehn, zwölf Jahre nach meiner Rückkehr aus Ceylon wird zwangsläufig zeigen, wie es kam, dass wir uns an diesen nostalgischen Londoner Plätzen trafen, und welchen Charakter unsere Zusammenkünfte hatten.
Dabei gibt es noch ein paar Tatsachen über uns, die ich herausstellen möchte, bevor ich in meiner Erzählung fortfahre. Wir waren und blieben vor allem und grundsätzlich immer eine Gruppe von Freunden. Unsere Wurzeln und die Wurzeln unserer Freundschaft gründeten in der Universität Cambridge. Von den dreizehn oben genannten Personen waren drei Frauen und zehn Männer; von den zehn Männern waren neun in Cambridge gewesen, und wir alle, außer Roger, waren mehr oder weniger gleichzeitig in Trinity und im King’s gewesen und waren enge Freunde, bevor ich nach Ceylon ging.
Es haben sich oft Gruppen zusammengeschlossen, Schriftsteller oder Künstler, die nicht nur miteinander befreundet waren, sondern die sich bewusst aufgrund gemeinsamer Grundsätze und Ziele oder künstlerischer oder sozialer Absichten vereint haben. Die Utilitarier, die Lake-Poets, die französischen Impressionisten oder die englischen Präraffaeliten waren solche Gruppen. Unsere Gruppe war ganz anders. Ihr Fundament war die Freundschaft, aus der bei einigen Liebe und Ehe wurde. Die Färbung unseres Fühlens und Denkens war uns durch das Klima von Cambridge und Moores Philosophie vermittelt worden, so wie das Klima Englands dem Gesicht des Engländers eine Färbung, das Klima Indiens aber dem Gesicht des Tamilen eine ganz andere Farbe gibt. Wir hatten keine gemeinsame Theorie, kein System und keine Prinzipien, zu denen wir die Welt bekehren wollten; wir waren keine Proselytenmacher, keine Missionare, Kreuzfahrer oder auch nur Propagandisten. Natürlich schuf Maynard das System oder die Theorie der Keynes’schen Nationalökonomie, die eine starke Wirkung auf Theorie und Praxis von Wirtschaft, Finanzwesen und Politik hatte, und Roger, Vanessa, Duncan und Clive spielten eine wichtige Rolle als Maler oder Kritiker bei dem, was man als postimpressionistische Bewegung bezeichnet. Aber Maynards Kreuzzug für die Keynes’sche Ökonomie und gegen die Orthodoxie der Banken und akademischen Volkswirtschaftler, und Rogers Kreuzzug für den Postimpressionismus und die »signifikante Form« und gegen die Orthodoxie der akademischen »gegenständlichen« Maler und Ästhetiker waren ebenso rein individuell wie Virginias Buch Die Wellen – sie hatten nichts mit irgendeiner Gruppe zu tun. Es gab so wenig eine gemeinsame Beziehung zwischen Rogers Critical and Speculative Essays on Art und Maynards Allgemeiner Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes und Virginias Orlando wie zwischen Benthams Prinzipien der Gesetzgebung und Hazlitts Principal Picture Galleries in England und Byrons Don Juan.
Ich komme jetzt auf den Abend des 3. Juli 1911, einem Montag, zurück. In Cambridge hatte ich während meines Wochenendes das beruhigende Vergnügen gehabt, die Menschen und Dinge, Wahrheiten und Werte unverändert und unveränderlich vorzufinden, denen ich die Liebe und Loyalität meiner Jugend gewidmet hatte. Am Gordon Square kam ich dagegen in eine Gesellschaft, die sich in diesen Jahren vollkommen verändert hatte, in der ich mich aber sofort und vollkommen zu Hause fühlte. Nichts ist alberner als das Prinzip, dass man in seinen Gefühlen und Vorlieben und Abneigungen widerspruchsfrei sein müsste. Wo es um Geschmack geht, gilt das Gesetz des Widerspruchs nicht. Es ist absurd, zu glauben, dass die Liebe zu Katzen oder rotem Bordeaux Grund oder Entschuldigung dafür wäre, Hunde oder Burgunder nicht zu lieben. Deshalb macht mir die beruhigende Feststellung, dass sich nichts geändert hat, genauso viel Vergnügen, wie die erregende Tatsache, dass alles neu ist.
Es hatte tatsächlich eine tiefgreifende Umwälzung am Gordon Square stattgefunden. Ich hatte 1904, wenige Tage, bevor ich England verließ, mit Thoby und seinen Schwestern, den beiden Miss Stephen, am Gordon Square 46 zu Abend gegessen. Als ich jetzt, sieben Jahre später, in den gleichen Räumen zum ersten Mal Vanessa, Virginia, Clive, Duncan und Walter Lamb wiedersah, stellte ich fest, dass ungefähr das Einzige, was sich nicht verändert hatte, die Möbel und die außerordentliche Schönheit der beiden Miss Stephen waren. Vanessa war, glaube ich, im Allgemeinen schöner zu nennen als Virginia. Ihre Züge waren vollkommener, ihre Augen größer und schöner, ihr Teint strahlender. Wenn Rupert der Adonis einer Göttin war, so hatte Vanessa in den Dreißigern etwas von der Herrlichkeit, die Adonis gesehen haben muss, als die Göttin plötzlich vor ihm stand. Auf viele Menschen wirkte sie eindrucksvoll und einschüchternd, denn sie trug etwas von drei Göttinnen in sich, wobei ihr Gesicht mehr von Athene und Artemis ausstrahlte als von Aphrodite. Ich selbst habe sie nie als einschüchternd empfunden, einerseits weil sie die schönste Stimme hatte, die ich je gehört habe, zum anderen wegen ihrer Gelassenheit und Ruhe. (Die Gelassenheit war ein bisschen aufgesetzt; sie reichte nicht in die Tiefe ihres Gemüts, in der auch eine außerordentliche Sensibilität, eine nervöse Spannung lag, die eine gewisse Ähnlichkeit mit der seelischen Labilität Virginias hatte.) Die eigenartige Kombination von großer Schönheit und weiblichem Charme, verbunden mit einer Art Versteinerung ihres Wesens und dem sarkastischen Humor, machten sie zu einer faszinierenden Persönlichkeit.
Trotz der großen Familienähnlichkeit zwischen den Schwestern war Virginia ein ganz eigener Typ. Auf den ersten Blick erschien sie weniger schön als Vanessa. Wenn es ihr gut ging, sie unbesorgt, vergnügt, amüsiert und angeregt war, leuchtete ihr Gesicht in beinahe ätherischer Schönheit. Außergewöhnlich schön war sie auch, wenn sie in aller Ruhe in ein Buch vertieft, lesend oder nachdenkend dasaß. Aber der Ausdruck, ja sogar ihre Gesichtszüge änderten sich mit außerordentlicher Schnelligkeit, wenn sich die Schatten der geistigen Anspannung abzeichneten, wenn Krankheit oder Sorgen sie aufwühlten. Sie war dann noch immer schön, aber ihre Angst und ihre Qual machten selbst die Schönheit quälend.
Virginia hat als einziger Mensch, den ich gut gekannt habe, das, was man Genie nennen muss. Genie deshalb, weil bei ihr der geistige Prozess gänzlich anders als der gewöhnlicher oder normaler Menschen zu sein scheint, und auch anders als die normalen geistigen Abläufe der ungewöhnlichen Menschen. Virginia hatte große Freude an gewöhnlichen Dingen wie Essen, Spazierengehen, Gespräche, Einkaufen, Boule-Spielen, Lesen. Sie mochte alle Arten alltäglicher Menschen, und kam gut mit ihnen aus, sobald sie sich gut genug kannten. (Fremden gegenüber zeigte sie eine merkwürdige Schüchternheit, die sich oft auf diese übertrug.) Im alltäglichen Leben und Umgang mit anderen sprach, dachte und handelte sie im Großen und Ganzen genauso wie diese, obwohl sie seltsamerweise etwas umgab, eine unbestimmte Aura, die sie in den Augen »gewöhnlicher« Menschen oft sonderbar erscheinen ließ.
In unserem Leben gab es ein wunderliches, häufiger auftretendes Beispiel dafür, das ich stets aufs Neue mit Verblüffung bemerkte. Wenn man durch London oder irgendeine andere große europäische Stadt geht, trifft man ab und zu auf Menschen, vor allem Frauen, die bei näherem Hinsehen unbeschreiblich lächerlich wirken. Ob sie dick sind oder dünn, mittleren Alters oder älter, es sind Frauen, die die übertriebene Mode ihrer Zeit, die ohnehin nur wenige, hübsche junge Dinger tragen können – und auch das nicht immer –, noch weiter übertreiben. Sie sind komische und alberne Karikaturen weiblichen Charmes. Virginia war dagegen für jeden Geschmack eine sehr schöne Frau, und viele Menschen würden auf sie die etwas dubiose Beschreibung »von bemerkenswertem Aussehen« angewendet haben; dazu hatte sie, wie ich finde, einen Sinn für hübsche, wenn auch ausgefallene Kleider. Und doch muss in ihrer Erscheinung etwas gewesen sein, das den meisten auf der Straße sonderbar und lächerlich vorkam. Ich gehöre zu den Menschen, die überall in der Menge untergehen. Selbst in einer fremden Stadt im Ausland, wo ich anders gekleidet bin als die Einwohner bemerkt mich niemand, und ich gehe auf den ersten Blick in Barcelona für einen Spanier und in Stockholm für einen Schweden durch. Aber in Barcelona wie in Stockholm würden neun von zehn Menschen Virginia anstarren oder sogar stehen bleiben und sie anstarren. Und nicht nur im Ausland, selbst in England blieben sie stehen und starrten und stießen einander an – »Sieh dir die an!« –, selbst in Piccadilly oder Lewes High Street, wo kaum jemand beachtet wird. Sie blieben nicht nur stehen und sahen ihr nach und stießen einander an; irgendetwas war an Virginia, das sie lächerlich fanden; eine groteske weibliche Karikatur, die die Menge als gewöhnlich akzeptiert hatte, brach beim Anblick Virginias sogar in Gelächter aus. Ich habe nie genau begriffen, was der Anlass für dieses Gelächter war. Es konnte auch nur zum Teil daran liegen, dass ihre Kleider nie ganz so aussahen wie die Kleider anderer. Auch hing es wohl damit zusammen, dass etwas Sonderbares und Beunruhigendes und damit für viele Menschen Lächerliches in ihrer Erscheinung lag; in der Art, wie sie ging – oft schien sie an etwas ganz anderes zu denken–, wenn sie etwas schleppend im Schatten eines Traumes die Straße entlanglief. Ob es alte Vetteln oder strahlende junge Dinger waren, sie konnten sich das Lachen oder Kichern nicht verkneifen.
Dieses Gelächter auf der Straße quälte sie. Sie hatte eine fast krankhafte Angst davor, angeschaut zu werden, und noch mehr davor, fotografiert zu werden. Deshalb gibt es so wenige Fotografien von ihr, auf denen sie natürlich wirkt, Fotografien, die die Persönlichkeit, die ihr Gesicht im alltäglichen Leben ausstrahlte, wiedergeben. Ein treffendes Beispiel für die enervierende Qual, die sie auszustehen hatte, wenn man sie ansah, war die Zeit, als Stephen Tomlin (Tommy, wie er immer genannt wurde) die Büste von ihr schuf, die jetzt in der National Portrait Gallery steht. Mit dem größten Widerwillen hatte sie sich schließlich überreden lassen, ihm Modell zu sitzen. Der Zweck jeder Sitzung war natürlich, dass er sie ansehen konnte, was Tommy auch mit anhaltender Intensität tat. Für sie war es wie eine chinesische Folter. Er war ein langsamer Arbeiter und konnte eine Stunde oder länger arbeiten, ohne dass ihm in den Sinn kam, was im Kopf seines gequälten Modells vor sich ging. Die Sitzungen endeten immer gerade noch rechtzeitig; hätten sie noch länger gedauert, wäre Virginia ernsthaft krank geworden. Eine Andeutung ihrer Qualen hat Tommy, wie ich finde, eingefangen und in den Lehm des Abbilds gebannt.
Ich sagte, dass sie im täglichen Leben weitgehend so dachte, sprach und handelte wie andere Leute, obwohl es immer dieses Element oder diese Aura gab, die für gewöhnliche Leute so sonderbar und beunruhigend waren, dass sie zur Selbstverteidigung, und um sich ihrer selbst zu versichern, kicherten oder laut lachten. Ich glaube, dass dieses Element eng verbunden war mit der Ader in ihr, die ich Genie nenne. Bei einer Unterhaltung hob sie von einem Augenblick zum anderen plötzlich ab, wie ich dazu zu sagen pflegte. Sie war ein ungewöhnlich amüsanter Gesprächspartner, denn sie hatte einen schnellen und intelligenten, geistreichen und humorvollen Kopf, war angemessen ernsthaft oder frivol, je nachdem, wie es die Gelegenheit oder das Thema erforderte. Aber irgendwann, ob bei einer Unterhaltung mit fünf oder sechs Leuten, oder wenn wir miteinander allein waren, konnte sie plötzlich »abheben« und irgendeine verrückte, faszinierende, ergötzliche, traumhafte, fast lyrische Beschreibung eines Ereignisses, eines Ortes oder einer Person geben. Mich erinnerte das immer an das Aufbrechen und Überfließen der Quellen im Herbst nach dem ersten Regen. Die gewöhnlichen geistigen Abläufe waren unterbrochen, und statt ihrer strömten, fast ungesteuert, die Wasser der schöpferischen Kraft und Fantasie hervor und versetzten sie und ihre Zuhörer in eine andere Welt. Im Gegensatz zu anderen guten oder auch brillanten Erzählern war sie nie langweilig, denn diese Darbietungen – aber Darbietungen ist das falsche Wort, sie zu beschreiben, sie kamen ja spontan – waren immer kurz.
Wenn sie zu einer dieser Fantasien abhob, spürte man, dass es so etwas wie Inspiration war, bei der die Gedanken und Bilder hervorsprudelten, ohne dass sie sie bewusst steuerte oder kontrollierte, wie sie es sonst in einer Unterhaltung tat. In dem Bericht über die Niederschrift der letzten Seiten von Die Wellen aus ihrem Tagebuch erkenne ich diesen geistigen Prozess wieder.
Samstag, den 7. Februar
In den wenigen Minuten, die mir bleiben, muss ich – dem Himmel sei Dank – über den Schluss der Wellen berichten. Ich schrieb die Worte ›O Tod‹ vor fünfzehn Minuten, nachdem ich die letzten zehn Seiten mit einigen Augenblicken solcher Intensität und solchen Rausches abgespult habe, dass ich hinter meiner eigenen Stimme herzustolpern schien, oder hinter einer Art Sprecher als wäre ich geisteskrank. Fast bekam ich Angst, weil ich mich an die Stimmen erinnerte, die mir vorauszufliegen pflegten.
»Hinter meiner eigenen Stimme herstolpern« und »die Stimmen, die mir vorausfliegen« – das ist bestimmt eine präzise Beschreibung der Inspiration des Genies und des Wahnsinns, die beweist, wie erschreckend dünn das Gedankengewebe oft ist, das das eine vom anderen trennt, eine Tatsache, die schon vor mindestens 2000 Jahren bekannt war und seitdem oft bemerkt worden ist. »Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit« – Es hat nie ein großes Genie gegeben, ohne eine Dosis Wahnsinn, sagt Seneca, [Wobei er Aristoteles zitiert. Anm. d. Hrsg.] und Dryden ließ es in dem abgedroschenen Kehrreim wieder anklingen:
»Der große Geist ist klar dem Wahnsinn eng verbunden, und dünne Wände scheiden ihre Grenzen.«
Das Ausbrechen des Geistes aus den gewöhnlichen Denkrastern, das ich bei Virginia fand, ist meiner Ansicht nach so etwas wie Inspiration oder Genie. Häufiger als andere Denkraster bringt es das hervor, was Sir Thomas Brown einen »flüchtigen Blick auf das Unbegreifliche und den Gedanken an Dinge, die vom Denken nur sanft gestreift werden« nannte. Es gibt Beweise, dass die größten der großen Genies das erfahren. Beethoven hatte ab und zu das, was sein treuer Schüler einen »Raptus« nannte, so etwas wie ein ungestümer, schöpferischer Ausbruch. In gewissem Sinne ist daran jedoch nichts Geheimnisvolles. Ein Raptus oder eine Inspiration ist offensichtlich nur eine seltene und wundervolle Form eines bekannten, alltäglichen geistigen Vorgangs. Graham Wallas hat in The Art of Thought zu Recht betont, wie wichtig Zeiten der Untätigkeit und des Nichtdenkens für das schöpferische Denken sind. Fast jeder dürfte schon einmal die Erfahrung gemacht haben, dass man sich vergebens mit irgendeinem intellektuellen oder auch emotionalen Problem herumschlägt, und wenn man es schließlich verzweifelt aufgegeben hat und an etwas ganz anderes denkt, bricht die Lösung blitzartig – wie eine Inspiration – hervor. Oder man geht sogar mit einem ungelösten Problem ins Bett und stellt am nächsten Morgen fest, dass man es im Schlaf gelöst hat. Das berühmteste Beispiel für dieses Phänomen ist das triumphierende »Heureka!« des Archimedes, als er aus dem Bad sprang, nachdem er in einem plötzlichen Aufblitzen das wissenschaftliche Prinzip entdeckt hatte, das ihm bei seinen Bemühungen immer wieder entglitten war. Die »Inspiration« des Schriftstellers und Beethovens Raptus sind gleicher Natur. Ein Beweis dafür ist, dass die Inspiration nur der Endpunkt einer längeren Periode beharrlichen bewussten Nachdenkens, oft auch eines Herumprobierens ist. Im Fall Beethoven wird das durch seine Notizbücher bewiesen. Auch für Virginia trifft das zu. Ich kenne keine Schriftsteller, die so stetig und bewusst über das, was sie schrieben, nachgedacht und gegrübelt haben wie sie; sie wälzte ihre Probleme hartnäckig im Kopf, während sie im Sessel vor dem Kamin saß oder ihren täglichen Spaziergang am Ufer der Sussex-Ouse machte. Sie konnte nur deshalb die letzten zehn Seiten der Wellen so herunterspulen und hinter ihrer eigenen Stimme und hinter den Stimmen, die ihr vorausflogen, herstolpern, weil sie dem Buch über Wochen und Monate Stunden intensiven, bewussten Nachdenkens gewidmet hatte, bevor die Worte tatsächlich niedergeschrieben wurden – genauso wie Archimedes nie sein »Ich habe es gefunden!« hätte rufen können, wenn er nicht schon bewusst und eifrig Stunden an diesem Problem gearbeitet hätte.
Nach dieser zweiten Abschweifung – einer allerdings höchst bedeutsamen Abschweifung – kann ich abermals zu dem Abend des 3. Juli 1911 zurückkehren. Zwei Dinge ließen mich sofort spüren, dass ich in eine Gesellschaft eingetreten war, die erstaunlich anders war als die, die ich 1904 am Gorden Square verlassen hatte, gar nicht zu reden von der Kipling’schen Gesellschaft, in der ich von 1904 bis 1911 in Ceylon gelebt hatte. Das eine war ein spontanes Gefühl von Vertrautheit, und zwar sowohl emotionaler als auch intellektueller Vertrautheit, die mich in das Cambridge meiner Jugend zurückführte. Was so anregend an Cambridge und besonderes der Gesellschaft jener Jahre gewesen war, war das Gefühl einer tiefen Vertrautheit mit einer Anzahl von Leuten, die man mochte und die ein leidenschaftliches Interesse an den gleichen Dingen hatten und die gleichen Ziele verfolgten – und die immer bereit waren, über sich und über die Welt zu lachen, sogar über die ernsten Dinge der Welt, die sie selbst sehr ernst nahmen. Aber das war ein Zustand gewesen, der nur auf Cambridge und die Society zutraf, auf eine kleine Zahl von Menschen, die Apostel waren. Auf den Gordon Square von 1904 traf das nicht zu, und vor allem schloss es Frauen ganz aus. Am Gordon Square im Juli 1911 war das Neue und Erregende für mich, dass das Gefühl von Vertrautheit und vollständiger Denk- und Redefreiheit viel umfassender war als in Cambridge vor sieben Jahren, und dass es vor allem Frauen einschloss.
1904 wäre es unvorstellbar gewesen, Lyttons oder Thobys Schwestern mit Vornamen anzureden. Es ist von merkwürdiger gesellschaftlicher Bedeutung, wenn man Vornamen statt Nachnamen benutzt und sich umarmt, statt einander die Hand zu geben. Wer nie in einer förmlichen Gesellschaft gelebt hat, kann diese enorme Bedeutung überhaupt nicht ermessen. Es erweckt ein – oft unbewusstes – Gefühl von Vertrautheit und Freiheit und reißt Schranken des Denkens und Fühlens ein. So konnte man bestimmte Themen diskutieren und gewisse (sexuelle) Dinge beim Namen nennen, was in Gegenwart von Miss Strachey und Miss Stephen vor sieben Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Hier fand ich zum ersten Mal einen viel vertrauteren (und offeneren) Freundeskreis vor, in dem die vollkommene Denk- und Redefreiheit jetzt auf Vanessa und Virginia, Pippa und Marjorie ausgedehnt war.
Edgar und ich kehrten Mitte August2 nach England zurück, und die folgenden fünf Monate waren die aufregendsten Monate meines ganzen Lebens. Während dieser Zeit entwickelte sich »Bloomsbury« richtig, und ich verliebte mich in Virginia. Ich fühlte, dass die Fundamente meines Lebens mehr und mehr ins Wanken gerieten, eine Krise folgte auf die andere, sodass ich kurzfristig die Entscheidung treffen musste, ob ich mein Leben nicht vollkommen umkrempeln sollte. Es gibt nichts Anregenderes, als solche Entscheidungen treffen zu müssen, in dem (zweifellos falschen) Gefühl, dass man Herr seiner Gefühle und Meister seines Geschickes ist. Der Schatten im Hintergrund meines Lebens war Ceylon. Hier in London und Cambridge wurde ich in den nächsten paar Monaten in ein Leben gestürzt, das in jeder Hinsicht das Gegenteil von dem war, was ich in Hambantota zurückgelassen hatte und zu dem ich am Ende meines Urlaubs zurückkehren sollte. Noch bevor ich beschloss, Virginia zu fragen, ob sie mich heiraten wolle, war mir klar, dass ich früher oder später entscheiden musste, ob ich wieder in den Verwaltungsdienst nach Ceylon zurückkehren oder alles hinwerfen wollte.
Wenige Tage nach meiner Rückkehr aus Dänemark begann ich, Das Dorf im Dschungel zu schreiben. Der Dschungel und die Menschen, die in den singhalesischen Dschungeldörfern lebten, faszinierten, ja verfolgten mich schon in Ceylon. Sie verfolgten mich in London, in Putney oder Bloomsbury, und in Cambridge weiter. Das Dorf im Dschungel war ein Roman, in dem ich sozusagen stellvertretend ihr Leben zu leben versuchte. In gewisser Weise war er auch ein Symbol für den Antiimperialismus, der mich in meinen letzten Jahren in Ceylon immer stärker gepackt hatte. Die singhalesische Lebensart in der bezaubernden Berglandschaft um Kandy oder auf den Reisfeldern und Kokosnussplantagen des Tieflands und vor allem in den fremdartigen Dschungeldörfern war es, die mich in Ceylon so fesselte; die Aussicht auf ein verfeinertes, europäisiertes Leben in Colombo, auf die Kontrolle über das Räderwerk der komplizierten Maschinerie der Zentralverwaltung mit dem trostlosen Pomp und Zeremoniell der imperialistischen Regierung erfüllten mich mit Zweifeln und Abscheu. Und ich wusste, wenn ich nach Ceylon zurückginge, würde ich mit ziemlicher Sicherheit nicht in das Dorf im Dschungel kommen, sondern an den Sitz der Macht in Colombo. Je länger ich an dem Dorf im Dschungel arbeitete, desto widerwärtiger war mir die Aussicht auf Erfolg in Colombo.
Virginia und Adrian Stephen wohnten zu der Zeit in einem großen Haus am Fitzroy Square und hielten einmal die Woche ihren »Abend«. Virginia hatte außerdem ein Landhaus in Firle bei Lewes gemietet; dorthin lud sie mich zu einem langen Wochenende im September ein. Es war noch immer Sommer, der endlose Sommer dieses wunderbaren Jahres, und als wir lesend im Park von Firle saßen oder über die Downs wanderten, schien es, als würden nie wieder Wolken den Himmel verdunkeln. Es war das erste Mal, dass ich die südlichen Downs gleichsam von innen kennenlernte, und die Schönheit der sanften weißen Kurven der Felder zwischen den großartigen grünen Kurven ihrer Täler fühlte. Seit jener Zeit habe ich immer in ihrer Nähe gelebt und erlebt, dass ihre natürliche Schönheit und Heiterkeit zu jeder Jahreszeit und Lebenslage ein Glücksgefühl noch steigern und Trübsal lindern kann. Danach begann ich Virginia und ihren Kreis am Fitzroy Square und den Kreis um Vanessa und Clive Bell am Gorden Square sehr häufig zu sehen. Das russische Ballett wurde für eine Weile das kuriose Zentrum sowohl des eleganten wie des intellektuellen London. Es war die große Zeit Diaghilews, mit Nijinski auf der Höhe seines Erfolgs in klassischen Balletten. Ich habe nie etwas Perfekteres oder Erregenderes auf der Bühne gesehen als Scheherezade, Karneval, Schwanensee und die anderen berühmten Klassiker. In fast allen Künsten und sogar in Spielen wie Kricket entwickelt sich zu unterschiedlichen Zeiten nach einem archaischen, verschwommenen Anfangsstadium ein klassischer Stil, der große Kraft, Freiheit und Schönheit mit auferlegter Strenge und Zurückhaltung verbindet. In den Händen eines großen Meisters, wie Sophokles, Thukydides, Vergil, Swift, La Fontaine, La Bruyère, ist diese Kombination von Originalität und Freiheit mit formaler Reinheit und Zurückhaltung unerhört bewegend und erregend, und es war dieses Element von Klassizismus in den Balletten von 1911, das sie so mitreißend machte. Das Vergnügen wurde noch gesteigert, weil man Abend für Abend nach Covent Garden gehen und all seine Freunde, die Menschen, die man am liebsten hatte, um sich versammelt sehen konnte, und sie alle waren bewegt und erregt wie man selbst. In meinem ganzen langen Leben in London ist das der einzige Fall, an den ich mich erinnern kann, wo die Intellektuellen Abend für Abend in Theater, Oper, Konzert oder andere Aufführungen gingen, was sie vermutlich in anderen Ländern und Städten auch taten und noch tun, wie etwa in Bayreuth oder Paris.
Bayreuth ruft mir ein anderes Thema aus dem Herbst 1911 ins Gedächtnis. Unter den ständigen Besuchern des russischen Balletts gab es seltsamerweise eine Wagner-Mode – seltsam deshalb, weil man sich kaum zwei durch und durch gegensätzlichere Produkte des menschlichen Geistes und der menschlichen Seele vorstellen kann. Virginia und Adrian pflegten – fast als Ritual – mit Saxon Sydney-Turner zusammen die Wagner-Festspiele in Bayreuth zu besuchen, wie Hugh Walpole und viele andere später auch. Saxon war meines Wissens in unserem Kreis der Initiator oder Anführer des Wagner-Kults; die Opern gefielen ihm, zum Teil deshalb, weil er sie sammelte wie Briefmarken, und weil das verwickelte Ineinanderverwobensein von »Motiven« seinem außerordentlichen Scharfsinn beim Lösen von Rätseln Aufgaben stellte; das Wotan- oder Siegfried-Motiv in dem Motiv der Feuermusik zu entdeckten, machte ihm das gleiche Vergnügen, wie das richtige Teil in ein Puzzle einzusetzen oder ein Kreuzworträtsel zu lösen. Ich wusste 1911 nichts von Wagner, sah aber ein, dass es an der Zeit war, mich ernsthaft mit ihm auseinanderzusetzen. Ich mietete also im Oktober eine Loge für den Ring in der Covent-Garden-Oper, und Virginia kam mit zu Rheingold, Siegfried und Götterdämmerung und zusammen mit Adrian und Rupert Brooke zur Walküre. Es war ein ungeheures Erlebnis: Die Opern fingen nachmittags an und dauerten bis nach elf Uhr abends; anschließend pflegten wir am Fitzroy Square zu essen. Ich bin froh, dass ich die vier Opern des Ring durchgehalten habe, obwohl ich niemals den Mut oder den Wunsch gehabt habe, das Erlebnis zu wiederholen. Auf seine Weise ist der Ring sicherlich ein Meisterwerk, aber ich mag ihn nicht und Wagner und seine Kunst mag ich auch nicht. Es gibt Stellen in Rheingold, in der Walküre und der Götterdämmerung, die von großer Schönheit und gelegentlich bewegend und erregend sind, aber ich finde sie insgesamt unerträglich monoton und langweilig. Die Deutschen haben im 19. Jahrhundert eine Tradition, eine Lebensphilosophie und Kunst entwickelt, die barbarisch, prunkhaft und unecht sind. Wagner war sowohl Ursache als auch Wirkung dieser widerwärtigen Entwicklung, die zu dem Höhepunkt und der Verherrlichung menschlicher Bestialität und Entwürdigung führte, zu Hitler und den Nazis. Wie gesagt, es gibt schöne und erregende Stellen im Ring; vielleicht kann man sie eher mehr beim frühen Wagner entdecken, in Lohengrin und den Meistersingern. Aber Spaß hat mir der Ring 1911 in meiner Loge, mit Virginia an meiner Seite, nicht gemacht, und Tristan und Parsifal haben mich abgestoßen und übertrafen den Ring bei Weitem an Langweiligkeit und Monotonie.
Im Oktober mussten Virginia und Adrian ein neues Haus suchen, weil der Mietvertrag für das Haus am Fitzroy Square auslief. Sie zogen in ein großes, viergeschossiges Haus am Brunswick Square, das sie auf – für jene Zeit – originelle Weise zu führen vorhatten. Adrian bewohnte die zweite und Virginia die dritte Etage. Maynard Keynes und Duncan Grant teilten sich in die erste, und mir bot man die vierte an, oder vielmehr ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer dort. Sie hatten eine wunderbare alte Familienköchin aus dem 19. Jahrhundert geerbt, Sophie3 und ein Stubenmädchen etwa des gleichen Jahrgangs. Frühstück wurde für alle Bewohner zubereitet, und jeden Morgen gab man schriftlich auf einer Tafel in der Halle bekannt, ob man zum Lunch und zum Dinner da wäre. Alle Mahlzeiten wurden auf Tabletts in die Halle gestellt, jeder nahm sich seins, speiste auf seinem Zimmer und stellte es nach dem Essen wieder in die Halle. Wir teilten alle Ausgaben für Haus und Haushalt miteinander. Ich zog am 4. Dezember ein und sah Virginia von diesem Moment an regelmäßig. Wir aßen oft zu Mittag oder Abend zusammen, wir gingen miteinander zum Gordon Square, um Vanessa zu besuchen oder um dort zu essen, wir machten Spaziergänge auf dem Land; gingen ins Theater oder zum russischen Ballett.
Ende 1911 war mir klar, dass ich Virginia liebte und dass ich ziemlich bald entscheiden musste, was daraus werden sollte. Konnte ich sie bitten, mich zu heiraten? Was war mit Ceylon? In ein paar Monaten war mein Urlaub abgelaufen, und ich würde nach Colombo zurück müssen. Wenn sie mich heiratete, würde ich natürlich den Dienst quittieren, aber was war, wenn sie ablehnte? Wenn sie mich nicht heiratete, wollte ich auch nicht nach Ceylon zurückgehen und erfolgreich im Civil Service wirken und als »Governor« enden. Ich hatte die vage Vorstellung, dass ich zurückgehen und mich für immer in die Verwaltung eines abgelegenen, rückständigen Distrikts wie Hambantota versenken könnte, aber im Hinterkopf dürfte ich schon gewusst haben, dass das bloße Hirngespinste waren. Ein paar Wochen lang schaffte ich es durch ausdauernde gesellschaftliche Aktivitäten, den Augenblick der Entscheidung hinauszuzögern. Ich fuhr nach Cambridge und blieb ein paar Tage als Hardys Gast im Trinity, und eine Woche später war ich wieder dort, als Moores Gast zum Stiftungsfest. Ich besuchte Bob Trevelyan in seinem bitterkalten Haus in den nördlichen Downs bei Dorking, und im neuen Jahr – am 8. Januar 1912 – fuhr ich für eine Woche zu Leopold nach Frome in Somerset.
Der Übergang von dem unaufhörlichen Wirbel Londons zur ruhigen Schläfrigkeit eines Pfarrhauses in Somerset war, als käme man direkt aus einem Tornado in eine Windstille oder aus den Saturnalien in ein Kloster. Endlich hatte ich Zeit nachzudenken. Ich brauchte achtundvierzig Stunden, um zu einer Entscheidung zu kommen, und am Mittwoch telegrafierte ich Virginia und fragte, ob ich sie am folgenden Tag sehen könne. Am nächsten Tag fuhr ich nach London und fragte sie, ob sie mich heiraten wollte. Sie sagte, sie wisse es nicht und brauche Zeit – unbegrenzt Zeit –, um mich besser kennenzulernen, bevor sie sich entschließen könne. Das brachte mich wegen meines Urlaubs in Verlegenheit, und es schien mir, soweit es um meine Entscheidung ging, richtiger, alle unwiderruflichen Schritte aufzuschieben, bis sie mir aufgezwungen würden. Also schrieb ich an den Kolonialminister und bat ihn, meinen Urlaub zu verlängern …
Mein Abschied aus dem Civil Service trat am 20. Mai 1912 in Kraft. Bis dahin hatte ich ein Gehalt von 22£ im Monat bezogen, mit dem man in London vor dem Krieg ganz komfortabel leben konnte. Für die Bourgeoisie war das damals ein wirtschaftliches Paradies; die Gesamtrechnung für meine komfortable Wohnung mit erstklassiger Küche betrug zum Beispiel elf bis zwölf Pfund monatlich. Aber nun kam ich nicht umhin, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass ich nach dem 20. Mai ohne feste Arbeit und ohne Lebensunterhalt dastand. Es stimmte schon, dass ich rund 600£ gespart hatte – eine Summe, die ich hauptsächlich aus einem Gewinn von 690£ übrig hatte. Ich hatte das Geld 1908 bei einem Pferderennen gewonnen. Über diese 690£ ist eine völlig falsche Legende in Umlauf gebracht worden, deren Ursprung man nicht erklären kann. Immer wieder wurde mir erzählt, und ich habe es auch mehr als einmal gedruckt gesehen, dass Virginia und ich die Hogarth Press mit dem gewonnenen Geld aus dem Pferderennen begründet hätten. Diese Behauptung ist absolut falsch. Wir begannen die Hogarth Press 1917 mit einem Kapital von 41£. 15s. 3d. Diese Summe setzte sich zusammen aus 38£. 8s. 3d, die wir für eine kleine Druckpresse und Lettern bezahlt hatten, und 3£. 7s. o d, den Gesamtkosten des ersten Buches, das wir druckten und veröffentlichten. Mit diesem Buch machten wir im ersten Jahr 6£. 7s Gewinn, den wir »wieder ins Geschäft steckten«, sodass Ende 1917 das Kapital, das wir in die Hogarth Press investiert hatten, 35£ betrug. Danach trug sich das Unternehmen durch die Einnahmen, und wir mussten nie wieder dafür »Kapital auftreiben«.
Aber von dieser Abschweifung kehre ich zurück zu dem finanziellen Problem, mit dem ich mich Anfang 1912 konfrontiert sah. Das Problem stellte sich mir, aber ich stellte mich ihm nicht. Ich ignorierte es einfach, oder schob vielmehr jede ernsthafte Beschäftigung damit von mir. Von den 600£ konnte ich meine gegenwärtige Lebensweise rund zwei Jahre lang beibehalten. Dann würde ich eine Möglichkeit finden müssen, mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich hatte eine vage Idee, dass ich es versuchen könnte, von meiner Schriftstellerei zu leben, und so beschloss ich, die Arbeitssuche nicht gleich in Angriff zu nehmen, sondern weiter an Das Dorf im Dschungel zu arbeiten.
Während der ersten sechs Monate des Jahres 1912 lebte ich außerordentlich gesellig. Ich fuhr mehr als einmal zum Wochenende nach Cambridge und hielt sogar einen Vortrag vor der Society. Ich besuchte Roger Fry in Guildford und Bob Trevelyan bei Dorking. Ich lernte die Morrells kennen – Philip, den liberalen Abgeordneten, und seine Frau, Lady Ottoline – und war Gast in dem Salon, den Ottoline am Bedford Square führte, und später auch an Wochenenden in Garsington Manor bei Oxford. In dieser Zeit traf ich häufig mit Virginia zusammen, und es geschah etwas, was auf unser späteres Leben großen Einfluss hatte, denn es brachte uns auf Dauer nach Sussex. Als ich sie in ihrem Landhaus in Firle besuchte, wanderten wir eines Tages über die Downs von Firle zum Tal der Ouse und trafen in einem dieser reizenden Täler oder Senken auf ein außerordentlich romantisch aussehendes Haus. Es lag an der Lewes-Seaford Road, aber zwischen Haus und Straße war eine große Weide voller Schafe. Es hatte Ausblick nach Westen, und aus seinen Fenstern und von der Terrasse vor dem Haus blickte man über die große Weide und das Ousetal auf die Kammlinie westlich des Flusses. Hinter dem Haus war ein steiler Hang, und im Norden und Süden führte eine Ulmenallee auf beiden Seiten der Weide zur Straße hinunter. Es gab Scheunen hinter dem Haus, aber abgesehen von der Hütte des Schäfers war weit und breit kein einziges Gebäude zu sehen.