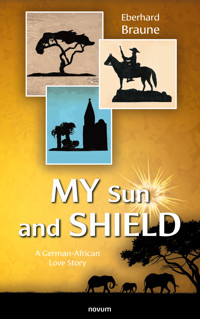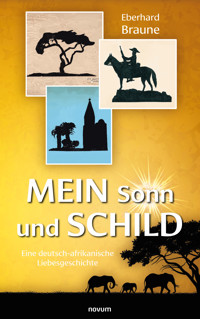
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ist unsere Kolonialgeschichte wirklich abgehandelt? – Der Autor nimmt uns auf eine tief persönlich empfundene Reise in unsere kollektive Vergangenheit – Sklaverei, Kolonialismus, Holocaust und auch der Neuanfang sind verknüpft. Wir tragen noch an den menschlichen Verfehlungen dieser Zeit. "Die Menschen haben Gott vergessen; deswegen ist alles passiert." Dagegen strahlt Afrikas sonnige Natur und eine neuerfahrene Liebe Gottes durch das Buch. Es geht um den tieferen Sinn und um Versöhnung im Auf und Ab des Menschengeschehens ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99146-522-5
ISBN e-book: 978-3-99146-523-2
Lektorat: Volker Wieckhorst
Umschlagfotos: Eberhard Braune; Yevgenii Movliev, Tarapong, Maksym Velishchuk | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Bild 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21: Eberhard Braune
Bild 10:https://www.namibiana.de/namibia-information/lexikon/begriff/wasserwirtschaft-in-swa-waterwese-in-swa-water-affairs-in-swa-by-h-w-stengel.html
Bild 11:https://www.theheritageportal.co.za/files/christuskirche-windhoek-restorica-august-1978png
www.novumverlag.com
Widmung
An Felicity
in liebevoller Erinnerung
in Freud und Leid in Seinem Schatten
für unsere Kinder und Kindeskinder
für Gottes Kinder überall
Worte zum Anklingen
Jede Geschichte ist eine Perspektive seiner Zeit und des Erzählers. Deutschland, seine Menschen, seine Geschichte, seine Kultur und seine Landschaft sind für mich eine immerwährende Quelle der Freude und Besinnung. In Deutschland habe ich auch zum ersten Mal Gott erfahren durch Menschen, die ihn lieb gehabt haben. Und als Deutscher in Afrikas Weiten erweitert sich die Perspektive fast ins Unendliche – na, nicht ganz.
„Wie oft sind wir geschritten
auf schmalen Negerpfad
wohl durch der Steppen Mitten
wenn früh der Morgen naht.
Wie lauschten wir dem Klange,
dem altvertrauten Sange
der Träger und Askari:
Heia, heia, Safari.“
Hans Anton Aschenborn (1888-1931)
Großvater Karl schrieb seinen Enkeln zur Auswanderung nach Afrika: „Gold habe ich nicht gefunden, auch keine Diamanten, aber von dem inneren Reichtum, den mir das Land (Deutsch-Südwest) schenkte, zehre ich noch heute.“ Der Becher ist voll, ja, er läuft über und will erzählt werden. Es geht hier nicht um das eigene Ich, sondern um das Schauen einer gewissen Erdenzeit. Aus Worten von Pastorin Sigi Oblander, auch Ostdeutsche, habe ich gelernt, dass manchmal ein ganzes Leben als Vorbereitung nötig ist, um dahin zu gelangen, wo Gott es vorgesehen hat.
Ohne dass meine Mutter, Tilla, nicht die liebevolle Brücke zur Vergangenheit wurde und immer wieder Sachen für uns Kinder aufgeschrieben hätte, wäre ich nie über den Start gekommen. Sie in diesen Seiten in ihren eigenen Worten zu hören, bringt das Erlebte bestimmt näher. Ohne dass Frauchen, Felicity, nicht immer wieder menschliche Schwächen ausgeglichen hätte, hätte ich heute nicht den Mut, Gedanken und Selbsterlebtes mit anderen zu teilen. Zu der dritten Reise nach Deutschland wäre es ganz bestimmt niemals ohne Gerda, Leon, Yorke, Marita, Surina, Louise, Beke und Judith gekommen. Wir sind Brüder und Schwestern geworden und sind noch immer zusammen im Geist auf Reise. Das Erzählte ist für Deutsche, und so musste es in deutscher Sprache – schwere Sprache – geschrieben werden. Ich hoffe trotzdem, dass es fließt und anspricht. Durch den Novum Verlag für Neuautoren konnte es überhaupt zu einem gedruckten deutschen Buch kommen. Mit seinem Profi-Team zusammen zu arbeiten, wurde ein besonderes Erlebnis.
Tief dankbar bin ich meinem Schöpfer, der mir immer bewusster „Sonne und Schild“ auf meiner Reise wurde. Und so will ich erzählen, so soll es anklingen.
Kein schöner Land in dieser Zeit,
als hier das unsere weit und breit.
Gute Reise – Heia Safari.
Gott mag es schenken, Gott mag es lenken,
Er hat die Gnad.
Erste Weihnacht in Südwest
„Wende Dein Gesicht der Sonne zu,
und Du lässt den Schatten hinter dir.“
Afrikanisches Sprichwort
1951 – Ein Schicksalsjahr für uns –, Flucht aus der Ostzone, Monate des Wartens in Westdeutschland, endlich die Schiffsreise nach Afrika, und nun die erste Weihnacht in Südwest. Südwest, das ist Südwestafrika. Wir, das ist die Mutter Tilla, der Vater Wolfgang, meine ältere Schwester Runhild, mein jüngerer Bruder Helmut und ich, der Eberhard, im April zehn geworden.
Geboren bin ich in Schwerin/Mecklenburg. Ich bin schon im ersten Jahr auf der Farm ein Südwester geworden. Das Südwesterlied, 1937 von Heinz Anton Klein-Werner geschrieben, muss man kennen, um das zu verstehen. Da heißt es:
„So hart wie Kameldornholz ist unser Land
Und trocken sind seine Riviere.
Die Klippen sind von der Sonne verbrannt
Und scheu sind im Busche die Tiere.
Und sollte man Euch fragen,
was hält Euch denn hier fest, ja fest,
Wir könnten nur sagen wir lieben Südwest.“
Wie lieb habe ich die Sonne und das Licht, den Kameldornbaum, eine Schirmakazie und Wahrzeichen des Landes, die „Riviere“, das sind die Flüsse, die meine Arbeit wurden, ein Leben lang als Hydrologe. Und den Busch und seine Vogel- und Tierwelt, es gibt nichts Schöneres. Die erste Farm war Ibenstein am Schafrevier, ungefähr 2 Stunden Autofahrt von Windhoek und meinem Schülerheim entfernt.
Als ich nach drei Monaten Schule und Schülerheim zum ersten Mal zu einem langen Wochenende auf die Farm konnte, war die Freude einfach zu groß. Ich war hinten auf dem Lastwagen und trommelte immer wieder aufs Autodach, worauf der Fahrer nicht anders konnte als anzuhalten und nachzusehen, ob alles in Ordnung war. Jeder Moment wurde ein Erlebnis. Im breiten, sandigen Schafrivier lernte ich das Eselreiten zusammen mit den „Pikanins“, den kleinen schwarzen Jungs der Farm. Und natürlich lernte ich schnell das Otjiherero als Umgangssprache. „Omonenne“ heißt groß und „katiti“ ist klein. Der Vorgänger meines Vaters als Farmverwalter hieß überall Katiti Müller, weil es so viele Müllers gab.
Farm Ibenstein war nur eine Űbergangsstation bei Freunden gewesen, bis Stiefvater Wolfgang eine eigene Farmverwalter-Stelle finden konnte. Das wurde dann die Farm Okakombo, eine Stunde per Auto von dem kleinen Ort Omaruru entfernt, aber 400 km von Windhoek und Schülerheim. Gefarmt wurde mit Karakulschafen und auch mit Rindern. Aufregend war es, wenn die Schafe abends von der Weide kommen und zur Tränke rennen. Gezählt werden die Schafe jeden Tag, wenn sie durch ein kleines Tor, alle auf einmal, versuchen, in den Kraal, so heißt das Viehgehege um die Tränke, zu kommen. Da ist das Zählen gar nicht leicht, und der Rat für den Anfänger war stets: „Zähl einfach die Beine und teil durch vier.“ Der Höhepunkt war aber das Brennen der jungen Rinder. Im Kraal werden sie einzeln mit einem Lederriemen am Hinterbein gefangen, von drei Mann umgeworfen und festgehalten, während ein vierter mit dem Brandeisen das Zeichen der Farm auf das Hinterteil anbringt. Die Szene – Staub, Geblök und Männergeschrei – muss man sich vorstellen. Die Hereros sind einfach Könner, was den Umgang mit Rindern anbetrifft. Ich kann mich an den langen Theodor erinnern, der alle übertraf, wenn es zum Brennen kam. Jeremias war der Schafspezialist, wichtig beim regelmäßigen Schlachten der Lämmer. Die Felle müssen abgezogen werden und zum Trocknen auf einen Rahmen gespannt werden, um eines Tages zu einem schicken Karakulpelz oder Mantel zusammengenäht zu werden. Die Fellchen kommen auf eine Auktion, wo Kenner die Qualität der Locke begutachten und den Preis bestimmen.
Auf der Farm Okakombo
Okakombo ist 5000 Hektar groß, wobei 1 Hektar 100x100 Meter sind. Die Farm ist in verschiedene eingezäunte „Kamps“ aufgeteilt, jeder Kamp mit seiner eigenen Wasserstelle. Die braucht man, um das Vieh regelmäßig zwischen den Kamps zu wechseln, um die Weide zu schonen. Zu den Kamps kommt man auf schmalen Sandpads mit dem Lastwagen oder zu Pferd. Ein Mitfahrer ist immer gefragt für das Auf- und Zumachen der vielen Farmtore – am Anfang nicht leicht, denn jedes Tor hat sein eigenes Drahtpatent. Die Fahrt ist jedes Mal ein Abenteuer, denn man weiß nie, was plötzlich aus dem dichten Busch erscheint – ein paar Erdmännchen, aufrecht am Padrand sitzend, zwei Stachelschweine unterwegs oder ein riesiger Kudubulle, der mit einem Satz im Busch verschwindet.
Zur Schule ging es von hier aus nur mit der Bahn, erst mal mit der Schmalspurbahn bis Karibib und dann mit der großen Bahn weiter nach Windhoek. Es gibt ein Foto von mir aus dem Zugfenster auf dem Omaruru-Bahnhof, das heißen könnte: „Auf die Zähne beißen, sonst kommen die Tränen.“ Zurück ins Schülerheim war nie leicht, aber dafür konnten Runhild und ich zweimal im Jahr in den großen Ferien nach Hause auf die Farm.
Meine Mutter hat uns etwas von dem ersten Weihnachten in Südwest, 1951, aufgeschrieben. „Mitte Dezember waren wir alle fünf zum ersten Mal auf Okakombo vereint! Die Freude, die uns alle erfüllte, ist mir zu beschreiben unmöglich. Die Kinder hatten sechs Wochen Schulferien und sollten nun auf Okakombo ein neues Zuhause finden, nach all den Schrecken, Ängsten und Sorgen, die Flucht und Heimatlosigkeit mit sich brachten. Das war nicht schwer, denn jeden Tag gab es etwas Neues zu erleben: die herrliche Landschaft mit dem Götterberg der Hereros, dem Okonjenje, in der Ferne, die Eingeborenen und ihre ausdrucksvolle Sprache, die Arbeit auf der Farm, das Vieh in den Krälen und das Wild im Feld.
Erst mal gab es viele Vorbereitungen, um überhaupt alle im ‚Haus’ unterzubringen. Wolfgang hatte mir schon eine Wasserleitung vom Windmotor zum Haus gelegt, hatte für die Badewanne, die im größten Badezimmer der Welt stand, nämlich in Gottes freier Natur, eine Nische am Haus hergerichtet, hatte das Wellblechdach des Hauses mit weiteren großen Steinen belegen lassen und die große Veranda mit Pfeilern abgestützt.“
Die ersten Weihnachtseinkäufe in Omaruru, 60 km Sandstraße entfernt, waren für die Farmangestellten. Jeder Mann bekam ein Hemd und eine Hose und für jede Frau 8-12 m Stoff, Blaudruck, für ein Kleid. Damit wurde die bekannte Herero-Tracht, das lange viktorianische Kleid mit den vielen Unterröcken und dem hohen Kopfschmuck, angefertigt. Für die Weihnachtsbäckerei konnte die Farm Milch, Butter und Eier liefern, und die Plätzchen waren ein großer Erfolg. Verzweifelt hatte ich über Wochen nach roten Äpfeln für die bunten Teller gesucht. Die Sommerweihnachten hatten alles ein bisschen durcheinandergebracht. Aber zwei Tage vor Weihnachten waren auf einmal rote Äpfel da. Dass sie nicht schmeckten, wusste ich da zum Glück noch nicht.
Der 24. Dezember brach an. Die Hitze war nach unseren damaligen Begriffen kaum überbietbar. Gegen Mittag teilte Wolfgang an jeden, der auf der Farm oder im Haus arbeitete, die doppelte Wochenration an Kost aus: Kaffee, Tee, Zucker, Maismehl – ihr Hauptnahrungsmittel –, Petroleum und Streichhölzer. Milch für „Omeire“ (Dickmilch) bekamen sie schon morgens, gleich nachdem Anna gemolken hatte. Aber das Fleisch für die Festtage musste noch verteilt werden. Jeremias, der Vormann, hatte dem neuen „Baas“ (Farm-Herr) vorgeschlagen, die „verrückte“ Kuh zu schlachten, und so geschah es. Um die Übergabe der „Präsente“ (Geschenke) ein wenig festlich zu gestalten, wurden Bretterkisten mit weißen Bettlaken und grünen Zweigen aus dem Feld bedeckt. Zu den Geschenken kamen dann noch Kuchen und „Lekkers“ (Bonbons) als Verzierung. Nun hatten wir uns noch festlich anzuziehen, bevor unsere Eingeborenen kamen. Jetzt erst konnten wir die Kerzen aus dem Kühler holen, sonst wären sie uns längst geschmolzen. Bald kam ein langer Zug von der Werft zum Farm-Haus. Wendoline ging voran, nein, sie schritt, wie alle Herero-Frauen. Alle waren sauber gekleidet, und Anna, die alte Melkerin, hatte ihr Kleid, aus dem immer eine Brust herausschaute, mit großen Sicherheitsnadeln geschlossen. Wir waren gespannt, aber Wolfgang hatte uns instruiert, wie sich die Bescherung abspielen würde. Während alle Männer und Frauen sich im Halbkreis vor der Veranda aufbauten, zündete ich die Kerzen an. Und nun begannen sie zu singen. O du fröhliche, O Tannenbaum und auch Stille Nacht. Es bewegte uns sehr, hier mitten im Busch deutsche Weihnachtslieder in einer fremden Sprache, Herero, zu hören.
Wolfgang machte seine Ansprache auf Deutsch, und Jeremias übersetzte. Nach einem Glas Wein für alle teilte Wolfgang die „Präsente“ aus, und der Bann war endlich mit vielen „dankie Baas“, „dankie Mister“ und „dankie Missies“ gebrochen. Wir durften nun lachen und reden und jedem „Frohe Weihnachten“ wünschen.
Nach dem Abendessen wollten wir Weihnachten in der Familie feiern. Als es soweit war, steckte ich die Kerzen in die Halter, und Wolfgang zündete sie an. Ein Glöckchen hatte sich irgendwo gefunden, und so konnten die Kinder wie zu Hause gerufen werden. Eberhard sprach die Weihnachtsgeschichte, und Runhild sagte ein Gedicht auf. Das singen unserer alten schönen Weihnachtslieder ging gar nicht schlecht, ganz ohne Grammofon oder Musikinstrumente. Dann durften endlich die Geschenke besehen und ausgepackt werden. Für uns hatten die beiden Großen gebastelt und gehandarbeitet. Strahlende Augen, lachende Gesichter, Weihnachtsfreude!
Die beiden Pakete von meinen Eltern aus Schwerin und von Wolfgangs Schwester Gudrun aus München packten wir gemeinsam beim milden Licht der Petroleumlampe aus. Aus Gudruns Paket schälte sich eine Meissner Kaffeekanne heraus. Meissen! Hier am Ende der Welt! Da stand sie nun inmitten des dürftigen Müllerschen Mobilars und fühlte sich gar nicht wohl. Aber sie brachte uns einen Gruß aus einer uns sehr fern gewordenen Welt, und es war mir, als verkündete sie mir eine besondere Botschaft – ihr werdet euch und euren Kindern eine Atmosphäre schaffen, die eurem Lebensstil gemäß ist. Im Paket meiner Eltern waren mehrere Dosen mit Pfefferkuchen von Haeberlein in Nürnberg. Mein Schrecken war größer als die Freude. Wie viel Schmuck hatte meine Mutter wohl hingeben müssen, für Westgeld, um diese Bestellung bei Haeberlein zu machen? Ach nein, Mutti, dachte ich, das hättest du nicht dürfen! Es dauerte lange, bis ich erkannte, was meine Mutter mit ihnen schickte: Erinnerung, Erinnerung an unser Berliner Zuhause, an unsere Weihnachtsfeste in noch unbeschwerter Zeit, Erinnerung an das, was wir verloren – und so nahm ich ihr Geschenk in tiefer Dankbarkeit an. Es war Heiligabend im Familienkreis mit vielen Gedanken an all das Schöne in unserer deutschen Heimat.
Spätabends, als sich schon alle zurückgezogen hatten, trat ich noch mal mit Runhild in die sternenübersäte Nacht hinaus. Stille, Unendlichkeit und Erhabenheit umgab uns, fast zu viel für ein menschliches Herz. Ein Südwester Weihnachtsgedicht, das der afrikanischen Weihnachtsstimmung entspricht, gehörte von da an zu jedem unserer Weihnachtsfeste in Afrika.
Die Heil’ge Nacht ist da,
so selten schön, wie ich sie niemals sah!
Es fällt kein Schnee, die Luft streicht lau und warm,
wie deutscher Frühling um die Farm.
So fern, so fern liegt alles Menschentreiben.
Kein Laut wird wach, nur dass im fernen Kraal
das Vieh sich regt, wie träumend noch einmal.
Rings dehnt der Busch sich unabsehbar weit
In seiner ernsten, großen Einsamkeit.
Und immer leuchtender schickt durch das Dunkel
des Südens Kreuz sein fremdartig Gefunkel.
Wie schwer muss es wohl für jeden Einzelnen von uns gewesen sein, als Okakombo, die neue Heimat, drei Jahre später verkauft wurde. Der Vater war plötzlich ohne Aufgabe und ohne Einkommen. Tilla fand eine Anstellung als Lehrerin in Omaruru, und Wolfgang fand nach langem Suchen eine Lagerverwalterstellung in Swakopmund, 300 km von allen entfernt. Es dauerte noch weitere drei Jahre, bis beide Eltern eine Stellung in Windhoek finden und eine gemeinsame Wohnung mieten konnten. Eberhard, der Schülerheimer, zog in ein neues Zuhause.
Die wenigen Farmjahre wurden bestimmend für mein ganzes Leben. Gottes freie Natur wollte ich nicht mehr missen, sie ständig zu sehen, zu hören, zu tasten und tief zu empfinden, das sollte zum normalen Leben gehören. Mein Beruf als Hydrologe und die lebenslange Teilnahme an der Wasserentwicklung im südlichen Afrika waren wie ein Geschenk. In den ersten Arbeitsjahren in Südwest hab ich das Land kreuz und quer durchreist, mein „Bett“ stand meist unter freiem Sternenhimmel. Jede Stimmung der Natur konnte ich erleben, den weiten Horizont, die gelben Gräserwogen, die blauen Berge in der Ferne, die weißen Wolkenberge, die sich in der Regenzeit täglich auftürmen, bis es endlich regnet, und den unglaublichen Schein ringsherum nach dem ersten Regen.
Aber im Laufe der Lebensjahre wuchs auch noch eine zweite Heimat. Deutschland steckte schon irgendwie in mir, durch Muttersprache, durch Sehnsucht der Eltern, durch das viele Schöne in Bildern, Worten und Gedanken, die mich als junger Mensch ständig umgaben und die ich bald selber bewusst mehr und mehr suchte. Bei meiner Schwester Runhild geschah es noch bewusster. Sie hatte die Schule schon frühzeitig verlassen müssen, um mitzuverdienen. Bald heiratete sie einen jungen Kaufmann aus Hessen, mit dem sie sich eine deutsche Heimat in Afrika schaffte. Und dann ein kleines Wunder. Noch zu Runhilds Lebzeiten heiratete ihre Tochter den Farmer der Farm Mecklenburg. Kaum zu glauben, für uns Mecklenburger! Dort liegt Runhild nun schon einige Jahre unter einem wunderschönen Dornenbaum begraben.
Herkunft
„Erst die Fremde lehrt uns,
was wir an der Heimat besitzen.“
Theodor Fontane
In mir ist etwas Deutsches, Schönes, Starkes, das Jahrhunderte, ja, Jahrtausende zurückreicht. Ich fühle mich Deutschland, seinen Menschen und seiner Geschichte tief verbunden. Irgendwie ist es mehr als meine unmittelbare Familie, es sind ganze Landschaften, verschiedene Mundarten und Gewohnheiten und natürlich Schrifttum und Musik, aus der all dies anklingt.
Alles, was ich über meinen Vater Eberhard Braune (geboren 1911 Schwäbisch-Gmünd, gefallen 1942 Woronesh, Russland) weiß, habe ich aus Erzählungen und Niederschriften meiner Mutter und aus einer Mappe mit Dokumenten von ihm. Sie waren im kleinen Rollschrank in unserer Schweriner Wohnung, wahrscheinlich vom Vater dort hineingelegt, während seines letzten Fronturlaubes, 1942. Meine Mutter weiß nur, dass sie vor der Flucht, 1950, einige Sachen aus dem Rollschrank herausgenommen hatte, die mit nach Westdeutschland und dann nach Afrika kamen. Diese Mappe hatte sie nach vielen Jahren zum ersten Mal geöffnet und mit einem Schreiben an mich weitergegeben.
„Aus der Ahnentafel kannst Du ersehen, dass Du ein Nachkomme von Carl-Christian Braune bist, der 1807 in Anhalt geboren wurde. Anhalt liegt in Mitteldeutschland. Die Hauptstadt ist die Universitätsstadt Halle. Anhalt ist ein flaches, fruchtbares Land und hat, soweit das Auge sehen kann, Weizen- und Zuckerrübenfelder. Dieser Teil Deutschlands wird von der Saale durchflossen, einem Fluss, der im deutschen Volkslied verherrlicht wird:
An der Saale hellem Strande stehen Burgen stolz und kühn,
ihre Dächer sind verfallen und
der Wind streicht durch die Hallen.
Wolken ziehen drüber hin.“
Carl-Christian Braune war Landwirt und Besitzer eines großen Gutes. Er war ein sehr intelligenter Bauer, eisern streng und von früh bis abends fleißig. Sein Sohn, Friedrich-Carl Braune, geb. 1834, vergrößerte den Besitz um ein Vielfaches. Seine Tochter Therese schrieb meiner Mutter aus ihren Erinnerungen: „Mein Vater hatte nur die Dorfschule besucht, war aber ein aufgeweckter Mensch und ein „selfmade man“ im besten Sinne des Wortes. In der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts, als in England die ersten Versuche der Industrialisierung begannen, in Deutschland aber von solcher Entwicklung noch nichts zu spüren war, kam er auf den Gedanken, aus seinen Gütern Saatzuchtbetriebe zu machen und Zuckerrübensaatgut zu verkaufen.
Die Braunes sind aus Anhalt
Die sorgfältige Auslese der Mutterrüben geschah in einem großen Laboratorium, in dem bis zu 14 Chemiker tätig waren. In Versuchsgärten mit Erwärmung des Bodens wurden verschiedene Düngearten ausprobiert und die besten Samen gezogen. Stecklinge aus diesen Gärten gingen an verschiedene Plantatoren, die daraus Zuckerrüben für die Fabriken zogen. Seine geschäftlichen Beziehungen und Aktivitäten weiteten sich über Deutschlands Grenzen aus nach Amerika. Unermüdlich fleißig saß er schon früh um 4 Uhr morgens am Schreibtisch, um seinen Beamten Dispositionen für die Arbeit zu geben. Punkt 5 Uhr musste ich den Kaffee bringen, dann ging der Vater durch die Wirtschaft, ritt ins Feld, und später erledigte er die umfangreiche Post. Bei aller Herzensgüte war er doch streng und verlangte viel von uns: ‚Ich kann nicht von meinen Leuten verlangen, dass sie da sind, wenn meine Kinder noch in den Betten liegen.‘“
Mein Großvater Alfred, der Benjamin der Familie, und seine Schwester Therese lösten sich aus der Firma und wurden von ihrem Vater Friedrich-Carl ausgezahlt, sie durch Heirat und Alfred, weil er aktiver Offizier im deutschen Kaiserreich wurde. Sein Einsatz als Truppenführer war mit dem Eisernen Kreuz II. und I. Klasse ausgezeichnet worden. Immer wieder war auch der liebe und stets hilfsbereite Mensch im Soldaten und Vorgesetzten zu erkennen. Seine Schwester erzählte ein treffendes Geschehen aus der Kriegszeit:
Die Großeltern Braune und Schmidt
„Alfred Braune, der Kompaniechef, nahm seinen Urlaub vor Weihnachten. Obwohl er selbst zwei kleine Söhne hatte, war es für ihn selbstverständlich, die für Soldaten im Krieg so schweren Weihnachtstage mit seinen Männern zusammen zu verbringen. Er fuhr Anfang Dezember von irgendwo in Frankreich in Richtung Heimat. Beim Abschied von seiner Truppe sagte er, alle könnten ihren Frauen seine Anschrift mitteilen, damit sie kleine Liebesgaben an seine Adresse schicken und er sie ihnen zum Heiligen Abend mitbringen könne. Im Laufe seines dreiwöchigen Urlaubs häuften sich die Liebespakete derart, dass er nicht wusste, wie er ihrer Herr werden sollte. Und immer mehr und immer größere Pakete, und nicht nur von den Frauen seiner Leute, kamen. Er hatte versprochen, alles mitzubringen, aber wie? Da kam ihm der rettende Gedanke: einen Eisenbahnwagen zu organisieren. Und so geschah es. Auf seine Kosten übernahm ein Waggon der Eisenbahn alle Pakete, sie kamen rechtzeitig an und brachten seinen Männern die größte nur mögliche Freude.“
1910 heiratete er Hanna, Tochter des Papierfabrikbesitzers Heinrich Lange, auch in Bernburg. Alfred Braune ließ sich später mit Hanna in Schwerin/Mecklenburg nieder, nachdem er den Ersten Weltkrieg als Hauptmann und Major überstanden hatte. Er erwarb das große, schöne Haus in der Schlossgartenallee, das in schweren späteren Jahren vielen ein Zufluchtsort werden sollte. Zu den drei Jungs, Eberhard, Wilfried und Karl-Heinz, kam nach dem Krieg noch Axel hinzu. Alfred konnte ein großes Haus führen mit viel Personal und konnte sich Grundbesitz und Jagden in anderen Teilen Mecklenburgs kaufen. Alfred stand zeit seines Lebens auf der Sonnenseite. Er liebte das Leben, die Menschen, die Tiere, Blumen und Bäume. Er war sehr musikalisch und hatte eine wunderbare Stimme. Aber schon 1925 starb Alfred nach kurzer schwerer Krankheit (Leukämie). Zu meiner Mutter sagte seine verbliebene Frau Hanna einmal später: „Lebte Alfred noch, so würde er dir jeden Morgen eine Rose zum Frühstück bringen.“
Der Älteste, Eberhard, war gerade 14 Jahre alt, als der Vater starb. Eberhard wurde der Helfer der Mutter in Erziehungsfragen und auch in Geldangelegenheiten. Alle vier besuchten das humanistische Gymnasium in Schwerin. Eberhard bestimmte, dass sich alle der Bündischen Jugend anschlossen. Dadurch gab es keine Erziehungsprobleme. Auf ein paar Schwarzweiß-Fotos kann man eine harmonische Jugend ersehen. Die Jungen zusammen im Schlossgarten, auf Lager mit Musikinstrumenten oder im Paddelboot. Aus Dokumenten, die zehn Jahre einschließen, wird klar, was für eine formende Rolle die Großdeutsche Jugend für diese Jungen und heranwachsenden Männer gespielt hat. Die Bündische Jugend war im 1. Weltkrieg aus der Wandervogelbewegung entstanden.
Ein Fahrtbericht von Eberhard lässt Mecklenburg lebendig werden: „ein Sturm Tag an der Küste, goldgelben die Getreidefelder, breitbeinig der Bauer und hochbeladen der letzte Erntewagen. Abend ist es geworden. Als wir mit festem Tritt Schwerin zuziehen, sinkt flammend die Sonne im Westen. Die Türme Schwerins, von der Abendsonne vergoldet, tauchen auf. Hoch strebt der Dom, die Stadt beherrschend, zum Himmel empor. Turm an Turm, eine wuchtige Masse, unser Schloss. Dort weiche Linien, die Schelfkirche, ein Edelstein aus der Zeit des Barock, ein Schmuckstück der Stadt, unseres Schwerin. Unser Schwerin, unser Mecklenburg jubelt es in unseren Herzen, als wir mit strammem Schritt und zackigem Lied in die Stadt einziehen.“
„Mecklenburg Fahrt“ in Nationale Jugend, 15. Mai 1925
Nach dem Abitur (1929) diente Eberhard bei der Schwarzen Reichswehr und begann danach mit dem Studium der Forstwissenschaft – in München, Hannoversch-Münden und dann an der Forstakademie in Eberswalde. Von viel Schweiß sprechen die langen, auf der Maschine geschriebenen Berichte zur Ablösung der Försterzeit. Von Forstämtern Hinrichshagen, Dargun, Neustrelitz, Rowa und Moidentin bei Neukloster ist die Rede. Zum Abschluss seines Neuklosterberichtes aus dem Jahre 1936 steht dann:
„Damit ist die schönste Zeit, die ich in meiner Referendarzeit bisher gehabt habe, leider beendet. Es war die Zeit, in der ich ein eigenes Revier hatte, in der ich Verantwortung hatte und in der ich Arbeit in Hülle und Fülle hatte, und darum hat mich diese Zeit so restlos befriedigt. Ich konnte viel draußen sein im Wald, aber doch nicht so viel, wie ich erwartet hatte. Die Schreibarbeit, die ein Reviermeister zu leisten hat, hatte ich mir jedenfalls erheblich geringer vorgestellt. Und trotzdem, das Leben eines Revierbeamten ist herrlich in einem so schönen Revier wie Moidentin.“
Ich, der Sohn Eberhards, weiß, daß ich ohne Krieg auch Förster irgendwo in Mecklenburg geworden wäre. Bei meinem Vater war es der Vater, der in ihm auf den vielen Pirschgängen in den schönsten Gegenden Mecklenburgs die Liebe zur Natur geweckt hat. Welch Wunder, dass ich in Afrika so schnell zu dem Hydrologenberuf gefunden hab. Der moderne Hydrologe sieht sich immer mehr als Ökologe und Naturschützer. Und kein Wunder, dass ich auf meinem zweiten Deutschlandbesuch, nach 60 Jahren, mehr Kilometer auf Wald- und Landwegen abgelegt habe als auf der Autobahn. In meinen Tagebüchern ist von den Kranichen am Schaalsee die Rede, von den verschiedenen Singvögeln im Thüringer Wald, von einem Habicht, der vor meinen Augen eine Taube reißt, und überall zwischen dem Text gibt es gepresste Feldblumen (die Küchenzelle, das Gemeine Waldveilchen, Löwenzahn, ein Himmelsschlüssel und ein Märzbecher).
Zu dem eigenen Forstamt, von dem Eberhard immer geträumt hat, kam es nicht mehr. Der Krieg wurde leider der bestimmende Teil seines erwachsenen Lebens. Seine Einstellung zum Wehrdienst fand 1934, mit 23 Jahren, statt, und am 1. September 1939 begann der Krieg, der Zweite Weltkrieg. Eberhard gehörte der Panzerabwehrabteilung 12 Schwerin, später die schwere Panzerjäger-Abteilung 611, als Leutnant an und war Adjutant des Kommandeurs, Prinz zu Waldeck und Pymont. Stationen in Russland waren der Durchbruch durch die Grenzstellungen, die Schlacht bei Smolensk und Durchbruch durch die Dnjepr-Stellung, Abwehrkämpfe im Jelnjabogen, Schlacht bei Kiew, Einnahme von Kursk und Abwehrschlachten dort und dann das Halten des Brückenkopfes Woronesh. Dort fiel mein Vater, der Oberleutnant Eberhard Braune. Hiernach nahm die Abteilung als Teil der Panzertruppen am geplanten Entsatz der 6. Armee im Kessel von Stalingrad teil und wurde dabei im Januar 1943 total vernichtet. Das und den Marsch in die Gefangenschaft im tiefsten russischen Winter brauchte der Vater nicht mehr mitzumachen.
Auch Karl Schmidt, Großvater mütterlicherseits, stammt aus Anhalt. Wirschleben war das Stammgut der Schmidts, wo Karl und seine sechs Geschwister groß geworden sind. Aber sein Vater Friedrich, der Linden-Schmidt, verkaufte später das Gut und die ihm auch gehörende Mühle, weil keiner seiner fünf Söhne das Gut übernehmen wollte. Karl wurde preußischer Offizier und meldete sich zur Schutztruppe nach Südwestafrika. 1912, zurück in Deutschland, heiratete er Mathilde Lücke. Er war Soldat in beiden Weltkriegen, zuletzt, schon 67, Oberstleutnant.
Die Jahre in Deutsch-Südwest als Offizier der Kaiserlichen Schutztruppe wurden für ihn die Erfüllung seines Lebens. Dass er nach vier Jahren wegen einer schweren Malaria nach Deutschland zurück musste, war fast tragisch. Durch die Folgen der Malaria verlor er das Licht des einen Auges. Bis in sein hohes Alter wurde er immer wieder von Malariaanfällen und entsetzlichen Augenschmerzen gequält. Nach längerem Krankenlager in Deutschland erhielt er verschiedene Kommandos in Berlin und in Ostpreußen. Er gehörte dem Regiment 147, dem Hindenburgregiment, an. Im 1. Weltkrieg wurde er beim Sturmangriff in der Schlacht bei Ypern schwer verwundet.
Nach dem Krieg brachte ihm seine lebensbejahende Art eine neue Aufgabe. Mit General Kempe zusammen übernahm er den „Reichsverband für Kriegspatenschaften“, dessen Aufgabe es war, Paten für verwaiste Offizierskinder zu finden. In Deutschland war das zu der Zeit so gut wie unmöglich. Die Großindustrie war zerschlagen und die reichen Fürstenhäuser verarmt. Der Großvater suchte neue Wege und fand Paten und Geldgeber im Ausland, vor allem in Holland und den nordischen Ländern, und da im Besonderen in den Königs- und Fürstenhäusern. Bald nahm das Büro an der Weidendammer Brücke ein ganzes Stockwerk ein. Neben den Büroräumen gab es nun auch Lagerräume für die vielen eingehenden Spenden wie Betten, Matratzen, Wäsche, Kleidung und Nahrungsmittel. 1935, im Rahmen der Gleichschaltung, liquidierte der neue nationalsozialistische Staat alle privaten sozialen Einrichtungen, und so auch den Reichsverband für Kriegspatenschaften. Alle Angestellten wurden entlassen, Gehalt und Pension entfielen. Das Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes erinnert uns noch heute an diese segensreiche Zeit des Großvaters.
Ein besonderes Erbe kam durch Karls Gattin, meine Großmutter, Henriette Ulricke Mathilde Lücke, in die Familie. Zur Verlobung 1935 schenkte ein Großonkel, Willi Wollank, meiner Mutter eine schlichte weiße Empire-Vase aus der Königlich Preußischen Porzellan-Manufaktur mit den Worten: „Halte sie in Ehren, sie ist ein altes Familienerbstück.“ Diese Vase schenkte ursprünglich die berühmte Gräfin Voß (1729–1814), Hofdame der Königin Luise, dem Hugenottenprediger Mulnier am königlichen Sommerhof in Paretz. Er wurde ausgezeichnet für seine Verdienste am preußischen Königshof.
Die Verbindung sah ich viele Jahre später zum ersten Mal bewusst, als ich ein großes Pergamentpapier mit dem Stammbaum der Lückes, auch in den Papieren meiner Mutter, auffaltete.
Johann Friedrich Ferdinand Mulnier – Prediger (1768–1842)Louise Auguste Mulnier (1803–?) & Daniel Liba (Prediger)Ulrike Marie Wilhelmine Liba (1826–1892) & August Friedrich Ferdinand Lücke (Prediger)Friedrich Wilhelm Otto Lücke (Kaufmann, 1851–1911) & Clara Maria Auguste WollankHenriette Ulricke Mathilde Lücke (1885–1980)Die Weltgeschichte, die dazu gehört, ist die Flucht Tausender Hugenotten aus Frankreich nach der Aufhebung des Edikts von Nante 1685. Etwa 20 000 ließen sich in Brandenburg-Preußen nieder, wo Kurfürst Friedrich Wilhelm ihnen besondere Privilegien gewährte. Überdurchschnittlich zahlreich waren Fachkräfte aus dem Textilgewerbe: Tuchmacher, Woll-Spinner, Mützen-, Handschuh- und Strumpfweber, Färber, Gobelin- und Seidenweber, Leinendrucker, Hutmacher und andere. Die größte Kolonie entstand in Berlin selbst, und dort gehörte um 1700 etwa jeder fünfte zu den geflüchteten Franzosen, die hauptsächlich in den neu entstandenen Städten Dorotheenstadt und Friedrichstadt sesshaft wurden. Laut meiner Mutter sprach die Oma Mathilde noch regelmäßig, wenn sie allein waren, mit ihrer Mutter Clara Französisch. Auch ging sie jedes Jahr in der Heiligen Nacht nach der Bescherung zu Hause ganz allein zum Gottesdienst in den französischen Dom in Berlin. Meine Mutter Mathilde (Tilla) wurde 1914 und ihre Schwester Wiltrud 1917 in Berlin-Steglitz geboren. Sie schreibt: „Wir wohnten in der Lauenburger Straße. Die Linden wuchsen uns ins Fenster hinein. Ich liebte den Duft der Linden und das Glockengeläut der nahen Kirche. Unsere Berliner Wohnung war eine ganz besondere Wohnung, groß, weiträumig und sonnendurchflutet, mit Stil und Gepräge, das ihr mein Vater gegeben hatte. Gemälde und Trophäen erzählten von seinen vier unvergesslichen Jahren als Schutztruppler in Südwestafrika.“
Als Tilla als Einundzwanzigjährige ihren Eltern eine Verlobung mit Eberhard Braune aus Schwerin und Student der Forstwissenschaften ankündigte, waren diese hocherfreut. Schon am nächsten Tag fuhr ihr Vater zur Direktorin des Pestalozzi-Fröbelhauses, wo Tilla gerade vor drei Monaten ihre Ausbildung zur Fürsorgerin begonnen hatte, und meldet sie ab. Die jeweilige Reaktion der Eltern ist ein Bild ihrer Zeit, aber auch der absolute Gegensatz dessen, was das Leben ihr noch bereithielt. Der Vater: „Du bist nun bis an dein Lebensende versorgt. Du heiratest in eine der wohlhabendsten Familien Mecklenburgs ein. Du brauchst keinen Beruf.“ Die Mutter: „Du wirst jetzt etwas anderes lernen, als arme Leute zu betreuen und dich dabei kaputt zu machen. Du musst nun lernen, wie man einen großen Forst und Gutshaushalt führt.“
Die Eltern – Eberhard und Tilla Braune
1938, nach einer langen Verlobungszeit, konnte endlich geheiratet werden. Eberhard war nun mecklenburgischer Forstassessor und sollte schon in einem Jahr ein eigenes Forstamt bekommen.
Aber das Glück war bald zu Ende. 1939 brach der Krieg aus, und 1942 musste Tillas Vater ihr die traurige Nachricht übermitteln, dass ihr Mann bei Woronesh auf dem Feld der Ehre gefallen war. Bruder Wilfried war schon 1941, auch in Russland, gefallen. Ein Jahr später erschütterte die Familie ein neuer Schicksalsschlag. Das schmidtsche Haus in der Lauenburgerstraße in Berlin wurde in einer schrecklichen Bombennacht zerstört. Aller Besitz, alle Erinnerungsstücke gingen in Flammen auf. Mit einem Köfferchen standen Karl und Mathilde am nächsten Tag an der Tür des Brauneschen Hauses in Schwerin. „Wir haben kein Zuhause mehr.“
In dieser Zeit wächst etwas Neues in der 28-jährigen Tilla: „Ich erkannte meine mir vom Schicksal aufgebürdete Aufgabe. Diese Aufgabe wart ihr, die Kinder, Euch zu bewahren und zu schützen und in das Leben zu führen. So wuchsen mir im Laufe der Zeit Kräfte zu, die mit dem Verstand nicht zu erklären sind.“ Bald meldete sich Tilla zur Schwesternausbildung beim Deutschen Roten Kreuz und wurde nach bestandenem Examen Schwesternhelferin. Von nun an tat sie täglich Dienst in Lazaretten und auf dem Bahnhof, wenn Verwundetentransporte ankamen. Später ließ sie sich auch in den Lagern für Ausgebombte einsetzen und betreute die jungen Frauen mit ihren kleinen Kindern.
An den Fronten, besonders an der Ostfront, sah es erschütternd aus. Im Februar 1944 fiel auch der jüngste Bruder, Axel, in Russland. 1945 wurde es auch an der Heimfront immer schwerer. Viele deutsche Städte waren durch Bombenangriffe in Trümmerhaufen verwandelt. Wieder war die ganze Familie in die Schlossgartenallee zusammengezogen. Im großen, vornehmen Herrenzimmer wurden nun Matratzenlager aufgeschlagen. Großmutter Hanna hatte außer Tillas Eltern auch noch die Familie Schlabitz, die aus Riga geflohen war, aufgenommen. Im Garten lagerten Flüchtlingstrecks aus dem Osten. Die Frauen kochten und wuschen in Hannas großer Küche.
In den Lazaretten waren die Verhältnisse inzwischen erschütternd geworden. Alle Schulen waren in Aufnahmestationen für verwundete und kranke Soldaten verwandelt worden. Und trotzdem reichten weder Betten noch Räume aus. Die schwer verwundeten Männer lagen auf der Erde und schon auf allen Gängen. Es gab weder Verbandszeug noch Medikamente, nur noch zu essen und zu trinken.
Im Mai kam es zur Kapitulation des Deutschen Reiches und einer neuen schweren Zeit unter den jeweiligen Besatzungsmächten. Zum ersten Mal gab es wirklich Hunger, denn die Versorgung über Lebensmittelkarten funktionierte nicht mehr. Nach kurzer amerikanischer und englischer Besatzung bekam man die Schreckensherrschaft unter der russischen Besatzung zu spüren, die zum Grauen der Zivilbevölkerung wurde und für viele, sehr viele den Tod bedeutete.
Das Prachthaus in der Schlossgartenallee musste von einem Tag zum anderen für die russische Besatzung geräumt werden. Zu der Familie in Westdeutschland gab es keine Verbindung mehr, denn es gab keinen Postverkehr mehr über die Zonengrenze. Tilla schreibt: „Es waren nicht nur Lebensmittelsorgen allein, die mich fast verzweifeln ließen. Die neue Verwaltung ließ mir einen Brief zugehen, wohl der erste Brief nach dem Zusammenbruch, der mich erreichte, welcher mich erstarren ließ. Auf einem grauen Stück Papier mit vielen Stempeln wurde mir mitgeteilt, dass ab sofort meine und meiner Kinder Pension nicht mehr gezahlt wird, weil mein Mann als deutscher Offizier gegen die ruhmreiche und siegreiche russische Armee gekämpft hat. Es war keine Zeit, über diese uns vernichtende Mitteilung zu brüten. Die Dinge überschlugen sich. Diesmal betraf die Nachricht, die in allen neuen Zeitungen abgedruckt war, nicht nur mich und die Familie. Jeder Deutsche war betroffen. Ab sofort wurden alle Konten, alle Sparguthaben, alle Aktien gesperrt. Das neue Wort hieß ,eingefroren‘. Nun waren wir alle völlig mittellos. Dunkel und im Tiefsten erschüttert ging für uns das Schreckensjahr 1945 zu Ende.“
Trotzdem kam es für Tilla zu einem neuen Lebensabschnitt. Die russische Besatzung ließ die Schulen wieder öffnen. Wegen des großen Lehrermangels gab es Aufrufe zu einer Lehrerausbildung. Männer waren entweder noch in Gefangenschaft oder tot oder in der Partei gewesen. Tilla bewarb sich. Im November 1946 bestand sie das Endexamen. Auch ihr Wunsch an der Gerhard-Hauptmann-Schule, ganz in ihrer Nähe, zu unterrichten, wurde erfüllt. „Ich hatte es geschafft. Ich hatte Freude an meiner Arbeit, liebte die Kinder, und sie hingen an mir. Die Hälfte waren Flüchtlingskinder, ganz arm, immer hungrig und immer müde. Das Unterrichten war schwer. Wir Lehrer hatten weder Lehrplan, Anschauungsmaterial noch Bücher. Für Kinder gab es zuerst kein einziges Buch. Hefte und Schreibhefte auch nicht. Papier gab es nicht. Runhild schrieb auf abgeschnittenen Zeitungsrändern. Wir Lehrer durften uns auf den Höfen der Ministerien Seiten aus den Akten holen, die die Russen nach ihrem Einmarsch aus den Fenstern geworfen hatten – zwei Jahre nach Kriegsende das einzige Papier in den Schulen.“
Das Leben in dieser Zeit als Frau allein mit der Verantwortung für zwei vaterlose Kinder blieb stets eine große Herausforderung. Im April 1947 heiratete Tilla wieder. Wolfgang Sydow war Landwirtschaftslehrer in Güstrow, an einer wiedereröffneten Landwirtschaftsschule außerhalb der Stadt. Er kannte Schwester Wiltrud und hatte schon oft in Schwerin bei der Familie Besuch gemacht und hatte immer etwas Besonderes vom Lande mit, sogar richtige Butter und ein Bauernbrot. Dass dies wirklich besonders war, merkten wir erst, als wir alle mit Wolfgang in unsere erste Wohnung neben der Mühle in Mühlrosin bei Güstrow einzogen. Auch auf dem Lande hatte die Bevölkerung weder Mehl noch Kartoffeln, von Fleisch und Fett ganz zu schweigen. Der Russe hatte auf Gespanne und Saatgut Beschlag gelegt, und 1946 und selbst 1947 wurde noch kaum geerntet. Aber trotzdem war es ein Paradies. Im Wald gab es Beeren und Pilze, die wir sammeln konnten. Auch Holz gab es.
Stiefvater Wolfgangs Lebensgang ist eine Geschichte für sich. Hier muss reichen, dass er aus der Neumark stammte und nach einer Landwirtschaftslehre 1937 vor einem Studium erst mal Welt-Luft schnappen wollte – wie sein Vater, der in jungen Jahren als Schiffsarzt die Welt gesehen hatte. Als ihn keiner, wie vereinbart, in Angola vom Schiff abholte, machte Wolfgang die Reise einfach weiter nach Südwestafrika. In zwei Jahren lernte er hier so manches über die Farmerei in Afrika – Rind- und Schafzucht. Es waren glückliche Jahre mit Freundschaften, die ein Leben lang hielten. Aber dann brach 1939 der 2. Weltkrieg aus, und Wolfgang wurde mit den meisten Deutschen des Landes interniert in Lagern in Südafrika, tausende Kilometer entfernt. In seinem Lager, Andalusia, war es ihm beschieden, mit deutschen Akademikern aus Pretoria interniert zu sein. In der provisorischen Lageruniversität lernte er Landwirtschaft und Vorgeschichte. Letzteres wurde später sein Hobby und eigentliche Lebensaufgabe. Und mit der Landwirtschaftsausbildung wurde er, oh Wunder, nach seiner Repatriierung 1945 als Lehrer in Deutschland angestellt.
Nach ein paar Monaten, zusammengedrängt in der Mühle, bekamen wir den Grundflur der „Villa Ulex“, ein wunderschönes Haus im Wald und am Inselsee gelegen. Es war schrecklich verwahrlost, aber Wolfgangs Improvisationstalent bewährte sich, und wir bekamen ein komfortables Heim. Wolfgang schaffte es, auch Frau Ulex und ihre Schwester in ihr Haus zurückzuholen. Als dann General Ulex ein paar Monate später aus russischer Kriegsgefangenschaft heimkehrte, hatte sich schon wieder eine Schicksalsgemeinschaft gebildet.
„Im Januar 1948 wurde Helmut geboren. Alles ging glatt, obwohl ich ein ausgemergeltes Etwas war. Aber der Junge war groß und kräftig. Fast unbegreiflich, wie das möglich war. Ernährung war nur durch die Afrikapakete möglich. Welch ein Glück. Zu kaufen gab es nichts, außer im HO-Laden, den ich nie betreten habe, für sehr viel Geld. Das Einzige, was Mutter und Kind zugebilligt wurde, war für jeden ein ¼ l. Milch, den der kleine Eberhard auf seinem Schulweg aus dem Dorf mitbrachte.“
Ja die Afrikapakete – von Wolfgangs Freunden aus Südwestafrika – kamen auf einmal ab Ende 1947 bei uns in der Ostzone an. Sie verbesserten nicht nur unsere Ernährung wesentlich, sondern erleichterten auch unser Leben. Mit Kaffee und Zigaretten konnten wir vieles eintauschen, z. B. einen Ofen, die Fahrräder und Schuhe. Ich, der Eberhard, kann mich nur an die herrliche, braune Peanutbutter in jedem Paket erinnern.
Aber was ist aus den Braunes geworden? Großmutter Hanna war in Schwerin geblieben, um auf ihren letzten Sohn Karl-Heinz zu warten. Von Großmutter Hanna habe ich Bilder aus der Vorkriegszeit, im Sessel sitzend, im parkartigen Garten mit ständigen Hausgästen aus Theater und Orchester. Als wir schon in Afrika waren, gaben die Russen den Schlossgarten und die Villen frei, und Hanna durfte wieder in ihr Haus ziehen. Nachdem sie und einige Helfer Haus und Garten wieder in einen annähernd menschenwürdigen Zustand gebracht hatten, wurden alle Häuser wieder beschlagnahmt. Am Schluss durfte sie ein Zimmer in ihrem eigenen Haus bewohnen. Ihr Glück war, dass Karl-Heinz wirklich irgendwann aus sibirischer Gefangenschaft zurückkam und es ihr gelang, ihm mit Schwiegersohn ein zweites Haus auf dem Grundstück zu bauen. Als Karl-Heinz dann viel zu früh starb, brach die Verbindung meiner Mutter zu Braunes Nachkommen in Schwerin leider ab.
Die vier Braune-Jungs
Zu den Anhalter-Braunes besteht auch keine Verbindung mehr. Aus Korrespondenz mit Großvater Alfreds Schwester Therese (*1871) konnte meine Mutter erfahren, dass die Russen sofort die brauneschen Güter konfiszierten und viele Männer verschleppten. Ihre eigenen drei Söhne waren schon alle im 1. Weltkrieg gefallen. Sie meinte, dass es in Anhalt keine Braunes mehr gibt und dass die Nachkommen in der ganzen Welt zerstreut leben. Meine Mutter schreibt: „Wenn auch aller Besitz und Reichtum verloren ist und die Wunden, die der Krieg durch den Soldatentod so vieler junger Braunes riss, niemals heilen werden, so lebt doch in den Nachkommen der Geist der Vorfahren, lebt ihre Tüchtigkeit, ihre Einsatzbereitschaft, leben ihre Begabungen und Talente und ihr Durchsetzungsvermögen. Aus den Hochs und Tiefs innerhalb der Brauneschen Familie kannst Du erkennen, dass nicht Geld und Gut ausschlaggebend für die Gestaltung des Lebens sind, sondern der Geist und der Wille.“
Meine Mutter hat sehr in der Vergangenheit gelebt, in der ihre Wurzeln waren, aber sie hat gleichzeitig neu aufgebaut und viele aus ihrem reichen Erbe weiter bereichert. Ohne daß meine Mutter nicht die liebevolle Brücke zur Vergangenheit wurde und immer wieder Sachen für uns Kinder aufgeschrieben hätte, wäre ich selber wahrscheinlich nie zum Schreiben gekommen. Zum 80. Geburtstag schrieben wir Kinder der Mutter in einem Glückwunsch: „,Sie kamen mit hoffenden Herzen‘ heißt es im Schutztruppenlied. So kamt auch Ihr, Mutti und Vati, 1951 in dies Land, und wie die Schutztruppler musstet Ihr Euch das Erhoffte erst erleiden und erkämpfen. Eure Stationen, kreuz und quer durch Südwest, bis die ganze Familie nach Jahren in Windhoek vereint war, würden für unsere Generation schon fast undenkbar sein. Wie wunderbar, dass man das Schwere vergessen kann, sogar Kraft daraus schöpfen kann und selbst im Schwersten immer wieder Lichtblicke, Schönes und Erbauliches finden kann. Das Schwere und das Schöne liegen bei Dir nie weit voneinander, Mutti. Es liegt in Deiner Natur, Dein Leben immer wieder neu auszurichten und gestalten zu müssen, ob im Krieg in Schwerin, ob auf der Farm, dann als der Alleinverdiener als Lehrerin in Omaruru und endlich im Hinterhofzimmer bei Menzels in Windhoek. Wie passend sind heute wieder die Worte von Großvater Karl Schmidt, damals, als Du mit uns nach Südwest ausreistest: ‚Gold habe ich nicht gefunden, auch keine Diamanten, aber von dem inneren Reichtum, den mir das Land schenkte, zehre ich noch heute.‘“
Die Flucht
„Nur durch die Hoffnung bleibt alles bereit,
immer wieder neu zu beginnen.“
Charles Péguy
Von der Flucht hat meine Mutter nie geredet, aber in ihren Niederschriften ist dieses Ereignis zentral. Sie schreibt: „Nun, da sich mein Leben zu Ende neigt, will ich versuchen, über die Flucht, die unser Leben erschütterte und bis in die Grundfesten veränderte, zu schreiben. Es ist unsagbar schwer, aber unsere Nachfahren sollen einmal nachlesen können, wie wir lebten und litten, wie wir planten und dann den Absprung wagten und dadurch für uns, unsere Kinder und Enkel ein Leben in Freiheit errangen. Mein Herzenswunsch ist, dass keiner meiner Nachkommen das durchleben muss, was damals deutsche Menschen, zu denen auch wir gehörten, durchlitten.“
Meine Mutter soll erzählen: „Unser Neuanfang als Familie mit Wolfgang in Güstrow war bestimmt nicht leicht, aber es war wieder Hoffnung da nach der Hoffnungslosigkeit des Zusammenbruchs. Auch an der Landwirtschaftsschule ging es voran, zusätzliche Lehrer, viele Schüler und ein gutes Verhältnis zwischen allen. Wir meinten, die schlimmste Zeit hätten wir überwunden. Da traf uns ein neuer Schlag. Wolfgang wurde abgeholt. Wohin, wieso, warum? Darauf gab es keine Antworten. Die russische Kommandantur ließ ihn aber wieder frei, denn er konnte mit seinen Ausweisen belegen, dass er während des ganzen Krieges im Camp in Andalusia, in Südafrika, als Internierter gewesen war und nicht als Offizier im Afrikakorps unter Rommel. Dies hatte ein Spitzel gegen Wolfgang vorgebracht. Als Mitbeweis hatte er Wolfgangs hohe schwarze Lederstiefel angeführt. Für uns war dies eine Warnung. Auch in Güstrow und hier am Inselsee gab es Spitzel. Sie gehörten zum System.
Drei Jahre waren schon vergangen, seit meine Schwester Wiltrud es noch gerade geschafft hatte, mit ihrem Mann in den Westen zu gelangen. Wir Schwestern, die wir davor zwei Jahre ganz eng miteinander in meiner Wohnung gelebt und alle Leiden zusammen durchlebt hatten, wussten nun kaum etwas voneinander. Natürlich wussten wir von Menschen, die es geschafft hatten, mit ihrer Familie im Westen Verbindung aufzunehmen. Man hörte von möglichen Übergängen da und dort, erfuhr auch von Gefahren, den strengen Grenzkontrollen, von Polizeihunden und selbst von der Möglichkeit, erschossen zu werden. Die Sehnsucht nach Wiltrud und das Wissenwollen um sie und die Kinder wuchs immer mehr, und eines Tages, als unser Baby, Helmut, ein halbes Jahr alt war, beschloss ich, über die Grenze zu Wiltrud zu gehen. Ich wollte es wagen, war jung, erst 33, zwar unterernährt, aber sonst gesund, und kein anderer kam für die Aufgabe infrage. Meine Mutter bot an, nach Güstrow zu kommen, um die Familie zu versorgen, was ich natürlich im Stillen gehofft hatte.
Es fing mit einer Bahnfahrt nach Hamersleben an, wo meine Tante Rieckchen als Berlin-Evakuierte hängen geblieben war. Dort sollte ein guter Übergang nach Westen sein. Viel wusste die Tante auch nicht, und eine Karte gab es nicht. Ein Bekannter konnte uns wenigstens die allgemeine Richtung und die Namen der nächsten Dörfer geben. Schwierig wurde es, als die Tante erklärte: ‚Ich komme mit.‘ Oh mein Gott, dachte ich nur, mit Tantchen bei Nacht und Nebel, wo sie schon auf ebener Straße dauernd umknickt. Sie hielt sich tapfer durch zwei Dörfer, aber als es dann querfeldein ging, saß die Tante plötzlich in einem Wassertümpel – ausgerutscht. Schuhe, Strümpfe, Rock und Mantel, alles war nass. Sie musste eiligst zurück, mit nur noch zwei Stunden zum Sonnenuntergang. Es gab Tränen, als ich allein in Richtung Westen weiterzog.
Nun ging es auf jeden Fall schneller, und ich erreichte das letzte Dorf wie geplant im Dunklen. Unheimlich wurde es. Die Straßen waren leer, aber alle Hunde fingen an zu bellen. Danach gab es keine Dörfer mehr, aber auch keine Wegezeichen. Es war eine sternenklare Nacht, und ich versuchte, mich am Nordhimmel zu orientieren. Über ein weites flaches Gelände ging es nach Westen – wenn meine Richtung stimmte. Plötzlich hörte ich so etwas wie einen leisen Pfiff. Was war das? Da, noch einmal! Ich rührte mich nicht weiter. Es war nichts zu sehen. Es stürzte sich auch kein Hund auf mich. Geflüsterte Worte hörte ich, ganz nah. Da erkannte ich die Umrisse eines Mannes in Uniform, der zwei Koffer trug. Ich wartete. Ein Eisenbahner kam aus dem Dunkel auf mich zu. Ganz leise stellte ich die völlig überflüssige Frage: ‚Wollen Sie auch über die Grenze? Suchen Sie auch den Baumstamm?‘ Aber dadurch löste sich die ungeheure Spannung, in der ich mich befand. Ja, er wollte auch nach Westen und kannte den Weg gut, da er jeden Monat zu Frau und Kindern rüberging. Er war Eisenbahner in Berlin, und auch für ihn gab es keinen anderen Weg in das andere Deutschland.
Nun gingen wir zusammen. Welche Erleichterung! Gegen Mitternacht waren wir endlich am Baumstamm. Nur noch hinüber, und du bist frei! Welch überwältigendes und unbekanntes Gefühl. Der Baumstamm überbrückte einen sehr tiefen steilen Graben. Unten rauschte Wasser. Der Mann machte sich sofort mit einem Koffer auf den Weg, kam zurück, und nun war ich an der Reihe. Ich hatte nur einen leichten Rucksack und war wie in einer Trance. Trotzdem machte ich es ihm nach, langsam seitlich über den Stamm zu gehen. Und plötzlich war ich im Westen. Der zweite Koffer schaffte es auch, und ohne ein Wort und ohne eine Verschnaufpause setzten wir unseren Weg zum Bahnhof Helmstedt fort. Als es dämmerte, erreichten wir ihn. Auf dem Bahnhof und im Wartesaal saßen und lagen viele schlafende Menschen, wohl alles Grenzgänger, die von verschiedenen Übergängen gekommen waren.
Um 6 Uhr ging der erste Zug nach Hannover. Ein richtiger Zug so wie früher vor dem Krieg – die Abteile und die Sitze waren heil, richtige Glasfenster, die man öffnen und schließen konnte. Vom Hannover Hauptbahnhof ging es weiter mit der Straßenbahn die Hildesheimer Straße entlang. Trümmer und Leere auf beiden Seiten, die Schrecken des Krieges. Bei Wiltrud und Rudolf war ich dann in einer anderen Welt, angefangen mit dem Willkommenskaffee und einem weißen, herrlich duftenden Brötchen mit richtiger Butter. In den nächsten Tagen ging ich auf die Straße und in die Geschäfte und sprach mit Menschen. Man konnte Brot und Lebensmittel ohne Karten einkaufen – und so viel, man haben wollte. Nur Geld brauchte man. Wer es nicht hatte, und das war ein großer Teil der Bevölkerung, führte ein ärmliches Leben. Es gab weder Renten noch Pensionen, nur so eine Art Fürsorgeunterstützung, die knapp zum Fristen des Lebens reichte. Wer aber arbeiten konnte, kam schnell zu Dingen, von denen man bei uns nicht einmal träumen konnte.
Ich sah an vielen Stellen Wiederaufbau, aber es gab noch keine frohen, unbeschwerten Menschen. Trotzdem. Warum ging bei uns in Mecklenburg nichts voran? Wir hatten nicht einmal zerstörte Städte, aber fruchtbares Land, und die Menschen hungerten noch immer. Es war der Russe, der jegliche Initiative tötete, und das mühsam, dennoch Erschaffene und Geerntete verschwand in Richtung Russland.
Für die Rückkehr, fünf Tage später, hatte Rudolf mir amerikanische Zigaretten besorgt. In schwierigen Situationen sollten die Wunder tun. Ich wollte sie nicht, weil mir das Talent zum Bestechen fehlt, aber Rudolf ließ nicht locker. Wiltrud beschenkte mich mit einer Cervelat–Wurst, und Rudolf packte mir Medikamente ein. Am Spätnachmittag war ich wieder am Grenzbahnhof Helmstedt angelangt. Ich gesellte mich zu einer Gruppe Menschen außerhalb des Bahnhofgeländes. Sie wollten in der Nacht mit einem ortskundigen Führer über die Grenze. Man merkte ihnen die Angst an. Den Führer konnte ich mir nicht leisten, und in so einer großen Gruppe schien es mir auch zu riskant. Ich fand jemand anderen, der mir den Weg in großen Zügen beschreiben konnte.
Bei untergehender Sonne ging es los. Es wurde dunkel, und wieder zogen die Sterne in aller Herrlichkeit auf. Welch Glück ich hatte! Immer weiter, nach meiner Zeitrechnung musste ich mich schon auf der Ostseite befinden. Einen Einschnitt oder Markierungspunkt gab es auf diesem Weg nicht. Ich wurde unsicher, meinte, die allgemeine Richtung in dem flachen Gelände verloren zu haben, glaubte sogar, im Kreis gegangen zu sein. Alles erschien mir auf einmal unheimlich. Kein anderer Mensch unterwegs? Plötzlich lösten sich aus der Dunkelheit zwei Gestalten mit Hunden. Polizei! Sie kamen auf mich zu und fragten leise, was ich hier wolle. Ich flüsterte zurück: ‚Ich will zum Bahnhof und nach Güstrow fahren. Dort wohne ich.‘ Rudolf, nun müssen deine amerikanischen Zigaretten ihre Wunder tun! Zwei Päckchen, für jeden eins, taten es, ich bekam sogar noch die Richtung zum Bahnhof.
Müde und wie ausgepumpt kam ich zum Mittag nach dem letzten Fußmarsch vom Güstrower Bahnhof zu Hause an. Der Weg nach Westen war gewagt und geschafft worden. Obwohl unser Leben hier in seiner Trost- und Hoffnungslosigkeit weiterging, war etwas anders geworden. Wir hatten ein neues Wissen, einen neuen Gedanken gewonnen: Es gibt noch eine andere Art von Leben, ein Leben ohne Druck, ein Leben in Freiheit. Der Gedanke wuchs immer mehr zum festen Plan – wir müssen fliehen: nicht nur in den Westen, sondern weiter nach Afrika.