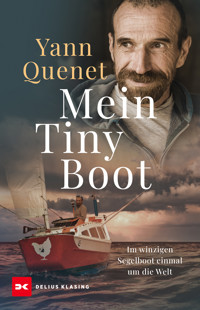
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Delius Klasing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die unglaubliche Geschichte einer Weltumseglung in einem selbstgebauten Boot Im Mai 2019 begibt sich Yann Quenet von Lissabon aus auf eine Reise um die Welt. Doch diese Reise ist alles andere als gewöhnlich. Denn das Gefährt, das er gewählt hat, ist ein Segelboot - genauer gesagt ein Segelbötchen. Mit nur 4 Metern Länge und einem selbstgebauten Konstruktionsprozess mit einem Schweizer Taschenmesser ist es ein Boot, mit dem sich andere nicht einmal auf den heimischen Baggersee trauen würden. Yann Quenet ist ein Autodidakt durch und durch. Ohne jegliche Erfahrung als Schiffbauingenieur oder erfahrener Segler, hat er nur ein Ziel vor Augen: Einfach in See zu stechen, den Soloseglern nachzueifern und den endlosen Horizont zu erleben. Sein Motto dabei lautet: Vereinfache die Dinge bis zum Maximum! • Ein Kindheitstraum wird wahr dank der Entschlossenheit und des außergewöhnlichen Einfallsreichtums eines autodidaktischen Seglers. • Eine sportliche und persönliche Heldentat, aber vor allem das Abenteuer eines freien Mannes auf der Suche nach Einfachheit und Emanzipation von gesellschaftlichen Konventionen. Ein Buch, das dafür plädiert, sich Zeit zu nehmen – im im Gegensatz zu den Zwängen der Schnelllebigkeit der heutigen Gesellschaft Yann Quenet berichtet von einem außergewöhnlichen dreijährigen Abenteuer, in dem er den Atlantik, den Pazifik und den Indischen Ozean überquert hat. Dabei besuchte er Brasilien, Polynesien, La Réunion und Südafrika. Geboren in Nantes und wohnhaft in Saint-Brieuc (Bretagne, Frankreich), hat Yann Quenet schon immer davon geträumt, um die Welt zu segeln. Als er fünfzig wurde, entschied er sich, seinen Traum zu verwirklichen. Er kündigte seinen Job und baute sein eigenes Boot, mit dem er schließlich in See stach. Mit einer zweifachen Berichterstattung in der YACHT und YACHT-online hat das Buch bereits ein großes Leserbriefecho erhalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yann Quenet
Mein Tiny Boot
Im winzigen Segelboot einmal um die Welt
Aus dem Französischen von Sarah Pasquay
DELIUS KLASING VERLAG
Für Corentin
INHALT
Präambel
Erster Versuch: Schiffbruch mit der SKROWL, August 2015
Ein neues Boot: die BALUCHON
Warum ein so kleines Boot?
Erster Teil: Der Atlantik
Überfahrt Lissabon–Kanarische Inseln, Mai 2019
Überquerung des Atlantiks: Hafen von Arrecife auf der Insel Lanzarote, Kanarische Inseln, November 2019
Guadeloupe
Überfahrt Guadeloupe–Panama, Februar 2020
Panama, März 2020
Zweiter Teil: Der Pazifik
Überfahrt Panama–Marquesasinseln, März 2020
Die Marquesasinseln
Überfahrt Marquesasinseln–Tahiti, Juni 2020
Tahiti – Inseln unter dem Winde
Überfahrt Raiatea–Neukaledonien, September 2020
Neukaledonien
Dritter Teil: Der Indische Ozean
Neukaledonien–La Réunion, die lange Strecke, Mai–Juli 2021
La Réunion
Überfahrt La Réunion–Südafrika, Oktober–November 2021
Südafrika, November 2021–Januar 2022
Vierter Teil: Die Rückreise
Kapstadt–St.-Helena, Januar–Februar 2022
St. Helena
St. Helena–Brasilien, März 2022
Brasilien
Brasilien–Azoren, April–Juni 2022
Die Azoren
Azoren–Bretagne, Juli–August 2022
Anhang
Technische Daten
Die automatische Windsteueranlage Bébert
Danke
»Kommt, meine Freunde,
Noch ist es nicht zu spät, nach einer neuen Welt zu suchen. […]
Denn ich will segeln bis hinter die untergehende Sonne. […]
Und obwohl wir nicht die Kraft haben,
Die Erde und Himmel einst bewegte,
Sind wir doch, was wir sind:
Helden mit Herzen vom gleichen Schlag,
Geschwächt von Zeit und Schicksal,
Aber stark in dem Willen,
Zu streben, zu suchen, zu finden und nicht nachzugeben.«
Alfred Tennyson
Auszug aus dem Gedicht »Ulysses«
PRÄAMBEL
ERSTER VERSUCH: SCHIFFBRUCH MIT DER SKROWL
AUGUST 2015
Ich bin der König der Welt! Vor einer guten Woche bin ich von La Coruña in Spanien gestartet und habe gerade wieder ein heftiges Unwetter überstanden. Die SKROWL, mein 4,30 Meter langes Mini-Segelboot, mit dem ich vor zwei Monaten von der Bretagne aus zu einer Weltumrundung aufgebrochen bin, hat sich super geschlagen. Wir sind nur noch 450 Seemeilen von Madeira entfernt und bewegen uns in flottem Tempo auf die Insel zu. Ich genieße meine Reise bei weit geöffnetem Luk, höre Musik und überlasse das Steuern der Windsteueranlage, einer Art Autopilot, die mit Hilfe des Windes funktioniert und besser steuert als alle Matrosen der Welt zusammen.
Der König der Welt? Von wegen!
Gerade ist es dunkel geworden. Ich suche den Horizont ab um sicherzustellen, dass keine anderen Schiffe in der Gegend unterwegs sind. Dann stelle ich meinen Wecker so ein, dass er 45 Minuten später klingelt, mache es mir bequem und schließe die Augen.
Plötzlich ein gewaltiges Krachen. Ich bekomme einen Schwall Wasser ins Gesicht. »Que pasa?!« In einer Flut von Wasser und Gegenständen werde ich quer durch die Kajüte geschleudert. In Sekundenschnelle füllt sich das Boot mit Wasser. Meine Rettungsweste löst aus und katapultiert mich mit solcher Wucht nach oben, dass ich mit dem Kopf gegen die neue Decke pralle, die nur wenige Augenblicke zuvor noch der Boden war. Der Katapulteffekt ist so heftig, dass ich das Gefühl habe, über den Bug gekentert zu sein. Im Innern des Bootes hat sich eine Luftblase gebildet. Es ist dunkler als in einem Ofenrohr. Überall blubbert es. Ich muss dringend etwas unternehmen! Eine kleine Stimme sagt mir, dass ich ruhig bleiben soll, aber ich bin ruhig. Ein wenig schläfrig und ziemlich durchnässt, aber ruhig.
Ich schaffe es nicht mehr, mich im Boot zu orientieren, dabei ist es gar nicht groß. Die Taschenlampe! Ja, genau: die Taschenlampe! Die brauche ich zuallererst. Sie ist am Pfosten der Kombüse festgemacht. Ich finde den Pfosten, aber da ist keine Taschenlampe mehr. Das kann doch nicht wahr sein!
Ein kleiner Lichtschein treibt an mir vorbei: Es ist mein Tablet, das in einer luftgefüllten Plastiktüte steckt und Musik ausspuckt. Ein Typ mit hoher Stimme fleht seine Geliebte an, dass sie ihm bitte nicht die Zöpfe abschneiden soll – dieser Song wird mir in den folgenden Stunden nicht mehr aus dem Kopf gehen. Mir fällt ein, dass ich hier ganz in der Nähe noch eine zweite Taschenlampe festgemacht habe, eine wasserfeste Lampe, die nur fünf Euro gekostet hat, aber trotzdem gut ist. Ich finde sie und es wird hell.
Im Licht wirkt alles noch albtraumhafter: das grüne Wasser, die Paddel und hunderte Gegenstände, die an ihrem Platz bleiben sollten, treiben in einem Höllenlärm umher und stoßen gegeneinander.
Ich versuche, das Boot von rechts nach links zu krängen, in der stillen Hoffnung, dass es sich wieder aufrichtet. Dabei hatte ich doch beim Bau nach bestem Gewissen mithilfe von Augenmaß und sogenanntem gesunden Menschenverstand eine ganze Menge sehr, sehr komplizierter Berechnungen angestellt. Die Möglichkeit eines geöffneten Luks hatte ich dabei allerdings nicht bedacht. Jetzt, kopfüber und vollgelaufen, treibt das Boot mit der Nase im 45-Grad-Winkel gen Himmel gerichtet über das Meer. Da kann ich noch so viel in alle Richtungen zappeln, es bringt nichts. Die arme SKROWL hat ihre stabilste Position gefunden und präsentiert dem Mond ungeniert ihr Unterteil.
Und jetzt? Muss ich dringend die Tasche mit der EPIRB finden, meiner Notfunkbake. Als starker Legastheniker tue ich mich schon unter normalen Umständen sehr schwer damit, rechts und links zu unterscheiden. Jetzt muss ich mir auch noch alles umgekehrt vorstellen, da ja aus rechts links geworden ist und umgekehrt. Um mich zu konzentrieren, schließe ich einen Moment lang die Augen. Es gelingt mir, die Tasche im Geiste zu orten. Ich strecke den Arm nach ihr aus, aber sie ist zu weit weg. Ich muss mit dem Kopf unter Wasser tauchen, um sie zu erreichen, aber mit meiner Weste geht das nicht. Ich ziehe sie aus und sie wird Teil des umhertreibenden Durcheinanders. Geschafft, endlich habe ich die verdammte Tasche!
Es ist ein wasserdichter Rucksack, an den die EPIRB geschnürt ist. »Scheiße! Wie funktioniert das Ding nochmal?« Mit der Lampe zwischen den Zähnen versuche ich die Anweisungen zu lesen, aber ich sehe rein gar nichts. Ich drücke allerlei Knöpfe, das Gerät beginnt zu blinken. Keine Ahnung, ob der Alarm auslöst, das wird sich später zeigen. Ich setze mir den Rucksack auf.
Und dann beginne ich, meinen restlichen Verstand zusammenzuklauben. Ich muss jetzt die Prozedur in Gang setzen, die ich im Kopf viele Male durchgegangen bin. Als erstes muss ich die Rettungsinsel, die auf dem Boden im Innern des Bootes befestigt ist, nach draußen befördern. Ich durchtrenne die Halteriemen mit meinem Schweizer Messer, das ich immer bei mir trage. Keine Ahnung warum, aber ich dachte, durch das Gewicht der Rettungsinsel würde das Archimedische Prinzip neutralisiert und das Ding ließe sich leicht durchs Wasser nach unten drücken. Von wegen! Der hydrostatische Auftrieb ist enorm. Vergeblich versuche ich, das Mistding nach unten in Richtung Ausgang zu bewegen, aber es bleibt hartnäckig an der Decke kleben. Schließlich umklammere ich es mit beiden Beinen und drücke es mit meinem ganzen Körper nach unten. Auf diese Weise gelingt es mir, mit der Rettungsinsel unterzutauchen und sie durch das Luk zu schieben. Jetzt treibt sie wahrscheinlich unter dem Cockpit. Ich ziehe an der Leine, mit der die Rettungsinsel ausgelöst wird. Wie lang ist die denn bloß? Endlich erreiche ich die eigentliche Auslöseleine und ziehe heftig daran, damit die Insel sich aufbläst, und um zu sehen, ob sich das Boot durch den Stoß vielleicht wieder aufrichtet. Aber nichts geschieht … Ich habe nicht stark genug gezogen! Pech, darum kümmere ich mich später. Ich binde mir die Leine an der Taille fest. Meine Beine fangen langsam an zu schlottern; das liegt sicher an der körperlichen Anstrengung, aber auch an der Kälte und am Adrenalin.
Jetzt kommt der nächste Schritt: die große wasserdichte Notfalltasche sichern, die überlebenswichtige Ausrüstung und Lebensmittel für mehrere Tage enthält. Ich schnappe mir den Lifebelt der Rettungsweste und befestige die Tasche daran. Dann schaffe ich sie auf demselben Weg nach draußen wie die Rettungsinsel. Danach greife ich mir den kleinen Behälter mit den Signalraketen, die werden draußen schließlich nützlicher sein als hier drinnen, und befestige ihn an meiner Taille.
Eigentlich ist es langsam an der Zeit, zu tauchen und das Bootsinnere zu verlassen, aber ich darf nichts vergessen und zwinge mich zum Nachdenken. Ich trage Shorts und T-Shirt. Wenn ich jetzt rausschwimme, werde ich mir in den kommenden Stunden mächtig einen abfrieren. Die Kiste mit meinen Klamotten stößt schon seit einer Weile gegen meinen Rücken. Ich öffne sie, hole eine Hose und einen Pulli raus und lasse den Behälter davontreiben – einer weniger, der mich nerven kann. Ich ziehe mir die neuen Klamotten an. Ein Schuh treibt direkt vor meiner Nase entlang. Ihn ziehe ich ebenfalls an, dann bleibt wenigstens ein Fuß warm.
Meine Lampe zeigt erste Anzeichen von Schwäche. Ich spanne die Leine der Rettungsinsel, damit sie sich nicht irgendwo auf dem Weg zum Ausgang verhakt, öffne mein Schweizer Messer und mache mich bereit, jedes Seil zu zertrennen, das mir den Weg versperrt. Dann hole ich einmal tief Luft, nehme die Lampe zwischen die Zähne und tauche – gluck gluck gluck!
In meinem Kopf singt der Typ immer noch von der Geliebten und den Zöpfen. Verdammt nochmal! Der hat sich beim Text aber wirklich gar keine Mühe gegeben! Ich schwimme aus dem Boot, gefolgt von dem Behälter mit den Signalraketen. Geschafft! Endlich bin ich draußen. Ich klammere mich an eines der Ruderblätter und ziehe an dem Behälter, aber er hat sich irgendwo verklemmt. Er kann nicht weit weg sein, ich werde ihn bestimmt leicht wiederfinden. Ich binde ihn fest und versuche, auf den Schiffsrumpf zu klettern. Das ist eine einzige Rutschpartie, und die Wellen spülen mich immer wieder runter, aber irgendwie schaffe ich es nach oben. Ich klemme mich zwischen den Kiel und eines der Schwerter und wickele meine Leine auf. Puh, was für eine Schinderei!
Ich leuchte um mich herum. Der Mast treibt auf dem Wasser und schlägt wie ein durchgeknallter Bock gegen den Rumpf. Wie kann es sein, dass er nicht mehr im Boot steckt? Auch den Deckel des Vorluks sehe ich umhertreiben. Keine Ahnung, wie er sich losreißen konnte. Das Segel wabert im Wasser und das drachenartige Geschöpf darauf, das eine Art »S« für SKROWL bildet, scheint mich belustigt anzusehen. Das Segel! Na klar! Ich muss es herholen, um mich vor der Gischt zu schützen. Und auch die Spriet, die ich in einen der Schwertkästen stecken kann. Dann bin ich besser zu sehen, falls ich in den nächsten Tagen einem Schiff begegne.
Ich mache mich gerade für einen erneuten Tauchgang bereit, als ich in nicht allzu großer Entfernung die Lichter eines Frachters sehe. Nicht einen Moment kommt mir in den Sinn, dass er extra meinetwegen hier sein könnte. Mir fällt ein, dass ich ein Handfunkgerät und ein Rettungslicht in meinem Rucksack habe. Scheiße! Der Rucksack ist vollgelaufen, wohl doch nicht so wasserdicht. Nicht so schlimm: Die Funke steckt in einem Beutel mit ZIP-Verschluss. Dummerweise ist auch der Beutel voll Wasser. Die Funke schwimmt in ihrem eigenen Saft und lässt sich natürlich nicht einschalten. Ich hole das Rettungslicht heraus, schalte es ein und schwenke es in Richtung des Frachters. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das bei dem Wellengang funktioniert, denn ich selbst kann den Frachter nur zeitweise sehen.
Unglaublich! Da ist ein zweiter Frachter! Ich schwenke mein Licht im Rhythmus von »Geliebte, oh, meine Geliebte«. Was für ein idiotischer Song! Der erste Frachter entfernt sich, aber ich befinde mich offenbar auf einer Schifffahrtsroute. Hab ich ein Glück!
Nicht zu fassen! Ich sehe gleichzeitig die grünen und die roten Lichter des zweiten Frachters. Das bedeutet, dass er direkt auf mich zukommt. Er sucht das Meer mit seinen Scheinwerfern ab. Mir fällt die EPIRB wieder ein, sie hat also tatsächlich ausgelöst. Ich kann nicht glauben, dass ein so großes Schiff nur für mich von seiner Route abweicht. Das schmeckt mir nicht recht. Trotzdem schwenke ich mein Rettungslicht noch stärker und wechsele dabei immer öfter den Arm, denn meine Schultern tun langsam verdammt weh.
Plötzlich werde ich von einer riesigen Welle getroffen und mehrere Meter weit weggespült. Was für ein Schlag, Herr im Himmel! Ich bin ganz benommen. Zum Glück bin ich festgebunden. Schnell klettere ich wieder auf den Rumpf, aber ich habe die Taschenlampe und mein Schweizer Messer verloren. Mir bleibt nur noch das Rettungslicht, das ich an meinem Handgelenk befestigt habe. Als ich wieder auf dem Rumpf bin, ist der Frachter nur noch wenige hundert Meter entfernt. Ein Scheinwerfer ist auf mich gerichtet und blendet mich. Ich schwenke mein Licht, um ihm zu sagen, dass ich ihn auch sehe! (Manchmal frage ich mich wirklich, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe.) Auf dem Vordeck erkenne ich drei Männchen mit orangefarbenen Anzügen und Helmen. Bestimmt verfluchen sie mich, dass sie meinetwegen bei diesem Wetter nach draußen müssen, anstatt in ihren warmen Kojen zu liegen.
50 Meter noch. Der Frachter kommt immer näher und hebt und senkt sich dabei um mehrere Meter. Das ist ziemlich beeindruckend. An Deck erkenne ich jede Menge Container. Ich muss mich konzentrieren, das wird jetzt brenzlig. Wenn ich nicht aufpasse, werde ich am Ende womöglich gegen den Rumpf des Frachters gequetscht. Ich löse die Leine von meiner Taille, behalte aber die Schlaufe in der Hand. Ich habe keine Ahnung, wie sie mich hier auflesen wollen, also kann ich wenigstens versuchen, mich nicht allzu dumm anzustellen. Einer der orangenen Männer schwenkt ebenfalls ein Rettungslicht. Er hat sich getäuscht, wenn er glaubt, dass ich bei diesen Wellen, die mit enormer Wucht gegen die Metallwand schlagen, ins Wasser springe.
Gleich wird die SKROWL den Frachter berühren. Auf dem Gipfel einer Welle entdecke ich ein Speigatt mit einer angeschweißten Querstrebe – das ist der Moment! Ich lasse die Leine los, springe an die Strebe und halte mich daran fest, als hinge mein Leben davon ab, was ja gar nicht so falsch ist. Ich klammere mich so stark daran, dass niemand mich davon wegreißen könnte. Die SKROWL ist wieder mehrere Meter nach unten gesunken. Ich hänge über dem Abgrund.
Ein Witzbold direkt über mir schreit mir zu, dass ich ihm die Hand geben soll. Der hat Nerven! Ohne einen dritten Halt, auf den ich einen Fuß setzen kann, werde ich diese verdammte Strebe ganz bestimmt nicht loslassen. Wenn ich eine Hand löse, bin ich tot! Instinktiv hebe ich die Beine, denn ich habe Angst, dass mein geliebtes Boot sie zerquetscht aus Rache, dass ich es allein gelassen habe. Doch nichts dergleichen passiert. Ganz im Gegenteil: Dieses tapfere kleine Boot kommt mir ein letztes Mal zu Hilfe. Ich spüre etwas unter meinen Füßen. Das ist die SKROWL! Mithilfe einer Welle trägt sie mich mindestens einen Meter nach oben. Ich bekomme die Oberkante der Reling zu fassen. Ein kräftiges Paar Hände ergreift meinen Arm. Ich setze einen Fuß in das Speigatt, spüre, dass mein anderes Bein gepackt wird, und fliege – schwupps! – über die Reling in Sicherheit. Ich hätte es gern mit einem lässigen »Hallo Leute« versucht, aber das ist vermutlich etwas unhöflich, nachdem sie meinetwegen bei diesem Wetter nach draußen mussten.
Meine Retter lächeln über das ganze Gesicht und genau das tue ich in diesem Augenblick wahrscheinlich auch. Sie bedeuten mir, ihnen zu folgen. Der Frachter hat wieder seine Route aufgenommen. Er schwankt fast noch mehr als mein kleines, vollgelaufenes Boot, das bereits außer Sichtweite sein muss. Ich bringe es nicht über mich zurückzublicken.
Der Typ mit den Zöpfen und der Frauenstimme hat aufgehört zu singen.
EIN NEUES BOOT: DIE BALUCHON
Als ich ein paar Wochen später wieder zuhause in der Bretagne bin, ziehe ich Bilanz: Ich bin grandios gescheitert, aber alles andere als entmutigt. Meinen Traum von der Weltumsegelung aufzugeben kommt für mich nicht in Frage. Ich muss nur ein wenig Abstand gewinnen und versuchen zu analysieren, was schiefgelaufen ist.
Außerdem muss ich wieder ein bisschen Geld verdienen und darüber nachdenken, wie die Nachfolgerin der SKROWL aussehen könnte. Nach dutzenden schlaflosen Nächten und ebenso vielen Litern Tee, hunderten Entwürfen und neuen Ideen steht der Plan für mein neues Boot, die BALUCHON (dt. Bündel). Ich finde, der Name passt sehr gut, denn das Boot ist klein, leicht, schnell gebaut, ohne Schnickschnack und mit einem Spritzer Humor. Ganz anders als SKROWL. Dieser Name ist damals aus einer gelehrten Mischung aus »Krill« (kleine Tiefseegarnelen, von denen Wale sich ernähren) und »scow« (englische Bezeichnung für ein Flachboot, also ein Boot mit breitem Bug) entstanden und erscheint mir aus heutiger Sicht ein wenig zu kriegerisch, ja prätentiös.
Die vier Meter lange und 1,60 Meter breite BALUCHON unterscheidet sich ein wenig von der SKROWL. Sie ist schmaler, aber vor allem hat sie einen tieferen Kiel mit einem Wulst, eine Art stählerner Torpedo, der 150 Kilogramm wiegt und 90 Zentimeter unter der Wasserlinie liegt. Dadurch sollte sich das aufrichtende Moment, das der SKROWL so gefehlt hat, entscheidend verbessern und meine neue Reisegefährtin im Falle einer Kenterung nicht kopfüber im Wasser liegen bleiben. Jeder macht Fehler, aber man sollte versuchen, nicht zweimal denselben Fehler zu begehen.
Seit dem Tag, als mein Sohn flügge geworden ist und unser beider Nest verlassen hat um Compagnon du Devoir zu werden, ein Handwerksgeselle auf Wanderschaft, bin ich einerseits voller Stolz auf ihn, andererseitshabe ich auch das Gefühl, meine Pflicht jetzt getan zu haben. An diesem Tag habe ich beschlossen, mich künftig in erster Linie um mich selbst zu kümmern und nur noch schöne Dinge zu tun. Ich habe eine lange Liste mit Projekten, die ich unbedingt umsetzen will, bevor es zu spät ist. Vor allem will ich meinen alten Traum von einer Weltumsegelung verwirklichen.
Ich kündigte meinen sehr, sehr langweiligen Bürojob (den ich aufgrund einer gewissen Trägheit länger als nötig ausgeübt habe) in der französischen Bauaufsichtsbehörde DDE, der Direction départementale de l’équipement, um mich nur noch den Dingen zu widmen, die für mich von Bedeutung sind. Um meine geringen Lebenshaltungskosten zu decken, gründete ich parallel dazu ein Kleinstunternehmen zur Planung und Konstruktion kleiner Sperrholzboote. Das ist zwar eine spannende Tätigkeit, doch leider mangelt es mir an Cleverness und Geschäftssinn. Die Gewinne erwiesen sich als wenig vereinbar mit meinem Wunsch, schnell wieder in See zu gehen. Die finanziellen Mittel für meine zweite Reise aufzutreiben, kostete mich daher mehr Zeit als gedacht. Das könnte man dann wohl als »Preis der Freiheit« bezeichnen.
Im Frühjahr 2016, also acht Monate nach meinem Schiffbruch, beginne ich mit der Konstruktion der BALUCHON, wobei ich natürlich auch immer wieder Zeit für die Aufträge meiner Miniwerft aufwenden muss. Außerdem verbringe ich jeden Sommer mehrere Wochen in Kanada, um einem Freund bei der Restaurierung seines 20-Meter-Schoners zu helfen. Eine Zeit lang helfe ich auch meinem Freund Hervé Le Merrer bei der Vorbereitung seiner verrückten Atlantiküberquerung mit dem Ruderboot und unterstütze das Team von Yvan Bourgnon bei der Vorbereitung seines Plans, mit einem Sportkatamaran durch die Nordwestpassage zu segeln. Neben der Arbeit an meinem eigenen Boot arbeite ich also auch an anderen Booten mit. Im Herbst 2018 ist die BALUCHON komplett fertig, aber die Saison schon zu weit fortgeschritten, um einen Aufbruch zu wagen. Daher muss ich mich leider noch etwas gedulden.
Ich beschließe, von Lissabon aus zu starten, etwa auf dem gleichen Breitengrad, auf dem ich die SKROWL verloren habe – eine Art logische Fortsetzung meiner vorherigen Reise. Eine Rolle spielt dabei auch, dass die BALUCHON in Frankreich nicht behördlich zugelassen ist und ich nicht die vorgeschriebene Ausrüstung besitze, um in mehr als drei Seemeilen Entfernung von der Küste zu segeln. Mit einem Start von Lissabon entgehe ich also auch den kleinen Schikanen der französischen Bürokratie und laufe nicht Gefahr, von einem übereifrigen Beamten der Schifffahrtsbehörden am Auslaufen gehindert zu werden.
Seit meiner Heimkehr nach dem Missgeschick mit der SKROWL habe ich mir eine Menge Spott, beißende Kritik und »Ich hab’s ja gleich gesagt«-Sprüche anhören müssen. Daher versuche ich mich so unauffällig wie möglich zu verhalten, aber die BALUCHON ist, trotz ihrer kleinen Größe, nicht wirklich unauffällig. Und meine Kumpels vom Hafen in Saint-Brieuc haben mühelos durchschaut, dass ich die geplante Weltumsegelung noch lange nicht an den Nagel gehängt habe. Mein Projekt sorgt für Gesprächsstoff auf den Bootsanlegern. Manche halten mich für einen großen Spinner. Andere haben erhebliche Zweifel an meinen Fähigkeiten und vergleichen sie mit ihren eigenen. Wieder andere behaupten aus reinem Trotz, dass es zwar vielleicht möglich, aber nicht sehr vernünftig wäre mit einem Vier-Meter-Boot aufs offene Meer zu fahren und dass die Idee ziemlich verrückt sei.
Ich unternehme einige Testfahrten auf See, bei denen ich prüfe, ob die BALUCHON gut schwimmt und vor allem, ob sie sich wieder aufrichtet, wenn sie gekentert auf dem Wasser liegt. Dann modifiziere ich einen winzigen Kippanhänger, indem ich eine Öffnung in die Mitte der Ladefläche fräse, um den Kiel dort einpassen zu können, kuppele das Ganze an meinen betagten Kleintransporter und verlasse eines schönen Morgens im Frühjahr 2019 die Bretagne mit Kurs auf das 1.700 Kilometer südlich gelegene Portugal, dem zweiten Ausgangspunkt meiner Reise zu fernen Zielen.
Frankreich, Spanien und Portugal auf kleinen Landstraßen zu durchqueren, ist ein Abenteuer für sich. Mein Anhänger entspricht nicht wirklich der Straßenverkehrsordnung und ist nicht versichert. Obendrein habe ich aus Nachlässigkeit den TÜV-Termin für meinen Transporter verstreichen lassen. Dessen Kupplung zeigt ernstliche Anzeichen von Schwäche, was mir große Sorgen bereitet. In den abgelegensten Winkeln Spaniens schaffe ich es nur mit Mühe und Not über einige ziemlich steile Pässe.
Da ich nicht sonderlich gern Auto fahre und nie die Autobahn nehme, brauche ich fast drei Tage bis nach Lissabon. Dort angekommen, will keine Marina mein Boot aufnehmen, obwohl es überall, wo ich frage, ganz offensichtlich genug Platz gibt (zumal für ein vier Meter langes Boot). Jedes Mal erhalte ich die Antwort, dass man im Voraus reservieren müsse, aber ich glaube, es liegt eher daran, dass mein wenig ansprechendes Äußeres und das seltsame Aussehen meines Bootes nicht wirklich den Standards portugiesischer Yachthäfen entsprechen. Nachdem ich fast einen ganzen Tag umhergefahren bin, finde ich endlich eine Werft, in der ich die BALUCHON_für ein paar Tage auf dem Trockenen stehen lassen kann, während ich meinen Transporter nach Hause bringe (ich kann ihn natürlich nicht einfach hier zurücklassen).
Meine Rückkehr nach Portugal ist ebenfalls wunderschön: 25 Stunden Busfahrt, die ich sehr genieße. Ich bin zwar ebenso kontaktfreudig wie eine alte, leere Batterie, aber ich beobachte gern Menschen, vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln und ganz besonders in Überlandbussen. Dort trifft man einen völlig anderen Typ Mensch als im Zug oder im Flugzeug – die meisten sind einfachere Leute. Ich liebe es mir auszumalen, welche Berufe die einzelnen Fahrgäste ausüben und was für ein Leben sie führen. Mein Sitznachbar zum Beispiel ist ein knorriger, alter Portugiese, der einen leicht verschlissenen Anzug trägt. Die Vorstellung, dass er seit Ewigkeiten in Frankreich malocht und nur von Zeit zu Zeit in sein abgelegenes Dorf in Portugal zurückkehrt, bewegt mich zutiefst. Auch wenn ich ihm, nachdem er an meiner Schulter eingeschlafen ist, am liebsten einen kräftigen Stoß mit dem Ellbogen versetzen würde. Das einzig wirklich Ärgerliche auf der Reise ist, dass mein Rucksack im Laderaum des Busses komplett geplündert wird. Die Leinen, Blöcke, Klemmen und die nagelneue französische Flagge, die ich noch in letzter Minute für meine kleine BALUCHON eingepackt habe, bleiben verschwunden.
WARUM EIN SO KLEINES BOOT?
Zunächst einmal möchte ich klarstellen, dass meine Entscheidung, in einem Miniboot zu reisen, keineswegs damit zu tun hat, dass ich Aufmerksamkeit erregen oder mich interessant machen will. Allein die Vorstellung verursacht mir Unbehagen und entspricht so gar nicht meinem Selbstverständnis.
Zu meinem Glück gibt es bereits einen Rekord mit einem noch kleineren Segelboot: Ein Australier namens Serge Testa hat in den 80er-Jahren auf einem 3,60 Meter langen Boot die Welt umrundet. Ihn zu übertrumpfen, interessiert mich ebenso wenig wie ein Eintrag im Buch der Rekorde. Dieses alberne Spiel, bei dem es darum geht, wer das kleinste hat – das Gegenteil des berühmten, weit verbreiteten Wettbewerbs um das Größte –, entspricht nicht wirklich meinem Plan. Mir geht es nur darum, in aller Einfachheit zu segeln. Obwohl der Rumpf des kleinsten Bootes, das erfolgreich um die Welt gesegelt ist, nur 3,60 Meter lang war, besaß es allerdings noch einen Bugspriet. Die Gesamtlänge unserer Boote dürfte sich letztlich also kaum unterscheiden.
Die Idee, mit einem ganz kleinen Boot zu segeln, ist nach und nach entstanden. Sie ist das Ergebnis jahrelanger Überlegungen, Konstruktionen und Fahrten auf mehr oder weniger großen Segelschiffen.
Der wahre Grund, warum ich mich für diese Art Boot entschieden habe, mag aber auch darin liegen, dass große Schiffe für die Großen gemacht sind, für Menschen mit gesicherten Lebensverhältnissen, die ein komfortables, massives Haus einem Baumhaus vorziehen. Im Grunde meines Herzens sehe ich mich trotz meines immer näher rückenden 50. Geburtstags eher als kleinen Jungen denn als verantwortungsbewussten Erwachsenen. Die Freude, die ich beim Bauen und Segeln meiner kleinen »Spielzeugboote« empfinde, gleicht der eines Kindes, das ein Modellsegelboot bastelt und sich darauf freut, es auf einem Bach oder dem Teich der nahegelegenen Grünanlage auszuprobieren.
Für fast alle gilt: Bevor man sich ein Boot anschafft, muss man ein bisschen gearbeitet und Geld gespart haben, um es sich leisten zu können. Und wenn man einmal eins besitzt, bringt es stets eine Vielzahl technischer und finanzieller Probleme mit sich, die es fortwährend zu lösen gilt, was auf die Dauer sehr anstrengend werden kann. Auf einem Segelboot geht alles eines Tages kaputt, nichts hält ewig. Dadurch ist man gezwungen, noch mehr zu arbeiten, um diese verdammte Nussschale seetüchtig zu halten.
Ich erzähle niemandem etwas Neues, wenn ich sage, dass unsere Zeit auf Erden begrenzt ist. Meiner Ansicht nach sollte man sie daher besser zum Segeln anstatt zum Finanzieren und Instandhalten eines Bootes nutzen. Wobei ich zugeben muss, dass es manchen auch echte Freude bereitet, Zeit in die Pflege ihres Bootes zu stecken und es mit der modernsten Ausrüstung auszustatten. Das muss man respektieren, doch bei mir verhält es sich anders: Je weniger Zeit ich am Kai oder bei der Arbeit zubringe, desto besser.
Ich wollte ein Boot haben, das sich einfach segeln und günstig herstellen lässt und auf das man sich verlassen kann (also ein Faulenzerboot). Aber auf keiner Bootsmesse dieser Welt findet man ein solches Boot, aus dem einfachen und sehr guten Grund, dass diejenigen, die Boote entwerfen und bauen, ebenso wie diejenigen, die sie kaufen, komplizierte und wenig verlässliche Boote haben wollen. Das mag paradox klingen, es sei denn, man ergänzt das Lastenheft noch um Geschwindigkeit und Komfort, zwei Merkmale, auf die ich wenig Wert lege und die die modernen Segelkreuzer unendlich kompliziert und problemanfällig machen.
Da ich die Dinge gern selbst in die Hand nehme, beschloss ich, das Boot in Eigenregie zu entwerfen und zu konstruieren. Das brachte eine weitere Vorgabe im Anforderungskatalog mit sich: Es musste sich megaschnell bauen lassen. Ich hatte keine Lust, mich jahrelang mit dem Bau eines Bootes zu befassen. Ein weiterer interessanter Vorteil: Ein Miniboot lässt sich sehr einfach auf dem Landweg transportieren, ohne dass dafür ein Auto mit besonders starkem Motor erforderlich wäre. Die Vorstellung, ein Land auf diese Weise zu durchqueren und zu besichtigen, erschien mir sehr verlockend, genau wie die Möglichkeit, das Boot fernab eines Yachthafens oder einer Werft einzulagern für den Fall, dass es auf unbestimmte Zeit an Land bleiben müsste. Das gab mir ein noch größeres Gefühl von Freiheit und Gelassenheit.
In Bezug auf die Sicherheit erschien mir das Abenteuer nicht gefährlicher, als es auf den ersten Blick wirkt. Vor allem, wenn ich das Boot von Anfang an so konzipierte, dass es unsinkbar und selbstaufrichtend war. Bei sehr schlechtem Wetter verhält sich ein sehr kleines, leichtes Boot wie ein Korken und bietet den Elementen nur wenig Angriffsfläche. Für mich wäre es im Innern des Bootes natürlich nicht sehr komfortabel, aber solange ich nicht in Küstennähe unterwegs wäre, stünden die Chancen gut, dass ich wieder rauskäme (vorausgesetzt, ich vergaß nicht, das Luk zu schließen!). Außerdem hatte ich das Boot von Anfang an so konzipiert, dass ich es komplett vom Einstiegsluk aus steuern kann. So brauchte ich kein richtiges Cockpit und muss auch nicht auf dem Deck herumturnen – die Hauptursache für tödliche Unfälle auf Segelbooten.
Durch die Kombination all dieser Faktoren näherte ich mich nach vielen Stunden des Nachdenkens dem Konzept des sehr kleinen, hochseetauglichen Bootes. Zuerst dem der SKROWL und dann, unter Berücksichtigung ihrer Mängel, dem der BALUCHON. Um die Sache noch etwas spannender zu machen, setzte ich mir das Ziel, für die BALUCHON mit einem maximalen Budget von 4.000 Euro (meine Ersparnisse zu Beginn der Arbeiten) und einer Bauzeit von 400 Stunden auszukommen – meiner Meinung nach hilft ein gewisser Zeitdruck sehr dabei, ein Projekt erfolgreich abzuschließen.
Ich habe es fast geschafft, diese Vorgaben einzuhalten. Allerdings brauchte ich noch etwa 100 weitere Arbeitsstunden, um den Kiel schwerer zu machen und hier und da ein paar Dinge zu verändern, sowie weitere 1.500 Euro um Segelausrüstung zu kaufen: einen günstigen elektrischen Autopiloten, zwei Batterien, zwei kleine Solarpaneele, ein gebrauchtes Handfunkgerät und einen persönlichen Notsender sowie einen AIS-Empfänger. AIS (Automatic Identification System) ist ein Funksystem, mit dem Informationen etwa über den Namen, die Größe, die Geschwindigkeit oder den Kurs von Schiffen in der Umgebung sowie über das Alter des Kapitäns und einige andere, nicht ganz so nützliche Dinge gesammelt werden. Das Versenden eines AIS-Signals ist normalerweise für Frachter und Schiffe ab einer bestimmten Tonnage vorgeschrieben. Bei einem solchen Budget war natürlich weder ein Motor noch ein ausgereiftes Navigationssystem drin und auch kein noch so kleines Gerät, über das ich mit dem Festland kommunizieren könnte.
Ich muss auch dazusagen, dass es mir nur dank eines gewissen Sinns für Wiederverwertung gelungen ist, mit diesem Budget zurechtzukommen. Der Kiel zum Beispiel hat mich nur die acht Bolzen gekostet, mit denen ich ihn am Rumpf befestigt habe. Er ist komplett aus zwei ein Zentimeter dicken Stahlblechen hergestellt, die ich vor einigen Jahren aus einer im Abriss befindlichen Fabrik bei mir in der Nähe mitgenommen habe, ergänzt um ein paar hier und da aufgelesene Bleistücke. Ähnlich verhält es sich mit der Farbe und einem Großteil der Schrauben, die hauptsächlich aus Überresten meiner früheren Boote und Werftprojekte stammen. Das Plexiglas für meine Luken erhielt ich im Tausch gegen eine Platte Sperrholz und einige Reste exotischen Holzes. Die Decksluken hingegen habe ich gebraucht für wenig Geld gekauft. Etwa 40 Prozent meines Gesamtbudgets gingen für den Kauf von zwei Carbonstangen drauf, aus denen ich meinen Mast herstellte, sowie für die professionelle Anfertigung des Segels.
Man muss kein genialer Schiffsarchitekt sein, um sich klarzumachen, dass es für den Entwurf eines Minibootes nicht ausreicht, ein größeres Boot zu kopieren oder sich von ihm inspirieren zu lassen und es dann zu verkleinern. Das nennt man »Extrapolation« und Extrapolationen führen im Bootsbau wie anderswo häufig zu idiotischen, wenig wirklichkeitstauglichen Ergebnissen.
Egal, ob man als Einhandsegler auf einem Boot von zehn oder vier Metern Länge unterwegs ist: Die benötigte Menge an Trinkwasser, Lebensmitteln und Grundausrüstung ist dieselbe, im letzteren Fall ist sie sogar noch größer, da die Fahrt logischerweise länger dauert. Deshalb musste ich einen speziellen Rumpf entwickeln, der im Verhältnis zu seiner Größe viel Ladung aufnehmen kann, ohne dadurch zu viel Tempo zu verlieren. Das erforderte natürlich eine Menge Gehirnschmalz. Mein Ziel war nicht, ein besonders schnelles Boot zu haben. Trotzdem galt es, eine komplizierte Gleichung zu lösen: Je länger eine Überfahrt dauert, desto mehr Lebensmittel und Trinkwasser müssen mit an Bord, aber je schwerer das Boot beladen ist, desto langsamer kommt es voran, desto länger dauert also die Überfahrt … Wie man sieht, ist es gar nicht so einfach, den Rumpf eines ganz kleinen Bootes zu entwerfen.
Außerdem wollte ich eine ziemlich bizarre Theorie in die Praxis umsetzen, die mir seit geraumer Zeit durch den Kopf ging. Schon seit einigen Jahrzehnten vollzieht sich bei der Konzeption der Rümpfe von Einrumpf-Renn- und -Fahrtenbooten ein bedeutender Wandel: Von schmalen, schweren, tiefen Rümpfen, die das Wasser wie ein Messer zerteilen, ist man nach und nach zu leichteren, flacheren Rümpfen übergegangen, deren Verhalten ein bisschen an das eines Löffels erinnert, den man über das Wasser gleiten lässt, oder sogar an das eines Kiesels, den man über das Wasser flitscht, oder eines Surfbretts. Dieser Wandel erklärt teilweise die unglaubliche Leistungssteigerung bei Segelbooten in den vergangenen Jahren. Betrachtet man die Form eines modernen Einrumpfbootes von unten, stellt man fest, dass der vordere Teil an der Wasserlinie





























